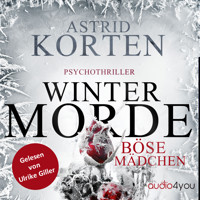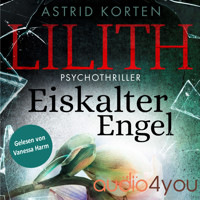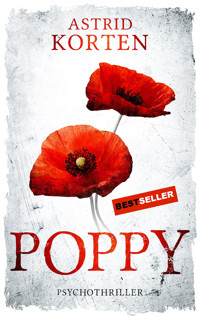4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ich bin dein Schatten, deine Stille, dein Feind. Satan. Sei also auf der Hut! Taubendorf, ein kleiner Ort in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze. In einem abgelegenen Haus am Waldrand leben die Wolkows, eine nach außen hin perfekte Familie, wäre da nicht die achtjährige Aljona, die nicht an Gott glaubt. Eines Tages erwischt Gregor Wolkow das Mädchen dabei, wie es nachts heimlich im Wald tanzt. Er wendet sich an den Ältestenrat der örtlichen Glaubensgemeinschaft. Aljonas Ungehorsam wird hart bestraft. Zweiundzwanzig Jahre später ist es keinem der Wolkow-Kinder gelungen, dem Terror des gläubigen Vaters zu entkommen. Sie sprechen kaum über die Folgen. Aljona kümmert sich um den verhassten, dementen Vater, aber der trügerische Frieden in der Familie fordert einen hohen Tribut. Als das Böse wie ein Sturm aufzieht und die Familie endgültig entzweit, drängen allzu lang gehütete Geheimnisse an die Oberfläche, und mit ihnen eine tödliche Gefahr … Blutvogel ist ein Meisterwerk auf dem Gebiet der Thriller. (Witch-Journal)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Über das Buch
Blutvogel
Prolog
Für Betty - in ihrem Himmel
Erster Brief an meinen Vater
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Zweiter Brief an meinen Vater.
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Dritter Brief an meinen Vater
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Vierter Brief an meinen Vater
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Fünfter Brief an meinen Vater
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Sechster Brief an meinen Vater
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Siebenter Brief an meinen Vater
Kapitel 22
Kapitel 23
Achter Brief an meinen Vater
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Neunter Brief an meinen Vater
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Zehnter Brief an meinen Vater
Kapitel 37
Letzter Brief an meinen Vater
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Anmerkung und Danksagung
Danksagung
Weitere Bücher der Autorin
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2022 Astrid Korten, Ferdinand-Weerth-Str. 31, 45219 Essen
Umschlaggestaltung: Kristin Pang
Umschlagabbildung: © Matilda Delves / Trevillion Images
Lektorat/Korrektorat: Doris Bartos/Angelika Hörner
Über das Buch
Ich bin dein Schatten, deine Stille, dein Feind. Satan.
Nimm dich in Acht.
Taubendorf, ein kleiner Ort in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze. In einem abgelegenen Haus am Waldrand leben die Wolkows, eine nach außen hin perfekte Familie, wäre da nicht die achtjährige Aljona, die nicht an Gott glaubt. Eines Tages erwischt Gregor Wolkow das Mädchen dabei, wie es nachts heimlich im Wald tanzt. Er wendet sich an den Ältestenrat der örtlichen Glaubensgemeinschaft. Aljonas Ungehorsam wird hart bestraft.
Zweiundzwanzig Jahre später ist es keinem der Wolkow-Kinder gelungen, dem Terror des gläubigen Vaters zu entkommen. Sie sprechen kaum über die Folgen. Aljona kümmert sich um den verhassten, dementen Vater, aber der trügerische Frieden in der Familie fordert einen hohen Tribut.
Als das Böse wie ein Sturm aufzieht und die Familie endgültig entzweit, drängen allzu lang gehütete Geheimnisse an die Oberfläche, und mit ihnen eine tödliche Gefahr …
Erste Stimmen:
Blutvogel ist ein Meisterwerk auf dem Gebiet der Thriller. (Witch-Journal)
Blutvogel
Ich werde dir folgen,
nichts hält mich auf.
Ich bin dein Schatten,
deine Stille,
dein Feind.
Das Versprechen des Bösen.
Ich werde dich mit Blut beträufeln,
dein Blut trinken,
deine Wunden lecken,
deine Narben aufritzen und
über dir schweben,
die Erinnerung sein,
die du auslöschen möchtest.
Ich bin ein Blutvogel.
Sei also auf der Hut.
Prolog
Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
Taubendorf, 1965
Das Mädchen schnappt nach Luft.
Es weiß, dass es sterben wird, der Pfarrer hat es in ihren Augen gesehen.
„Der menschliche Körper besteht zu fünfundsechzig Prozent aus Sauerstoff“, sagt er. „Das ist eine Menge, nicht wahr, mein Kind?“
Das Mädchen will antworten. Es gelingt ihm nicht.
„Sprechen verbraucht Sauerstoff“, warnt er. „Man stirbt schneller.“
Das Mädchen fragt sich, wie der Pfarrer ihm den Ungehorsam nehmen will…
Es war heute wieder im Wald. Es flieht oft dorthin, wenn es zuhause diesen Gott, den es nicht gibt, anbeten muss. Würde es ihn geben, dann würde der Vater ihm nicht immer drohen. Der Wald ist friedlich und geheimnisvoll. Selbst im Dunkeln findet es den Weg dorthin, vorbei an den Hartriegelbüschen, über die Felder bis zur Lichtung. Heute sah es im schwindenden Tageslicht, dass der Strauch seine kugeligen Blüten verloren hatte. Das machte ihm Angst.
Während es stundenlang auf den letzten Faden Sonnenlicht wartete, hörte es die Geräusche des Waldes, das Krachen der Äste und das Rauschen der Blätter, das Raunen der Wurzeln und das Gekicher der Gräser, und die Elfen. Es sah den Zauber, den sie in die Luft webten, wie gesponnenes Silber, und es dachte: Hier bin ich die Königin.
Erst als das Mondlicht blass und geisterhaft über ihm hing und der böige Märzwind tote Zweige rascheln ließ, tanzte das Mädchen mit den Geistern des Waldes. Sein langes braunes Haar wurde dann meist vom Wind gepeitscht, jetzt flatterte sein weißes Nachthemd wie ein Segel um seine Beine.
Das Mädchen tanzte und tanzte, breitete die Arme aus, lachte. Drehte sich im Kreis. Schneller und schneller. Doch plötzlich hüllte sich der Himmel in Schleier und färbte sich violett. Das Blut rauschte in seinen Ohren, ihm wurde übel. Die Sterne am Himmel begannen sich auch zu drehen, zunächst langsam, dann schneller und schneller, bis ihn eine tiefe Schwärze erfasste.
Als das Mädchen wieder zu sich kam, lag es auf dem Rücken im Moos. Es öffnete die Augen, sah, dass der Mond heller schien, dass Wolken an seinem Licht vorbeieilten, dass der Himmel sternenklar wurde. Etwas brach durch den Wald, es hörte ein Splittern und Krachen, erkannte die Schritte, schwer und bedrohlich. Kurz darauf war hoch über ihm das wütende Gesicht des Vaters.
Es zuckte zusammen. „Bin ich tot, Vater?“
„Tot?“, schrie der Vater in die Nacht hinaus.
Seine merkwürdig krächzende Stimme erschreckte das Mädchen zutiefst. Diesen Klang hatte es noch nie vernommen. „Wirst du mich jetzt töten, Papa?“
Die Lippen des Vaters formten seltsame Worte, mit den Augen, trübe und finster, sah er das Kind von Zorn ergriffen an.
Er beugte sich vor und hielt seine Lippen ganz nah an das Ohr des Mädchens. „Niemand will dich töten. Ich hatte dir verboten, in den Wald zu gehen und den Teufel heraufzubeschwören. Ich bringe dich jetzt zum Pfarrer, er wird dir den Spuk und deinen Ungehorsam austreiben.“
Das Mädchen sprang erschrocken auf. „Die Kinder in der Schule sagen, dass der Pfarrer der höllische Vorsitzende des Hohen Rats der Teufel ist. Was soll er mir dann austreiben?“
„Sei still! Was für ein Unfug!“
Plötzlich streckte das Mädchen die Arme dem Himmel entgegen. „Ich tanze nur mit den Geistern des Waldes, Vater. Das sind meine Freunde, sie verstehen mich und hören mir zu. Sie sagen, dass man ein Kind nicht auspeitschen darf, sie sagen, dass du der Teufel bist, weil du das machst!“, schreit es.
Der Vater ballte die Fäuste und schlug zu. Er packte das bewusstlose Mädchen an beiden Armen und schleifte es zum Wagen…
Das Mädchen öffnet langsam die Augen, es bekommt kaum noch Luft. Sein Körper schmerzt. Der Pfarrer steht vor ihm und beugt sich hinunter, sodass er die volle Aufmerksamkeit des Kindes hat.
„Ein Erwachsener atmet durchschnittlich zwölf bis sechzehn Mal pro Minute“, flüstert er. „Wie alt bist du? Acht Jahre? Nun, ein Kind in Panik atmet häufiger.“
Das Mädchen bewegt den Kopf und schnappt vergeblich nach Luft. Als der zarte Körper urplötzlich zuckt, lockert der Pfarrer den Plastikbeutel, den er dem Mädchen über den Kopf gestülpt hat, ein wenig. Er atmet tief ein und pustet seine Luft in den Beutel. Dann klebt er alles wieder zu, setzt sich und schaut zu, wie das Kind nach Sauerstoff ringt.
„Ohne Sauerstoff stirbt der Körper, so einfach ist das. Nach dreißig Sekunden wirst du das Bewusstsein verlieren. Nach ein paar Minuten treten im Gehirn irreparable Schäden auf. Kurz darauf stirbst du.“
Die Augen des Pfarrers glänzen teuflisch. Sein Gesicht ist rot. „Du warst also mal wieder ungehorsam, hat mir dein Vater gesagt“, raunt er und legt seine Kleidung ab…
Das Mädchen weiß, es wird sterben.
Und es weiß, dass der Pfarrer nichts fühlt.
Für Betty - in ihrem Himmel
Ich kann tanzen, doch ich tanze nicht
Ich kann singen, doch ich singe nicht
Ich kann lesen, doch die Tränen in den Augen sind so scharf
Also denke ich, das hat keinen Sinn
Und ich schreibe ein paar Worte hin
Diese Worte träum‘ ich später in der Nacht
Was man nicht darf.
Ich kann sterben, doch ich sterbe nicht
Ich kann leben, doch ich lebe nicht
Ich kann gehen, doch die Füße sind zu schlaff
Drum erzähl‘ ich die Vergangenheit
Und ich spüre etwas Ewigkeit
Dieses Spüren ist das Letzte was ich hab
Und was ich schaff.
Draußen, alles ist so draußen, alles kommt von außen
Nur das Böse bleibt im Inneren versteint
Morden, einmal jemand morden, was ist nur geworden
Dass mir dieses Wort so menschenfreundlich scheint.
Ich kann weinen, doch ich weine nicht
Ich kann schreien, doch ich schreie nicht
Und ich frage nicht einmal mehr
Was die Antwort einmal war
Denn ich sitze, seit mein Herz zerriss,
In der Stille, in der Finsternis
Und die Sonne scheint auf alles jeden Tag
Und jedes Jahr
(Songtext Georg Kreisler, Musiker und Kabarettist)
Erster Brief an meinen Vater
22 Jahre später
Glatter als weiche Butter ist sein Mund,
und Feindschaft ist sein Herz;
geschmeidiger als Öl sind seine Worte,
aber sie sind gezogene Schwerter.
Psalm 55, 22
Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich alles, was du gesagt hast, aus meinem Gedächtnis löschen möchte, wie du es früher mit einem Text auf dem Computer gemacht hast, der dir nicht gefiel. Einfach die Löschtaste drücken.
Leerer Bildschirm.
Wunderbar leer.
Erstaunlich leer.
In Gedanken füge ich stets noch einen Wunsch hinzu: Ich würde dich auch gerne aus meinem Leben streichen und stelle mir vor, ich gebe deinem zittrigen Körper – nein warte – deinem Leben einen Delete-Schubs: Vater gelöscht!
In die Unendlichkeit entschwunden.
In die Hölle, wo du hingehörst.
Wenn ich das denke, fühle ich mich schuldig.
Verdammt, es gelingt dir immer noch, dieses ungesunde Schuldgefühl in mir hervorzurufen. Wie machst du das nur?
Die Welt ist voller Versuchungen, hast du uns gegenüber immer wieder behauptet. Der Teufel steckt in allem, was scheinbar Spaß macht. Beispielsweise eine Diskothek oder ein Fernseher. Du glaubst, dass Spaß dem Leben Schaden zufügt, dabei schenkt er dir vielmehr etwas: Tiefe, Besinnlichkeit, pures Glück, Freude.
Ich liebe es immer noch zu tanzen. Wenn ich gut gelaunt bin, schwinge ich meine Beine und tanze. Dann empfinde ich Freude, bin glücklich, denke an schöne Dinge und habe großartige Einfälle.
Du hast uns gelehrt, dass die Frau aus Adams Rippe erschaffen wurde. Dass Mann und Frau sich gegenseitig unterstützen sollen, dass der Mann aber immer derjenige ist, der innerhalb einer Beziehung die Entscheidungen trifft. Dass wahre Liebe auf Vertrauen und Hingabe gründet. Dass die Frau ihre wahre Stärke vor allem durch ihre Unterwerfung zeigt: Sie schenkt ihrem Mann ihr volles Vertrauen, ist ihm ergeben. Das zeugt von Mut und Einsicht. Glaubst du? Bist du dir da so sicher?
Ich bin allergisch gegen jede Art von Abhängigkeit. Beim Wort ‚Unterwerfung‘ überfluten mich zerstörerische Gedanken und mir wird übel. Auch habe ich noch nie einen Mann getroffen, dem ich mein volles Vertrauen schenken möchte. Du hast dieses Vertrauen in mir gekonnt getötet. Aber meine Zeit wird kommen, denn ich halte mich nicht für einen Feigling.
Der Sonntag ist der Tag des Herrn, einer deiner unerschütterlichen Standpunkte. Du hast es immer wieder gesagt, es uns fast ins Hirn gebrannt: Exodus 20, Vers 8: Gedenkt den Tag des Sabbats, dass ihr ihn heilighaltet.
Ich erinnere mich so gut an die Sonntage. Sofort, wenn ich nach dem Aufwachen die Augen öffnete, spürte ich dieses beklemmende Gefühl in der Brust. Jeden Sonntag hoffte ich, dass es in Strömen regnen würde, denn dann konnten wir nicht hinausgehen. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass der Eismann gegen drei Uhr in die Straße fuhr, viel geringer, das Glöckchen würde nicht läuten, um die Leute aus ihren Häusern zu locken. Dieses Glöckchen war eine entsetzliche Sache. Sobald ich es hörte, bekam ich ein unbändiges Verlangen nach Vanilleeis mit Schlagsahne. Ein sternförmiger Klecks Schlagsahne auf dem Eishörnchen, sodass, wenn man daran schlurfte, die Sahne auf halber Höhe der Wangen und der Nasenspitze ihre Spuren hinterließ. Ich sabberte schon bei dem Gedanken daran. Aber wir durften sonntags kein Eis essen. Sonntags durften wir nichts Schönes, nichts Lustiges machen.
Wenn es regnete, kamen mir die Sonntage weniger schlimm vor. Die Kirchgänge waren eine willkommene Abwechslung zu den Stunden, in denen du uns aus der Bibel vorgelesen hast und Mama uns Mädchen beibrachte, wie man Socken stopft oder wir gemeinsam eine Tischdecke besticken mussten. Manchmal fiel mir ihr Blick auf, wenn er kurz von dem abwich, was sie gerade tat. Sie seufzte zwei, drei Sekunden mit den Augen. Sobald sie aber sah, dass ich sie beobachtete, änderte sich dieser Blick, und sie wurde wieder die fügsame, gehorsame, unbeirrbar glückliche Frau, wie es die Frau eines christlichen Grundschulleiters sein sollte. Es war immer nur für einen kurzen Moment, dass ihre Augen eine andere Sprache sprachen. Jedes Mal, wenn es geschah, hast du mit deiner mahnenden Art sie anzusehen, eingegriffen. Ohne ein Wort zu sagen, hast du Mamas Gedanken in die von dir vorgegebene Richtung zurückgelenkt.
Im Kellerschrank lagen immer eine Karbatsche und eine Gerte bereit.
David und ich wissen, wie es sich anfühlt, damit ausgepeitscht und geschlagen zu werden. Du hast uns im Namen Gottes gegeißelt. Er hätte dich gezwungen einzugreifen, wenn eines deiner Kinder einen schweren Fehler beging, hast du behauptet. Wie zu fluchen, gierig nach einem Keks zu greifen, sich heimlich in das Haus des Nachbarn zu schleichen, um fernzusehen oder unmoralische Handlungen zu begehen. Dafür wurde David am häufigsten verprügelt. Er konnte nicht verhindern, dass du ihn beim Wichsen unter der Dusche oder in seinem Bett erwischt hast, während er glücklich stöhnte. Aber es ist dir nicht gelungen, ihn davon abzuhalten.
Die Karbatsche liegt immer noch im Kellerschrank, ganz hinten, verborgen vor dem bloßen Anblick. Sie liegt dort als stummes Zeugnis von Einschüchterung, Zwang und Indoktrination. Manchmal wurden wir alle auf einmal aus dem Haus geschickt, mit dem Hinweis, dass wir erst nach einer Stunde zurückkommen durften. Du standest dann breitbeinig vor dem Kellerschrank. Ich erinnere mich an Mamas Blick, als wir nacheinander schweigend zur Tür hinausgingen. Sie sah aus, als ob sie mit uns kommen wollte und versuchte, uns mit einem freundlichen Blick zu beruhigen, aber in ihren Augen lag pure Angst. Als wir zurückkehrten, herrschte eisiges Schweigen zwischen euch. Mama ignorierte dich dann entschieden für den Rest des Tages.
Was geschah, nachdem wir das Haus verlassen mussten? Was hast du im Keller mit Mama gemacht? Wurde sie auch für irgendetwas bestraft? Wofür? Sie hat doch niemals geflucht. Nicht irgendwo heimlich ferngesehen oder aus der Keksdose genascht. Sie hat dir aufs Wort gehorcht. Sie hat dich überdies ermächtigt, in ihrem Namen abzustimmen, es kam ihr niemals in den Sinn, ihre eigenen Wünsche zu äußern. Was könnte also der Grund dafür sein, dass du keine Zuschauer dabei haben wolltest? Hat sie vielleicht heimlich masturbiert?
Ich habe mich entschieden, dir in nächster Zeit einige Briefe zu schreiben. Ich werde dir alles sagen, was mich seit Monaten beschäftigt.
Meine Worte brüllen dich an.
Ich feuere sie auf dich ab.
Übergieße dich mit ihnen.
Ich würde dich gerne damit erwürgen.
Oder sie als Dolche in dein Hirn jagen.
Kapitel 1
Taubendorf, 1987
Aljona
In der Nacht erwache ich durstig und nehme einen Schluck Mineralwasser aus der Flasche, die auf dem Nachtschränkchen steht. Der Hund liegt neben meinem Bett auf dem Boden, er schläft tief und fest. Ich beobachte seine Atmung. Mit meinem Bodyguard ist das ungute Gefühl in den Hintergrund geraten. Dennoch schlummert es in mir, noch ist es nicht verschwunden.
Das Mondlicht lässt mich nicht einschlafen. Der Mond sieht heute anders aus, rede ich mir ein. Er wirft bedrohliche Schatten auf die Bettdecke. Ich überlege aufzustehen und die Vorhänge zu schließen. Dann werde ich morgen früh nach dem Aufwachen auch die Sternrenette-Apfelbäume vom Bett aus nicht sehen müssen. Und die seltsamen Vampirfinken, die mein Vater Blutvögel nennt. Sie machen mir Angst.
Vater … Jetzt verachte ich das Mondlicht.
Ich schleiche zum Fenster. Der Mond ist so echt, so weiß wie Milch, mehr geht nicht. Er fließt über meinen Körper, lässt mich schaudern. Eilig ziehe ich die Vorhänge zu. Mir ist kalt. Mein Körper zittert ein wenig. Es sind die Erinnerungen, die meine innere Kälte hervorrufen. Ich fische den Morgenmantel vom Boden, ziehe ihn über und lege mich wieder ins Bett. Schließe die Augen.
Der Hund bewegt sich, er knurrt. Ich halte den Atem an. Irgendetwas ist da draußen. Ist mein Vater womöglich aufgewacht? Geistert er wieder durchs Haus? Wenn er nur nicht wieder wütend wird. Ich ertrage keinen wütenden Mann mehr.
Schuldgefühle… Die muss ich auch loswerden, sie beschleichen mich aber immer wieder. Dabei habe ich nicht im Mondlicht getanzt.
Loswerden… Das wird mir sicher gelingen, wenn ich die Schuldgefühle konsequent ignoriere. Ich schaffe es aber nicht.
Meine Augenlider sind schwer, ich möchte in einen Traum gleiten, der mich glücklich macht, und versuchen, positive Erinnerungen zu wecken: Ein Mann streicht mit seiner Nase über meine Wangen, meinen Hals, er flüstert, dass mein Parfüm ihn glücklich macht. Während wir im Wald tanzen, küsst er mich innig, erstickt mich fast mit seinen Küssen. Nie wieder werde ich ein anderes Parfüm benutzen, wispere ich im Traum.
Das Zittern lässt langsam nach, ich murmele ein paar Worte in die Stille meines Schlafzimmers. Atme erleichtert auf. Die Vorhänge sind geschlossen, keine bedrohlichen Schatten mehr. Keine Blutvögel, die mich anstarren. Nur Schuldgefühle und eine Melodie.
Die Melodie der Nacht ist am Morgen noch gegenwärtig. Jetzt vermengt sie sich mit dem verschatteten Bild meiner Mutter im Zimmer. Es ist eine Melodie, die Mutter immer gesummt hat, wenn Vater nicht in der Nähe war: „Der arme Mensch ist General. Es ist wahrhaftig ein Skandal. Er hätte wirklich – und dafür wird er noch brennen – auf seine Familie etwas Rücksicht nehmen kennen!“ Mutter liebte die bissigen Lieder des österreichischen Kabarettisten Georg Kreisler.
Ich stehe auf, öffne die Vorhänge. Das Licht der Sonne bricht durch das Fenster in mein Zimmer. Die Melodie stirbt, das Bild kippt.
Für heute hat der Wetterfrosch wieder fünfunddreißig Grad vorausgesagt. Wenn diese Temperaturen zwei weitere Tage anhalten, ist es eine wahre Hitzewelle. Die erste seit fünfzehn Jahren.
Ich bin früh aufgestanden, um im Haus noch ein bisschen aufzuräumen. Gestern Abend habe ich bis halb zwölf hinter der verdammten Nähmaschine verbracht, wie ein altes gebücktes Weib, und die neuen Röcke und Blusen mit Ziernähten perfektioniert. Jetzt hängen sie fein säuberlich gepresst auf Bügeln an der Tür des Kleiderschranks. Es sind solide Schnitte, vielleicht ein wenig formlos. Sie verhüllen nicht nur die Kontur meines schlanken Körpers, sondern auch das, was ich unter ihnen trage.
Bei der Vorstellung, dass ich demnächst in meinen neuen Kleidern durch Taubendorf stolziere und niemand den geringsten Verdacht hegt, ich könne sexy Unterwäsche unter dem langen Rock tragen, kichere ich vor Aufregung.
Ich weiß, dass vor allem die Leute in meinem Alter, die nicht zur Kirchengemeinde gehören, mich für eine altjüngferliche Erscheinung halten. Ich bin es von klein auf gewohnt, dass sie sich über meine Kleidung und mein Haar lustig machen. Angefangen hat es, als ich noch zur Schule ging. Damals gab es einen täglichen Kampf zwischen den Kindern der katholischen und denen der evangelischen Schule. Die katholischen Kids nannten die evangelischen Kinder halsstarrige Gören, fromme Wichtigtuer und Bibelfritzen. Die reformierten Kids posaunten, dass die katholischen Narren Statuen anbeten und die Mutter Gottes, Maria verehrten. Aber sie brüllten nicht so laut wie die katholischen Schüler.
Uns war es strengstens untersagt, auf der Straße zu schreien oder zu fluchen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie Vater mit seiner tiefen Bassstimme während des Essens über die respektlose Erziehung der katholischen Kinder sprach und wie er uns mit erhobenem Finger befahl, weder mit Worten noch mit Taten darauf zu reagieren.
Ich zuckte dennoch jedes Mal bei der Missbilligung meiner langen Röcke und dem ewigen Zopf, der mir bis zur Taille fiel und mir selbst heute noch bei jedem Schritt über den Rücken tanzt, zusammen. Heute werde ich zwar nicht mehr verspottet, aber ich spüre noch oft die Blicke der Leute auf mir.
In Taubendorf hat sich seit meiner Kindheit einiges verändert. Junge Menschen sind in die Großstädte gezogen, angelockt von den Freiheiten, die sie sich dort erlauben können. Viele haben sich rigoros von allem losgesagt, was mit Religion und der Glaubensgemeinschaft zu tun hat. Nur eine geringe Anzahl der Kinder, mit denen ich die Schule besucht habe, leben heute noch als Erwachsene im Ort und befolgt die Bräuche und Regeln unserer Gemeinschaft. Sie gehen immer noch in die Kirche. Ihre Kinder sehen damals wie heute einheitlich aus, wie in John Carpenters Dorf der Verdammten. Es werden zwar immer weniger, aber sie bescheren mir eine Gänsehaut, wenn ich einem von ihnen in den Geschäften begegne.
Heute besteht die Gruppe der Gläubigen, die zu unserer Kirchengemeinde gehört, aus Menschen, die in sieben benachbarten Dörfern des amtlichen Siedlungsgebiets der Sorben/Wenden leben. Sie kommen immer noch an zwei Tagen pro Woche und jeden Sonntag in die Taubendorfer Kirche, die seit dem siebzehnten Jahrhundert ihr Treffpunkt ist.
Ich bin Aljona Wolkow und das einzige Familienmitglied ohne biblischen Vornamen. Meine polnische Mutter hatte darauf bestanden, obwohl es deswegen fast zum Glaubenskrieg mit Vater gekommen wäre, hat Mutter mir einmal anvertraut.
Wir feiern heute den Geburtstag meines dementen Vaters. Die anderen Mitglieder der Familie werden gegen zehn Uhr eintreffen. Sarah, die Ehefrau meines Bruders Johann, bringt Salate mit und meine Schwester Esther hat mir versprochen, eine Erdbeerbowle zu machen. Ich hoffe, dass sie dieses Mal einen leichten Rosé hinzufügen wird, der der Bowle einen spritzigen Geschmack verleiht. Mein Bruder David hatte es Esther vorgeschlagen, als wir uns zu Ostern trafen. Er bereitete in der Küche Sandwiches zu.
„Machs einfach und behalte es für dich“, sagte er. „Sollte dich jemand fragen, dann sagst du, es sei alkoholfreier Wein als Geschmacksverbesserer. Außerdem… Was kümmert es dich? Hauptsache, die Bowle schmeckt. Oder glaubst du, dass sich sofort die Hölle und die Verdammnis in Bewegung setzen, um dich zu begrüßen, wenn du zur Abwechslung mal ein paar Tropfen Alkohol trinkst?“
Esther grübelte. „Ich will aber nicht lügen“, erwiderte sie. „Und ich möchte auch nicht darüber streiten. Du weißt, dass unser Vater Alkohol verabscheut.“
Ich habe eine Flasche Sekt Rosé in den Küchenschrank gelegt. Falls Esther uns wieder eine wässrige Bowle auftischt, werde ich in einem unbewachten Moment den Inhalt der Flasche hineinkippen.
Wenn die ganze Familie zu Besuch kommt, erwarten sie, dass ich auch einen Apfelkuchen backe, weil mein Bruder Johann darauf besteht. Immer Apfelkuchen, nie etwas anderes.
„Daran erinnert sich Papa noch immer“, behauptet Johann – für David eine typische Aussage seines Bruders.
„Seit wann kennt unser Vater etwas anderes als Bibeltexte, Aljona?“, fragte er mich, als er und sein Freund Peter neulich auf einen Kaffee vorbeikamen. „Aber sicher, ein Apfelkuchen ist ja so gediegen. Apfelkuchen ist ja ein bisschen christlich. Ein anständiger Kuchen, das ist er.“ Er rollte mit den Augen. „Wenn man es aber genau nimmt, ist der Apfel die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis. Du solltest einen schönen geilen Schokoladenkuchen backen, wenn die ganze Familie da ist, Aljona. Schokolade hat etwas Unanständiges, etwas Schlüpfriges. Und dann garnierst du ihn mit diesen großen Schokoladenlocken!“ Er tätschelte die Hand seines Freundes. „Oh, das bringt mich auf spannende Gedanken. Ich werde auf dem Rückweg eine Tüte Schoko-Muffins kaufen und dann wirst du etwas erleben, mein Süßer“, versprach er seinem Peter.
Dennoch schien es mir nicht klug, Davids Rat zu befolgen. Johann würde das als Provokation auffassen und wütend werden. Ich möchte am Geburtstag meines Vaters keinen Ärger haben. Jedenfalls nicht in Gegenwart von meiner Schwester Kira.
Seit gestern ruht der Apfelkuchen im kühlen Keller, damit das Mandelmus in den Kuchen einziehen kann.
Es ist bereits halb zehn. Die Pflegerin, die jeden Tag aus dem polnischen Teil von Guben zu uns kommt, duscht meinen Vater, ich höre den alten Mann toben. Arme Ulita.
Schlagartig erfasst mich ein unbehagliches Gefühl. Ich werfe rasch einen Blick aus dem Küchenfenster, öffne es. Die Morgensonne fällt in einem schmalen, gleißenden Strahl in die Küche. Auf der Mauer des zugewachsenen Gartens vor dem Haus sitzt die graue Katze des Nachbarn, die träge mit dem Schwanz zuckt. Die Härchen auf meinen Armen stellen sich auf. Ich suche die Umgebung ab, bis mein Blick an der Tür der Scheune gegenüber hängenbleibt. Sie steht sperrangelweit offen. Normalerweise ist sie immer fest verriegelt. Dies ist das erste Mal, dass heute Morgen ein Lebenszeichen von dem staubigen Gebäude ausgeht. Seltsam. Ich entdecke Kira, sie läuft mit dem Hund im Hof hinter den anderen Katzen her.
„Lass es ruhiger angehen, Kira!“, rufe ich ihr zu. „Es ist viel zu heiß. Nicht, dass du mir vor lauter Hitze noch umkippst!“ Ich schließe das Fenster, sodass die Hitze nicht ins Haus strömt.
Witalij ist in den Ort geradelt, um Schlagsahne zu kaufen. Er ist immer bereit, mir zu helfen, wenn ich etwas vergessen habe. Esther ist der Meinung, dass Witalij als Handwerker und Gärtner eine viel zu vertraute Position im Haus einnimmt, zumal er nicht in die Kirche geht. Ich höre mir den Blödsinn stets kommentarlos an. Was würde ich nur ohne Witalij anfangen, allein in diesem Haus, mit einem dementen Vater und einer mittelmäßig intelligenten Schwester?
David zieht mich oft wegen Witalij auf. „Sag mal, Aljona, Schwesterherz, könnte es vielleicht nicht doch etwas mit euch werden? Der Mann sieht gut aus, er kann arbeiten wie ein Pferd, hat Humor und er liest genauso gerne Bücher wie du.“
Ich winke lachend ab. „Hör auf, du Narr. Ich bin dreißig, Witalij ist fünf Jahre jünger als ich und macht gewiss jeden Samstagabend in der Disco Jagd auf junge Mädchen.“
Dass Witalij eine Diskothek besucht, ist Esther auch ein Dorn im Auge. Als sie deswegen einmal außer sich geriet, weil sich ein Diskothekenbesuch nicht mit ihrem Glauben vereinbaren lässt, protestierte ich energisch. „Witalij arbeitet für uns, Esther. Wir können ihm nichts aufzwingen und nichts verbieten. Der Mann ist nicht unser Sklave!“
Nach meinen Worten grübelte Esther eine weitere Stunde finster vor sich hin.
Kira ist nicht mehr auf dem Hof zu sehen. Ich frage mich, wo sie sich herumtreibt. Das Kläffen des Hundes dringt zu mir durch. Zweimal lautes Aufbellen, gefolgt von einem kurzen, unterdrückten Jaulen und dann herrscht vollkommene Stille, die ein Kaleidoskop aus Gewaltszenen auf meiner Netzhaut hinterlässt. Ich öffne das Fenster wieder, höre ein Geräusch, das aus der Scheune kommt. Was macht Kira nur dort?
In Windeseile verlasse ich das Haus, eile über den Hof zur Scheune. Mir kommt es vor, als würde das dunkle Loch mich heranzoomen, wie ein Auge, das mich hypnotisiert. Meine Hände beginnen zu zittern, ich spüre meinen Pulsschlag in den Ohren. Die Katze des Nachbarn schießt an mir vorbei. Ich zucke kurz zusammen.
„Kira, wo bist du?“, rufe ich. „Komm sofort da raus! David und die Familie treffen jeden Moment ein. Du machst dich noch ganz schmutzig!“
Ich stoße die Tür auf, werde geblendet. Das Licht bricht wie ein Wasserschwall über mich herein. Es durchflutet meine Netzhaut, als wollte es an meinen Pupillen vorbei direkt in meinen Schädel. Ich kann nichts fokussieren, nichts wahrnehmen, es gibt nur dieses alles einnehmende Strahlen. Irgendwo in der Scheune explodiert etwas mit einem ohrenbetäubenden Knall. Wellen von Schmerz schießen durch meinen Körper. Ich stürze zu Boden. Bewegungen zeichnen sich ab. Sonnenlicht flackert, flimmert, flüchtig, tanzt vor meinen Augen.
Ich bin nicht tot. Das ist nicht der Himmel. Das ist auch nicht die Hölle. Es ist Witalij. Ich kann nicht atmen, glaube zu ersticken, suche Orientierung in der verzerrten Welt. Füße treten wenige Zentimeter neben meinem Kopf auf, machen aber keine Geräusche. Da ist nur Vibration, Zittern, Berührung, mehr nicht.
Ich werde hochgehoben, der Horizont verschiebt sich. Alles ist so nah, das Licht, die Stille, das Ende. Alles zerfließt.
Ich sinke in die Ohnmacht.
Kapitel 2
Witalij
Witalij Matuh biegt gerade mit dem Fahrrad in den Wirtschaftsweg ein, als er den Schuss hört. Die letzte Kurve versperrt ihm die Sicht auf das Haus. Er tritt in die Pedale. Auf den ohrenbetäubenden Knall folgt eine tödliche Stille. Als er die Kurve passiert, sieht er in der Ferne nur noch die graue Staubwolke eines davonrasenden Autos. Das Fabrikat erkennt er nicht. Die Staubwand wird kleiner und kleiner. Verflüchtigt sich. Verschwindet ganz.
Wind, morgendliche Hitze. Die schmale Flucht der Schleierwolken am Horizont, kein Donnergrollen, kein sanftes Fallen eines Sommerregens. Er hat eindeutig einen Schuss gehört.
Aljona steht nicht wie gewohnt am offenen Fenster, ihr Leuchten erhellt nicht sein Gesicht. Sie liegt blutüberströmt auf dem Boden vor der Scheune. Ihr Brustkorb hebt sich schwach. Er kniet neben Aljona nieder und wählt mit dem Handy den Notruf. Immer wieder versucht sie, ihm etwas zu sagen, das ähnlich klingt wie: „Keine Polizei, meine Schuld.“
Kira – vor Schreck erstarrt – drückt ihren Körper gegen die Scheunentür. „Puff, puff, puff“, ruft sie immer wieder. Neben ihr steht Ulita, die Pflegerin des dementen Gregor Wolkow.
„Ich habe nichts gehört, Witalij“, wispert Ulita. „Habe versucht, Herrn Wolkow unter Kontrolle zu halten. Der alte Mann schreit um Hilfe und versucht ständig, mir in die Handgelenke zu beißen. Ab sofort werde ich das nicht mehr alleine machen. Der Mann versteht nichts, gehorcht niemandem, dreht vor Aufregung durch, wenn man auch nur einen Blick auf seine Hose wirft. Er ist nicht zu bändigen und tobt, bis er die Dusche verlassen kann und angezogen wird. Er braucht eine Betreuung durch zwei Personen. Ich mache das nicht mehr alleine!“
Witalij spürt, dass sein Adamsapfel hervortritt, als würge er einen riesigen Bissen hinunter und sieht Ulita wütend an. „Los! Bring Kira ins Haus, Ulita!“, brüllt er. „Hole ein Kissen für Aljonas Kopf! Beeile dich! Und hör auf, Blödsinn über den alten Wolkow zu erzählen! Siehst du nicht, was hier los ist?“
Aljona blutet stark, ihr Gesicht ist kreidebleich, ihre Atmung flach. Witalij legt ihren Kopf zur Seite, fühlt immer wieder ihren Puls, spricht beruhigende Worte.
Aljona zittert, sie droht das Bewusstsein zu verlieren. Er hält ihre Hand, achtet auf ihre Atmung. Er weiß nicht, was er sonst tun soll. Die Welt um ihn rauscht nur noch. Er hatte sie nicht schützen, der Kugel ihres Feindes nicht entgegentreten können. Niemand kann seinen Schmerz beschreiben. Niemand sollte es tun. Auch er selbst nicht, obwohl er immer wieder nach Worten sucht.
Es dauert fast eine Viertelstunde, bis das Rumoren ferner Geräusche in sein Bewusstsein dringt und zu etwas Bekanntem verwandelt: Ein Krankenwagen und die Polizei fahren mit heulenden Sirenen in den Hof. Dann ist da Stimmengewirr. Erst nur Silben, dann ganze Wörter. „Treten Sie bitte zur Seite!“, fordert ihn ein Sanitäter auf. Steriler Geruch dringt in seine Nase.
„Schussverletzung“, rollt es über Witalij herein. „Hoher Blutverlust.“
Der Sanitäter klatscht Aljona ins Gesicht. „Hallo, Frau Wolkow. Hierbleiben! Nicht einschlafen! Hallo!“ Eine Tasche wird in Windeseile geöffnet, Ampullen werden abgeknickt, Spritzen aufgezogen, Aljonas Ärmel wird hochgekrempelt. Witalij schaut weg.
„Kreislauf stabilisiert sich“, hört er kurz darauf.
Plötzlich fasst jemand seinen Arm. „Alles wird gut, Witalij, sie bringen Aljona jetzt ins Krankenhaus“, beruhigt David ihn, der unmittelbar nach dem Krankenwagen eingetroffen sein muss. „Ich fahre hinter dem Krankenwagen her.“
Die Turmglocke der Kirche läutet zweimal, als der gesamte Hof mit gelbem und rotem Band abgesperrt wird. Zwei Männer der technischen Ermittlungsabteilung sichern die Spuren und haben die Familie gebeten, ins Haus zu gehen.
David ist soeben aus dem Krankenhaus zurückgekehrt und steuert direkt auf die Terrasse zu, wo sich die Familie versammelt hat. Witalij wartet einige Sekunden. Die Terrassentür steht offen, der Blick auf den Garten ist malerisch. Für Momente stellt Witalij sich vor, dass es ein Gemälde ist. Ein aufgemalter Garten an der Wand. Überall farbenfrohe Blumen. Aber David ist in das Bild hineingetreten, steht auf der Terrasse, spricht mit Johann, der auf einem weißen Stuhl sitzt. Witalij kann die Worte hören, aus der Ferne wabern sie heran.
Jetzt ist auch Witalij draußen, auf der Terrasse.
„Aljonas Leben ist nicht in Gefahr“, sagt David erleichtert. „Zwei Projektile steckten in ihrer Schulterkapsel und wurden chirurgisch entfernt. Sie hat viel Blut verloren, aber nach den Blutkonserven wird es ihr wieder besser gehen. Ja, Aljona hatte Glück“, wiederholt er.
Witalij nickt. „Mann, ich konnte vor Schreck kaum atmen, David. Ich dachte, sie würde mir aus den Händen gleiten. Du weißt, dass ich nicht so religiös bin wie deine Familie, aber glaub mir, ich habe zu Gott gebetet, dass sie es schafft.“
David klopft ihm auf die Schulter. „Es hat geholfen, mein Freund, ich danke dir.“
Johann und Sarah sitzen mit Gregor Wolkow unter dem großen Sonnenschirm auf der Terrasse. Sie versuchen, ihrem Vater zu erzählen, was passiert ist, aber sein Hirn kann die Information nicht speichern. Er vergisst es sofort wieder.
Sarah macht eine hoffnungslose ‚Lass-nur-Geste‘, aber Johann gibt nicht auf. „Aljona wurde in der Scheune angeschossen, Papa. Schau mich an. Aljona, deineTochter. Du weißt, wer das ist, nicht wahr?“
Wolkow starrt seinen ältesten Sohn schweigend an, er sucht nach Worten, die sein verwirrter Geist nicht findet.
„Sie hat Glück gehabt, Papa. Wir sind alle sehr schockiert. Was für eine Tragödie, und das an deinem Geburtstag. Dein achtzigster Geburtstag. Wir wollten ihn mit der ganzen Familie feiern.“
Wolkow nickt. „Aljona … Will … nicht.“ Er lacht leise. Es ist eher das Kichern eines bockigen Kindes.
„Siehst du, Sarah. Papa versteht sehr gut, was ich sage. Er weiß sehr wohl, dass er heute seinen achtzigsten Geburtstag feiert.“
„Achtzig?“, wiederholt Wolkow zögernd und sieht Johann mit großen Augen an. „Herzlichen Glückwunsch. Oh … So alt …“ Das nächste Wort schluckt er hinunter.
„Er kapiert es also so gut, Johann? Lass es!“, mischt sich David ein. „Du wirst den alten Mann nur noch mehr verwirren, als er es ohnehin schon ist.“
„Nein! Ich betrachte Vater immer noch als einen vollwertigen Menschen und möchte ihn auch so behandeln. Kapiert?!“
David zuckt mit den Schultern. „Tue, was du nicht lassen kannst, Johann.“ Er geht auf Esther zu, die gerade die Terrasse betritt. „Gibt es etwas zu essen, Schwesterherz? Mein Magen knurrt vor lauter Aufregung.“
Sarah presst ihre Lippen zusammen. „Ich verstehe nicht, wie du nur einen Bissen hinunterbekommen kannst, David. Deine Schwester liegt schwer verletzt im Krankenhaus, sie könnte jetzt tot sein. Und wer weiß, vielleicht sind wir im Moment alle in Gefahr. Fragt sich denn niemand, was hier los ist?“ Ihre Stimme überschlägt sich. „Sollen wir jetzt hier nur herumsitzen, Salate essen und Bowle trinken?“
Esther nimmt das Gesagte kaum wahr, auch ignoriert sie den hysterischen Klang in Sarahs Stimme. „Die Leute von der Kriminalpolizei sind eingetroffen“, sagt sie. „Sie warten im Wohnzimmer und wollen mit uns sprechen. Mit allen!“ Dann dreht sie sich um und geht zurück ins Haus. David folgt ihr.
Sarah und Johann warten eine Weile. „Geh du zuerst, Johann“, sagt Sarah. „Ich bringe Vater in sein Zimmer. Die vielen Polizisten und die ganze Aufregung sind nicht gut für ihn. Puh, ich glaube, ich bin hier die Einzige, die nicht glaubt, dass das, was passiert ist, normal ist.“ Johann zuckt mit den Schultern, steht auf.
Im Hintergrund verebben die Worte der Familie. Ohne Aljona ist alles anders, denkt Witalij. Er ist allein auf dem Spielfeld der Wolkows, verkatert, obwohl er nicht getrunken hat. Erschöpft. Auf eine Weise, die schmerzt. Er verspürt Angst. Klebrig wabert sie an ihm entlang.
Er hatte in den vergangenen Tagen tief in seinem Inneren eine Gefahr gespürt, war instinktiv auf der Hut. Aljona sollte niemals einen Grund haben, sich zu fürchten. Er würde jeden auslöschen, der ihr zu nah kam. Wie oft wollte er schon auf den verwirrten Herrn Wolkow zugehen und ihn aus der Realität verschwinden lassen, er besann sich aber immer wieder. Wenn Aljona davon wüsste, wäre sie gewiss nicht sehr erfreut. Was für eine Scheiße läuft hier bloß ab?, fragt er sich.
Eine Weile wartet Witalij noch, dann geht auch er hinein.
Alles ist so nah, denkt er. Das Kichern, die Hitze, der Wahn, die Gefahr. Das Böse.
Kapitel 3
Hilke
Während sie auf Witalij Matuh wartet, schaut Hilke sich im Wohnzimmer um, das halb im Schatten, halb im Sonnenlicht liegt. Auf dem Tisch steht eine Glaskanne mit Eistee. Pfefferminz, frisch, mit Honig. Gläser. An den Wänden hängen zahlreiche Kruzifixe, im Bücherregal ein Sammelsurium an Bibelausgaben. Die Familienmitglieder beäugen sich misstrauisch. Einer der Söhne – Johann – hat eindeutig das Sagen, die Augen sind auf seine Schwester Esther gerichtet, die immer wieder zu ihm rüberlinst.
Ihre Augen scannen auch das Familienfoto auf dem Kaminsims. Es zeigt den alten Herrn Wolkow mit seinen Kindern – ohne die Mutter. Die Kinder sehen darauf seltsam glücklich und ahnungslos aus – erwartungsvoll, als wäre das Leben, das vor ihnen liegt, eine Selbstverständlichkeit. Aber Hilke weiß es besser. Das Foto täuscht den Betrachter und weckt seltsame Erinnerungen an ihre eigene Vergangenheit. Sie kennt dieses Lächeln, die Körperhaltung der Kinder, die nur dem Schutz dient, nur allzu gut. Sie fragt sich, welche Geheimnisse diese Familie birgt.
Sie ist noch müde, weil sie mitten in der vergangenen Nacht aufgewacht war, als die Scheinwerfer eines Fahrzeuges durch die Bäume an ihrem Fenster vorbeihuschten. Das Licht war schwach, kraftlos und grau an den Rändern. Dann umschloss sie wieder die Nacht, aber in einem Augenblick der Orientierungslosigkeit wusste sie nicht, wo sie war: in einem Hotelzimmer in Guben, nicht in ihrer Wohnung in Cottbus. Die Zimmerdecke war nur einige Zentimeter von ihrem Kopf entfernt, daran würde sie sich nie gewöhnen. Als würde sie in einem Sarg erwachen. Morgen würde sie um ein anderes Zimmer bitten. Sie ließ sich in die Kissen zurückfallen, drehte sich auf die Seite, die Matratze quietschte unter ihr. Sie lauschte ihrem panischen Atmen, zog die Beine an, krümmte sich wie ein Embryo, schloss die Augen und versuchte, die Geräusche von draußen auszublenden. Sie klangen schrill und disharmonisch – Nachttiere, deren Rufe sich in das Brummen vorbeifahrender Fahrzeuge mischen. Sie wusste, dass sie eine unruhige Nacht vor sich hatte. Erst der Anruf eines Kollegen hatte sie am nächsten Morgen aufgeweckt.
Hilke seufzt, atmet ein und konzentriert sich wieder auf ihre Umgebung. Ausatmen. Den Gedankennebel vertreiben. Dieser Ort, diese Familie bereiten ihr Unbehagen. Sie weiß nicht genau warum.
Witalij Matuh betritt den Raum. Sein Blick ist scheinbar hinter einem unsichtbaren Schleier. Sein Verstand verweilt immer noch in der Scheune, glaubt Hilke. Er versteht nicht, warum irgendjemand auf Aljona Wolkow geschossen hat.
Sie steht auf und geht auf den Mann zu. „Sie müssen Witalij Matuh sein. Dann sind wir komplett. Prima. Ich bin Hilke Fuchs, Landeskriminalamt Brandenburg.“ Ihr Händedruck ist fest, das weiß sie. „Das ist mein Kollege, Constantin Borsig, von der Kripo Guben.“
Johann Wolkow kraust die Stirn. „Wie bitte? Wieso Landeskriminalamt? Was hat das LKA mit diesem Angriff zu tun?“
Constantin sucht ihre Augen, wendet sich dann Johann Wolkow zu. „Ihr Fall“, antwortet er. „Sie ist der Boss.“ Hilke nickt allen im Raum zu. Die Worte hallen nach.
Mein Fall, denkt sie und schließt für Sekunden die Augen. Ich bin der Boss. Ist das so? Warum hatte sie von Anfang an den Eindruck, dass sie in Wahrheit das Sagen hat und nicht der Kollege von der Mordkommission Guben? Weil sie eine gute Polizistin und eine brillante Analytikerin ist. Weil der Fall ihre Vergangenheit berührt. Weil sie persönlich involviert ist.
Weil es stimmt.
„Die Waffe, mit der auf ihre Schwester geschossen wurde, können wir mit einem anderen Fall in Verbindung bringen, für das das LKA Brandenburg zuständig ist“, antwortet Hilke. „Bei diesem Gewaltdelikt arbeiten wir mit der Kripo Guben zusammen.“
Auf Wolkows Stirn erscheint eine Zornesfalte. „Was denn für ein Fall?“
„Darüber können wir Ihnen keine Auskunft geben“, antwortet Constantin Borsig.
„Hm…“ Johann Wolkow würdigt ihren Kollegen mit keinem weiteren Blick, setzt sich und schaut durch die geöffnete Terrassentür nach draußen.
Hilke folgt seinem Blick. Was sie sieht, hält sie für einige Sekunden für ein Trugbild. Die Luft flirrt in der grellen Sonne über dem Rasen.
Constantin Borsig nimmt sein Tablet in die Hand und bittet alle, ihm zu sagen, wer sie sind und in welcher Beziehung sie zu dem Opfer stehen. Er tippt die Namen ein, stellt Fragen. Hilke sitzt schweigend und aufmerksam an seiner Seite, konzentriert sich auf die Antworten. Macht sich Notizen. Mit einem Mal spürt sie den Blick von Esther Wolkow im Nacken und schaut auf.
Esther Wolkow sieht mitgenommen aus, als wären die letzten Jahre ein langer, mühsamer Weg gewesen, den sie allein gehen musste. Es ist Hilke egal, sie hätte eine Frau wie Esther überall wiedererkannt. Diese Haltung, diese Stimme. Es überrascht sie, dass sie selbst diese Gesten verinnerlicht hat. Alles an Esther Wolkow ist ihr vertraut. Wie sie sich vorbeugt, wie sie sie mustert, das Zusammenkneifen der Augen, der fragende Blick. Jedes Detail hat sich so tief in Hilke eingebrannt, dass es mehr als nur eine Erinnerung hervorruft: Es ist die Körperhaltung, die Gestik und Mimik ihres ehemaligen Psychotherapeuten, der sie als Kind nach dem Tod ihrer leiblichen Eltern über viele Jahre manipuliert und gequält hat.
Esther Wolkow zögert kurz, starrt sie an, bevor sie den Blick senkt. Hilke weiß: Diese Frau ist sich nicht sicher, ob eine LKA-Beamtin eine Bedrohung darstellt. Hilke möchte Esther gerne fragen, welche Bedrohung am helllichten Tag in dem halbschattigen Wohnzimmer von ihr ausgehen könnte.
Interesse flackert in Esthers Augen auf. „Kennen wir uns?“, fragt sie.
Ihre Frage wundert Hilke nicht. Esther Wolkow ist ein neugieriger Mensch; auch wenn sie die Polizistin noch nicht einordnen kann, zeigt sie keine Spur von Misstrauen. Die gefährlichsten Menschen sind nicht misstrauisch, sie sind interessiert.
In Esther Wolkow wird keine Panik hochkommen. Vielleicht wird sie aber den Raum verlassen. Oder die Fragen unbeeindruckt beantworten. Esther Wolkow ist gut für Überraschungen, denn sie ist unberechenbar. Ein letzter Gedanke wirbelt durch Hilkes Kopf: In Esther ruht womöglich ein Dämon.
„Und wer kann uns denn nun sagen, welche Personen im Haus waren, als auf Aljona Wolkow geschossen wurde?“, fragt Constantin Borsig.
David Wolkow zeigt auf Witalij Matuh.
„Ich bin hier sozusagen der Mann für Haus und Garten, Herr Borsig“, antwortet er. „Aljona hatte mich zum Mittagessen eingeladen. Herr Wolkow wird heute achtzig.“
Borsig nickt. „Aber waren Sie denn zum Zeitpunkt, als geschossen wurde, anwesend oder nur in der Nähe, Herr Matuh?“
Witalij schüttelt den Kopf. „Nein. Ich musste noch einmal mit dem Fahrrad in den Ort, um Schlagsahne zu holen.“
„Und wer von Ihnen war dann im Haus?“
„Gregor Wolkow, der zu dem Zeitpunkt von Ulita, seiner polnischen Pflegerin, versorgt wurde. Und dann waren da noch Esther, die älteste Tochter von Herrn Wolkow und Kira, die jüngere Tochter.“
„Als Sie in den Ort geradelt sind, Herr Matuh, haben Sie da etwas Verdächtiges bemerkt, Herr Matuh?“
„Nein. Nichts, rein gar nichts. Alles war wie immer.“
„Kein unbekanntes Auto, das am Straßenrand stand?“
„Nein.“ Witalij seufzt. „Ich habe nichts gesehen. Da war kein einziges Fahrzeug auf der Zufahrtsstraße. Aber als ich zurückkam, raste jemand mit einer halsbrecherischen Geschwindigkeit in Richtung Guben davon.“
Hilke schaut auf ihren Notizblock. „Wo ist denn diese jüngere Tochter? Kira, richtig?“ Sie sieht in die Runde.
„Sie hat sich hingelegt“, antwortet Johann. „Wir haben ihr eine Valium-Tablette zur Beruhigung gegeben, die sie stets bekommt, wenn sie zu aufgeregt ist. Sie hat immerhin gesehen, dass Aljona blutüberströmt auf dem Boden lag.“
„Könnten wir kurz mit ihr sprechen, Herr Wolkow?“
Ein merkwürdiges Schweigen huscht durch den Raum. Alle blicken zu Boden – bis auf David Wolkow.
„Kira ist zurückgeblieben“, durchbricht David das Schweigen. „Obwohl ich nicht glaube, dass man diesen Begriff heutzutage noch verwenden kann. Aber Sie wissen, was ich meine?“
„Wissen Sie, ob Kira den Täter gesehen hat, Herr Wolkow?“
„Nein, aber soweit ich verstanden habe, weiß Witalij mehr darüber.“
Witalij hebt den Blick.
„Sie sagte, sie sei in den Keller gegangen, um sich den Apfelkuchen anzusehen, Frau Fuchs“, erwidert er. „Durch das Kellerfenster hörte sie Aljona im Hof ihren Namen rufen. Dann war da dieser Knall. Das habe ich ihren Worten entnommen. Kira muss die Treppe hinaufgegangen und hinausgelaufen sein, denn als ich in den Hof fuhr, stand sie in der Küchentür, hechelte und schrie.“
Hilke sieht, dass Witalij in Gedanken bei dem Moment weilt, der noch nicht lange zurückliegt, der ihn erschüttert hat, sieht, dass ihr Kollege die Augen zusammenkneift, tief seufzt und sich kaum noch beherrschen kann; sie spürt seine Ungeduld.
„Hat vielleicht irgendjemand in diesem Raum eine Vermutung, wer ihre Schwester töten wollte? Und warum?“, fragt Borsig gereizt. Sein Blick ist jetzt auf Johann, David und Esther gerichtet. Das freundliche Lächeln ist weg, verschwunden, ohne Spuren zu hinterlassen.
„Sie zu töten?“, fragt Esther erschrocken. „Hat jemand versucht, Aljona zu töten?“
„Was dachten Sie denn, was es bedeutet, wenn jemand auf einen anderen Menschen schießt?“
Esther schluckt ein paar Mal, räuspert sich. „Ich dachte, es wäre ein Unfall oder so. Ein Eindringling, der von Aljona erwischt wurde. Ich habe Aljona so oft darauf hingewiesen, dass sie die Türen besser abschließen soll. Hier liegt alles zum Mitnehmen herum. Früher war es egal, aber heutzutage muss man vorsichtig sein. Nicht nur im Ort trifft man auf seltsame Menschen. Auch hier auf dem Land, wissen Sie. Ausländer und so. Ich will natürlich nicht diskriminieren, aber trotzdem… Dies ist das letzte Haus am Ortsende. Wenn man von hier fliehen muss, gelingt das im Handumdrehen. Wir sind so gefährdet, so verletzlich.“ Esther schweigt abrupt und sieht jetzt Hilke irritiert an.
„Aljona hat keine Feinde“, fährt Esther fort. „Sie ist immer hier, bei unserem Vater.“
Wieder fällt eine seltsame Stille.
„Ist das so? Ist sie immer hier, bei ihrem Vater?“ In Hilkes Stimme vibriert Unglauben.
Mit einem Mal schluckt Esther heftig.
Nein, denkt Hilke, diese Schauspielerin stimmt eine Klage an. Es ist ein langer Ton, der anschwillt, aber er dringt nicht ganz zu ihr durch. Esther ist in sich gekehrt. Bleibt stumm. Alles hier wirkt fremd, als wäre selbst sie ein Teil dieser Inszenierung.
„Aljona ist immer hier, von Montag bis Freitag“, antwortet Johann barsch. „Samstag und Sonntag hat sie frei, dann müssen Sarah und Esther für sie einspringen. Es sei denn, es gibt etwas zu feiern, wie den heutigen Geburtstag unseres Vaters.“
Hilke nickt.
„Ich mache das gerne. Ich übernehme gerne Aljonas Aufgaben“, sagt Esther leise. Es ist nicht klar, wen sie plötzlich kleinlaut zu überzeugen versucht.
„Oh. Ich dachte, du tust das für unseren Vater“, blafft Johann sie an.
Esther wird blass, sie schließt einen Moment die Augen, würgt die Tränen ab.
David sucht das Gesicht seines Bruders ab. Die Wut arbeitet in ihm, sie zieht seine innere Aufruhr und das Schweigen in die Länge.
„Was soll dieser Ton, Johann?“, fragt er. „Wozu soll das gut sein? Hörst du denn nie auf, Aljona zu kritisieren?