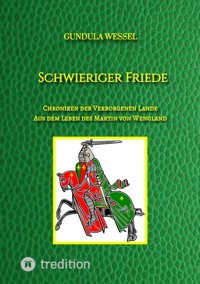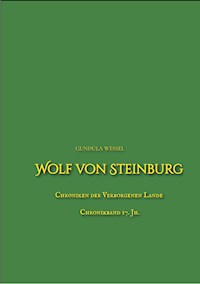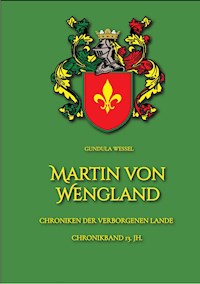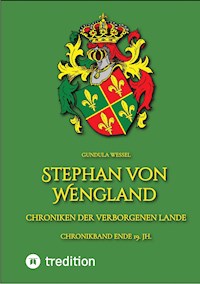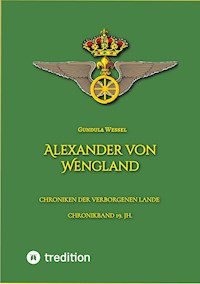2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Robert Bennett
- Sprache: Deutsch
USA unmittelbar nach dem Sezessionskrieg: Robert Bennett, der Major, und Martin Moore, der Marshal, haben im Krieg auf verschiedenen Seiten gestanden, sind aber gute Freunde. Als die Ablehnung seiner Nachbarn den Südstaatler Moore aus Virginia vertreibt, hat Bennett, Adjutant des US-Präsidenten, einen Job für seinen Freund. Schon bald geraten sie mit dem Ku-Klux-Klan aneinander – und treffen auf alte Bekannte, die sie in die tiefste Hölle wünschen. Und obendrein ist da noch der Präsident, dessen Posten alles andere als sicher ist ... Fortsetzung des Romans "... denn ein Haus, das gespalten ist, kann nicht bestehen"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gundula Wessel
Βεννεττ & Μοορε Δερ Μαφορ υνδ δερ Μαρσηαλ
Βοδψγυαρδσ γεγεν δεν Κλαν
Band 2 der Reihe Robert Bennett – Der Major und der Marshal
© 2023 Gundula Wessel
Der Major und der Marshal
Bodyguards gegen den Klan
Website: https://gundolfs-bibliothek.becksys.de/
Coverdesign von: Gundula Wessel unter Verwendung bearbeiteter lizenzfreier Bilder von Freepik und berra810 von Pixabay
Satz & Layout von: Gundula Wessel
ISBN Softcover: 978-3-384-08690-7
ISBN Hardcover: 978-3-384-08691-4
ISBN E-Book: 978-3-384-08692-1
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: Gundula Wessel, Anne-Frank-Weg 22, 25436 Tornesch, Germany.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Προλογ
Kapitel 1
Φαμιλιενανγελεγενηειτεν
Kapitel 2
Γεβυρτ εινερ Αυσγεβυρτ
Kapitel 3
Ειν νευερ Αυϕτραγ
Kapitel 4
Σοργεν
Kapitel 5
Μισστραυεν
Kapitel 6
Γενοσσεν ιμ Υνγειστε
Kapitel 7
Ναχηβαρσχηαϕτ
Kapitel 8
Ζυρεδεν
Kapitel 9
Καμπϕ υμ διε ςινχεντι-Φαρμ
Kapitel 10
Ερωαχηεν
Kapitel 11
Φεστπλανυνγ
Kapitel 12
Σιλῶεστερϕευερωερκ
Επιλογ
Γλοσσαρ
Bodyguards gegen den Klan
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Προλογ
Γλοσσαρ
Bodyguards gegen den Klan
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Προλογ
Im September 1865 war in den USA der Schlachtenlärm des Bürgerkrieges verhallt, die allerletzten Landtruppen der geschlagenen Konföderierten Staaten hatten sich ergeben. Der Süden lag besiegt am Boden, weitgehend zerstört und verwüstet.
Allein ein einsames konföderiertes Kaperschiff, die ALABAMA, war vom Zusammenbruch der Konföderation und dem daraus resultierenden Kriegsende noch nicht informiert und brachte weiterhin Schiffe der Vereinigten Staaten auf – ein Einzelfall. Die Südstaatler waren durch die totale Niederlage viel zu geschockt, um nach den grausamen Verlusten an Menschenleben und den rüden Verwüstungen an landwirtschaftlichen Flächen, Gebäuden und privatem Hab und Gut durch Unionstruppen noch an eine Fortführung des Kampfes für ihre Unabhängigkeit zu denken. Zur Niederlage kam noch der materielle Verlust hinzu, denn die Weißen im Süden verloren zu einem guten Teil dreifach: Erstens hatte man ihnen durch die Sklavenbefreiung praktisch ihr Vermögen enteignet. Schließlich waren die schwarzen Sklaven nichts anderes als eine Kapitalanlage, buchstäblich arbeitendes Geld. Zweitens sollten sie für dieselbe Arbeit, die ihnen die Sklaven vor dem Krieg für mehr oder weniger gute Kost und Logis gemacht hatten, nun zusätzlich bezahlen. Und drittens waren viele Plantagen und Stadthäuser zerstört, so dass für deren Instandsetzung hohe Summen investiert werden mussten, die ob der übrigen Vermögensverluste nicht ohne weiteres aufgebracht werden konnten.
Unklar blieb in den ersten Monaten nach dem Krieg, ob der Norden den Süden für den vom Zaun gebrochenen Streit noch weiter bluten lassen wollte. Wohl stammte Präsident Johnson selbst aus Tennessee, hatte aber die Sezession seines Heimatstaates und der anderen zehn Südstaaten immer scharf verurteilt. Außerdem stammte er aus bescheidenen Verhältnissen, was ihn nach Ansicht vieler Südstaatler für überzogene Neidreaktionen geradezu prädestinierte. Im Kongress war durch die Wahl vom 6. November 1864 eine komfortable Mehrheit für die radikalen Republikaner entstanden, die grobe Maßnahmen in den besiegten Staaten vehement befürworteten. Nach dem Willen vieler Kongressabgeordneter sollten Truppen der nun wiederhergestellten Union die elf abtrünnigen Staaten besetzen, um jede Regung von Widerstand gegen die neuen, unionstreuen Regierungen im Keim zu ersticken.
Zur Überraschung der geschlagenen Südstaaten erfüllte Johnson die lautstarken Forderungen nach harten Repressionen in der ehemaligen Konföderation aber nicht, sondern hielt sich an die noch von Präsident Lincoln geplante Versöhnungspolitik.
In seiner Antrittsrede vom 4. März 1865 hatte Lincoln Gerechtigkeit für alle und Versöhnung der Kriegsgegner als seine künftige Politik umrissen und seinem Nachfolger als Erbe hinterlassen. Johnson interpretierte die Rede auf seine eigene Weise und beschränkte die Verfolgung der Konföderierten auf deren politische Köpfe und Leute, die mehr als zwanzigtausend Dollar ihr eigen nannten – wobei auch nicht ganz klar war, ob diese Summe für Vermögen vor oder nach dem Krieg galt, was durchaus ein himmelweiter Unterschied sein konnte. Wiederholt hatten Abgeordnete in der sitzungsfreien Zeit nach dem Krieg darauf hingewiesen, dass mit dem ersten Zusammentreten des Kongresses ein anderer Wind wehen würde – und dass sich dann auch der Präsident warm anziehen müsse. Der aber versuchte, bis zur ersten Sitzung am 4. Dezember 1865 Fakten zu schaffen, die nicht einfach rückgängig zu machen waren; jedenfalls nicht, ohne die Gefahr eines Wiederaufflammens des Krieges heraufzubeschwören – trotz aller Ressentiments gegen neues Blutvergießen auf beiden Seiten.
Die Folgen, die sein Handeln für sich selbst und auch für die Südstaaten haben konnte, ignorierte der Präsident. Stur wie ein Maulesel folgte er dem eingeschlagenen Pfad, auf keine Warnung und keinen Rat hörend. Ob seine Entscheidungen aber wirklich Bestand haben würden, das war nicht zu übersehen, weder für die wütend zeternden Kongressabgeordneten, die einstweilen nichts tun konnten, noch für die unter dem Damoklesschwert totaler Enteignung stehenden Südstaatler, schon gar nicht für den Präsidenten selbst.
Nachdem der Krieg nun beendet war, wurden aber nicht nur die Soldaten der besiegten Konföderation nicht mehr benötigt. Auch die größten Teile der Unionsarmee wurden aufgelöst und die Leute heimgeschickt. Für diejenigen, für die der Krieg die Chance zu schneller Karriere gewesen war, begann die große Lebenskrise, als sie feststellen mussten, dass ihre Generalsränge nur so genannte Brevet-Ränge waren, zeitlich begrenzte Dienstgrade, die nur für die Zeit der Existenz der von ihnen befehligten Freiwilligenverbände galten. Einer von denen, auf die dies zutraf, war Major-General George Armstrong Custer, ein Akademiekamerad von Robert Bennett, ebenfalls gerade sechsundzwanzig Jahre alt. Wie fast alle viel zu schnell beförderten Offiziere stutzte man ihn zurück. Custer fand sich als Lieutenant-Colonel in der verbliebenen Restarmee wieder – und hatte damit seine Probleme
Anderen, vor allem älteren Offizieren, die reguläre Truppen kommandiert hatten, bot man an, mit einem höheren Rang in Pension zu gehen oder mit einem niedrigeren Dienstgrad zu bleiben. Unter diese Regelung fielen Brigadier-General Frederick Bennett und Colonel Richard Craig. Frederick Bennett überlegte nicht lange. Er war neunundfünfzig Jahre alt, hatte ein lahmes Bein und fand, dass er sich lange genug mit Indianern und anderem Gesindel herumgeärgert hatte. Sein erster Diensttag als Major-General war denn auch sein letzter. Richard Craig hatte seine Armeezugehörigkeit ohnehin nur für die Zeit des Krieges als notwendig angesehen und nahm mit einiger Freude den Stern des Brigadier-Generals als pauschale Auszeichnung für seine Dienste entgegen.
Mit der Pensionierung von Richard Craig und Frederick Bennett und der Auflösung der zur Brigade gehörenden Freiwilligenverbände stellte sich zum einen in der 7th US-Cavalry nicht nur die Kommandeursfrage, sondern eher die Existenzfrage der Brigade selbst. Kriegsminister Stanton beantwortete sie auf die einfachste Weise: Er löste Brigade Bennett mitsamt der 7th US-Cavalry auf und erfüllte damit gleich eine von den Kongressabgeordneten diskutierte Sparmaßnahme.
Am 16. September 1865 verabschiedete der Präsident die Brigade Bennett in deren Heimatfort Donelson. Die Soldaten erhielten ihren ehrenvollen Abschied, alle bekamen die Medaille der Army of the Potomac. Ein letztes Mal paradierte die Truppe vor Präsident und Kriegsminister.
Robert Bennett, als Major des Stabes und Adjutant des Präsidenten anwesend, konnte seine Tränen genauso wenig unterdrücken wie seine Kameraden. Es war für sie alle ein trauriger Moment, als die Regimentsfahnen feierlich eingerollt wurden, um nie mehr unter freiem Himmel zu flattern – und das ausgerechnet an dem Tag, der für die 7th US-Cavalry so etwas wie ein Regimentsfeiertag war.
Genau drei Jahre zuvor war die 7th US-Cavalry zum Tagesgespräch der gesamten Army of the Potomac geworden, als es der C-Schwadron in der Schlacht am Antietam gelungen war, durch raffinierte Schutzbauten den linken Flügel der Armee zu stabilisieren und ein ganzes Infanteriebataillon durch die bloße Aushilfe von zwanzig Mann von eiligem Rückzug abzuhalten. Viele Männer waren damals gefallen, noch mehr verwundet worden, manche – wie Robert Bennett und Thomas Craig – hatten nur knapp überlebt. Schon zum damaligen Zeitpunkt hatte der Armeechef Frederick Bennett die Weisung erteilen wollen, das arg dezimierte Regiment, mindestens aber die praktisch nicht mehr existente C-Schwadron aufzulösen. Frederick hatte sich geweigert, hatte das Regiment samt der C-Schwadron erhalten und wieder aufgefüllt und zu einer der erfolgreichsten und besten Einheiten der Armee gemacht. Nun existierte es nicht mehr.
In diesem, für sie alle einschneidenden Moment, konnten die recht hartgesottenen Männer der 7th US-Cavalry die Reaktion der Südstaatler begreifen, die vor knapp einem halben Jahr so geweint hatten.
Kapitel 1
Φαμιλιενανγελεγενηειτεν
Im Gegensatz zu seinen früheren Kameraden hatte Robert einigermaßen planbare Zukunftsaussichten, wenn seine Aufgabe auch sehr direkt mit dem Amt des Präsidenten verknüpft war. Im Augenblick dachte er allerdings nicht daran, dass er seinen Job schon bald wieder verlieren könnte, nämlich dann, wenn Johnson bei den nächsten Wahlen gegen einen anderen Kandidaten verlieren würde – oder wenn der Kongress mit der Drohung durchkommen sollte, ihn nach einem Impeachment-Verfahren* abzusetzen.
Im Moment war Robert eher mit familiären Dingen beschäftigt. Susan, seine Frau, erwartete ihr erstes Kind, und der berechnete Geburtstermin stand unmittelbar bevor. Der Spätsommer war heiß in diesem Jahr, und Susan litt unter der Hitze. Ihre Mutter und ihre Tante waren nach Washington gekommen, um die junge Frau zu unterstützen und spazierten täglich mit ihr am Potomac entlang, wo es etwas frischer war als in der Stadt selbst.
Einige Tage später, es war der 25. September, rutschte Robert bei einem Arbeitstee des Präsidenten unruhig auf seinem Stuhl hin und her.
„Sie sind geistesabwesend und unruhig, Major!“, rügte Präsident Johnson. „Sitzen Sie endlich still!“
Robert schrak zusammen.
„Entschuldigung, Mr. President. Ich mache mir nur Sorgen um meine Frau. Es ging ihr heute Morgen nicht sehr gut.“
Johnson sah Robert eine Weile an.
„Ich verstehe zwar, dass Sie in Sorge sind, aber nehmen Sie sich jetzt bitte zusammen, Major Bennett!“
Robert wusste, dass Johnson keine Disziplinlosigkeiten duldete. Wegen der Auflösung seines alten Regiments hatte es auch gewisse Missstimmung zwischen dem Präsidenten und seinem Adjutanten gegeben, doch waren solche Meinungsverschiedenheiten in der Regel von kurzer Dauer. Zum jetzigen Zeitpunkt störten sie allerdings.
„Ich werd’s versuchen, Mr. President“, versprach Robert mit dem Anflug eines Seufzens nervös und mühte sich, stillzusitzen. Es gelang ihm halbwegs, dafür wurden seine Fingernägel kürzer.
Schließlich hatte er die ihm unendlich lang erscheinende Konferenz überstanden und stürmte, gleich nachdem Johnson die Sitzung für beendet erklärt hatte, aus dem Raum. Minister Stanton sah ihm über den Brillenrand nach.
„Erstaunlich, wie nervös ein sonst so abgebrühter Soldat sein kann, wenn seine Frau ein Kind bekommt.“
General Grant, der Armeechef, paffte an seiner Zigarre.
„Ist mir genauso gegangen, als mein Sohn geboren wurde. Ich bin wie ein Löwe im Käfig herumgelaufen. Kennen Sie eigentlich Mrs. Bennett?“, fragte er Stanton. Der Minister schüttelte den Kopf.
„Schade, Mr. Stanton, da haben Sie was verpasst. Major Bennetts Frau ist ein echter Engel, außerdem mehr als nur hübsch – sogar im schwangeren Zustand. Wenn der Krieg noch etwas länger gewesen wäre, hätte ich Mrs. Bennett als nächsten Sanitätsoffizier* in den Stab geholt. Das Mädchen ist einfach einmalig. Wenn sich ein Mann um so eine Frau keine Sorgen macht, dann ist er aus Stein.“
Robert stürmte in seine Wohnung und wurde gleich von seinem Vater abgefangen.
„Halt, mein Junge!“, kommandierte er und hielt seinen Sohn am Ärmel fest.
„He, was soll das?“
„Komm, bleib’ hier. Die Geburt hat begonnen. Du störst jetzt nur“, erwiderte Frederick.
„Dad, lass mich zu meiner Frau!“, forderte Robert knurrend.
„Kommt nicht in Frage!“, versetzte der General a. D. „Ich habe von deiner Schwiegermutter den strikten Befehl, dich da nicht ‘rein zu lassen. Ich bin immer noch so viel Soldat, dass ich solche Befehle befolge. Du kannst Susan doch nicht helfen.“
„Ich habe ihr die Suppe eingebrockt!“, widersprach Robert. „Schließlich habe ich das Kind gezeugt!“
Frederick grinste, dass sich der sauber gestutzte weiße Bart sträubte.
„Komm, mein Sohn, häng’ den verdammten Säbel aus, zieh’ dir was Bequemes an und bleib’ hier im Wohnzimmer. Deine Frau hat Hilfe durch ihre Mutter und ihre Tante.“
„Ich wünschte, Lucas würde noch leben. Mir wäre sehr viel wohler, wenn er hier wäre und sich um Susan kümmern könnte“, seufzte Robert.
„Vielleicht ist dir entgangen, dass Louisa Craig Hebamme ist – trotz der Tatsache, dass sie Nonne ist. Und ‘ne Hebamme ist jetzt eher gefragt als ein Arzt.“
Robert schnaubte, aber er hängte den Säbel aus, zog den Uniformrock aus und nahm die beengende Schleife vom Hemdkragen ab. Zunächst setzte er sich auch in einen der Sessel im Wohnzimmer, von dem das Schlafzimmer direkt abging, aber lange hielt er es im Sitzen nicht aus. Er stand auf und begann, unruhig auf und ab zu gehen. Weder sein Vater noch sein inzwischen hinzugekommener Schwiegervater konnten ihn beruhigen.
Louisa Craig kam aus dem Schlafzimmer.
„Setz’ dich endlich hin!“, kommandierte sie. „Du machst deine Frau ganz nervös, so wie du hier herum tigerst.“
„Das soll sie mir selber sagen!“, entgegnete Robert gereizt und wollte an der Nonne vorbei, aber sie stoppte ihn.
„Nein, du gehst da nicht ‘rein. Du bist ihr mit deiner Nervosität keine Hilfe. Das regt sie unnötig auf.“
Robert wollte etwas einwenden, aber Louisa schüttelte nur den Kopf.
„Junge, Junge, mich würdest du Nervösling beim Kinderkriegen jedenfalls völlig aus dem Konzept bringen!“
„In die Verlegenheit dürftest du kaum kommen!“, versetzte Robert bissig.
„Vielleicht wollte ich nicht mit einem solchen Nervenbündel wie dir behaftet sein?“, grinste Louisa.
„Ich hab’ ‘ne andere Geschichte gehört, weshalb du in den Orden eingetreten bist, aber …“
Robert kam nicht weiter, denn Susan schrie laut auf. Er wollte an Louisa vorbei, aber sie verstellte ihm hartnäckig den Weg, sein Vater und sein Schwiegervater hielten ihn mit einiger Gewalt fest.
„Lasst mich zu meiner Frau, verdammt!“, rief er und wehrte sich, kam aber nicht los. Einen Moment war Stille, dann krähte ein Baby.
So sehr sich die Geschwister Craig und Roberts Vater auch mühten, er war nicht mehr zu halten und brach ins Schlafzimmer durch.
„Susan!“, schrie er. Gwendolyn Craig drehte sich erschrocken um, das Baby in Tüchern verpackt auf dem Arm.
„Pscht, schrei nicht so. Sie ist gerade eingeschlafen“, warnte sie leise. Robert wurde bleich.
„Was? Ist … ist sie …?“, stotterte er.
„Nein, sie ist nur sehr erschöpft.“
„Sind … sind beide gesund?“
Gwendolyn lächelte und überreichte ihm das Bündel.
„Ja, das sind sie. Hier, Vater, nimm deinen Sohn.“
Er nahm ihr die dicken Steckkissen ab und sah seinen Sohn an. Der Kleine hatte dunkle Locken und war von der Geburtsanstrengung puterrot. Robert streichelte das winzige Gesichtchen sanft mit dem Zeigefinger und küsste den Kleinen. Das Baby hörte auf zu schreien und schlug die zugekniffenen Äuglein auf, lachte seinen Vater an. Robert sah genauer hin, soweit es der Tränenschleier erlaubte und bemerkte, dass sein Sohn sanfte braune Augen hatte.
Mit dem Kind im Arm setzte er sich an Susans Bett. Sie spürte die leichte Erschütterung und wachte auf.
„Robert!“, flüsterte sie matt. Er beugte sich über sie, küsste sie und strich ihr zärtlich durch das schweißverklebte Haar.
„Ihr habt es geschafft, Schatz. Herzlichen Glückwunsch, Mom“, sagte er. „Wie geht es dir, Liebling?“
„Es war anstrengend, ich bin völlig fertig; aber sonst geht’s mir besser als heute Morgen.“
Robert hob das Steckkissen etwas an, damit Susan ihr Kind sehen konnte.
„Sieh mal – dein Sohn“, lächelte er. Susan versuchte, sein Lächeln zu erwidern.
„Falsch. Unser Sohn“, erwiderte sie schwach.
„Und wie soll euer Sohn heißen?“, erkundigte sich Richard von der Tür.
„Christopher!“, erwiderte Susan zwar matt, aber entschlossen. Ihre Eltern, Tante und Schwiegervater sahen sie verblüfft an.
„Wie kommst du auf den Namen?“, fragte Gwendolyn.
„Es ist Roberts zweiter Name, der mir immer sehr gut gefallen hat. Außerdem hieß Großvater Craig so. Und als zweiten Namen hätte ich gern Lucas“, begründete Susan.
„Christopher Lucas Bennett! Klingt gut. Genauso wird er getauft, mein Schatz“, versprach Robert und küsste seine Frau noch einmal.
„Komm jetzt, Susan sollte jetzt schlafen“, mahnte Gwendolyn ihren Schwiegersohn.
„Ma, Susan ist mir nicht von der Seite gewichen, als es mir schlecht ging. Und ich werde hier nicht weggehen!“, protestierte er.
„Lass nur, Schatz. Das ist schon Frauenarbeit. Geh’ nur. Für dich war’s bestimmt aufregender als für mich.“
Aber Robert ließ sich nicht einfach fortschicken. Gemeinsam mit seiner Schwiegermutter blieb er bei Susan und Klein-Christopher. Vollends verblüfft war Gwendolyn aber, als Robert sie bat, ihm zu zeigen, wie man ein Baby richtig trockenlegt.
„Na schön, ich zeig’s dir“, seufzte Gwendolyn, als Robert nicht locker ließ. „Aber ich garantiere dir, dass das nichts für dich ist, großer Krieger“, warnte sie.
„Wie soll ich das jetzt verstehen?“
„Bobby – Berufssoldaten und Kinderwickeln, das passt nicht zusammen. Ich hab’ meine Erfahrungen.“
Robert lächelte.
„Ma, ich werde mich nicht vor der Verantwortung drücken, indem ich meine Tätigkeit in Sachen Kinder aufs Zeugen beschränke. Ich habe mir oft gewünscht, mein Vater hätte mehr Zeit mit uns Kindern verbracht. Jetzt habe ich die Gelegenheit, es bei meinen Kindern besser zu machen.“
„Lobenswerter Vorsatz, mein Junge. Fast jeder junge Ehemann hat ihn – aber kaum einer erfüllt ihn.“