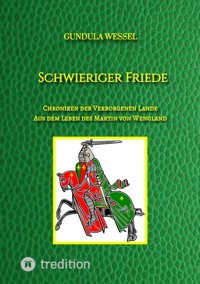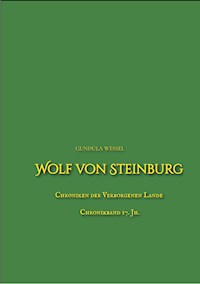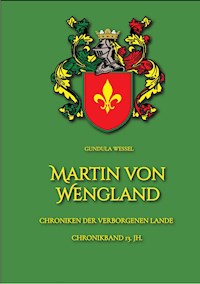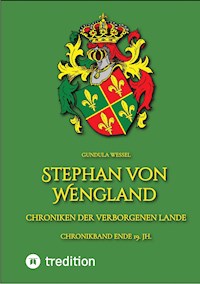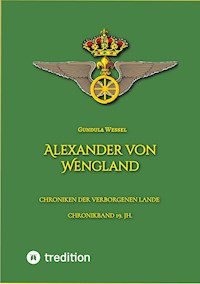
5,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Buch besteht aus zwei Teilen. Teil 1 befasst sich mit dem Eisenbahnbau im Königreich Wengland, für den König Wilhelm seinen jüngsten Sohn Alexander aus der Schweiz zurückruft, wo der junge Mann als Vermessungsingenieur beim Bau der Gotthardbahn arbeitet. Alexander kehrt nur widerwillig zurück, gefällt ihm seine Arbeit doch. Er ist überrascht, seine eigentliche Arbeit auch zu Hause fortführen zu können. Er lernt auf der Heimfahrt Simone Haldenstein kennen, deren Vater Kopf der Sozialistischen Partei Wenglands ist und als Gegner der Monarchie im Staatsgefängnis von Palparuva sitzt. Er verliebt sich in sie, gibt ihr Arbeit bei der Bahn und kann auch für die Freilassung ihres Vaters sorgen, der sich aber sehr undankbar zeigt. Alexanders Liebe zu Simone wirft ihm einige Steine in den Weg, die beide aber überwinden können und schließlich heiraten. Mit der Vollendung der ersten Teilstrecke endet das erste Buch. Teil 2 befasst sich mit Alexanders Vergangenheit, die ihn in der Gegenwart einholt, als sein ältester Bruder Friedrich mit Frau, Sohn und Leibkutscher bei einem Bombenattentat ums Leben kommt. Verdächtig sind ausgerechnet seine jüngeren Brüder Eberhard und Alexander. Alexander kann mithilfe seiner Frau Ermittlungen aufnehmen, die den angeblichen Eberhard als wilzarischen Agenten Gobur Simat entlarven, der das Attentat befohlen hat. Er verfolgt ihn bis in die Schweiz, wo der echte Eberhard Jahre zuvor bei einem Bergunfall ums Leben gekommen ist. Alexander kann seinen toten Bruder nach Wengland zurückbringen und die Nachfolge als Kronprinz antreten, aber Simat wird nicht nach Wengland ausgeliefert und kann untertauchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gundula Wessel
Chroniken der Verborgenen Lande
Alexander von Wengland
© 2022 Gundula Wessel
Umschlaggestaltung: Gundula Wessel
ISBN Hardcover: 978-3-347-53042-3
ISBN E-Book: 978-3-347-53042-0
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhalt
Vorwort
Erstes Buch
Eine Eisenbahn für Wengland
Prolog
Kapitel 1
Befehl zur Heimkehr
Kapitel 2
Schicksalhafte Begegnung
Kapitel 3
Ein unverschämter Patron
Kapitel 4
Überraschungen
Kapitel 5
Ein neuer Anfang
Kapitel 6
Unruhestifter
Kapitel 7
Ausgebremste Revolution
Kapitel 8
Königliche Einladung
Kapitel 9
Freundlicher Empfang
Kapitel 10
Festnacht
Kapitel 11
Morgengeflüster
Kapitel 12
Bruderzwist
Kapitel 13
Heftige Reaktionen
Kapitel 14
Geschäftssinn
Kapitel 15
Aussprache
Kapitel 16
Auslandsglück
Kapitel 17
Rückkehr
Kapitel 18
Anbruch einer neuen Zeit
Zweites Buch
Schatten der Vergangenheit
Prolog
Kapitel 1
Attentat
Kapitel 2
Ungewissheit
Kapitel 3
Verdacht
Kapitel 4
Doppelte Buchführung
Kapitel 5
Ermittlungen
Kapitel 6
Verschwörung
Kapitel 7
Schatten der Vergangenheit
Kapitel 8
Erste Ergebnisse
Kapitel 9
Begegnung im Kirchhof
Kapitel 10
Stehaufmännchen
Kapitel 11
Zugriff
Kapitel 12
Trauerfeier
Epilog
Glossar
Vorwort
Die Geschichte des Königreichs Wengland geht weiter. Hier präsentiere ich meinen Lesern einen Abschnitt, der in den Jahren 1871 – 1875 spielt und Alexander, den jüngsten von drei Söhnen des wenglischen Königspaares Wilhelm und Annette, als zentrale Figur hat.
Die handschriftliche Vorlage, die ich Ende der Achtzigerjahre zu schreiben begann, als ich in der Schweiz Sommerurlaub gemacht habe, beinhaltet die komplette Geschichte, wie sie mir eingefallen und durch den Kugelschreiber auf Papier geflossen ist. Als ich Mitte der Neunzigerjahre mein erstes Notebook hatte und begann, meine handschriftlichen Geschichten zu digitalisieren, habe ich zunächst zwei voneinander getrennte Dateien hergestellt, weil die Handlung der Geschichte in zwei Teile zerfiel: den Beginn des Eisenbahnbaus im Königreich Wengland und in eine Spionagegeschichte, in der Alexander seine Vergangenheit einholt und er feststellen muss, dass in seiner Familie nicht alles so ist, wie es scheint. Theoretisch wäre noch ein dritter Teil denkbar, den ich aber bis heute nur konzeptionell entwickelt habe und der bisher als Epilog des zweiten Teils vorhanden ist. In zwei Teilen habe ich die Geschichte dann in den 2000ern bei fanfiktion.de als eigenes Werk veröffentlicht, wobei der Epilog am zweiten Teil hängt.
Bei der jetzigen Umsetzung in Buchform erschienen die beiden Teile als jeweils zu wenig umfangreich, um in zwei getrennten Bänden veröffentlicht zu werden. Es sind nach wie vor zwei Bücher, die ich hier aber in einem Band versammelt meinen Lesern anbiete.
Der Epilog könnte weiter ausformuliert werden und theoretisch zu einer eigenen dritten Geschichte im Leben des Alexander von Wengland werden. Sollte seitens meiner Leser Interesse daran bestehen, bitte ich, über den Tredition-Verlag in Hamburg mit mir Kontakt aufzunehmen.
In diesem Buch finden sich einige Begriffe, die vielleicht nicht jeder kennt. Ich habe sie mit * gekennzeichnet und am Ende des Buches ein Glossar hierfür eingefügt.
Ferner finden sich einige Sätze, die phonetisch in Schwyzerdütsch geschrieben sind. Ein schweizerischer Bekannter hat sie so als – wenigstens phonetisch – korrekt befunden. Ich habe dort Fußnoten mit der hochdeutschen Übersetzung eingefügt.
Gundula Wessel, Tornesch, im Januar 2022
Erstes Buch
Eine Eisenbahn für Wengland
Prolog
Während im übrigen Europa des Jahres 1871 die Nachricht von der Wiedererrichtung des deutschen Kaiserreiches die Runde machte, hatte König Wilhelm von Wengland ganz andere Sorgen. Noch immer war Europa ein riesiger Flickenteppich mehr oder weniger großer Reiche – von kleinen Grafschaften, die kaum fünfzig Meilen lang und dreißig Meilen breit waren, über mittelgroße Fürstentümer bis hin zu Großherzogtümern, deren Herrscher nach Königskronen griffen. Doch die Flicken auf diesem bunten Teppich begannen zusammenzuschmelzen, nachdem sich 1864 ein massiver Gegensatz zwischen Preußen und Österreich entwickelt und sich in einem kurzen, aber folgenreichen Krieg entladen hatte. Preußen griff nach immer mehr Territorien, hatte sich das Rheinland, das Königreich Hannover – die Stammlande des britischen Königshauses! – und zahlreiche andere kleine Fürstentümer wie zum Beispiel Neuenburg am westlichen Rand der Schweiz einverleibt. Nach dem Sieg von 1871 über Frankreich war Preußen zum Kernland des neuen Deutschen Reiches aufgestiegen, sein König war Kaiser des Reiches geworden – erwählt und bestätigt von den deutschen Fürsten. Reichskanzler Bismarck hatte den Vielvölkerstaat Österreich ganz bewusst aus diesem neuen Reich gedrängt.
Wilhelm konnte es immer noch nicht fassen, wie knapp nicht nur Wengland, sondern auch Wilzarien, Breitenstein und Scharfenburg einem ähnlichen Schicksal wie Hannover entgangen waren. Unter seinem Vater, Ferdinand von Wengland, war Wengland ein in der europäischen Welt offen vorhandenes Fürstentum gewesen, das es seit den Tagen des Dreißigjährigen Krieges gewesen war. Fürst Ferdinand war durch seine Hilfe gegenüber dem König von Preußen und dem Kaiser von Österreich die Anerkennung als König zuteil geworden. Ohne das Versprechen dieser beiden Herrscher hätte Ferdinand wohl eher mit Napoleon gemeinsame Sache gemacht. Der Franzosenkaiser hatte Ferdinand mit der Königskrone ködern wollen, aber da die französischen Truppen im Zusammenwirken mit Wilzarien Südwengland, Hirschfeld und Karlsfeld arg gerupft hatten, hatte Ferdinand gewisse Animositäten gegen Napoleons Truppen. Also hatte er Preußen und Österreich ein entsprechendes Angebot gemacht und es mit der Bedingung versehen, als König von Wengland anerkannt zu werden.
Angesichts der Qualität der fürstlichen Truppen hätte eine Zusammenarbeit der Wengländer mit den Franzosen unabsehbare Folgen haben können. Daran war weder Preußen noch Österreich gelegen. Zudem hatte es beide Herrscher nichts gekostet, Ferdinand als König anzuerkennen. Wengland hatte sich seit Fürst Wolfs Zeiten unauffällig immer selbstständiger gemacht, bis es schließlich aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation ausgeschieden war, ohne dass der Kaiser das überhaupt bemerkt hatte. Mit dem endgültigen Zusammenbruch des Reiches 1806 war Wengland ein völlig souveräner Staat geworden. Ob dieser Staat von einem Fürsten oder einem König regiert wurde, spielte für Preußen überhaupt keine, für das gebeutelte Österreich nur eine untergeordnete Rolle. Wichtig war für beide hingegen, dass Wengland mit ihnen gegen Napoleon verbündet war. Dank des eingetretenen Erfolges gab es seit 1815 wieder ein Königreich Wengland in denselben Grenzen, die vor bald sechshundert Jahren unter seinem großen König Ulrich das Reich bezeichnet hatten.
Die Herrscher Wenglands und seiner Nachbarstaaten wussten, dass auf die großen Nachbarn wie Preußen, Österreich und Frankreich nur bedingt Verlass war. Österreich hatte beim Wiener Kongress ein Durchmarschrecht durch die Hohen Lande verlangt, war jedoch am Widerstand Preußens und der Hohen Lande selbst gescheitert. Es blieb deshalb die Gefahr, dass Österreich trotz der Anerkennung der Souveränität der Hohen Lande in eines der Lande einmarschieren würde, um seine Autorität im südlich der Hohen Lande gelegenen italienischen Reichsgebiet durchsetzen zu wollen. In Zeiten der Bedrohung von außen nutzten die Herren der Hohen Lande deshalb etwas, das in die fortschrittsgläubige Zeit des 19. Jahrhunderts so wenig passte wie ein Zündnadelgewehr ins Mittelalter: Zauber!
Jahrhunderte zuvor war es einem Goden, einem Priester einer längst untergegangenen Religion, gelungen, die ganze Region mit einem Zauber zu verbergen. Der Zauber war in Vergessenheit geraten, als die Pest die Region entvölkert hatte. Erst durch einen Zufall war Simon, der Sohn des Fürsten Wolf, auf einen riesigen Diamanten gestoßen, der tief im Keller eines Schlosses in der Nähe von Münster versteckt war – und auf das dazugehörige Buch, das ihm das Geheimnis dieses Steins verraten hatte. Seither konnte die Region wieder verborgen werden, wenn die regionalen Herrscher es wünschten. Wer in Zeit der verborgenen Existenz an die Grenzen der Hohen Lande kam, der kam in eines der Nachbarländer der Region, aber nicht in die Region hinein – es sei denn, er hatte einen Schlüssel bei sich, der das Tor in die verborgenen Hohen Lande öffnete …
Die Welt schien durch neue Verkehrsmittel wie etwa die Eisenbahn immer kleiner zu werden und Europa durch das Wachsen der großen Nationen immer gefährlicher. Das Expansionsstreben Frankreichs unter den Revolutionären und später unter Napoleon sowie das Streben Preußens, in den deutschsprachigen Gebieten Europas die bestimmende Macht zu sein, waren eine so eindringliche Warnung gewesen, dass die Herren der Hohen Lande ihre Feindseligkeiten beiseitegeschoben hatten und 1850 die gesamte Region in die Verborgenheit versetzt hatten, die seither wieder ausschließlich Verborgene Lande genannt wurden. Letzter Auslöser war die preußische Polizeiaktion im Großherzogtum Baden gewesen, wo Republikaner den Großherzog gestürzt und eine Republik ausgerufen hatten. Der benachbarte König von Württemberg, der König von Bayern und die Landgrafen von Hessen hatten schlichtweg Angst gehabt, dass der badische virus republicanus auf ihre Länder übergreifen würde und hatten zusammen mit dem militärisch mächtigen Preußen die badische Demokratie brutal zerschlagen.
Die Könige Wenglands und Wilzariens, der Fürst von Breitenstein und der Herzog von Scharfenburg fürchteten sowohl die republikanischen Ideen als auch die preußische Militärmacht, der sie zu wenig entgegenzusetzen hatten, um selbstständig zu bleiben. So hatten sie ihre Auslandsvertretungen in den meisten europäischen Staaten offiziell geschlossen, vorgeblich an Handelsfirmen verkauft, in deren Hinterzimmern die Diplomaten der Region gleichwohl weiterhin tätig waren und im Notfall Anlaufstellen für reisende Wengländer, Wilzaren, Breitensteiner oder Scharfenburger waren.
Es gab nach 1850 nur einen einzigen Staat in Europa, von dem aus die Verborgenen Lande ohne Schwierigkeiten erreicht werden konnten, und das war die Schweiz. Das kleine Land in der Mitte Europas hatte beim Wiener Kongress von 1815 als Preis für die Anerkennung seiner äußeren Grenzen auf Verlangen der europäischen Großmächte „immerwährende Neutralität“ erklären müssen – und genau das machte die Schweiz für die Herren der Verborgenen Lande ausreichend vertrauenswürdig, um die dortige Gebirgsgrenze nur teilweise zu verbergen. Offen blieben jene Grenzübergänge, die sich in Gebirgshöhlen oder speziell dafür gebauten Tunneln befanden. Mit der Schweiz bestanden weiterhin volle diplomatische Beziehungen und das Abkommen, dass die fraglichen Grenzübergänge nur für Personen geöffnet wurden, die sich als Einwohner der Verborgenen Lande ausweisen konnten.
Dass sich die Herren der Verborgenen Lande einig waren, was das Verstecken einer Fläche so groß wie Baden, Württemberg, Bayern, Deutsch-Österreich und die Schweiz zusammen betraf, bedeutete keineswegs, dass in der Region Krieg unbekannt war. Wengland und Wilzarien führten nahezu ständig Krieg miteinander – meist um die seit 1265 zu Wengland gehörende Grenzprovinz Aventur, deren Besitz Wengland aber seit der Abtretung durch Wilzarien stets verteidigt hatte. In einem Jahrzehnt waren vier bis fünf Jahre Krieg normal …
Kapitel 1
Befehl zur Heimkehr
König Wilhelm hatte lange vor einer großen Wandkarte gebrütet. Fast dreihundert Jahre war Wengland in seine dreizehn Grafschaften geteilt gewesen. In dieser Zeit hatten die einzelnen Provinzen höchst unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht. In den vergangenen zweihundert Jahren hatten zwar die Wunden der Teilung geheilt werden können, aber es waren Narben zurückgeblieben, die die Grafschaften untereinander schwer erreichbar machten. Für den König stellte sich die Frage, ob die vorhandenen Verkehrswege ausgebaut werden sollten, oder ob man neue Wege zu beschreiten sollte. Als geeignete Alternative zur Postkutsche war wohl die Eisenbahn anzusehen, die in den weiter nördlich liegenden Ländern der offenen Welt schon Einzug gehalten hatte und das Verkehrswesen dort geradezu revolutioniert hatte.
Wilhelms Blick fiel auf die Herkunftsbeschriftung. Topographisches Amt, Steinburg, gezeichnet: Alexander von Steinburg stand dort. Der König seufzte. Alexander müsste da sein! Der Junge hatte Ideen. Aber Wilhelm wusste nicht einmal genau, wo sein jüngster Sohn sich aufhielt.
Er zog heftig an der Klingelschnur. Ein Diener in grüner Livree erschien.
„Majestät haben geläutet?“
„Gerhard, lassen Sie den Außenminister von Stotzeck kommen.“
„Der Herr Außenminister ist gestern Morgen auf Ihre Veranlassung nach Bern gereist, Majestät“, erklärte der Diener.
„Auch das noch!“, knurrte Wilhelm. „Dann lassen Sie General von Aschewerth holen.“
„Jawohl, Majestät.“
Der Diener buckelte und ging.
Eine halbe Stunde später war der General bei seinem König.
„Majestät haben mich rufen lassen?“
„Ja. Von Aschewerth – wo kann sich Prinz Alexander aufhalten?“
„Ach, herrje!“, entfuhr es dem General. „Majestät sehen mich ratlos. Ich weiß nur, dass er ins Ausland wollte.“
„Ja, bei Gott, das weiß ich auch, Herr General! Ich will wissen, wo der Bengel sich herumtreibt!“, entfuhr es Wilhelm. Der General dachte eine Weile nach.
„Kurz bevor er den Dienst bei mir beendete, habe ich in seiner Stube Bücher über Amerika und die Schweiz gesehen. Soll ich über unsere Botschaften in Bern und Washington anfragen, ob Seine Königliche Hoheit dort eingetroffen ist?“
„Tun Sie das, von Aschewerth. Aber etwas zügig, bitte.“
„Jawoll, Majestät!“
Hubert von Aschewerth knallte vernehmlich die Hacken zusammen und verschwand eilig.
Drei Stunden später war der General mit einem Berg von Depeschen zurück.
„Wir haben ihn in der Schweiz gefunden. Er ist in Andermatt im Kanton Uri“, erklärte von Aschewerth strahlend.
„Dann holen Sie ihn aus Uri zurück! Ich brauche ihn jetzt hier!“
„Majestät mögen mir verzeihen, aber ich glaube nicht, dass er kommen wird“, gab der General zu bedenken.
„General von Aschewerth: Egal, wie Sie es machen – ich will meinen Sohn hier in Steinburg haben! Schreiben Sie ihm, schicken Sie einen Kurier oder machen Sie sonst etwas. Aber ich brauche Alexander in spätestens drei Monaten hier!“
Der General salutierte.
„Ich tue mein Bestes, Majestät“, versprach er und eilte davon.
Alexander hatte zu den Soldaten gehört, die General von Aschewerth äußerst ungern hatte gehen lassen. Der junge Mann hatte sich nicht nur durch unbedingte Tapferkeit, sondern auch durch Klugheit ausgezeichnet. Folgte man der Chronik der wenglischen Herrscher, musste Alexander an die Qualitäten eines Martin oder Ulrich von Wengland heranreichen. Beide waren nicht nur Ritter gewesen, sondern hatten sich auch der Wissenschaft geöffnet. Alexander schien aus dem gleichen Holz geschnitzt zu sein. General von Aschewerth hatte dessen Aufenthaltsort denn auch bezeichnenderweise nicht über die Botschaft in Bern, sondern über die Universität Wachtelberg bekommen. Nach Auskunft der Physikalischen Fakultät war der Prinz mit einer Gruppe von Vermessungstechnikern nach Andermatt im schweizerischen Kanton Uri aufgebrochen, wo zurzeit Vermessungsarbeiten für eine Bahnverbindung zwischen Andermatt und Airolo über den Gotthardpass stattfanden.
General von Aschewerth sandte eine dringende Depesche an den jüngsten Sohn des Königs nach dem Postamt in Andermatt, mit der Aufforderung, umgehend nach Steinburg zurückzukehren.
Alexander war jetzt sechsundzwanzig Jahre alt. Mit zwanzig Jahren hatte er den unter wenglischen Adligen üblichen Schulabschluss Abitur gemacht und war danach – wie jeder männliche Wengländer – zum Militärdienst eingezogen worden. Männliche Abituranwärter des Adels durchliefen ab der Untersekunda, der 10. Klasse der Gesamtschulzeit von dreizehn Jahren, bereits die Kadettenschule, in der sie neben einer breiten Allgemeinbildung bereits ihre militärische Ausbildung als angehende Offiziere erhielten. Nach dem Abitur wurden die jungen Männer des wenglischen Adels bereits als Offiziere in den eigentlichen Militärdienst eingezogen, der dann mindestens zwei Jahre dauerte.
Während Alexanders Militärzeit hatte Wengland mit Wilzarien wieder einmal einen heftigen Krieg um die Provinz Aventur geführt, der auf beiden Seiten hohe Verluste verursacht hatte. Nach diversen Verwundungen, darunter einer wirklich schweren, die er nur knapp überlebt hatte, und monatelanger Gefangenschaft hatte er zum frühestmöglichen Zeitpunkt seinen Militärdienst quittiert und – so weit wie möglich von Aventur entfernt – an der Universität Wachtelberg Vermessungstechnik studiert. Weil den angehenden Offizieren auf der Kadettenschule bestimmte Elemente der Vermessungstechnik beigebracht wurden, hatte er nach zwei Semestern bereits die Prüfung zum Vermessungsingenieur ablegen können und danach ein halbes Jahr lang im Topographischen Amt von Steinburg gearbeitet.
Jawohl, gearbeitet! Prinzen aus dem Hause Wengland-Steinburg waren ohnehin keine geborenen Müßiggänger. Alexanders ältere Brüder Friedrich und Eberhard hatten ihre hohen Posten bei Armee und Polizei nicht nur ehrenhalber inne, sondern verstanden ihr Handwerk dort ebenso gut wie ihre Untergebenen.
Im Hotel Zur Post in Andermatt, wo der Prinz wohnte, wusste der Wirt von dem ausländischen Gast nicht mehr, als dass er es mit dem Vermessungsingenieur von Steinburg zu tun hatte. Die Depesche, die dort ankam, war aber an Herrn Alexander von Wengland gerichtet. Als Alexander abends müde in sein Hotel kam und – wie gewöhnlich – nach Nachrichten fragte, eröffnete der Wirt:
„Für Sie habe ich nichts. Aber kennen Sie unter Ihren Leuten einen Herrn von Wengland?“
Alexander wurde hellhörig.
„Darf ich fragen, von wem die Depesche ist?“
„Die ist doch nicht für Sie?“, wunderte sich der Wirt.
„Ich bin Wengländer – und wenn ich Post von wenglischen Behörden bekomme, schreiben die immer an Alexander von Wengland. Die begreifen’s einfach nicht.“
Der Wirt lugte unter den Tresen. Kriegsministerium des Königreichs Wengland stand auf der Depesche als Absender.
„Dann könnte die Nachricht doch für Sie bestimmt sein“, sagte er noch zögernd und gab Alexander die Depesche. Der bedankte sich höflich und ging in sein Zimmer hinauf.
‚Paps sucht also nach mir’, seufzte er in Gedanken. Zwei Jahre war er jetzt nicht mehr in Steinburg gewesen. Seine Arbeit als Vermessungsingenieur bei verschiedenen Eisenbahngesellschaften hatte ihn völlig in Anspruch genommen. Er hängte sein Tagesbündel an den Garderobenhaken, ließ sich müde auf sein Bett fallen und riss das Depeschensiegel auf.
>>SOFORTIGE ANWESENHEIT EW. KGL. HOHEIT IN STEINBURG ERFORDERLICH. ANGELEGENHEIT NATIONALEN INTERESSES. BITTE DEPESCHE BESTAETIGEN UND SCHNELLSTMOEGLICH ANREISEN. GEZ.: GEN. V. ASCHEWERTH. P.S.: IN UNIFORM!<<
Alexander hatte prompt die Befürchtung, Wengland befände sich – wieder einmal – in Grenzstreitigkeiten um die Grafschaft Aventur. Der Prinz zog seine Uhr aus der Tasche. Es war schon nach zehn Uhr abends. Die Telegrafenstation der schweizerischen Post hatte jetzt ohnehin geschlossen. Er würde seine Bestätigung am nächsten Morgen abgeben. Er war so müde, dass er nicht einmal mehr Hunger hatte. Dabei hatten auf der Tageskarte so leckere Schweinsplätzli, herrlich saftige Schweineschnitzel, gestanden. Aber Alexander wollte im Augenblick nur schlafen.
Am folgenden Morgen sandte er vom Postamt aus diese Nachricht:
>>HABE DEPESCHE ERHALTEN. KUENDIGUNG HIER ERFORDERLICH ODER SPAETERE FORTSETZUNG MEINER ARBEIT HIER MOEGLICH?
GEZ. A.V.STEINBURG<<
Die Antwort aus Steinburg war überdeutlich: Er sollte kündigen!
‚Wenndas so aussieht, liegt Wengland im Krieg!’, durchzuckte es den Prinzen. Er eilte ins Hotel Weißes Kreuz, wo der Chefingenieur Henninger logierte. Er überraschte ihn beim Frühstück.
„Tut mir Leid, Sie beim Frühstück zu stören, Herr Henninger“, sagte Alexander.
„Was gibt’s?“, fragte der Chefingenieur.
„Ich habe eine Depesche von zu Hause bekommen. Das Kriegsministerium zitiert mich heim nach Steinburg.“
„Oh je! Was Schlimmes?“
„Ich fürchte fast. Entweder ist mein Vater verstorben oder Wengland hat mit irgendwem Streit.“
„Ist Ihr Vater ein bedeutender Mann, Herr von Steinburg?“
„Na ja, kann man so sehen“, erwiderte der Prinz. Es musste nicht jeder wissen, dass er ein königlicher Prinz war.
„Kommen Sie wieder?“, fragte Henninger.
„Nach der Anweisung muss ich kündigen. Ich weiß nicht genau, wann meine Aufgaben daheim beendet sein werden.“
„Das ist bitter. Ihre Vermessungen brauche ich nicht zu überprüfen. Es gibt hier durchaus Ingenieure, bei denen das notwendig ist. Ich verliere Sie ungern, Herr von Steinburg.“
„Ich gehe auch ungern, weil ich die Gotthardbahn gern ganz mit gebaut hätte“, erwiderte Alexander mit einem traurigen Lächeln.
Er bekam den fälligen Lohn ausgezahlt – einschließlich der Prämien eine stattliche Summe – beglich seine Hotelrechnung und buchte den Postkutschenkurs nach Altdorf. Eine Reise mit der Postkutsche dauerte relativ lange, und Alexander wünschte sich dringend eine bereits bestehende Eisenbahn. Auf seiner Reiseroute heim nach Wengland gab es allerdings keine Eisenbahn. Selbst im fortschrittlichen Breitenstein existierte nur eine kaum drei wenglische Meilen lange Eisenbahnverbindung zwischen Dominiksburg und Palparuva/Breitenstein. Und diese kurze Strecke war zurzeit nicht schneller als die Postkutsche. Palparuva/Breitenstein, eine schöne Stadt am Fuß des Piz Palparuva, war der letzte Ort auf Breitensteiner Boden. Nach Erledigung der Breitensteiner Pass- und Zollformalitäten rollte die Anschlusskutsche über die wenglische Grenze.
Sechs Tage nach seinem Aufbruch von Andermatt hatte Prinz Alexander den Grenzort erreicht. Bei der wenglischen Passkontrolle wies er den für die Schweiz gültigen Reisepass vor, in dem der Adelstitel nicht erwähnt wurde. Der Grenzsoldat schaute in ein Verzeichnis, als er im Pass die Buchstabenkombination SKH in der Passnummer fand, die selten war. Der Mann zuckte zusammen, als er anhand des Verzeichnisses feststellte, dass er ein Mitglied der königlichen Familie vor sich hatte.
„Verzeihung, Königliche Hoheit!“, hustete der Grenzbeamte und gab Alexander seinen Pass mit einem zackigen Salut zurück.
„Schon gut, schon gut“, wehrte der Prinz freundlich ab. „Wo ist das nächste Zeughaus? Ich brauche eine Uniform.“
„In Palparuva-Dorf, Königliche Hoheit.“
„Wann geht die Postkutsche nach Steinburg?“
Der Grenzbeamte sah auf die große Standuhr in der Amtsstube. Es war zehn Minuten vor zehn Uhr am Vormittag.
„In zehn Minuten, Königliche Hoheit.“
„Und die nächste?“
„Nicht vor morgen Nachmittag, Königliche Hoheit.“
„Dann werde ich mich beeilen, noch einen Fahrschein zu bekommen. Danke.“
Kapitel 2
Schicksalhafte Begegnung
Alexander eilte aus der Amtsstube und lief die Straße zur Poststation hinunter, die noch eine Viertelmeile von der Grenzstation entfernt war. Er kam gerade noch rechtzeitig zum Postamt, um einen Fahrschein zu lösen und zur bereits abfahrbereit wartenden Kutsche zu kommen. Der Postillion hielt dem Fahrgast eifrig die Tür der Kutsche auf, Alexander stieg ein. Die Kutsche hatte insgesamt sechs Sitzplätze. Nur ein Platz in Fahrtrichtung war besetzt. Eine junge Dame saß im Fond. Ihr Blick hatte etwas Furchtsames an sich, als sie den fremden Mann einsteigen sah.
„Guten Tag“, grüßte Alexander höflich und zog den Hut. „Gestatten Sie, dass ich Ihnen gegenüber Platz nehme?“
„Wie es Ihnen beliebt, mein Herr“, erwiderte sie. Der Prinz setzte den Hut wieder auf, nahm wie gewünscht Platz. Der Kutscher trieb die Pferde an. Der Wagen setzte sich rumpelnd in Bewegung.
„Macht es Ihnen nichts aus, rückwärts zu fahren?“, fragte die junge Dame erstaunt.
„Nein, durchaus nicht. Außerdem hätten Sie es vielleicht als aufdringlich empfinden können, wenn ich mich einfach neben Sie gesetzt hätte.“
„Mir wird immer übel, wenn ich rückwärtsfahren muss. Deshalb bin ich immer schon eine Stunde vor Abfahrt in der Kutsche.“
„Sie reisen öfter mit der Postkutsche?“
„Mindestens einmal im Monat“, bestätigte die junge Dame.
„Ziemlich gefährlich – so ganz allein“, mutmaßte er.
„Oh, bisher habe ich noch keine Räuber getroffen. Und diesmal reise ich sogar mit männlichem Begleitschutz“, erwiderte sie mit einer Geste zu ihm. Er musste lachen.
„Verzeihen Sie meine Neugier, mein Fräulein. Darf ich fragen, weshalb Sie so oft reisen? Die meisten Frauen sind froh, wenn ihnen Reisen erspart bleiben.“
„Mein Vater lebt hier in Palparuva Grenze. Einmal im Monat besuche ich ihn. Sonst wohne ich in Steinburg“, erklärte die junge Frau. Der junge Mann überlegte einen Moment. In Palparuva/Wengland Grenze gab es nicht viel. Im Gegensatz zum Nachbarn gleichen Namens in Breitenstein und zu Palparuva-Dorf unten im Tal war der Flecken klein und lag auf der östlichen Seite des Quartenpasses, wo die Talebene fast zweitausend Fuß höher lag als in Palparuva/Breitenstein. Die Gegend war eine unwirtliche Bergregion. Außer der Poststation gab es nur eine Försterei und ein Staatsgefängnis für Schwerverbrecher in der Grenzfestung.
„Ist Ihr Vater der Förster hier oder Beamter im Gefängnis?“, fragte er. Die junge Frau wurde merklich blasser.
Noch bevor sie etwas sagen konnte, fuhr die Kutsche durch ein großes Schlagloch, und ihre Handtasche fiel herunter. Der Verschluss öffnete sich und der Inhalt landete auf dem Kutschenboden. Alexander war etwas schneller als seine Mitreisende und las den Tascheninhalt auf. Dabei hielt er plötzlich einen Besucherpassierschein des Staatsgefängnisses in der Hand. Er sah die ängstlichen Augen seines Gegenübers, packte schweigend alles ein und reichte ihr die Tasche.
„Passen Sie gut drauf auf“, empfahl er lächelnd. Sie nahm ihm die Tasche ab und presste sie ängstlich an sich.
„Zeigen Sie mich an?“
Alexander war völlig verblüfft.
„Warum sollte ich das tun“, fragte er.
„Es ist immerhin verboten, Gefangene im Palparuva-Gefängnis zu besuchen.“
„Sie haben doch offenbar einen ordnungsgemäßen Passierschein. Also tun Sie nichts Verbotenes.“
Die junge Frau schüttelte den Kopf.
„Mir ist klar, dass jemand, der so deutlich auf seine Königstreue hinweist, nicht auf die Idee verfallen würde, etwas zu tun, das gegen die Gesetze des Regimes verstoßen würde“, sagte sie. Er lehnte sich zurück und runzelte leicht die Stirn.
„Was meinen Sie mit dem deutlichen Hinweis auf Königstreue?“, fragte er.
„Die Lilie, die Sie an der Krawatte tragen“, erklärte sie. Er tastete nach seiner Krawattennadel, deren Kopf aus einem kleinen, goldfarbenen Schild mit gekrönter Lilie bestand. Er lächelte sanft.
„Oh, das ist unter Wengländern, die im Ausland leben, das übliche Erkennungszeichen und hat nichts mit dem Königshaus zu tun“, erwiderte er. Sein Gegenüber entspannte sich wieder.
„Bitte, erklären Sie mir, was an Ihrem Tun verboten ist. Ich finde es nicht“, bat er dann.
„Es ist verboten, Gefangene zu besuchen. Es gibt keine legalen Passierscheine, mein Herr.“
„Aber dann müssten die Wachen es spätestens nach dem zweiten Versuch spitzbekommen, dass Sie dort nichts zu suchen haben und Ihnen gleichfalls ein Zimmer auf Staatskosten geben“, wunderte sich der Prinz.
„Für einen bestimmten Personenkreis gibt es Passierscheine, die aber nicht übertragbar sind – und die Angehörige schon gleich gar nicht bekommen.“
Sie wurde noch blasser, als ihr klar wurde, dass sie gerade eine Beichte vor jemandem ablegte, den sie nicht genau kannte. Das warme Lächeln auf dem Gesicht ihres Mitreisenden war allerdings Vertrauen einflößend. Der junge Mann sah nicht so kalt und unnahbar aus, wie die Staatsbeamten, die ihr sonst begegneten.
„Ich war lange nicht in Wengland, deshalb stelle ich so dumme Fragen. Verzeihen Sie mir bitte“, sagte Alexander nach einer Pause. „Mir ist neu, dass Angehörige Gefangene nicht mehr besuchen dürfen.“
„Seit etwa sechs Jahren – seit Prinz Eberhard Chef der Polizei ist – werden Leute, die nicht völlig untertänig zu Seiner Majestät stehen, brutal unterdrückt und werden teilweise sogar ohne Prozess eingesperrt. Man will von Seiten des Regimes jede Opposition unterdrücken – und das auch noch totschweigen, die Gefangenen einfach vergessen!“
„Nicht zu glauben! Bewahren Sie den Passierschein gut auf, lassen Sie ihn nicht in falsche Hände geraten. Von mir erfährt niemand etwas“, versprach er.
Pünktlich um zwölf Uhr erreichte die Kutsche Palparuva-Dorf und hielt vor der Poststation, der auch das Wirtshaus Zur Post angeschlossen war.
„Palparuva-Dorf!“, rief der Postillion. „Zwei Stunden Aufenthalt!“
Alexander stieg aus und half der jungen Frau aus dem Wagen.
„Danke, mein Herr“, sagte die junge Frau. „Übrigens, hier, in der Post kann man sehr gut essen“, setzte sie mit einem Lächeln hinzu.
„Ist das als Einladung zu verstehen, mit Ihnen gemeinsam zu essen?“, erkundigte er sich mit einem sanften Lächeln.
„Wenn Sie möchten?“
„Gern“, lächelte er. Er hielt ihr höflich die Tür der Gaststube auf.
„Ah, Grüß Gott, Fräulein Haldenstein!“, grüßte der Wirt. „Den üblichen Tisch?“
„Nein, Herr Postwirt. Sie sehen, ich bin heute nicht allein.“
Der Postwirt verbeugte sich knapp, dann sah er die Ziernadel an Alexanders Krawatte. Das freundliche Lächeln des Wirts erlosch wie eine Petroleumlampe, die man ausbläst.
„Im Ausland gewesen?“, fragte er den jungen Mann.
„Ja, wieso?“
„Weil Sie nicht wie einer von der Polizei aussehen“, erwiderte der Wirt.
„Seit wann gibt’s denn in Wengland Polizei ohne Uniform?“, wunderte sich Alexander.
„Seit Prinz Eberhard als Chef der Polizei eine geheime Einheit gegründet hat, die eben keine Uniform trägt. Die Leute laufen ganz normal gekleidet herum – sieht man von der Auslandslilie ab, die die in der Krawatte tragen. Und ehe man sich’s versieht, findet man sich da oben wieder“, sagte der Wirt und wies mit dem Daumen in Richtung Palparuvapass. „Was darf ich den Herrschaften bringen?“
„Haben Sie von Ihrem leckeren Gulasch?“, fragte die junge Frau.
„Ich hab’ mir gedacht, dass Sie heute kommen und habe welches im Angebot.“
„Dann hätte ich gern davon.“
„Und Sie, mein Herr?“
„Das nehme ich auch“, lächelte Alexander.
Das Essen zog sich etwas hin, weil die Nudeln, die der Koch als Beilage zum Gulasch zubereitet hatte, recht pappig geraten waren. In Alexanders bisherigem Arbeitsumfeld in der Schweiz war Italien nicht weit, beim Bahnbau am Gotthard waren viele Italiener beschäftigt – und Italiener haben eine besondere Beziehung zu Nudeln. Breiige Nudeln sind für Italiener ein Sakrileg beim Essen. Und wer einmal als Nichtitaliener al dente gekochte Nudeln gegessen hat, verzichtet dankend auf Nudelbrei …
Der Prinz monierte freundlich, aber bestimmt, dass ihm diese Nudeln nicht schmeckten. Der entsetzte Wirt ließ den Koch antreten, der diensteifrig zusagte, die Nudeln wie gewünscht al dente zu kochen. Bis er das richtig hinbekam, verging allerdings eine halbe Stunde, in der das Gulasch warm gehalten werden musste.
Schließlich waren Gulasch und Nudeln dann doch serviert und schmeckten wirklich ausgesprochen gut. Alexander sah auf die Standuhr in der Gaststube. Es war inzwischen ein Uhr.
„Noch eine knappe Stunde bis zur Weiterfahrt“, brummte er, als er auf die Uhr sah. „Bitte entschuldigen Sie mich. Ich habe noch etwas zu erledigen“, bat er dann die junge Frau.
„Was kann man in dieser Bergeinsamkeit zu erledigen haben?“, wunderte sie sich.
„Nun, wenn man per Einberufungsbefehl nach Hause gerufen wird, bedeutet das Uniformzwang auf wenglischem Boden. Hätte Palparuva Grenze ein Zeughaus, wäre ich schon bis hier in Uniform mitgefahren“, erklärte er mit verschmitztem Lächeln. Fräulein Haldenstein schnappte heftig nach Luft.
„Was?“, entfuhr es ihr. Er verbeugte sich und drehte sich dann zum Wirt um.
„Ich gehe noch zum Zeughaus, um mir meine befohlene Uniform zu holen. Stellen Sie bitte inzwischen die Rechnung. Es geht zusammen auf meine Rechnung.“
„Mir wäre lieber, Sie zahlen gleich“, brummte der Wirt. Alexander seufzte, zog seine Taschenuhr aus der Weste und legte sie auf den Tresen.
„Genügt die als Pfand, dass ich wiederkomme?“
„Nein, nur Bares ist Wahres“, grunzte der Wirt.
„Dann bitte die Rechnung.“
„Muss ich ja erst mal zusammenrechnen …“
„Dann tun Sie das bitte zügig. Sonst fährt die Kutsche noch ohne mich weiter – und die Kosten für die Extrapost stelle ich Ihnen in Rechnung. Die dürfte teurer sein als das Essen!“, versetzte der Prinz mit gewisser Reizung in der Stimme.
„Is’ ja gut, ich mach’ ja schon.“
Schwitzend rechnete der Wirt zusammen, Alexander bezahlte und verließ das Gasthaus.
Das Zeughaus war direkt um die Ecke der Poststation gelegen. Alexander legte seinen Reservistenausweis vor und bekam eine Reiseuniform der wenglischen Gardekavallerie.
Wenn ein Wengländer aus dem Ausland zurückgerufen wurde und der Rückruf den amtlichen Zusatz enthielt, dass er in Uniform erscheinen sollte, galt das als Einberufung als Reservist. Einberufene Reservisten hatten in Wengland während der normalen Dienstzeiten von morgens sechs Uhr bis abends sechs Uhr Uniform zu tragen. Alexander war kein aktiver Soldat mehr und hatte in den USA die Vorzüge des Zivilistenlebens kennengelernt. Dennoch war er ein gehorsamer Diener seines Landes und beachtete die für ihn gültigen Vorschriften – mochten sie ihm auch missfallen.
Als er sich umgezogen hatte, musste er feststellen, dass ihm die grüne Uniform immer noch gut stand, auch wenn er sie zwei Jahre nicht mehr getragen hatte.
Der Uniformrock war aus einem sehr feinen dunkelgrünen Tuch gefertigt, hatte einen scharlachroten Stehkragen und ebensolche Aufschläge, die jeweils von einer schmalen goldenen Litze am Rand verziert wurden. Die Farbe Rot bezeichnete in der wenglischen Armee die Kavallerie, die goldene Litze war bei allen Waffengattungen das Abzeichen für die Garderegimenter. Neun goldfarbene Knöpfe, verziert mit der königlichen Lilie, verschlossen den Rock. Schulterklappen hatte der Rock nicht, da zur Reiseuniform weder Seitengewehr noch Tornister getragen wurden, deren Riemen die Schulterklappen sonst Halt gegeben hätten. Je zwei kleine sechszackige Silbersterne, untereinander angeordnet auf beiden Seiten des Stehkragens markierten Alexanders Dienstgrad als Oberleutnant. Über den Rock gehörte ein schwarzes Lederkoppel mit rundem Schloss, das die Königskrone zeigte. Diese Schlossvariante war – wie die Goldlitze an Kragen und Aufschlägen – allein den Garderegimentern vorbehalten.
Außerdem gehörten eine schwarze Hose mit roter Seitenpaspel und blanke schwarze Halbstiefel zur Reiseuniform. Als Krönung setzte Alexander eine österreichisch anmutende, steife Offiziersmütze auf. Sie war mit dem gleichen dunkelgrünen Tuch bezogen, aus dem auch der Rock gefertigt war und hatte einen blanken schwarzen Lederschirm. Über dem goldfarbenen Sturmriemen waren senkrecht angeordnet zwei Kokarden angebracht: Die obere, die etwa zur Hälfte über die der Mützenkrone ragte, war oval und zeigte kreisförmig angeordnet die wenglischen Staatsfarben – außen Gold, Rot in der Mitte und im Zentrum Grün – und hatte an der Rückseite über der Mützenkrone eine Vorrichtung, in die ein Federbusch eingesteckt werden konnte. Im Zentrum der oberen Kokarde waren eine goldene Königskrone und eine ebenfalls goldene Wappenlilie untereinander angeordnet. Die untere Kokarde war rund, goldfarben und zeigte nur die Lilie Wenglands. Während die obere Kokarde aus Litze, Samt und metallenen Applikationen gefertigt war und auf einer ovalen hölzernen Scheibe montiert war, bestand die untere aus poliertem Metall. Beide Kokarden waren durch eine 3/8 Zoll breite, goldfarbene Soutacheschnur verbunden.
Ein Blick auf die Uhr zeigte dem Prinzen, dass es Zeit wurde, zu gehen, wenn er die Postkutsche noch erreichen wollte. Seinen Zivilanzug verpackte er sorgsam im Koffer und eilte zur Kutsche.
Zu seiner Überraschung war der Postillion noch nicht auf dem Kutschbock, obwohl es bereits Schlag zwei war. Alexander packte seinen Koffer aufs Wagendach und ging in die Posthalterei.
„Wird der Fahrplan nicht eingehalten?“, fragte er etwas unwirsch. Der Postillion sprang erschrocken auf.
„Der Postwirt sagte mir, Sie kämen eventuell später. Ich habe auf Sie gewartet, Herr Oberleutnant“, sagte er.
„Meinetwegen braucht sich niemand zu verspäten. Und vergessen Sie ganz schnell, dass ich Oberleutnant bin!“
„Jawoll, Herr Oberleutnant!“
„Postillion!“
Alexander schüttelte nur noch den Kopf und stieg in die Kutsche ein, in der Fräulein Haldenstein bereits saß. Sie wurde kreidebleich, als sie den jungen Mann in Uniform sah. Er lächelte sie sanft an.
„Werden Sie mir jetzt nicht ohnmächtig. Ich beiße nicht, nur weil ich ab jetzt in Uniform bin“, sagte er.
„Na ja, wenn man Verwandte im Staatsgefängnis hat, betrachtet man Uniformierte vielleicht mit anderen Augen als die so genannten braven Bürger.“
„Ich bin kein anderer geworden, seit wir vor einer Stunde am selben Tisch gesessen haben“, erwiderte er. Die junge Frau ließ ein spöttisches Lachen hören.
„Bis jetzt war jeder wie ausgewechselt, sofern er einen Zivilanzug mit einer Uniform vertauscht hat. Ich habe Leute gekannt, die ihre besten Freunde ohne zu fragen niedergeknüppelt haben, kaum dass sie eine Uniform angezogen haben“, entgegnete sie bitter.
„Und wieso?“
„Weil jemand es ihnen befohlen hat, Herr Offizier! Sie sind doch auch so unglaublich gehorsam, dass Sie selbst in dieser Bergwildnis, in der kein Kontrolleur herumläuft, völlig selbstverständlich eine Uniform anziehen!“, hielt sie ihm vor.
„Ja, das ist richtig. Das für mich als einberufenen Reservisten gültige Gesetz schreibt das vor. Erwischt mich ein Amtsträger in Zivil, bedeutet das Strafe für mich. Der Grenzbeamte in Palparuva ist verpflichtet, sämtliche Militärposten an der Strecke zu informieren, dass ich als Reservist einberufen bin. Er gibt das einschließlich einer Personenbeschreibung weiter. Der Zeughauswachtmeister war bereits über mein Kommen unterrichtet. Wäre ich in Palparuva-Dorf in Zivil in die Kutsche gestiegen, hätte ich die Zeughauswache am Hals gehabt – mit dem Vorwurf der Fahnenflucht. Eine gesetzliche Vorschrift ist aber etwas anderes als ein direkter Befehl. Widerspricht ein Befehl geltendem Gesetz, darf ich ihn nicht einmal ausführen“, erwiderte Alexander.
„Aber ein Soldat muss seinem König gehorchen. Und wenn der morgen befiehlt, dass Sie auf eine Demonstration schießen, dann …“
„Na, da sei Gott vor!“, entfuhr es ihm. „Wenn der König sein Volk nur noch mit Waffengewalt beherrschen kann, muss ich ihn mal fragen, warum das so ist.“
„Sie wären gewiss der erste Soldat, der nicht in blindem Gehorsam schießen würde“, mutmaßte die junge Frau.
„Sagen wir, ich habe – im Gegensatz zu anderen – die Möglichkeit, Fragen zu stellen.“
„Sie? Ein kleiner Oberleutnant? Sie haben doch keinen Einfluss bei Hof!“
„Nehmen Sie das ruhig an. Darf ich fragen, was Ihr Vater eigentlich verbrochen hat, dass man ihn eingekerkert hat?“
„Mein Vater hatte eine Arztpraxis in Steinburg. Er hat eine unvorsichtige Äußerung gemacht, die einen Patienten – ein Mitglied der Geheimpolizei, wie ich erfahren habe – prompt zu einer Verhaftung gereizt hat.“
„Was hat er denn so Schlimmes gesagt?“, bohrte er unnachgiebig weiter.
„Er hat gefragt, was eigentlich gegen diese Verrückten, diese Sozialisten, einzuwenden sei. Das seien doch nur harmlose Spinner.“
Er lachte auf.
„Das hätte von mir sein können!“, rief er fröhlich. „Ich danke Ihnen, mein Fräulein. Vielleicht war es doch nicht so völlig sinnlos, mich ganz aus der Schweiz zu holen!“
Die junge Frau war sichtlich erstaunt.
„Sie, ein Soldat, waren in der neutralen Schweiz?“
„Ich bin kein aktiver Offizier mehr, sondern Reservist. Ich habe zwei Jahre als Vermessungsingenieur in den Vereinigten Staaten und in der Schweiz gearbeitet. Meine Einberufung hat mich bei der Vermessung der neuen Eisenbahnstrecke über den Gotthardpass erwischt. Es passt mir überhaupt nicht, das können Sie mir glauben! Und wenn es heute Abend sechs Uhr schlägt, dann hängt diese Uniform im Schrank und ich bin wieder in Zivil.“
„Seltsam. Jeder in diesem Lande, der sich zu König und Vaterland bekennt, schmückt sich heute mit einer Uniform. Selbst die Postsortierer im Hauptpostamt in Steinburg hüllen sich in prächtige Uniformen“, wunderte sie sich.
„Eine Krankheit, die in Europa weit verbreitet ist. Ich halte es für eine Modeerscheinung“, erwiderte er.
„Seien Sie bloß vorsichtig, vor wem Sie solche Äußerungen machen. Sie landen schneller in Palparuva, als Sie es ahnen“, orakelte die junge Dame.
„Nun, ich bin in einer Position, die mir solche Mätzchen erlaubt, ohne dass ich gleich verfolgt werde“, lächelte der junge Mann verbindlich.
„Wer könnte sich so etwas erlauben, wenn er mit dem Königshaus nicht verwandt ist?“, fragte sie. „Gestatten Sie, wenn ich Sie nach Ihrem Namen frage?“
„Wie unhöflich von mir. Verzeihen Sie, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Von Steinburg, Alexander von Steinburg. Und Ihr Name ist Haldenstein, habe ich das in der Postwirtschaft so richtig verstanden?“
„Ja, richtig. Simone Haldenstein.“
„Haldenstein … Und Ihr Vater ist Arzt, sagten Sie?“
„Ja“
„Chirurg, oder?“
„Ja“
„Ich kenne ihn. Einer der besten Chirurgen, die Steinburg als Grafschaft zu bieten hat“, bemerkte Alexander.
„Ja, aber es hat ihm nichts genützt, Herr von Steinburg.“
„Wie lange sitzt er schon?“
„Fünf Monate.“
„Vielleicht kann ich etwas für ihn tun“, bot er an.
„Danke, das ist mit einem Preisschild versehen – und das will ich auf keinen Fall.“
„Es hätte keinen Preis. Ihr Vater hat mich vor einigen Jahren nach einem Bergunfall vor dem Rollstuhl bewahrt. Wenn ich versuche, ihm zu helfen, dann a) weil ich ihm dankbar bin, b) was er getan zu haben scheint, in keiner Weise eine Einkerkerung rechtfertigt und c) weil ich Ihren Mut rückhaltlos bewundere.“
„Ich mag nicht mehr glauben, was mir angeblich einflussreiche Männer erzählen“, widersprach sie. Ihre dunkelblauen Augen nahmen einen melancholischen Zug an.
„Das erwarte ich nicht“, erwiderte er. „Vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit, etwas zu tun. Wir werden sehen.“
Kapitel 3
Ein unverschämter Patron
Die Kutsche erreichte die nächste Station, Bravadur, gegen fünf Uhr abends. Alexander stieg steifbeinig aus dem Kutschenfond aus und half Fräulein Haldenstein ritterlich aus dem Wagen.
„Ich wünschte, hier gäbe es auch Eisenbahnen“, seufzte er. „Dann könnten wir schon längst in Steinburg sein. Vom Quartenpass bis nach Steinburg sind’s immer noch drei Tagereisen. Daran hat sich seit König Philipps Zeit nichts geändert – und das ist bald tausend Jahre her.“
Der Prinz ließ es sich nicht nehmen, der jungen Dame das Gepäck zu tragen. Der Wirt vom Posthotel kannte Fräulein Haldenstein offenbar ebenso wie der Postwirt in Palparuva-Dorf.
„Grüß Gott, Fräulein Haldenstein. Ihr Zimmer ist schon fertig. Nummer Sechs, wie immer.“
Mit einem etwas schmierigen Grinsen reichte er Simone den Zimmerschlüssel, die sich mit leicht zitternder Hand eintrug und den Schlüssel mit einem eher gezwungenen Lächeln annahm. Sie bedankte sich artig und ging die Treppe neben der Rezeption hinauf.
„Herr Oberleutnant, was kann ich für Sie tun?“, wandte sich der Postwirt an Alexander.
„Ich hätte gern ein Zimmer mit einem gescheiten Abendessen und einem guten Frühstück.“
„Ja, gewiss doch. Ham’s den Pass dabei, Herr Oberleutnant?“
Alexander legte gehorsam den Pass vor.
„Mir wäre lieb, Herr Wirt, wenn Sie den dämlichen Dienstgrad wegließen und mich einfach mit Herr von Steinburg anredeten.“
Der Wirt sah in den Pass, dessen Buchstabenkombination SKH3 in der Passnummer Alexander immerhin als den dritten Sohn des Königs auswies.
„Aber hier steht doch …
„Von Steinburg genügt völlig!“, entgegnete der Prinz scharf.
„Ja, gewiss, Herr von Steinburg!“, buckelte der Wirt.
„Ich hätte gern ein Bad genommen. Kann ich das auf dem Zimmer bekommen?“
„Wenn Königli… äh … Sie es wünschen, jederzeit.“
„Dann lassen Sie es mir bitte in einer halben Stunde richten und setzen Sie es mit auf die Rechnung.“
„Jawohl“
Der katzbuckelnde Wirt war dem Prinzen regelrecht zuwider. Aber die Öligkeit gegenüber Fräulein Haldenstein war ihm geradezu unheimlich. Das Mädchen hatte richtig unglücklich ausgesehen, als sie den Zimmerschlüssel genommen hatte. Anscheinend befand sie sich in einer Zwangssituation. Wenn es diese Passierscheine nur für einen bestimmten Personenkreis legal gab, zu dem sie nicht gehörte und der Schein nicht gestohlen war – erpresste vielleicht jemand die junge Frau? Viel Geld war nach der Schließung der Praxis gewiss nicht zu holen, aber Simone Haldenstein war ein hübsches Mädchen. Da konnten ganz andere Dinge oben auf der schier unerschöpflichen Forderungsliste eines Erpressers stehen …
Alexander bekam das Zimmer 7, gegenüber dem Zimmer der so unglücklichen jungen Dame. Das Hotel war ein altes Haus, dessen Wände und Türen recht dürftig waren. Jedes etwas lautere Geräusch aus den Nachbarzimmern war zu hören. Alexander packte seine Sachen nur soweit aus, als er am Abend Kleidung brauchte. Dann erschien der Hoteldiener und richtete ihm das Bad. Er hatte sich gerade eingeseift, da hörte er einen heftigen Wortwechsel von gegenüber, der ihn aufmerksam machte:
„Wie? Sie wollen nicht? Das ist aber ganz gegen unsere Abmachung. Passierschein gegen Sie, Fräulein Haldenstein. Aber bitte, wenn Sie nicht wollen – mein Vater sitzt ja nicht. Aber Ihre Schulden werden Sie noch bezahlen, Fräuleinchen!“
„Ich kann nicht mehr, Herr von Drechselberg. Lassen Sie mich endlich in Ruhe!“
„Ho, wo werd’ ich denn? So einen Leckerbissen bekommt man nicht alle Tage. Außerdem schulden Sie es mir!“
Ein erstickter Ruf, der als:
„Hilfe!“, zu deuten war, ließ Alexander keine Sekunde länger im Bad bleiben. Er sprang aus der Wanne, trocknete sich oberflächlich ab, warf sich den Bademantel über und stürzte nach Gegenüber. Er kam gerade zurecht, um einen älteren Mann an einer Vergewaltigung zu hindern. Alexander riss ihn grob von seinem Opfer weg, verpasste ihm rechts und links schallende Ohrfeigen, schleppte ihn am Schlafittchen in den Flur und versetzte ihm einen Fußtritt, der den Lümmel die Treppe hinunterwarf.
„Wenn ich Sie je wieder dabei erwische, dass Sie einer Dame an die Wäsche wollen, Herr von Drechselberg, sind Sie die längste Zeit der Kommandant vom Palparuva-Gefängnis gewesen!“, rief er hinterher. Edgar von Drechselberg rappelte sich am Fuß der Treppe auf und sah zornig hinauf. Zu seinem Schrecken erkannte er Prinz Alexander von Wengland. Er erbleichte.
„Jawohl, Königliche Hoheit! ‘S wird nicht wieder vorkommen. Ganz gewiss nicht.“
Alexander blieb oben an der Treppe stehen.
„Wo der Ausgang ist, wissen Sie hoffentlich!“, knurrte er.
„Ja, ja“, buckelte von Drechselberg. Unter vielen Verbeugungen machte er sich auf den Rückzug, bekam schließlich das Laufen und rannte aus dem Hotel, als sei Luzifer persönlich hinter ihm her. Die Tür krachte hinter ihm ins Schloss.
Der Wirt sah verstohlen hinauf.
„Ich glaube, Herr Wirt, wir haben nachher noch ein Wörtchen miteinander zu reden“, knurrte Alexander den erbleichenden Wirt an. Offensichtlich hatte das Treffen mit dessen Billigung stattgefunden. Der Wirt buckelte untertänig.
Der Prinz machte kehrt und ging in den kleinen Flur zurück. Simones Zimmertür stand noch offen.
„Ist Ihnen etwas passiert?“, fragte er in das Zimmer hinein, ohne es zu betreten. Sie schüttelte nur schluchzend den Kopf und wagte nicht, aufzusehen.
„Es ist gleich sechs. Darf ich Sie bitten, beim Abendessen mein Gast zu sein?“, fragte er höflich an. Sie schüttelte heftig den Kopf.
„Einmal am Tag reicht“, erwiderte sie schluchzend.
„Na gut. Beruhigen Sie sich erst einmal. Versprechen Sie mir nur, dass Sie überhaupt etwas essen.“
„Ich danke Ihnen für Ihr beherztes Eingreifen, Herr von Steinburg. Aber, bitte – lassen Sie mich jetzt allein.“
Alexander nickte schweigend, schloss leise die Tür und ging in sein eigenes Zimmer. Zunächst setzte er sein unterbrochenes Bad fort, rasierte sich noch und zog sich wieder seinen zivilen Sommeranzug an.
Bevor er sich zum Essen setzte, nahm er sich den Wirt vor:
„Wenn ich mich recht erinnere, Herr Wirt, ist es in Wengland nicht erlaubt, unverheirateten Paaren oder Einzelpersonen ein Doppelzimmer zu vermieten!“, sagte er so leise, dass es außer dem Wirt niemand hören konnte.
„Nein“, bestätigte der Wirt.
„Und trotzdem haben Sie Fräulein Haldenstein ungefragt ein Doppelzimmer vermietet?“
„Wo… woher wi… wi… wissen Sie das?“, stotterte der Wirt.
„Weil ich vor einer halben Stunde Herrn von Drechselberg aus einem Doppelzimmer geholt habe, wo er offensichtlich dabei war, Fräulein Haldenstein Gewalt anzutun! Das Gebrüll muss doch bis in die Gaststube gedröhnt haben!“
Der Wirt suchte nach einem Mauseloch, in das er verschwinden konnte, aber Alexander packte ihn und hielt ihn fest.
„Wenn Sie zum Ausgleich Ihrer Mittäterschaft Fräulein Haldenstein diesmal das Zimmer, Abendessen und Frühstück kostenlos in Anspruch nehmen lassen, verzichte ich darauf, die Sache an die große Glocke zu hängen. Außerdem zähle ich auf Sie, dass Fräulein Haldenstein hier stets ein sauberes Einzelzimmer bekommt, wenn sie auf der Durchreise ist. Verstanden?“
„J… ja, Königliche Hoheit“, jammerte der Wirt.
„Gut. Und nun bekommen Sie wieder Contenance und servieren Sie mir das Abendessen.“
Der Wirt nickte nur.
Alexander betrat die Gaststube, suchte sich einen Tisch, wo niemand hinter ihm sitzen konnte und er den Raum gänzlich im Blickfeld hatte. Seit er in den USA gearbeitet hatte, wo die Sitten unter den Eisenbahnleuten manchmal recht rau waren, hatte er sich das zur Gewohnheit gemacht. Der Wirt bot ihm eifrig den als Menü auf der Speisekarte stehenden Kalbsbraten mit Knödeln und Kraut an.
„Dazu ein Dunkelbier?“, fragte er unsicher. Alexander nickte lächelnd. Der Wirt atmete auf, ging in Richtung Küche und wischte sich den Angstschweiß ab, wobei er hoffte, dass der Prinz es nicht bemerkte.
Kurz nachdem er Alexander die Suppe serviert hatte, kam Fräulein Haldenstein in die Gaststube. Unschlüssig blieb sie an der Tür stehen. Ihr bisheriger Reisegefährte saß allein im Gastraum. Zögernd lenkte sie ihre Schritte zu ihm.
„Darf ich mich zu Ihnen setzen?“, fragte sie vorsichtig. Er legte sofort den Löffel weg, stand auf und schob ihr einen Stuhl zurecht.
„Selbstverständlich“, sagte er. Höflich rückte er den Stuhl wieder hin, als sie sich setzte.
„Dem Wirt habe ich die Ohren lang gezogen. Sie haben für diesmal freie Kost und Logis“, sagte er dann. Sie sah ihn erschrocken an.
„Und für die nächsten Besuche bei Ihrem Herrn Vater haben Sie hier ein Einzelzimmer“, setzte er grinsend hinzu.
„Sie wissen, was mich diese Passierscheine gekostet haben. Was ist Ihr Preis, Herr von Steinburg?“, fragte sie leise, dennoch ätzend.
„Ob Sie es glauben oder es bleiben lassen: Für Sie tue ich das umsonst“, erwiderte er mit einem ebenso sanften wie verführerischen Lächeln.
„Danke, aber meine Quelle für die Passierscheine ist durch Ihr Eingreifen leider versiegt.“
Alexander schüttelte den Kopf.
„Sie werden die Erlaubnis bekommen. Auch kostenlos.“
„Warum tun Sie das?“, fragte sie. Es klang beinahe verzweifelt.
„Ich hasse nichts mehr als Ungerechtigkeit und Ausnutzerei“, erklärte er. Der Wirt kam.
„Darf ich servieren?“, fragte er beflissen.
„Ja“, sagte Alexander. „Das Menü bitte auch für Fräulein Haldenstein.“
„Sehr wohl.“
Der Wirt beeilte sich, in die Küche zu kommen. Simone war völlig überrascht.
„In den letzten Monaten ist mir mancher Mann begegnet: Die Polizisten in Steinburg, die Beamten der Staatsanwaltschaft, der Direktor vom Gefängnis. Alle wollten für den kleinsten Gefallen einen hohen Preis. Jemand wie Sie ist mir noch nicht begegnet.“
Er war mit der Suppe fertig und schob die leere Tasse beiseite.
„Zeigen Sie mir mal den Passierschein?“, bat er. Sie suchte in ihrer Handtasche und reichte ihm den Ausweis. Es war eine formlose Erlaubnis, das Gefängnistor einmalig hin und zurück passieren zu dürfen, unterschrieben von Oberst Edgar von Drechselberg – im Auftrag Seiner Majestät, König Wilhelm I. von Wengland. Alexander lächelte. So einen Wisch konnte er auch unterschreiben, sogar mit größerer Vollmacht.
„Ich brauche nur ein gewöhnliches Stück Papier, eine Schreibfeder, ein paar Tropfen Tinte und etwas Siegellack“, sagte er. „Dann haben Sie einen Passierschein, den Sie nicht zu erneuern brauchen.“
Die junge Frau sah ihn ungläubig an.
„Wer sind Sie, dass Sie solche Erlaubnisse geben können?“
„Jemand, der solche Vollmacht hat“, gab er nebulös zurück.
„Wenn man das nicht glaubt, auf wen kann ich mich dann berufen?“
„In Behördenkreisen, vor allem ganz oben in den Behörden, löst der Name von Steinburg durchaus heftiges Buckeln aus“, lächelte der Prinz freundlich. Simone kam nicht dazu, etwas zu erwidern, weil der Wirt ihre Suppe und Alexanders Hauptgang servierte. Als der sich wieder entfernt hatte, bohrte sie weiter:
„Guter Gott, wer sind Sie?“
„Warum ist Ihnen das so wichtig?“
„Weil ich keinen Reinfall erleben will“, erklärte sie.
„Das werden Sie auch nicht“, versprach er.
„Dann, bitte – wer hat Ihnen solche Vollmacht gegeben? Ich muss es wissen!“
„Gut“, sagte er. „Aber legen Sie bitte den Löffel weg und schlucken Sie erst herunter.“
Sie tat wie ihr geheißen, dann sah sie in seinen inländischen Pass, der ihn ausdrücklich als Angehörigen des Königshauses auswies.
„Fallen Sie mir bloß nicht in Ohnmacht“, warnte er, als er ihre schreckgeweiteten Augen sah.
„Oh, gute Güte! Jetzt begreife ich!“, sagte sie langsam. Die Suppe wollte nicht mehr rutschen.
„Fräulein Haldenstein – Ihre Suppe wird kalt!“, erinnerte er grinsend.
„Ich bin verwirrt, Königliche …“
„Halt – von Steinburg ist völlig ausreichend!“
„Sie legen keinen Wert auf korrekte Betitelung?“ fragte sie erstaunt.
„Was soll’s? Der Titel ist hohl und leer. Friedrich, mein ältester Bruder erbt Krone und Reich, Eberhard, der zweite, den Grafentitel. Für einen dritten Sohn war kein Titel mehr drin. Ich habe nur Geld zu erben. So beschränke ich mich auf das kleine von, arbeite für meinen Lebensunterhalt und lege meine Apanage zinsbringend an.“
„Aber Ihre Unterschrift scheint mehr wert zu sein, als Sie mich jetzt gerade glauben machen wollen“, lächelte Simone etwas gelöster.
„Je nun, es ist nicht abzustreiten, dass ich ein Prinz des Königreichs Wengland bin. Was solche Erlaubnisse anbelangt, sind alle Prinzen gleichberechtigt – ob thronerbend oder nicht. Das hat König Ulrich so im Codex Rex Wenglandia so festgelegt. Und auf den und die Bibel haben alle wenglischen Könige und Grafen ihre Amtseide abzulegen.“
Simone zügelte für die Dauer des Essens ihre Neugier.
„Meine Güte, bin ich satt!“, pustete sie danach.