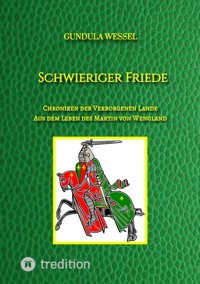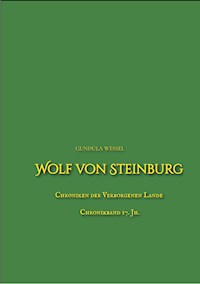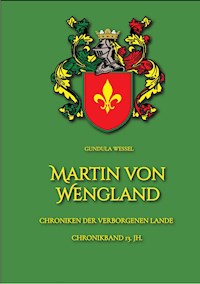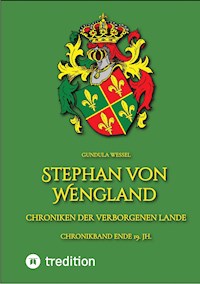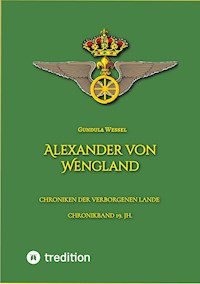3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nord und Süd stehen sich in Amerika unversöhnlich gegenüber, als der Sezessionskrieg ausbricht und Familien und Freunde auseinandergerissen werden. Der frischgebackene US-Leutnant Robert Bennett bekommt die ganze Wucht des sich entfesselnden Bürgerkrieges zu spüren: Zwei seiner besten Freunde und sein eigener Bruder sind plötzlich seine Feinde. Roberts große Liebe zu Susan, der Schwester seines Freundes und Regimentskameraden Thomas Craig, fordert einen hohen Preis von ihm, als er ihr ein Versprechen gibt. Denn es kämpfen nicht nur reguläre Truppen gegeneinander. Partisanen, die zwischen allen Fronten stehen, machen beiden Seiten das Leben schwer. Und Yancey Morrows und seinen Partisanen in die Hände zu fallen, ist nahezu gleichbedeutend mit einem Todesurteil … Dieser Band ist die 2. Auflage des bereits 2004 unter dem Titel "Der zerrissene Adler" erschienenen Romans.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1162
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Für meine Eltern Lydia und Heinz, die ich mit meinen Fragen entsetzlich genervt habe, die mir aber die nötigen Informationen zugänglich machten.
Für Claudia, die mit mir um die Wette spann.
Für Regina, die sich als Probeleserin zur Verfügung stellte.
Für Andrea und Alex, deren lockere Sprüche ich zitieren durfte.
Für Wolfgang, der mir den Mut gemacht hat, dieses Buch zu veröffentlichen.
Gundula Wessel
… DENN EIN HAUS, DAS GESPALTEN IST, KANN NICHT BESTEHEN
Amerikas Kampf um die Einheit der Nation 1861 - 1865
Band 1 der Reihe
Robert Bennett – Der Major und der Marshal
© 2022 Gundula Wessel
… denn ein Haus, das gespalten ist, kann nicht bestehen
Amerikas Kampf um die Einheit der Nation 1861 – 1865
2. Auflage, Vorgängerausgabe 2004 Der zerrissene Adler
Buchsatz Gundula Wessel
Titelfoto Gundula Wessel
ISBN Softcover: 978-3-347-61404-8
ISBN Hardcover: 978-3-347-61405-5
ISBN E-Book: 978-3-347-61408-6
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Der Neujahrsball
Kapitel 2
Colonel Bennetts Regiment
Kapitel 3
Flucht in den Süden
Kapitel 4
Die neue Einheit
Kapitel 5
Gefallene Würfel
Kapitel 6
Captain Cabot
Kapitel 7
Feuertaufe
Kapitel 8
Ein falscher Verdacht und seine Folgen
Kapitel 9
Versetzungen
Kapitel 10
Feindschaft
Kapitel 11
Dover/Tennessee - Heimkehr in die Fremde
Kapitel 12
Desaster am Bull Run
Kapitel 13
Antietam
Kapitel 14
Um Leben und Tod
Kapitel 15
Kleine Wunder
Kapitel 16
Neuer Beginn
Kapitel 17
Vicksburg
Kapitel 18
Der Preis der Hilfe
Kapitel 19
In der Falle
Kapitel 20
Rettungsaktion
Kapitel 21
Fort Payne
Kapitel 22
Wiedersehen in Taylor’s Mill
Kapitel 23
Begegnungen
Kapitel 24
Ausgetrickst
Kapitel 25
Ein unmöglicher Plan
Kapitel 26
Vorbereitungen
Kapitel 27
Partisanenjagd
Kapitel 28
Väterliche Denkzettel
Kapitel 29
Kriegsgericht
Kapitel 30
Einsichten
Kapitel 31
Wilderness
Kapitel 32
Shenandoah
Kapitel 33
Verfehlte Rache
Kapitel 34
Bitterer Sieg
Kapitel 35
Neue Pläne und Karfreitagsschock
Kapitel 36
Abrechnung am Cumberland
Kapitel 37
Good Bye, Tennessee!
Glossar
Prolog
Es war der 20. Dezember des Jahres 1860.
Im Kasino der Militärakademie West Point feierten die Kadetten des Abschlussjahrgangs die bestandene Prüfung. Der Jahrgang 1856 war ein außergewöhnlich guter Jahrgang gewesen. Von den im Mai 1856 aufgenommenen einhundert Anwärtern hatten fünfundneunzig die Abschlussprüfung bestanden. Am Nachmittag war eine feierliche Zeremonie in der Schulaula gewesen, in der sie ihre Offizierspatente erhalten hatten und zum Second-Lieutenant befördert worden waren. Jetzt veranstalteten die Ex-Kadetten eine eigene Feier, zu der sie auch die meisten Lehrer eingeladen hatten.
Aber dieser 20. Dezember 1860 war kein normaler 20. Dezember für die Vereinigten Staaten von Amerika. Es war der Tag, an dem die Union der Vereinigten Staaten nach dem Willen des Konvents von South Carolina aufgelöst werden sollte!
South Carolina war einer der Staaten der USA, in denen Sklavenhaltung nicht nur erlaubt war, sondern als Grundlage des Wirtschaftslebens betrachtet wurde. Die Frage, ob es einem Menschen erlaubt sein sollte, einen anderen sein sächliches Eigentum zu nennen, entzweite die Bürger der USA bereits seit etwa dreißig Jahren. Es hatte sich im Laufe der Zeit eine Zweiteilung des gewaltigen Landes herausgebildet: Der Norden bestand im Wesentlichen aus Staaten, in denen die Sklaverei verboten war oder Sklaven jedenfalls nicht gehalten wurden. Der Süden mit seinen Monokulturen von Baumwolle und Tabak lebte hauptsächlich von der Sklaverei. Die Sklaverei stellte wirtschaftlich den günstigsten Weg für die Südstaatler dar, weil ein Sklave nur den Anschaffungspreis kostete und später außer Kost und Logis keine weiteren pekuniären Belastungen verursachte.
Zwar war den Verfassungsvätern das Gewissen nicht leicht gewesen, als sie die Sklaverei weiterhin zuließen; schließlich stand sie in grundlegendem Gegensatz zur Unabhängigkeitserklärung, in der es hieß, dass alle Menschen gleiche Rechte besäßen, die unveräußerlich seien, so das Leben, die Freiheit und das Streben nach Glück. Thomas Jefferson, der Architekt der amerikanischen Unabhängigkeit, hatte die Sklaverei denn auch mehr als – wirtschaftlich – notwendiges Übel betrachtet. Doch so wie er sahen es nicht alle Sklavenhalter. Seit den Zeiten George Washingtons waren es die reichen Söhne der Südstaaten gewesen, die den Präsidenten gestellt hatten. Und sobald sich im Senat oder im Repräsentantenhaus Opposition gegen die Sklaverei regte, drohten die Sklavenhalterstaaten regelmäßig mit der Sezession, dem Ausscheiden aus der Union. An einer Verselbstständigung der Südstaaten war in den letzten dreißig Jahren keinem Parlamentarier in Washington D.C. gelegen, denn der Süden war reich, sehr reich. Erst mit der Vergrößerung der Industrie im Norden hatte sich der Widerstand der Abolitionisten – wie die Leute genannt wurden, die für die Freiheit der Schwarzen eintraten – eine solidere Grundlage verschaffen können. Doch trotz der im Norden wachsenden Ablehnung der Sklaverei wollte niemand ernsthaft die Auflösung der Union riskieren, und so kam es immer wieder zu Kompromissen im Parlament, die ein Weiterbestehen der Sklaverei im Süden ermöglichten und den Bestand der Union als solcher garantierten. Einer dieser Kompromisse besagte, dass die Sklaverei auf eine Linie südlich von 36° 30 nördlicher Breite beschränkt sein sollte.
1854 jedoch hatte das Kansas-Nebraska-Gesetz das Parlament passiert, das der Bevölkerung die Entscheidung über Sklaverei oder nicht überlassen sollte. Pikant an diesem Kompromiss war, dass die vom Kansas-Nebraska-Gesetz betroffenen Territorien nördlich dieser Linie lagen, die Mason-Dixon-Linie genannt wurde. Die auf den ersten Blick positive Regelung beschwor Unruhen herauf, als die Anhänger der Abolitionisten und der Sklavenhalter in die fraglichen Territorien zogen, um der jeweils eigenen Seite bei den bevorstehenden Abstimmungen Gewicht zu geben und dabei aneinander gerieten. In Kansas herrschte Aufruhr, Mord und Totschlag, so dass der Staat bald als Bloody Kansas bezeichnet wurde.
Hinzu kam, dass der Präsident der Vereinigten Staaten bisher stets mit massiver Unterstützung des reichen Südens gewählt worden war. Wenn er selbst schon nicht direkt aus dem Süden kam, war er doch sehr abhängig von der Gunst der Südstaatler. Am 6. November 1860 war aber etwas geschehen, das in der kurzen Geschichte der USA kein Beispiel kannte: Abraham Lincoln, ein Anwalt aus Kentucky, der seine politische Karriere in Illinois begonnen hatte, war im Jahr zuvor zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner gekürt worden und am Wahltag zum 16. Präsidenten der USA gewählt worden. Das Besondere daran war, dass er nicht eine einzige Wahlmännerstimme aus den Südstaaten bekommen hatte. Lincoln hatte sich zum Ziel gesetzt, den Siedlern im Norden und Westen und der einheimischen Industrie zu helfen. Zu diesem Zweck wollte er neue Schutzzölle einführen, die gerade erst in einem der vielen Kompromisse abgebaut worden waren. Vor allem aber war Lincoln gegen die Sklaverei und vertrat die Auffassung, dass ein Volk nicht glücklich sein könnte, wenn ein Teil frei und der andere unfrei sei. Er hatte dennoch nicht die Absicht, die Sklaverei sofort abzuschaffen, weil ihm durchaus bewusst war, dass er zum einen nicht die Macht hatte, einen solchen Schritt zu tun, zum anderen, dass ein solches Gesetz die Sklaven haltenden Staaten in ihrer Gesamtheit aus der Union treiben würde. Lincoln war weit blickend genug, zu erkennen, dass eine Spaltung des Landes den Untergang des Ganzen bedeuten konnte. In einer Rede im Senatswahlkampf 1858 gab er diesen Bedenken Ausdruck, indem er sagte:
„Ein Haus, das in sich uneins ist, kann nicht bestehen!“
Der Süden glaubte sich durch Lincolns Wahlprogramm vernachlässigt und in seinen Privilegien bedroht. Es kam zu dem Bruch, der von den dreizehn Sklaven haltenden Staaten schon mehrfach angedroht worden war. South Carolina tat den entscheidenden Schritt, wählte einen Konvent, der die Verfassung der Vereinigten Staaten passend auslegte und den Bruch vollzog, indem er an jenem 20. Dezember, an dem diese Geschichte beginnt, eine Verordnung ratifizierte, die alle Beziehungen an die Vereinigten Staaten auflöste.
Die jungen Männer, die im Schulkasino ihren Abschluss feierten, waren nicht ahnungslos. Die echten Yankees, die Nordstaatler, prügelten sich häufig mit den ebenso echten Dixies, den heißblütigen Südstaatlern, von südlich der Mason-Dixon-Linie. Zwar gab es auch Ausnahmen unter den Ex-Kadetten, die sich lieber auf die Ausbildung konzentriert hatten, statt sich zu raufen – aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Und die Regel war, dass Nord und Süd sich nicht vertrugen. Für diesen Tag allerdings war eine Art Waffenstillstand vereinbart worden. Selbst die, die sich sonst die Köpfe eingeschlagen hätten, blieben friedlich, aber eine gewisse Spannung lag in der Luft.
Vier der genannten Ausnahmen hatten sich zu einem Billardspiel am grünen Tisch eingefunden.
Robert Christopher Bennett, Thomas Steven Craig, Martin Luther Moore und Mark Zachary Ashley hatten nicht die Absicht, sich zu streiten, nur weil Bennett und Craig aus dem Norden, Ashley und Moore aus dem Süden waren. Robert stützte sich auf seinen Queue und wartete auf seinen Einsatz. Er war jetzt einundzwanzigdreiviertel Jahre alt, hochgewachsen und schlank, trug das dunkle, leicht krause Haar sehr kurz geschnitten und hatte wache, intelligente Augen, die braun wie Haselnüsse waren. Um die Augen bildeten sich Lachfältchen, die bewiesen, dass der oft ernste junge Mann durchaus herzlich lachen konnte. Im Moment blickte er eher etwas skeptisch. Auf der Stirn bildete sich über der spitzen Nase eine steile Falte.
„Was du vorhast, geht daneben, Tom“, warnte er seinen Freund und Mannschaftskameraden Thomas Craig, der eben die weiße Kugel anvisierte.
„Halt’ dich raus, du mathematischer Blindgänger“, knurrte Tom, ohne aufzusehen, und führte seinen geplanten Stoß aus. Die weiße Kugel verfehlte die Elf knapp und rutschte auch an allen anderen noch auf dem Tisch befindlichen Kugeln vorbei. Thomas seufzte.
„Hab’ ich dir doch gesagt“, grinste Robert schelmisch. Thomas richtete sich auf. Er war ebenso groß wie Robert, hatte blaue Augen, war strohblond und trug einen noch leicht flaumigen Oberlippenbart. Es gab viele, die Robert und Thomas für Brüder hielten, so ähnlich waren sie sich trotz der Unterschiede in Haar- und Augenfarbe. Tatsächlich bestand eine entfernte Verwandtschaft, da beide ihre Abstammung auf den im 17. Jahrhundert in die Neue Welt eingewanderten Dänen Dag Merrild zurückführten. Craig schüttelte den Kopf und sah Bennett vorwurfsvoll an.
„Du weißt genau, dass ich nicht zielen kann, wenn du mir auf die Finger siehst, Bob“, sagte er und gab Martin Moore einen Wink. „Du bist dran, Martin.“
Moore war ein dunkelhaariger junger Mann von zwanzig Jahren, mathematisch ein wahres Genie, der gute Aussichten hatte, bei der Artillerie Karriere zu machen. Moore stammte aus Virginia. Sein Vater hatte eine Tabak- und Baumwollplantage, die von rund zweihundert Schwarzen bewirtschaftet wurde. Im Gegensatz zu den eher wenig bemittelten Offizierssöhnen Craig und Bennett schwamm Martin geradezu im Geld. Wegen der Sklaven auf der Plantage waren Robert und Martin häufiger aneinander geraten, aber es war stets bei einer hitzigen Diskussion geblieben. Die Hitzigkeit war jedoch regelmäßig verpufft, wenn einer von beiden für eine Arbeit nicht gelernt hatte. Der andere hatte ihm mit Sicherheit rechtzeitig den entsprechenden Schummelzettel zugeschoben.
Jetzt suchte Martin sich seinen Platz sorgfältig aus und stieß die auf der Platte verbliebenen Kugeln seiner Mannschaft mit einer yankeehaften Präzision in die Löcher.
„Kapierst du das, Bobby?“, fragte Tom entsetzt. Bennett nickte.
„Martin ist in Mathematik besser als wir“, erwiderte er lächelnd. Moore sah nur kurz hoch, grinste Bennett freundlich an – und räumte die Platte ab. Zufrieden brummend richtete er sich auf und sah Robert und Thomas herausfordernd an.
„Was ist, Yankeeboys? Revanche?“, fragte er.
„Sicher. Kann man ja nicht mit ansehen, dass die Dixies hier alles abräumen“, erwiderte Bennett lachend.
„Willst du’s noch mal mit Thomas riskieren, oder ziehst du einen anderen Partner vor, Bob?“
„Nichts gegen dein mathematisches Genie, Martin, aber Billard spiele ich grundsätzlich mit Tom zusammen“, erklärte Robert. „Das werde ich nicht am letzten Tag auf West Point ändern.“
Moore justierte das Dreieck mit den fünfzehn bunten Elfenbeinkugeln und wandte sich an Ashley:
„Lassen wir die Verlierer anfangen, Mark?“
„Keine Einwände, Martin“, erwiderte Ashley. Auch er war aus dem Süden, genauer: aus Georgia. Sein Vater besaß eine Baumwollkämmerei und eine Sägemühle in Atlanta und hatte in Savannah noch eine Textilfabrik. Wie Vater Moore war Vater Ashley zu den Reichen des Landes zu zählen.
Martin gab Robert einen Wink. Robert rieb sein Queue mit Kreide ein, zielte kurz und eröffnete mit einem ebenso kurzen wie harten Stoß. Mit zufriedenem Lächeln sah er der Elf nach, die gemächlich in ein Eckloch kullerte.
„Die Halben, Tommy“, sagte er. Sein Hinweis bezog sich darauf, dass die Kugeln, die mit den Ziffern ab der Neun bezeichnet sind, schmale Ringe um den Äquator haben und Halbe genannt werden, während die Kugeln mit den niedrigeren Ziffern einfarbig sind und nur die Ziffer selbst in einem weißen Kreis steht. Diese werden deshalb auch Volle genannt. Thomas sah seinem Freund mit triumphierender Miene zu, als der eine Kugel nach der anderen in den Löchern verschwinden ließ. Ashley und Moore sahen sich betreten an.
„He, Moment mal, das gilt nicht!“, protestierte Mark. „Wieso spielst du eigentlich so gut Billard, wenn du in Mathematik so eine Niete bist?“
„Weil ich mit der Praxis mehr anfangen kann als mit Theorie“, brummte Bennett.
Gerade wollte er anfangen, auch die Vollen abzuräumen, als lautes Gepolter von der Tür die Aufmerksamkeit der Spieler forderte.
„Extrablatt!“, tönte es von dort. „He, Jungs, hört mal alle her!“
Steve Graham, ebenfalls ein Ex-Kadett aus dem Abschlussjahrgang, sprang auf die Theke und schwenkte eine dünne Sonderausgabe der New York Times.
„Hört mal, ihr Politikbanausen. Wird vor allem die Jungs aus South Carolina interessieren. Hier steht: Eilmeldung! Konvent von Charleston/South Carolina ratifiziert Unabhängigkeitserklärung! South Carolina tritt aus der Union der Vereinigten Staaten aus und erklärt alle Bindungen an die USA für gelöst! Ende des Zitats. Jungs, Eure Landesväter haben unserer Verfassung gerade einen Fußtritt versetzt“, rief er.
Einen Moment war eine Stille im Kasino, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Dann begannen die Leute aus South Carolina zu jubeln. Es waren nur wenige. Die anderen Südstaatler waren verunsichert, wussten im Moment nicht, wie sie sich verhalten sollten. Die meisten machten ihren Standpunkt vom künftigen Verhalten ihrer Heimatstaaten abhängig.
Ein leises, aber deutliches Räuspern störte den Jubel der Männer aus South Carolina.
„Ihr solltet nicht zu früh jubeln, Freunde“, warnte Robert. „Euch ist doch hoffentlich klar, dass die Union eine Sezession nicht einfach hinnehmen wird. Das gibt ‘ne Menge Ärger.“
„Wer sollte uns wohl dazu bringen, diese schwachsinnige Union nicht aufzukündigen?“, fragte Andrew Newport. Er war aus South Carolina.
„Der Präsident, sei es der amtierende – Buchanan – oder der gewählte – Lincoln. Weder der eine noch der andere kann zulassen, dass ein oder mehrere Staaten wie beleidigte Schuljungs davonschleichen. Lasst euch gewarnt sein. Die Einheit unseres Landes ist lebenswichtig für uns. Ein Zerbrechen können wir uns nicht leisten“, erklärte Bennett.
„So etwas kann auch nur ein feiger Yankee von sich geben. Ohne uns mutige Südstaatler kommt ihr wohl nicht aus. Gib’s zu, Bennett: Du hast die Hose jetzt schon gestrichen voll“, spottete Newport. Der vierschrötige Riese aus Charleston schob sich nach vorn. Robert war klar, dass er bei einer Schlägerei gegen Newport keine Chance hatte. Andrew ließ ihn am ausgestreckten Arm verhungern. Er hatte buchstäblich einschlägige Erfahrungen aus dem Boxunterricht. Mark Ashley überblickte die Situation und wusste sofort, dass der junge Mann aus dem Nebraska-Territorium Newport körperlich nicht gewachsen war.
„Newport – du suchst Streit“, bremste Ashley. „Hier und heute ist nicht der richtige Ort dafür. Hauen könnt ihr euch immer noch, wenn es zu einem offenen Konflikt kommt. Aber davon abgesehen, glaube ich nicht, dass es wirklich Krieg gibt. Wetten?“, warf Ashley seinen Köder aus. Für Wetten waren die Kadetten immer zu haben gewesen. Daran änderte auch die Beförderung zum Second-Lieutenant nichts. Bennett warf Ashley einen dankbaren Blick zu. Die Situation war gerettet.
„Ich wette, dass der Krieg ausbleibt“, sagte Mark. „Sollte es trotzdem zu einem Krieg zwischen den amerikanischen Staaten kommen, dann werde ich – so wahr ich Marcus Zachary Ashley aus Georgia bin – diesen Krieg mit dem Rang durchstehen, mit dem ich hineingehe – oder mir damit die Radieschen von unten ansehen“, machte Mark sein Wettangebot.
„Und was soll das bedeuten?“, fragte Newport ebenso abschätzig wie immer noch herausfordernd.
„Newport, du bist ebenso lang wie vernagelt“, schalt Ashley beinahe sanft. „Welcher gute Offizier lässt seine Karriere sausen? Ich meine es ernst: Ich halte einen Bürgerkrieg für so unwahrscheinlich, dass ich meine Karriere drauf verwette.“
„Wer hält dagegen?“, fragte Graham, zückte ein Stück Kreide und eröffnete an der Tafel, an der sonst die Getränkepreise standen, ein Wettbuch. Der von Ashley ausgestreute Funke zündete. Die wettfreudigen Ex-Kadetten hielten eifrig mit. Alle verpflichteten sich, im Falle eines Sezessionskrieges auf ihre Karriere zu verzichten, wenn sie zu Ashleys Meinung tendierten. Robert Bennett und Thomas Craig hielten sich lange zurück, aber schließlich trat Robert doch an den ‚Wettschalter.
„Heute haben wir den 20. Dezember 1860“, sagte er langsam. „Am 4. März tritt unser neuer Präsident sein Amt an. Spätestens dann muss der Süden Farbe bekennen. Ich glaube, so lange werden die Sklavenstaaten nicht warten. Ich bin überzeugt, dass wir bis zum 4. März die Keilerei längst haben. Sollte ich mich irren, lasse ich mich im nächsten Krieg, den die Vereinigten Staaten führen, nicht befördern“, erklärte er. Graham zögerte, Roberts Wetteinsatz zu notieren.
„Das ist ‘n Wort!“, rief es irgendwo von hinten.
„Bravo, du Kriegsprophet!“, höhnte ein anderer. Robert stand noch an der Bar, als ihm jemand von hinten auf die Schulter tippte.
„He, Bennett!“
„Du schon wieder, Andrew?“, fragte er, ohne sich umzudrehen.
„Du willst doch unbedingt Krieg, Bennett, oder?“, fragte Newport. Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte Newport Bennett um und schlug einen rechten Haken.
„Bitte, da hast du ihn!“, lachte er dröhnend. Der Schlag warf Robert über die Theke. Newport ging um den Tresen herum, schob Graham sachte beiseite und stellte Bennett am Kragen wieder auf die Beine. Sein Grinsen wurde breiter.
„Und noch mal, weil’s so schön war!“, knurrte er und brachte einen unangenehmen Tiefschlag an. Robert japste noch einmal, sackte zusammen und blieb liegen.
Thomas Craig wurde es jetzt zu viel. Er mochte nicht zulassen, dass sein bester Freund verprügelt wurde und keiner eingriff, um Robert zu helfen. Eilig drängte er sich zur Theke durch und knuffte den Riesen aus South Carolina in den Rücken, worauf der sich umdrehte. Tom rieb sich kurz die geballte Faust, holte aus und platzierte eine rechte Gerade auf Newports Kinnspitze. Ohne lange zu überlegen fügte er noch einen mächtigen Hieb in die Magengegend hinzu. Aber der fleischgewordene Panzerschrank aus Charleston zeigte nur ein mildes Lächeln.
„Hast du schon geschlagen, Tommy?“, fragte er sanft. Thomas sah völlig verblüfft auf – und dann bezog Craig Dresche wie seit seiner Collegezeit nicht mehr. Weil er sich aber noch halbwegs decken konnte, gelangen Newport bei ihm nicht solche Treffer wie bei dem völlig überraschten Robert.
Moore hatte inzwischen Bennett wieder zu sich gebracht.
„Oh, Gott im Himmel, hat der einen Schlag am Leib!“, stöhnte Robert.
„Stimmt“, grinste Martin. „Tom bekommt auch grade sein Teil ab.“
„Wie?“
Robert war mit einem Schlag wieder wach.
„Steve, gib mir den Putzlappen“, verlangte er.
„Das Ding ist nass!“, warnte Graham.
„Eben!“, knurrte Robert. „Das ist das Einzige, was Newport zur Vernunft bringen kann!“
Er nahm Graham den nassen Putzlappen ab, der etwa die Größe eines Handtuchs hatte, schwang den Lappen wie ein Lasso und ließ ihn in Richtung des Riesen fliegen. Die Drehung vor dem Start bewirkte, dass das lange Tuch sich dreimal um Newports Kopf wickelte und ihn zu Boden warf. Baldwin und Gordon fingen Tom auf, der unter Newports Hieben zu Boden ging.
„Jesus, wo bin ich?“, fragte Thomas, als er gleich darauf aus der gewaltsamen Narkose erwachte. „Und wo sind die Trümmer von dem Haus, das mir auf den Kopf gefallen ist?“
„Im Kasino, Tommy“, lachte Ronald Gordon. „Und die Trümmer liegen da drüben!“, wies er tränenlachend auf Newport, der sich am Boden wälzte und verzweifelt versuchte, den Putzlappen loszuwerden. Er schaffte es einfach nicht. Schließlich griff Robert ein, weil sich seine Kameraden nur vor Lachen die Seiten hielten, aber dem mit dem Ersticken ringenden Newport nicht halfen.
„Jetzt reicht’s! Du bist genug gestraft, Andy“, sagte er, klemmte den Riesen am Boden fest und wickelte ihn wieder aus. Ein Knie hatte er auf Newports Brust. „Aber wenn du nicht vernünftig bist, mach ich die Windel wieder zu!“, drohte er.
„Verd…!“
„Newport!“, warnte Robert. „Vorsicht – Putzlappen!“
„Bloß nicht! Lass mich hoch, Bennett!“
„Unter einer Bedingung.“
„Ich tu’ alles, was du willst, Bob, aber bleib’ mir mit dem Lappen vom Leib“, versprach Andrew.
„Du spielst jetzt ganz friedlich eine Partie Billard mit mir.“
„Okay.“
„Gut.“
Robert nahm Newport bei der Hand und zog ihn hoch.
„Und keinen Streit mehr, bis es wirklich ernst wird“, warnte er noch.
„Streit? Ich streite doch nie, Bennett“, brummelte Newport gemütlich, ließ sich ein Queue geben und spielte ganz friedlich Billard mit Robert.
Am folgenden Tag, nach der Abschlussparade, trennten sich die frischgebackenen Lieutenants und machten sich auf den Weg in ihre Heimatstaaten, ohne sich noch einmal im Frieden zu begegnen.
Kapitel 1
Der Neujahrsball
Am folgenden Tag fand die Abschlussparade der Absolventen auf dem großen Exerzierplatz der Akademie statt. Unter den Besuchern der Veranstaltung, die öffentlich war, waren auch Dr. Lucas Craig und Benjamin Bennett.
Dr. Craig war Chirurg, der in einem Krankenhaus in Brooklyn arbeitete. Er plante jedoch, sich selbstständig zu machen und im folgenden Jahr eine Praxis in Dover/Tennessee von einem alten Kommilitonen zu übernehmen. Er besuchte die Parade für seinen älteren Bruder Richard, Thomas Craigs Vater. Mit dem Militär hatte er wenig im Sinn. Im Gegensatz zu seinem Bruder hatte er keinen Militärdienst geleistet und hatte auch nicht vor, es zu tun. Er war der Meinung, dass er als Arzt schon in Friedenszeiten mehr als genug zu tun hatte. Von einem Krieg erwartete er nur Unheil.
Benjamin Bennett war Rechtsanwalt in Boston. Wie alle Männer der Familie Bennett hatte er wenigstens eine Zeitlang Militärdienst geleistet, hatte aber erkannt, dass ein Leben in Uniform nicht seinem Wesen entsprach.
Die Tatsache, dass er Rechtswissenschaften studiert hatte und Anwalt geworden war, hatte ihn von seinem Bruder Frederick, Roberts Vater, getrennt. Die Brüder waren schwer zerstritten, weil Frederick Bennett nichts mehr hasste als Indianer und Rechtsanwälte. Der Familienzwist mit dem Bruder hinderte Benjamin Bennett aber nicht daran, seine Neffen Robert und Philip wie Söhne zu lieben. Robert hatte eine sehr gute Abschlussprüfung abgelegt – sah man von indiskutablen Leistungen im mathematischen Bereich ab, was ihn nicht gerade für eine Karriere als Pionier oder Artilleristen empfahl. Benjamin, der gute Leistungen sehr schätzte, hatte sich deshalb einen Tag frei genommen, um seinem Neffen gleich nach der Parade zu gratulieren. Aus ähnlichen Beweggründen war Lucas Craig in West Point erschienen.
„Danke, dass du gekommen bist, Onkel Ben“, bedankte Robert sich später.
„Wenn dein Vater schon keine Zeit hat, seinen ganzen Stolz abzuholen, muss ich es wohl tun“, erwiderte Benjamin. „Bleibst du über Weihnachten?“
„Tom Craig hat mir eine Einladung seines Onkels Lucas aus New York gegeben. Onkel Lucas hat uns für Weihnachten eingeladen und Thomas’ Eltern über Neujahr. Ich werde erst zum Dienstantritt nach Fort Randall zurückkehren.“
„Hast du schon eine Einheit, mein Junge?“
„Ich habe mich zur Kavallerie verpflichtet, genau wie Tom. Aber unsere Zuordnung ist noch nicht geklärt. Es könnte sein, dass wir dem Regiment meines Vaters zugeordnet werden. Paps baut in Randall eine neue Truppe auf, von der aber noch keiner weiß, ob der Kongress sie überhaupt haben will. Entweder wird es ein Milizregiment oder ein siebentes US-Kavallerie-Regiment. Papa weiß es noch nicht. Miliz würde mir – ehrlich gesagt – quer durch den Hals gehen. Mit Sonntagssoldaten hab’ ich’s nicht so“, erklärte Robert.
„Hast du was von Phil gehört?“, fragte Benjamin. Robert nickte.
„Er hat mir geschrieben. Wenn ich ihn recht verstanden habe, will er den Dienst quittieren und ein Jurastudium anfangen. Ich kann mir vorstellen, was Daddy dazu sagt. Der wird vor Wut die Wände hochgehen.“
„Ja, Philip hat mir das auch geschrieben. Er hatte schon immer die Neigung zur Jurisprudenz, aber euer Vater hat ihn in die Uniform gesteckt. Was ist eigentlich mit dir? Was wolltest du eigentlich machen?“
Robert lachte herzlich.
„Du wirst es kaum glauben, Onkel Ben: Ich habe nie etwas anderes im Sinn gehabt, als Soldat werden zu wollen. Im Gegensatz zu Philip bin ich nun mal unter Uniformen aufgewachsen. Das hinterlässt gewisse Spuren.“
„Was hältst du von Juristerei?“
„Der zweitschönste Job, den ich mir denken könnte“, grinste Robert. „Ich habe jeden Rechtskurs belegt, den ich auf der Akademie erwischen konnte. Wenn Daddy das spitz bekommt, setzt es Ohrfeigen. Aber ich muss es ihm nicht auf die Nase binden.“
Wenn Robert und Thomas Benjamins Einladung, zum Weihnachtsfest zu bleiben, auch nicht annahmen, so besuchten sie ihn doch noch kurz in Boston, bevor sie nach New York reisten, mochte es zunächst auch einen Umweg bedeuten. Von dort schickte Tom eine Depesche nach Topeka, wo seine Eltern und Geschwister lebten, mit der Ankündigung, er und Robert würden pünktlich am 31. Dezember eintreffen.
Der Telegrammbote klopfte morgens um sieben am Haus von Richard Craig. Der Captain a. D. öffnete noch recht verschlafen.
„Guten Morgen, Sir. Ein Telegramm für Sie“, grüßte der Bote freundlich.
„Danke, Mr. Marcus. Das wär’s gewesen, wenn Sie um zehn gekommen wären“, gähnte Richard Craig. „Trotzdem – fröhliche Weihnachten“, setzte er hinzu und gab dem Boten ein gutes Trinkgeld, der freudestrahlend weiterging. Craig öffnete das Depeschensiegel und las das Telegramm seines ältesten Sohnes:
„ANKOMME DEZEMBER 31. ROBERT KOMMT MIT. ERWARTE GROSSE PORTION KRAPFEN! TOM“
Richard lachte herzlich. Gwendolyn, seine Frau, hatte Thomas angedroht, keine Silvesterkrapfen zu backen, wenn er Robert Bennett nicht zu Neujahr mitbrächte. Silvester ohne Mutters Krapfen war für Thomas kein Silvester. Das Rezept hatte Gwendolyn von ihrer Schwiegermutter Helen, die aus Kassel im Deutschen Bund stammte.
Die Craigs kannten Robert Bennett schon so lange, wie er lebte. Richard Craig war ein guter Freund von Frederick Bennett und Roberts Taufpate. Richard Craig und Frederick Bennett hatten lange Jahre in derselben Einheit gedient, waren deshalb in denselben Forts stationiert gewesen. Die enge Freundschaft der Väter hatte dazu geführt, dass die Kinder die Eltern der anderen als eine deutlich nähere von Art Verwandtschaft ansahen als sie tatsächlich bestand.
Sechs Jahre zuvor hatte Richard aber seinen Abschied genommen und war in den Holzhandel gegangen, hatte eine Stelle in Topeka/Kansas angenommen. Die Familien waren getrennt worden, als Frederick 1854 in die neu gegründete Stadt Omaha im Nebraska-Territorium versetzt worden war. Der Kontakt hatte ein wenig gelitten, was aber nicht hieß, dass er völlig abgebrochen war. Richard und Gwendolyn Craig hatten jedenfalls darauf bestanden, dass Robert Bennett das Neujahrsfest in Topeka feiern sollte.
„Gwendy!“, rief Craig.
„Ja, Dick?“
„Tom hat telegrafiert! Er kommt Silvester nach Hause!“
„Bringt er Robert mit?“
„Ja. Er schreibt, dass der junge Bennett mitkommt. Und du sollst auf keinen Fall deine Krapfen unterschlagen!“, rief Richard. Aus dem ersten Stock kam nur das fröhliche Lachen seiner Frau.
Im Hause der Craigs begannen fleißige Vorbereitungen für die Ankunft der Lieutenants. So eifrig wie jetzt hatten Susan und Frank, Toms jüngere Geschwister, ihren Eltern schon lange nicht mehr geholfen.
Am frühen Nachmittag des 31. Dezember 1860 trafen die jungen Männer in Topeka ein. In Warrensburg hatten sie die Eisenbahn verlassen und waren den Rest des Weges geritten.
„Hübsche kleine Stadt. Immer noch richtig verträumt“, bemerkte Robert, als sie in den Ort hineinritten.
„Oh, das ist nicht immer so. Wenn hier Abolitionisten und Sklavokraten zusammenstoßen, ist man als Normalsterblicher besser nicht auf der Straße. Ich hoffe, dass sich das in den letzten vier Jahren etwas beruhigt hat. Und dann hat Vater mir geschrieben, dass geplant ist, die Eisenbahn von Warrensburg über Kansas City nach Topeka und darüber hinaus Richtung Westen zu verlängern. Dann ist es mit der Ruhe ohnehin vorbei“, erwiderte Tom mit einem Anflug von Melancholie.
„Wo ist euer Haus?“
„Das weiße Gebäude da vorn ist es schon.“
Sie ritten auf das bezeichnete Haus zu, banden ihre Pferde an der Veranda fest. Tom sprang die drei Stufen bis zur Tür mit einem Satz hoch und klopfte. Es dauerte auch nur wenige Augenblicke, bis sich die Tür öffnete und Gwendolyn ihren ältesten Sohn glücklich umarmte.
„Tommy, endlich bist du wieder da! Willkommen zu Hause!“
„Danke, Mom“, erwiderte Tom und gab seiner Mutter einen Begrüßungskuss. „Ich hoffe, es gibt Krapfen?“
„Wie immer, wenn du heimkommst.“
Gwendolyns Blick fiel auf Robert, der unten an der Treppe stand.
„Herzlich willkommen, Robert!“, sagte sie. „Du bist ja eine Ewigkeit nicht mehr bei uns gewesen.“
Er stieg die Treppe hinauf und machte einen höflichen Diener.
„Danke für die Einladung, Tante Gwendy. Tom hat nicht viel Mühe gehabt, mich zu überreden.“
„Ma, wo sind die Kleinen eigentlich?“, fragte Tom.
„Die sind in die Stadt gefahren, um noch einige Sachen einzukaufen“, erwiderte Gwendolyn. „Kommt doch erst mal rein. Bei der Kälte braucht ihr nicht draußen zu stehen“, lud sie dann ein.
„Danke, aber ich will mein Pferd erst versorgen. Wo kann ich den Burschen unterstellen?“, fragte Robert. Thomas winkte ihm.
„Komm mit.“
Als sie die Pferde in den Stall gebracht hatten, zeigte Richard Robert sein Zimmer und verband gleich eine Hausführung damit. Solange die Familie in Topeka wohnte, war noch niemand von den Bennetts zu Besuch gewesen.
„Was macht dein Vater Robert?“, fragte Richard, als er mit seinem Taufpaten wieder im Wohnzimmer angekommen war.
„Er ist immer noch Soldat, ist vor einem Jahr zum Lieutenant-Colonel befördert worden und hat jetzt den Auftrag, oben im Nebraska-Territorium ein neues Regiment aufzustellen, hat er mir geschrieben. Aber der Auftrag kam noch von Kriegsminister Floyd unter Präsident Buchanan. Wer weiß, ob der neue Minister die Truppe überhaupt noch will.“
„Wie geht’s ihm sonst?“
„Abgesehen von der Unsicherheit mit seiner Truppe geht’s ihm gut. Er lässt schöne Grüße bestellen. Betty hat mir allerdings noch verraten, dass die Lausekälte zu Hause Papas Bein arge Schwierigkeiten macht. Sie behauptet, Daddys rechtes Bein wäre der beste Wetterprophet.“
„Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie er sich die Verletzung damals in Mexiko 46/47 eingefangen hat“, geriet Richard in Erinnerungen. „Wir lagen gerade …“
„Stopp, die Geschichte kenne ich auswendig!“, bremste Robert. „Papa erzählt sie beinahe alle Tage.“
„Dann werde ich dich damit nicht belämmern“, lachte Richard auf. Thomas kam herein.
„Wenn du erlaubst, Papa, werde ich dir Robert jetzt für eine Weile entführen und ihm die Stadt zeigen“, sagte er.
„Geht nur. Aber seid zum Abendessen zurück.“
Kaum waren die Freunde fort, kehrten Thomas’ jüngere Geschwister Susan und Frank von ihrem Einkauf zurück.
„Das nächste Mal bestelle ich eine zweite Kutsche!“, protestierte Frank. „Ein Wagen fasst das alles nicht, wenn Susan ohne eindeutige Anweisungen einkaufen will.“ Er grinste frech. „Und ich glaube, wir haben noch nicht alles bekommen. Susy hat ein Gesicht gemacht wie dreizehn Tage Regenwetter!“, petzte er.
„Ekel!“, fauchte seine Schwester und sprang die Treppe hinauf ins erste Stockwerk. Richard folgte seiner Tochter besorgt.
„Fehlt noch etwas? Soll ich Tom noch mal losschicken?“
„Nein, nein, Papa. Was ich einkaufen wollte, haben wir bekommen“, widersprach Susan.
„Und warum machst du so ein Gesicht?“
„Ach, Paps, ich hab’ keine Lust, heute zum Neujahrsball zu gehen.“
„Das ist ja ganz was Neues! Seit wann hast du keine Lust mehr zum Tanzen, Susy?“, wunderte sich Richard.
„Roger O’Malley ist doch vor zehn Tagen weggezogen. Ohne Roger macht mir kein Tanz richtig Spaß, Daddy. Außerdem habe ich ohne Roger keinen Tischherrn und ersten Tanzpartner mehr. Und ohne Tischherrn zum Ball zu gehen, ist völlig unmöglich. Nein, ich mag nicht.“
„Und wenn ich einen passenden Ersatz auftreibe?“
„Den kannst du doch nicht aus dem Hut zaubern, Paps. Kann Tom das nicht machen, wenn ich unbedingt mitmuss?“
„Thomas ist an Miss Covington vergeben. Das weißt du doch“, erinnerte Richard.
„Ausgerechnet diese Zicke?“, ereiferte sich Susan.
„Susan, bitte!“, bremste der Vater den aufkommenden Wutanfall seiner Tochter. „Ich werde einen Ersatz finden, und ich erwarte, dass du dich anständig benimmst. Sonst hast du eine Menge Ärger, meine liebe Tochter!“
Susan nickte brummig, aber sie sagte nichts mehr. Sie wusste, wann es besser war, den Vater nicht weiter zu reizen.
Richard Craig ging nachdenklich hinunter. Susan konnte unausstehlich sein, wenn ihr Tischpartner ihr nicht passte. Sie hatte es oft genug bewiesen. Vater Craig stellte sich also die Frage, wem er die Kratzbürste Susan anvertrauen sollte – oder sollte er besser andrehen sagen? Trotz angestrengten Nachdenkens wollte ihm kein passender Partner für Susan einfallen. Schließlich fragte er seine Frau um Rat.
„Gwendy, Susan will nicht zum Neujahrsball mitkommen“, sagte er, als er die Küche betrat.
„Und warum nicht?“
„Sie hat keinen Tanzpartner mehr, seit O’Malley weggezogen ist. Ich müsste ihr wohl einen suchen.“
„Und warum bist du dann noch nicht weg? Um acht beginnt die Veranstaltung“, erinnerte Gwendolyn, beinahe uninteressiert.
„Gwendy, du kennst unsere Tochter mindestens so gut wie ich, wenn nicht noch besser. Wenn sie sich seit dem großen Ball zum Unabhängigkeitstag in Fort Larned nicht völlig verändert hat, kann sie unausstehlich sein. Denk mal daran, wie sie den armen Lieutenant Parker fertig gemacht hat. Susan kann richtig widerlich sein, wenn ihr derjenige, mit dem sie am Tisch sitzt, nicht gefällt. Ich hätte wirklich Gewissensbisse …“
„Lass nur, Dick, ich mache das schon. Bis jetzt habe ich immer noch jemanden gefunden“, beruhigte Gwendolyn ihren Mann.
„Bis jetzt war auch immer Roger O’Malley zur Stelle. Aber der hat sich plötzlich erinnert, dass er aus South Carolina ist und hat sich lieber den Rebellen da unten angeschlossen!“, schnaufte Richard. „Ich wüsste nicht, wer sonst mit unserer Tochter fertig werden könnte, ohne von ihr unmöglich gemacht zu werden“, gab er zu bedenken.
„Lass dich überraschen, Dick. Du wirst sehen, dass ich den Richtigen gefunden habe – spätestens um Mitternacht“, lächelte Gwendolyn. Ihr war gerade eine Idee gekommen …
Einige Zeit danach kehrten Thomas und Robert aus der Stadt zurück. Gwendolyn Craig packte die Gelegenheit beim Schopfe, ihre Idee gleich zu verwirklichen und bat Robert ins Wohnzimmer. Sie schloss die Tür und fragte:
„Robert, tanzt du noch so gut wie früher?“
Der junge Mann war sehr überrascht.
„Ich hatte nicht viel Gelegenheit, es in den letzten vier Jahren auszuprobieren. Es langt grade noch für English Waltz, Polka und einen Square Dance. Ich hoffe, dass es für einen Garnisonsball reicht.“
„Bestimmt, mein Junge. Du hast doch sicher für heute Abend noch keine Tischdame oder?“
„Nein, ich hatte gehofft, Tommy würde mir behilflich sein. Schließlich bin ich hier fremd.“
„Wärst du einverstanden, Susan heute Abend zum Ball zu begleiten?“
Robert erinnerte sich an ein Mädchen, das er zuletzt vor sechs Jahren gesehen hatte. Susan war gerade vierzehn Jahre alt gewesen, als er sie in Omaha verabschiedet hatte. Der junge Mann war nie sehr zu Mädchen hingezogen gewesen, sie hatten ihn bisher einfach nicht interessiert. Zudem hatte er oft erlebt, wie sehr seine Mutter geweint hatte, wenn sein Vater auf einem Feldzug gewesen war. Er wollte nicht, dass sich jemand um ihn Sorgen machte. Aber der Name Susan Craig löste eine ganz seltsame Empfindung bei Robert Bennett aus. Das Besondere daran war, dass ihm zwar viele Mädchen schöne Augen gemacht hatten, die ihm absolut nicht gefielen, nur Susan hatte ihn nie mit diesem verliebte-Katzen-Blick bedacht, den Robert so gar nicht mochte. Und genau das war es, was Robert so an ihr schätzte.
„Es wäre mir eine Ehre“, sagte er lächelnd.
„Hast du Susan schon gesehen? Sie ist richtig erwachsen geworden.“
„Nein. Als ich ankam, war sie noch einkaufen“, erwiderte Robert.
„Dann warte einen Moment“, sagte Gwendolyn und verließ eilig das Wohnzimmer.
Es war inzwischen sieben Uhr abends, und Susan war dabei, sich für den Silvesterball fertig zu machen. Gerade kämmte sie ihre halblangen, braunen Locken, als es klopfte und sie die Stimme ihrer Mutter hörte:
„Susy, mach bitte auf.“
„Sofort, Mama!“, rief sie, einen Kamm zwischen den Zähnen. Eilig sprang sie auf und öffnete die Tür.
„Was ist denn? Fehlt doch noch etwas?“, fragte sie erschrocken.
„Nein, im Gegenteil, mein Kind: Es ist jetzt wirklich alles komplett. Ich habe für heute Abend einen Begleiter für dich gefunden“, strahlte Mutter Craig. Susans Miene war alles andere als glücklich.
„Mama, du hast doch nicht etwa einen Fremden …?“
„Nein, Unsinn. Du kennst ihn, aber du hast ihn schon lange nicht mehr gesehen. Mach dich fertig, dann stelle ich ihn dir vor.“
Kaum fünf Minuten später war Susan im Wohnzimmer. Völlig verblüfft erkannte sie Robert Bennett.
„Bobby, du?“, fragte sie verwirrt nach. Der Lieutenant sprang auf, als er Susan sah. Wenn das nicht die Frau seiner Träume war! Gwendolyn Craig lächelte viel sagend und nahm Susan bei der Hand.
„Susan, Bob Bennett wird heute Abend dein Tischherr sein“, sagte sie. Dann wandte sie sich an den jungen Mann:
„Robert, ich vertraue dir Susan an. Pass bitte gut auf sie auf.“
„Selbstverständlich Tante Gwendy. Es ist mir eine Ehre, Susan.“
Er lächelte Susan warm an und bedachte ihre Hand mit einem höflichen Handkuss.
„Ganz meinerseits, Robert“, erwiderte sie mit nicht zu übersehender Röte im Gesicht.
Viertel vor acht hielt eine Kalesche von Fort Leavenworth vor der Haustür. Ein Soldat in großer Uniform hielt die Wagentür auf. Richard Craig hatte seine alte Uniform aus dem Schrank geholt und hatte sich vom biederen Holzkaufmann wieder in den schneidigen Captain Craig verwandelt. Sämtliche Orden, die er sich in seiner Karriere verdient hatte, waren fein säuberlich aufgesteckt. Er half seiner Frau in den Wagen. Gwendolyn Craig war anzusehen, dass ihr Mann es mit Holzhandel zu Geld gebracht hatte. Ihr Mantel war mit allerfeinstem Biberfell besetzt. An den Ohrläppchen glitzerten diamantbesetzte Ohrringe, die allein ein Vermögen wert waren. Ohne es eigentlich zu wollen, verglich Robert Susan mit ihrer Mutter. Was die Mutter aufgedonnert war, war die Tochter bescheiden. Sie trug nicht einmal einen Ring, geschweige denn solches Geschmeide wie diamantene Ohrringe. Auch ihr Mantel war nicht von der Pracht wie der ihrer Mutter, was nicht hieß, dass er seinen Zweck nicht erfüllte. Vorsichtig half Robert Susan in die Kalesche und stieg dann selbst als Letzter ein. Tom war zu den Covingtons geritten, um mit Captain Covington, dessen Frau und Tochter Angela zum Ballhaus zu fahren. Richard Craig klopfte an die Wagenfront und der Kutscher fuhr los.
Eine Viertelstunde später saßen die Gäste im Ballhaus. Das Organisationskomitee der Garnisonen Riley und Leavenworth veranstaltete den Neujahrsball als gemeinsames Fest der Garnisonsangehörigen, zu dem auch alle ehemaligen Mitglieder der Garnisonseinheiten eingeladen worden waren. Da Topeka ziemlich genau in der Mitte zwischen beiden Garnisonsstandorten lag, hatte das Komitee den Stars and Stripes Saloon in Topeka für das Fest gemietet. Die Organisatoren hatten sich alle Mühe gegeben, deutlich zu machen, dass dieses Fest von Soldaten für Soldaten gemacht war. Der Saal war mit Girlanden und Rosetten in den Staatsfarben Rot, Weiß und Blau geschmückt, dazu hatten sie sämtliche Regimentsfahnen und Schwadronswimpel gut sichtbar aufgehängt. Der Kommandant des Forts Riley eröffnete den Ball, und die Kapellen der Garnisonen spielten abwechselnd Tanzmusik, die in die Beine ging und bewies, dass die Musiker mehr konnten, als nur Märsche blasen.
Robert kam sich recht unbeholfen vor. Er brachte es weder fertig, mit seiner Tischdame ein Gespräch anzuknüpfen, noch war es ihm beschieden, mit ihr zu tanzen. Irgendwie hatte sie immer eine passende Ausrede. Aber schließlich kam ihm der Zufall zu Hilfe: Susan begann zu niesen und konnte ihr Taschentuch nicht finden.
„Nimm meins, Susan. Es ist ganz sauber“, bot er an. „Gesundheit!“, setzte er hinzu, als sie nochmals herzhaft nieste.
„Tschii! Danke, Bob. Oh, ich glaube, ich habe mich ganz scheußlich erkältet. Kein Wunder, wenn Petrus nicht weiß, ob nun Herbst oder Winter sein soll.“
Sie schnupfte aus und wollte Robert sein Taschentuch zurückgeben, als ihr die Stickerei in der Ecke des Tuchs auffiel.
„Oh“, sagte sie, „das ist aber hübsch. Noch von deiner Mutter?“
„Nein, das hat Betty mir zum Geburtstag geschickt. Sie hat die Stickkunst unserer Mutter offensichtlich geerbt.“
Der Anfang war gemacht. Das Gespräch entwickelte sich nun rasch und nahm die jungen Leute völlig in Anspruch; so sehr, dass sie die Zeit und das Tanzen vergaßen. Schließlich schlug es elf.
„Was? Schon elf?“, wunderte er sich. „Ich denke, wir sollten doch noch ein Tänzchen wagen, ehe es Mitternacht ist. Würdest du mir die Ehre des nächsten Tanzes geben, Susan?“
Im gleichen Moment stimmte die Kapelle von Fort Leavenworth einen English Waltz an. Sie zögerte einen Moment.
„Ja, gern“, sagte sie dann und ließ sich auf die Tanzfläche führen. Robert hatte das Gefühl, eine Feder in den Armen zu halten, so leicht schwebte Susan mit ihm dahin. Der junge Lieutenant war sicher, noch nie mit einem Mädchen getanzt zu haben, das so perfekt Walzer tanzte. Schließlich konnte er nicht mehr umhin, ihr das auch zu sagen:
„Du tanzt wundervoll Walzer. Du bist so leicht wie eine Feder“, lächelte er warm. Die Reaktion, die darauf folgte, hatte er allerdings überhaupt nicht erwartet: Sie wurde weiß und rot und blieb plötzlich stehen.
„Was ist? Ist dir nicht gut?“, fragte er besorgt nach.
„Oh, du … du Ekel!“, zischte Susan giftig, machte sich von dem völlig verblüfften Lieutenant Bennett frei und rannte hinaus. Er brauchte einen Moment, um sich zu fassen.
„Susan!“, rief er hinter ihr her. „Susan, bleib hier!“
Er drängte sich durch die Gäste auf der Tanzfläche, die den Eklat gleichfalls überrascht beobachtet hatten. Aber Susan war verschwunden. Nach einiger Zeit traf er auf Tom.
„Was war das?“, fragte der entsetzt.
„Das wüsste ich auch gern. Wir haben uns prächtig vertragen, bis ich ihr gesagt habe, wie schön sie Walzer tanzt. Hat sie öfter solche Anwandlungen?“
„Komisch, immer wenn ihr jemand sagt, dass sie eine Walzerfee ist, macht sie dasselbe Theater. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Ich hätte dich warnen sollen“, erwiderte Tom.
„Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte?“
„Bei uns zu Hause wäre sie garantiert in ihrem Zimmer. Wo sie sich hier verkrochen haben könnte, weiß ich nicht. Aber diesmal warne ich dich gleich: Mach dir keine Hoffnung, sie wieder in den Ballsaal zu lotsen. Meine Schwester kann unausstehlich sein, wenn sie schmollt. Und ich fürchte, dass sie jetzt schmollt. Alles, was du jetzt erreichst, ist, dass sie dich unmöglich macht.“
„Das hat sie bereits“, seufzte Robert. „Danke für die Warnung, Tommy, aber schlimmer kann es nicht mehr werden. Ich will es wenigstens versuchen.“
Während Robert weiterhin Susan suchte, setzte Thomas sich zu seinen Eltern.
„Ich hab’s ja geahnt. Robert mit Susan zusammenzuspannen, konnte nicht gut gehen. Susan ist ne Kratzbürste. Mama, so blamiert man keine Gäste!“, sagte er vorwurfsvoll. Gwendolyn lächelte freundlich.
„Warte es ab, mein Junge, warte es ab“, beruhigte sie ihren ältesten Sohn. „Ich glaube, Robert hat mehr Erfolg mit ihr als Roger O’Malley, glaub’ mir“, orakelte sie dann.
Robert hatte den Saloon erfolglos abgesucht und wandte sich schließlich an den Wirt.
„Haben Sie Miss Craig gesehen?“
„Miss Craig? Ja, die ist vor einer Viertelstunde rausgegangen. Sie war ganz bleich und sagte, ihr wäre nicht gut. Sie hat ihren Mantel allerdings nicht mitgenommen. Ich habe angenommen, sie wäre durch den anderen Eingang zurückgekommen.“
Robert schüttelte den Kopf.
„Nein, ist sie nicht. Könnte ich meinen Mantel und den von Miss Craig haben?“
„Gewiss.“
Der Wirt gab Bennett die beiden Mäntel. Schon im Hinausgehen zog er seinen Mantel an und nahm den von Susan über den Arm.
Draußen im Garten musste er noch eine ganze Weile suchen, bis er sie endlich schmollend und frierend hinter einem Baum fand.
„Hier steckst du? He, was soll das?“, sprach er sie an.
„Oh, lass du mich zufrieden! Du bist wahrhaftig nicht besser als die anderen! Fast hätte ich es geglaubt! Lass mich allein!“, schnaubte sie.
„Kompliment zu deinem Versteckspiel. Ich habe dich geschlagene zwanzig Minuten gesucht. Mädchen, wenn du dir nicht die Kripilz holen willst, ziehst du das nächste Mal den Mantel an, wenn du schon ausreißt“, sagte er sanftmütig.
„Ach was, ich bin selten … Tschii!“
„So siehst du aus!“, lachte er auf. „Ich habe deinen Mantel mitgebracht – und den ziehst du jetzt bitte an! Komm.“
Widerstrebend ließ sie sich von ihm in den Mantel helfen und drehte sich dann wieder brüsk um.
„Ich finde, du bist mir eine Erklärung schuldig, Susan“, sagte er leise. Sie wollte wieder davonlaufen, aber diesmal bekam er sie rechtzeitig am Arm zu fassen.
„Stopp! Hier geblieben, Miss Craig!“, sagte er und drehte sie mit sanfter Gewalt um. „Gestatte mir die Frage, was so ungewöhnlich daran ist, wenn ein junger Mann einer jungen Dame ein Kompliment über ihre Tanzkünste macht, dass sie gleich davonläuft?“, fragte er.
Sie blitzte ihn wütend an.
„Dieses Kompliment, wie du es nennst, Robert, ist mir schon oft gemacht worden – es ist nur nie ernst gemeint gewesen, wie ich weiß. Wir haben uns lange unterhalten. Denk’ nicht, ich hätte nicht bemerkt, wie ironisch du sein kannst. In Bezug auf meine Tanzkünste vertrage ich nicht sehr viel Spaß, Sir! Und jetzt lass mich endlich allein!“, giftete sie.
„Oh, nein!“, widersprach Robert. „Kommt gar nicht in Frage! Du kannst recht kratzbürstig sein, Susan, aber damit wirst du mich nicht los. Ich weiß, ich kann ironisch sein – aber was ich einer Dame beim Tanz sage, ist ernst gemeint.“
Ohne ihre Gegenwehr zu beachten, zog er sie vorsichtig an sich.
„Darum sage ich es dir noch einmal:“, setzte er dann hinzu, „Du tanzt wunderbar, Susan. Ich habe noch niemals erlebt, dass eine Dame so schön tanzt.“ Er machte eine kurze Pause. „Ich meine es absolut ehrlich, Susan“, sagte er leise. Sie sah auf und entdeckte einen warmen, verständnisvollen Schimmer in seinen Augen. Seine Nähe war ihr lieber, als sie zugeben mochte, und sie gab ihre Gegenwehr auf.
„Das ist nett gesagt, aber schwer zu glauben“, sagte sie dennoch abweisend. Es hörte sich beinahe flehend an. Aber sie ließ es zu, dass er sie umarmte und ihr sanft über das Haar strich.
„Ich bin nicht nur ironisch, sondern auch ganz widerwärtig neugierig. Warum fällt es dir so schwer, mir zu glauben“, fragte er leise. Ein eisiger Luftzug brachte sie dazu, sich dicht an seine Mantelpelerine zu kuscheln. Es war warm dort, und seine Nähe gab ihr eine Sicherheit, die sie bisher nicht gekannt hatte.
„Na gut“, seufzte sie, „da du so penetrant fragst, muss ich es dir wohl erklären. Aber versprich mir eines: Erzähle es niemandem und lach’ bitte nicht darüber!“
„Versprochen.“
„Vor vier Jahren nahm mein Vater mich zum ersten Mal mit auf einen Ball. Einer meiner Tanzpartner war ein junger Captain, der wie ein junger Gott tanzte. Er machte mir das gleiche Kompliment wie du, aber er hatte so einen merkwürdigen Unterton dabei. Wenig später beobachtete ich, wie er mit einigen Kameraden zu mir hinschaute, einige zweideutige Bewegungen machte und dann mit ihnen zu lachen begann. Auf längeren Umwegen fand ich heraus, dass ich mit den Beinen durcheinander geraten war und mit ihm in einer mehr als zweideutigen Position getanzt hatte. Seitdem renne ich davon, wenn mir einer ein Kompliment über meine Tanzkünste macht, weil ich fürchte, ich könnte wieder…“
Sie brach ab und machte sich heftig von ihm frei.
„Ach, wieso erzähle ich dir das eigentlich? Du wirst sowieso nichts Besseres zu tun haben, als das brühwarm …“
Weiter kam sie nicht. Robert hielt sie fest und drehte sie grob zu sich.
„Susan!“, erboste er sich. Er fühlte sich jetzt in seiner Ehre gekränkt. „Es gibt auch bei mir einen Punkt, an dem der Spaß aufhört: Nämlich dann, wenn jemand an meinem Wort zweifelt! Ich habe dir mein Wort gegeben, nichts weiterzuerzählen und dich nicht auszulachen. Ich habe nicht vor, es zu brechen!“, stellte er zornig klar. Susan erschrak. Plötzlich tat es ihr Leid, ihm misstraut zu haben, ja ihn überhaupt so behandelt zu haben.
„Es tut mir Leid, Bob. Entschuldige bitte“, bat sie leise um Verzeihung. Er umarmte sie und zog sie ganz nah an sich.
„Ist gut. Tu’ es nur nie wieder“, erwiderte er sanft. Sie spürte, dass seine behandschuhte Hand vorsichtig eine Träne fortwischte. Sein warmes Lächeln verzauberte das Mädchen.
„Susan, wenn ich nicht fürchten müsste, dass du wieder das Weite suchst, würde ich dich jetzt küssen“, flüsterte er vertraulich. Augenblicklich loderte wieder Zorn in ihren dunkelblauen Augen auf. Sie stemmte die Hände in die Hüften.
„Du Wüstling!“, schalt sie wütend. Sie kam nicht zum Davonlaufen, denn er hielt sie sanft, aber unnachgiebig fest.
„Genau deshalb lasse ich es ja auch“, grinste er jungenhaft. Es hatte ihn einige Beherrschung gekostet, zu unterlassen, was seine Lippen unbedingt tun wollten. Er griff in seine Hosentasche und zog seine Taschenuhr hervor.
„Schon zwanzig vor zwölf“, sagte er. „Ich denke, wir haben genug frische Luft geschnappt. Außerdem willst du bestimmt mit deinen Eltern auf das neue Jahr anstoßen, oder?“
Sie nickte.
„Ist dir jetzt wohler?“, fragte er.
„Ja. Danke, dass ich mit dir reden konnte.“
Er bot ihr den Arm, in den sie sich gern einhakte. Langsam gingen sie zum Festsaal zurück. An der Garderobe half er ihr aus dem Mantel und kehrte mit ihr in den Saal zurück. Am Eingang wartete Gwendolyn Craig schon aufgeregt.
„Mein Gott, wo warst du so lange, Kind?“
„Ihr war nicht gut, Tante Gwendy. Der Wirt hat mir gesagt, sie sei ganz blass und ohne Mantel nach draußen gegangen. Ich habe ihr den Mantel gebracht und wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht. Sie hat sich wieder erholt.“
„Und der Krawall vorhin?“, hakte Gwendolyn mit strengem Blick auf ihre Tochter nach.
„Hängt damit zusammen“, erklärte Robert. „Bei Kreislaufzusammenbrüchen kann so etwas vorkommen, hat mir jedenfalls Onkel Lucas erklärt.“
„Wie bitte?“
„Oh, als ich mit Tom bei Onkel Lucas war, hatten wir das Thema Kreislaufkollaps. Er hat dabei erklärt, dass es bei einem Kollaps durchaus zu so etwas wie Halluzinationen kommen kann. Wer weiß, welche Albtraumgestalten Susan vorhin gesehen hat“, schwindelte der Lieutenant. Gwendolyn nahm das zur Kenntnis.
„Es ist gleich zwölf. Verträgst du schon Sekt, Susan?“
„Vielleicht.“
„Ich bin in ihrer Nähe, Tante Gwendy. Es wird nichts passieren“, versprach Robert. Mit deutlichen Zweifeln im Gesicht brachte Gwendolyn ihrer Tochter und dem Familienfreund den Sekt. Fast im gleichen Augenblick schlug es zwölf Uhr. Der Wirt des Saloons und einige Soldaten löschten rasch die Kerzen im Raum, neben den Kerzenständern postierten sich Soldaten mit brennenden Dochten, um später die Kerzen wieder zu entzünden. Als es dunkel war, stimmte der Kapellmeister das Lied Auld Lang Syne an, in das die Gäste einstimmten.
Susan stand immer noch neben Robert und bemerkte, dass er ganz sanft seinen Arm um ihre Schultern legte. Es war ein wunderbares Gefühl und sie lehnte sich an ihn.
„Danke“, sagte sie leise. „Und ein frohes Neues Jahr.“
„Ein frohes Neues Jahr. Wofür danke?“
„Dafür, dass du mich zurückgeholt hast, und dafür, dass du für mich geschwindelt hast, dass sich die Balken bogen.“
„Für dich würde ich fast alles tun, Susan“, hörte sie ihn leise sagen. „Ich mag dich sehr“, setzte er flüsternd hinzu.
„Noch ist es dunkel, Bobby“, erwiderte sie im gleichen Ton.
„Ist das eine Einladung?“
„Ja.“
Eine weitere Aufforderung war unnötig. Er nutzte umgehend die sich ihm bietende Chance und küsste sie. Als der Wirt wieder Licht machen ließ, ahnte niemand etwas von der soeben angebahnten Romanze zwischen Robert Bennett und Susan Craig. Die Gäste stießen mit den Gläsern an, wünschten sich ein gutes Neues Jahr, sprachen über die Ereignisse des vergangenen Jahres. Gwendolyn Craig sah zu Robert und Susan hinüber und entdeckte einen deutlichen Blick, den die jungen Leute tauschten. Erst das beginnende Feuerwerk, das von den Sprengmeistern der Riley-Garnison veranstaltet wurde, rief sie wieder in die Wirklichkeit zurück.
Als die Gäste vom Feuerwerk in den Festsaal zurückkehrten, sah Richard Craig nachdenklich auf die Riesentorte, die der Wirt mit seinem Chefkoch gerade anschnitt. Die Torte war vierstöckig, auf jedem Stockwerk war eine Ziffer. Sie bildeten zusammen die Jahreszahl 1861.
„Ich werde das dumme Gefühl nicht los, dass dies erst einmal das letzte friedliche Neujahr sein wird“, murmelte Richard pessimistisch. Thomas hörte seinen Vater sinnieren und lachte auf.
„Paps, du bist ein Schwarzseher! Ich glaube nicht, dass die Sezession eine so ansteckende Krankheit ist. South Carolina kann alleine nicht viel ausrichten. Du wirst sehen: In ein paar Monaten ist die Sezession nur noch Geschichte.“
„Oder der Spuk fängt erst richtig an“, unkte Richard. „Was meinst du, Robert?“
„Ich habe mich noch nicht so recht damit befasst“, antwortete Bennett zurückhaltend. Doch dann sprudelte es aus ihm heraus:
„Aber wenn das Beispiel Schule macht – und das werden die kommenden Wochen und Monate zeigen müssen – laufen uns bald sämtliche Sklavenstaaten aus der Union weg, vorausgesetzt, wir hindern sie nicht daran.“
„Muss diese Fachsimpelei sein?“, fragte Gwendolyn Craig erbost. Im Geiste sah sie die Männer schon hitzig diskutierend um die Tische sitzen. Ob es allerdings beim Diskutieren bleiben würde, stand in den Sternen, denn es gab noch immer einige Soldaten und Offiziere aus den Südstaaten in den Einheiten, die ausgesprochen hitzig veranlagt waren. Bevor es zur Saalschlacht kam, musste das Thema Sezession unbedingt beendet werden.
„Meine Güte, Gwendy!“, entfuhr es Richard Craig. „Man muss doch mal über politische Dinge reden! Schließlich leben wir in einer Demokratie.“
„Aber doch nicht ausgerechnet zehn Minuten, nachdem ein neues Jahr begonnen hat, Dick!“, gab Mrs. Craig zurück. Damit ließ sie ihren Mann stehen und bahnte sich einen Weg zum Kapellmeister.
„Tambourmajor Masterson!“, rief sie. Don Masterson drehte sich um.
„Mrs. Craig? Was kann ich für Sie tun?“
„Die Männer fangen an zu fachsimpeln. Tun Sie was dagegen und veranstalten Sie zwei oder drei Tänze Damenwahl, Donald.“
Don Masterson grinste.
„Selbstverständlich, Mrs. Craig“, sagte der Kapellmeister und ließ einen Tusch blasen. Die Gespräche verstummten sofort.
„Ich erbitte der Kameraden geschätzte Aufmerksamkeit! Meine Damen, meine Herren: Drei Tänze mit dem Herrn Ihrer Wahl – Damenwahl!“, rief Masterson.
Zunächst war Stille. Die Damen waren etwas schüchtern. Schließlich machte Gwendolyn Craig den Anfang und forderte Captain Covington auf. Der Bann war gebrochen und die Damen holten sich die Soldaten und Offiziere auf das Parkett – Ende der Politik! Susan Craig war noch unschlüssig, als sie Angela Covington geradewegs auf Robert Bennett zu rauschen sah.
‚Augenblick, werte Dame!‘, dachte sie. ‚Da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden!‘
Sie fasste sich ein Herz und ging die drei Schritte zu ihm.
„Darf ich um diesen Tanz bitten, Robert?“, fragte sie mit hochrotem Kopf.
„Gern, Susan“, erwiderte er lächelnd und ließ sich von ihr auf das Parkett führen. Angela hatte das Nachsehen und tröstete sich mit Richard Craig
Der Ball dauerte bis in den frühen Morgen an. Gegen vier Uhr morgens verabschiedeten sich die ersten Gäste. Um fünf Uhr verließen auch die Craigs und ihr Gast den Festsaal. Gwendolyn und Richard Craig bemerkten, dass zwischen Robert und Susan etwas begonnen hatte, was sie zunächst erschreckte, was sie aber letztlich weder unterbinden wollten noch konnten. Zudem war es Richard nur recht, wenn der Sohn seines besten Freundes sich vielleicht in seine Tochter verliebt hatte.
„Hat es dir gefallen, Robert?“, fragte der Captain a. D. Der junge Mann nickte.
„Ich glaube, ich habe noch kein schöneres Neujahrsfest erlebt“, antwortete er. Er sah Susan an.
„Und schuld daran ist meine so bezaubernde Tischdame“, setzte er hinzu. Sie spürte, dass sie rot wurde. Zu ihrem Glück stoppte die Kalesche in diesem Moment vor dem Haus der Craigs. Die Ankunft entband sie von einer Antwort, die sie im Augenblick noch nicht geben konnte. Der Kutscher stieg vom Bock und öffnete den Wagenschlag. Robert stieg aus und bot Susan die Hand, um ihr beim Aussteigen zu helfen.
„Galant, der junge Mann“, flüsterte Gwendolyn Craig ihrem Mann zu.
Schon wenig später ging Gwendolyn Craig durch das Haus, um die letzten Lichter zu löschen. Als sie Susan eine gute Nacht wünschte, zupfte Susan ihre Mutter am Ärmel.
„Du, Ma … ?“
„Was ist denn?“ fragte Gwendolyn sanft.
„Mama, ich hab’ so ein Gefühl wie Ameisen in Händen und Füßen und schwindlig ist mir auch. Ma, ist das immer so, wenn man einen Menschen sehr gern hat?“
„Zu meiner Zeit war es jedenfalls so“, lächelte die Mutter. „Er gefällt dir wohl, der Robert Bennett, hm?“
„Jaaa! Ach Mom, er hat so hübsche Augen und er sieht so gut aus in der Uniform. Mama, er tanzt einfach hinreißend. Oh, ich hab’ ihn so gern!“
„Dann träum schön von deinem Herzenshelden, mein Kind. Gute Nacht, Spatz.“
„Gute Nacht, Mama“, erwiderte Susan. Ein deutliches, sehr zufriedenes Seufzen mischte sich unter den Gruß.
Ein paar Zimmer weiter wünschte Thomas seinem Freund eine angenehme Nachtruhe.
„Danke, Tom“, erwiderte Robert. „Tommy …“, setzte er dann an.
„Ja?“
„Tom, ich glaube, ich habe mich verliebt.“
„Wie bitte?“ fragte Tom erschrocken. „Was hast du gesagt? Ich habe nicht richtig gehört!“
„Doch, du hast völlig richtig gehört. Ich habe mich verliebt, Thomas – und zwar in deine Schwester Susan“, wiederholte Bennett. „Du hast Recht: Sie kann ein Biest sein, ohne Zweifel – aber ein sehr nettes Biest“, lächelte er versonnen.
„Wenn ich mich recht erinnere, hast du dich nie …“
„Nein, für die dummen Gänse, die du und George mir unterjubeln wollten, gewiss nicht, stimmt. Aber deine Schwester, Tommy, das ist ganz was anderes. Du hast nicht untertrieben, als du sie als Schwan beschrieben hast.“
Thomas grinste über das ganze Gesicht.
„Tut’s weh?“
„Bitte? Mir geht’s prächtig nach diesem wundervollen Abend. Was sollte wehtun?“
„Na, Amors Pfeil!“, lachte Thomas auf. Robert sah ihn verblüfft an, bis Tom auf einen Gegenstand hinter ihm wies. Robert drehte sich um und entdeckte eine Gipsfigur in der Ecke über dem Ofen, die Gott Amor als Putte mit Pfeil und Bogen darstellte. Die Figur schien ihn schelmisch anzugrinsen. Fehlte nur noch, dass Amor den Daumen hob, um anzuzeigen, dass er wieder einmal mitten ins Schwarze getroffen hatte. Gott Amor hatte zugeschlagen …
Kapitel 2
Colonel Bennetts Regiment
Pobert blieb noch zehn Tage nach Neujahr in Topeka, dann machte er sich auf den Weg nach Fort Randall, wo sein Vater und seine Geschwister auf ihn warteten. Tom hatte noch länger Urlaub und würde Anfang Februar nachkommen. Als Robert am 15. Januar 1861 nach Fort Randall zurückkehrte, glaubte er, diese zehn Tage müssten für immer einen besonderen Platz in seiner Erinnerung haben. Ganz besonders die wundervolle Schlittenfahrt mit Susan … Ihm wurde noch ganz warm, wenn er daran dachte.
Die Armeekalesche, die ihn von der Postkutschenstation abgeholt hatte, passierte das Tor und stoppte dann so hart, dass der junge Mann aus seinen Träumen gerissen wurde. Er stieg steifbeinig aus und ließ sich vom Fahrer sein weniges Gepäck heruntergeben. Die Tür des Kommandantenbüros öffnete sich und Lieutenant-Colonel Frederick Bennett trat heraus. Er blinzelte in die ebenso strahlende wie tief stehende Wintersonne. Robert war versucht, sofort zu ihm hinzustürzen und ihn zu begrüßen, wie es sich für einen Sohn gehörte, der nach vier Jahren Abwesenheit heimkehrte, aber er besann sich rechtzeitig. Er war in Uniform, betrachtete sich also als im Dienst befindlich und hatte sich entsprechend zu verhalten. Sein Vater war Soldat vom Scheitel bis zur Sohle und erwartete von einem Soldaten ein militärisches Verhalten. Es war jetzt nachmittags kurz nach drei Uhr, also noch Dienstzeit. Robert winkte einen Soldaten herbei, drückte ihm seine Tasche in die Hand und ging dann zur Kommandantur. Unten an der zweistufigen Treppe blieb er stehen, stand stramm und salutierte, wie man es ihm auf West Point beigebracht hatte.
„Second-Lieutenant Robert Bennett meldet sich zum Dienst, Sir!“
„Danke, Lieutenant Bennett. Melden Sie sich beim Quartermaster-Sergeant. Er wir Ihnen Ihr Quartier zuweisen. Ich erwarte Sie zur Eintragung in die Regimentsstammrolle um vier Uhr. Wegtreten!“, antwortete Frederick Bennett im selben militärischen Tonfall. Robert salutierte erneut, sein Vater erwiderte den Gruß. Der Lieutenant drehte auf dem Absatz um und marschierte zu dem Soldaten zurück, der mit seiner Tasche erwartungsvoll neben der Kutsche stand.
„Trooper, begleiten Sie mich zum Quartermaster-Sergeant!“, forderte Robert den Mann auf.
„Ja, Sir! Darf ich vorangehen, Sir?“
Robert sagte nichts, sondern machte nur eine auffordernde Handbewegung.
„Soll ich, Sir?“
„Ja, Trooper, nun gehen Sie schon!“
Der Trooper ging voraus und brachte den Lieutenant zu einem am nördlichen Wehrgang gelegenen Blockhaus. An der Tür war ein Holzschild angebracht, auf dem in weißen Buchstaben Quartermaster-Sergeant geschrieben stand. Der Trooper klopfte an und öffnete die Tür, ohne eine Antwort abzuwarten.
„Sir, der neue Lieutenant ist da“, meldete er Robert an.
„Danke, Elliot“, kam es von drinnen. Elliot machte eine einladende Handbewegung und Robert trat ein.
„Second-Lieutenant Robert Bennett meldet sich zum Dienst und möchte sein Quartier beziehen“, sagte er.
„Willkommen, Sir. Ich bin Quartermaster-Sergeant Van Dyke. Das ist Trooper Elliot. Ich habe eine gute Stube für Sie reserviert. Elliot wird Ihr Gepäck gleich rüberbringen. Sie haben Stube fünfzehn, direkt neben Ihrem Bruder, Sir. Wenn Sie einen Burschen brauchen, empfehle ich Trooper Elliot, Sir.“
Van Dyke reichte Robert den Stubenschlüssel.
„Danke, Mr. Van Dyke. Ich werde mich zunächst einrichten. Wie ist die allgemeine Lage hier?“