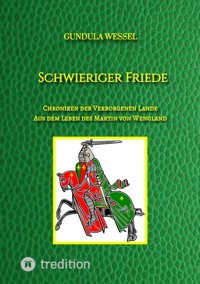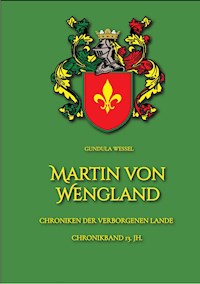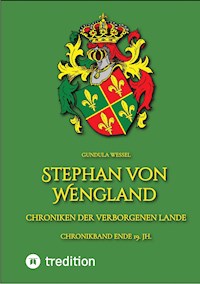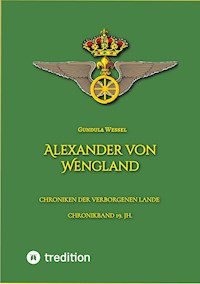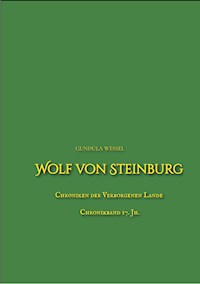
4,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Chroniken der Verborgenen Lande
- Sprache: Deutsch
Unmittelbar vor Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges tritt Wolf von Steinburg in die Dienste Graf Tillys, General der katholischen Liga. Wolf ist der Nachkomme der Könige Wenglands, doch die Familie ist verarmt, das Königreich lange verloren und in seine Grafschaften aufgelöst. Der brutale Krieg führt den jungen Mann kreuz und quer durch das Reich Kaiser Ferdinands II. Im Heer des Kaisers findet Wolf auch Männer, die so wie er aus Wengland stammen und sich ein Wiedererstehen des territorialen Wengland wünschen. Als Wolf in Stadtlohn der schönen Katharina von Braunsberg begegnet, verliert er sein Herz. Doch Katharinas Vater hat andere Pläne ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gundula Wessel
Chroniken der Verborgenen Lande
Wolf von Steinburg
Chronikband 17. Jahrhundert
© 2022 Gundula Wessel
Wolf von Steinburg
Chroniken der Verborgenen Lande
Chronikband 17. Jh.
Autor: Gundula Wessel
Umschlaggestaltung, Illustration: Gundula Wessel
ISBN Softcover: 978-3-347-64986-6
ISBN Hardcover: 978-3-347-64987-3
ISBN E-Book: 978-3-347-64998-9
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Des Feldherrn Page
Kapitel 2
Die Last des Krieges
Kapitel 3
Verhandlungsgeschick
Kapitel 4
Die Rose von Stadtlohn
Kapitel 5
Eine Frage der Ehre
Kapitel 6
Hochzeit
Kapitel 7
Wallenstein
Kapitel 8
Dreibeck
Kapitel 9
Kerkerliebe
Kapitel 10
Flucht
Kapitel 11
Rückkehr
Kapitel 12
Kampf um Dreibeck
Kapitel 13
Quartiergerangel
Kapitel 14
Hahnenkampf
Kapitel 15
Ruhe nach dem Sturm
Kapitel 16
Der Stadthauptmann
Kapitel 17
Erinnerungen
Kapitel 18
Machtkampf mit dem Stadtrat
Kapitel 19
Erkenntnisse
Kapitel 20
Vorratsplanung
Kapitel 21
Dunkle Wolken am Horizont
Kapitel 22
Alte Gulden
Kapitel 23
Prager Geheimnisse
Kapitel 24
Kaiserliches Gericht
Kapitel 25
Herrenduell
Kapitel 26
Der Fürst von Wengland
Kapitel 27
Heimkehr
Kapitel 28
Das Geheimnis der Lilie
Kapitel 29
Abrechnungen
Kapitel 30
Geschenke
Glossar
Prolog
Man schrieb das Jahr 1617. Wenn man die Landkarten dieses Jahres mit denen des 13. Jahrhunderts verglich, fiel – abgesehen davon, dass die modernen Karten erheblich präziser waren – eine gravierende Änderung auf: Die Königreiche Wengland und Wilzarien existierten nicht mehr. Sie waren einfach verschwunden, in das Heilige Römische Reich Deutscher Nation eingegliedert. Doch es gab noch die Grafschaften und Fürstentümer, aus denen diese Länder bestanden hatten. Wie war es dazu gekommen?
Wengland war ein glückliches Königreich, wenn es auch nicht immer mit vollkommenem Frieden gesegnet war. Nachdem König Ulrich I. nach fünf Jahren wilzarischer Besetzung mit Hilfe des Herzogs von Scharfenburg im Jahr 1264 eine genügend große Armee gegen König Ranador von Wilzarien und sein als unbesiegbar geltendes Heer hatte senden können und die Wilzaren tatsächlich vernichtend geschlagen waren, war Wengland um die Provinz Aventur und um ein Problem reicher. Das Problem bestand darin, dass weder Ranadors direkter Erbe Sevur noch dessen Nachfolger diese Provinz aufgeben wollten.
Trotz eines starken Friedenswillens des wenglischen Königs kam es alle paar Monate zu ernsthaften Grenzkonflikten mit dem Nachbarn Wilzarien. Diese Grenzkonflikte waren aber die einzigen kriegerischen Auseinandersetzungen, denen sich Wengland ausgesetzt sah. Mit den anderen Nachbarn bestanden unter dem friedfertigen König Ulrich und seinen Erben nicht nur freundschaftliche Beziehungen, sondern zeitweise sehr enge familiäre Verbindungen. So hatte eine Tochter Ulrichs den Fürsten von Breitenstein geheiratet, sein jüngerer Sohn Berthold hatte die Grafschaft Löwenstein geerbt und war in Scharfenburg ein geachteter Graf und Richter, der die Tochter des Markgrafen von Rebmark heiratete. Seit dieser Zeit entspannte sich das Verhältnis des wenglischen Königshauses zum Rebmärker Grafenhaus, das immer noch die Herzöge von Scharfenburg stellte. In den internationalen Beziehungen standen nur der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und der König von Wilzarien nicht freundschaftlich zu Wengland. Der König von Wilzarien eben wegen der ehemals wilzarischen Provinz Aventur, der Kaiser wegen der unabhängigen Existenz des Königreichs Wengland, das allen Werbeversuchen widerstand, sich ins Kaiserreich eingliedern zu lassen.
Im Innern hatte Wengland Frieden und einen Wohlstand, der mit dem seiner Nachbarstaaten nicht zu vergleichen war. Wenglands Bauern und Bürger arbeiteten zuerst für ihren eigenen Geldbeutel, dann erst für König und Vaterland. Bereits seit den Tagen Martins II. galt ein einheitlicher Steuersatz von zehn Prozent aller Einnahmen der Bürger Wenglands. Niemand, nicht einmal der König oder seine Adligen, waren von diesen Steuern befreit. Diese Steuerpraxis verhinderte die Leibeigenschaft, die in fast sämtlichen Nachbarstaaten Wenglands üblich war, weil damit Fronarbeiten der Bauern und Bürger völlig unterbunden wurden. Kein Bauer musste an die Scholle gebunden* werden, wie es im Heiligen Römischen Reich untertreibend genannt wurde. Ganz gleich, wie hoch der Ertrag war, der Bauer war sicher, dass neun Zehntel seiner Ernte und seiner Viehbestände ihm ganz allein gehörten. Der Geldfluss war regelmäßig und reichlich. Zwar konnten die Bürger wählen, ob sie den Zehnt (in diesem Fall entsprach die Bezeichnung auch den tatsächlichen Abgaben) in Form von Bargeld oder als Naturalleistung erbringen wollten, aber zumeist wurde die Abgabe bar geleistet. Der königliche Schatzmeister – meist war es der Graf von Eschenfels – verwaltete das Staatsvermögen Wenglands, das in den Fundamenträumen der Steinburg aufbewahrt wurde. Um diesen steinernen „Tresor“ wussten nur der Schatzmeister und der König selbst – ebenso, wie um den Weg, der in die Schatzkammer führte.
König Ulrich I. hatte kurz nach seiner Krönung seine Gesetzessammlung, den Codex Rex Wenglandia, in Kraft gesetzt. Neben dem Umstand, dass die dreimonatigen Exerzitien für den Thronfolger nach dem Tod des Königs wegfielen, hatte er die Gerichtsbarkeit in Wengland neu geregelt. Zwar gab es nach wie vor das Adelsgericht, das Streitigkeiten unter Adligen entschied, und die Grafschaftsgerichte, die die Prozesse der Bürger untereinander entschieden und auch zuständig waren, wenn sich Bürger und Adel stritten, aber die Besetzung der Gerichte änderte sich ein wenig. Das Adelsgericht bestand immer noch aus dem Grafenrat des Reiches, aber Ulrich verlangte von den Grafen, dass sie die Gesetze kannten und danach richteten – und nicht nach eigenem Gutdünken, wie das früher der Fall gewesen war. Die Gerichte der Grafschaften waren ursprünglich nur Sache des Provinzgrafen gewesen. Nun gab der Provinzgraf die Rechtsprechung an juristisch geschulte Leute ab, die nicht einmal zwangsläufig von Adel sein mussten. Voraussetzung für die Besetzung der Richterstelle war aber, dass der Kandidat lesen und schreiben konnte und die Gesetze Wenglands kannte. Sehr häufig wurden die Grafschaftsgerichte deshalb durch Geistliche besetzt. Um der Gefahr vorzubeugen, dass die geistlichen Richter statt des Gesetzbuches die Bibel zu Hilfe nahmen und mehr nach göttlichem Ratschluss als nach den Gesetzen des Landes richteten, ließ Ulrich den Richtereid auf den Codex Rex Wenglandia ablegen, den Treueid zum König auf die Bibel. Testamentarisch verpflichtete der König alle seine Nachfolger, diese unabhängige Gerichtsbarkeit zu achten.
König Ulrich I. hatte wie sein Großvater Wengland lange regiert. Die fünfundzwanzig Jahre seiner Herrschaft stellten eine Blütezeit des Handels und des Handwerks dar. Bauern, Händler und Handwerker machten Wengland reich. Diesen Reichtum behielt das Land aber nicht unbedingt für sich selbst, sondern gab ärmeren Nachbarn davon ab. Diese Praxis bewirkte, dass im Ausland kein rechter Neid gegen die Wengländer aufkam.
Aber es gab einen Feind, der auch Wengland unprovoziert angriff; einen Feind, der mit härterer Konsequenz zuschlug, als die Wilzaren es je getan hatten, der mehr Wengländer tötete, als sie in allen Kriegen gestorben waren, die Wengland in seiner nun fast fünfhundertjährigen Geschichte als Königreich hatte führen müssen; ein Feind, dem das wenglische Heer hilflos gegenüberstand, weil er mit Schwert und Lanze nicht zu bekämpfen war: Die Pest!
Die grauenhafte Pestepidemie, die in den Jahren 1348 bis 1352 fast ganz Europa überflutete und auf dem gesamten Kontinent etwa ein Drittel der Bevölkerung dahinraffte, wütete in Wengland besonders schlimm. Beinahe sieben Zehntel der wenglischen Bevölkerung wurden ein Opfer der entsetzlichen Krankheit, gegen die man kein Mittel hatte. Als man dahinter kam, dass die Ratten die Pest brachten, gab es nicht wenige, die herzhaft auf König Ulrich fluchten, der persönlich dafür gesorgt hatte, dass den Ratten nicht mit zu viel Härte nachgestellt wurde. Zu sehr hatte er sich daran erinnert, dass es eine Ratte gewesen war, die ihm einmal geholfen hatte, aus wilzarischer Gefangenschaft zu entkommen.
In der stets volksnahen königlichen Familie hatte die Pest schwere Opfer gefordert. Von der einst weit verzweigten Familie lebten 1353 noch der alte König Berthold, König Ulrichs jüngster Sohn, der bereits über achtzig Jahre zählte und Prinz Albert, ein Ururenkel von König Ulrich, der gerade mal sieben Jahre alt* war. Seit König Ulrichs Tod 1290 hatten nicht weniger als sechs Könige auf dem Thron Wenglands gesessen und ihn nach Ulrichs Vorbild verwaltet. Martin III., Ulrichs älterer Sohn, hatte dreißig Jahre regiert, sein Enkel Ulrich II. achtundzwanzig Jahre. Als Ulrich II. als erster wenglischer König 1348 an der Pest starb, beerbte ihn sein Sohn Adolf, starb aber noch im selben Jahr ebenfalls an der Pest. Rudolf II., Ulrichs II. jüngerer Bruder, erbte den Thron und starb nach wenigen Wochen an der Pest; ebenso waren seinem Sohn Simon nur wenige Wochen als König vergönnt, der kurz nach dem Jahreswechsel 1348/49 König wurde, denn nur wenige Monate nach der Thronbesteigung fiel er der Pest zum Opfer. Weil Simons II. Ehe mit Bettina von Bravadur kinderlos geblieben war, übernahm Mitte 1349 Berthold, Ulrich I. jüngerer Sohn, mit 82 Jahren den Thron, wofür er aus Scharfenburg zurückkehrte. Sein eigener Sohn Maximilian erlag nur Tage nach der Krönung seines Vaters der Pest, dessen Frau Carla starb Anfang 1350. So blieben nur König Berthold und sein dreijähriger Enkel Albert von der Familie Wengland-Steinburg übrig.
Wengland war ausgeblutet, denn praktisch alle Familien waren in dieser Weise von der Pest betroffen. Die Ernte war mangels Ernteleuten nicht eingefahren, es konnte nichts mehr ausgesät werden, es herrschte bittere Not in dem vorher so glücklichen Land. In seiner Not wandte König Berthold sich 1352 an den Kaiser Karl IV. und bat ihn flehentlich um Hilfe. Kaiser Karl sandte einen Unterhändler, der mit weit reichenden Vollmachten ausgestattet war. Der Unterhändler, Fürst Michael von Breitenstein, selbst mit dem wenglischen Königshaus verwandt, hatte viel Verständnis für den alten, bereits vom Tode gezeichneten König. Aber der Kaiser sah in Wenglands Hilferuf die Gelegenheit, sich dieses Reich endlich untertan zu machen. So hatte er Fürst Michael die unmissverständliche Weisung mit auf den Weg gegeben, dass Wengland als unabhängiger Territorialstaat verschwinden solle, in seine dreizehn Provinzen aufzulösen sei und dem Reich einverleibt werden solle. Um dies zu erreichen, bezog sich der Kaiser auf ein ebenso unbestätigtes wie unwahres Gerücht, dass Berthold gar nicht Ulrichs Sohn war, sondern aus einer unehelichen Liaison zwischen Königin Adelheid und Graf Siegmar von Aventur entsprungen war. Da die wenglische Unabhängigkeit an einen König aus dem Hause Wengland-Steinburg gebunden war, war dies die Möglichkeit eben diese Unabhängigkeit in Frage zu stellen.
Michael war darüber ausgesprochen unglücklich, weil er den Schutz durch den bedeutenden, mächtigen und militärisch starken, aber doch so friedfertigen Nachbarn Wengland wesentlich mehr schätzte, als die Lippenbekenntnisse des weit entfernten Kaisers, der von Prag oder Luxemburg aus noch nie diese schöne und friedliche Region besucht hatte. Aber des Kaisers Wille war unabänderlich. So, wie er die Mark Brandenburg dem Reich einverleiben wollte, wollte er auch Wengland haben.
König Berthold nahm die Bedingungen des Kaisers zur Kenntnis. Es war unerheblich, dass er das Gerücht der unehelichen Herkunft durchaus widerlegen konnte. Er konnte die Bedingungen nur akzeptieren oder einen Krieg mit dem Kaiser riskieren, der sich ohnehin auf den Weg nach Italien machen wollte, um seine Ansprüche dort durchzusetzen. Wengland hätte dann auf seinem Weg gelegen. Berthold war klar, dass er eine Auseinandersetzung mit dem Kaiser und dessen mächtigem Vasallenheer verlieren würde. Schweren Herzens nahm er die Bedingungen an.
Am 21. November 1353, nur wenige Tage nach der Vertragsunterzeichnung verstarb König Berthold an Altersschwäche und – wie die meisten seiner noch lebenden Untertanen behaupteten – nicht zuletzt an gebrochenem Herzen, dass er das hatte aufgeben müssen, was fünfhundert Jahre zuvor mühsam erworben worden war: Wenglands Königskrone. Auf Bitten von Fürst Michael und der wenglischen Grafen gestand Kaiser Karl zu, Berthold als König von Wengland im Dom zu Steinburg beizusetzen. Fürst Michael erwies dem toten König noch einen letzten Dienst, indem er Königskrone, Amtskette, Schwert und Zepter beiseite schaffte und sie im Felsentresor unter der Steinburg deponierte, statt sie Berthold mit ins ungeschützte Grab zu geben. Zu groß war die Gefahr, dass der Kaiser sie vernichtete oder zweckentfremdete. Es war Bertholds letzter Wille gewesen, dass sie eines Tages wieder einen freien König Wenglands zieren würden.
Doch bis dahin schien der Weg unendlich, nachdem der Kaiser die Grafen Wenglands zu reichsunmittelbaren Fürsten erklärte und sie damit vom Hause Wengland-Steinburg trennte. Fürst Michael wurde als Thronverwalter des kleinen Albert eingesetzt, der nun nur noch Anspruch auf den Titel des Grafen von Steinburg hatte. Wenn die Grafen von Steinburg auch immer noch das edle Blut der Könige Wenglands hatten: Sie waren zur Bedeutungslosigkeit im Chor der Reichsfürsten verurteilt. Durch eine Ungeschicklichkeit zur Zeit der Reformation gingen die Grafen von Steinburg sogar zeitweilig der Reichsunmittelbarkeit verlustig und gewannen sie nur mühsam zurück. Fortan hielten sich die Grafen von Steinburg in ihrer politischen Meinungsäußerung sehr zurück und traten nach außen kaum noch in Erscheinung, um nicht den geringen Erfolg wieder in Frage zu stellen. Aber das Volk der Grafschaft liebte seine Grafen nach wie vor, denn so, wie sie als Könige gerecht gewesen waren, waren sie es auch als Grafen.
Wilzarien, das immer und immer wieder bei der Rückeroberung Aventurs erfolglos gewesen war, sah nach der Zerschlagung Wenglands seine Chance, sich die verlorene Provinz zurückzuholen – und scheiterte bitter. Doch diesmal waren es nicht Wengländer, die Wilzarien besiegten und es wieder freigaben, sondern Vasallenheere des Kaisers, die Wilzarien ebenso wie Wengland in seine Fürstentümer zerstückelten. Aber Wilzarien hatte noch mehr zu leiden. Wengland war ein christliches Land gewesen, Wilzarien verehrte immer noch die alten Götter, die die Wangionen – der ursprüngliche Stamm, der im Zuge der Völkerwanderung in die Verborgenen Lande gezogen war – mitgebracht hatten. Nach der Eroberung durch kaiserliche Truppen wurde das Land brutal christianisiert, die Ausübung des alten Glaubens unter Androhung der Todesstrafe verboten. In Wilzarien wütete die Heilige Inquisition so heftig, dass die Feuer der Scheiterhaufen kaum noch ausgingen. Aber auch Wengland wurde von der Inquisition nicht mehr verschont. Seine Könige hatten die Inquisitoren nie in ihren Grenzen geduldet, aber jetzt fielen sie auch dort ein und suchten mit Eifer nach Ketzern – und fanden sie auch, wenn sie Erfolge brauchten!
Gerade das nun zu Ende gegangene Jahrhundert war für die Grafschaften Wenglands und die Fürstentümer Wilzariens besonders grausam gewesen. Neue Glaubenslehren und die Gegenreformation der alten katholischen Kirche hatten schlimme Spuren hinterlassen. Die Grafschaften des ehemaligen Wengland waren mehrheitlich katholisch geblieben und hatten dafür mit den eher dem Protestantismus zuneigenden Fürsten Breitensteins öfter heftigen Streit gehabt. Doch welcher Zusammenhalt unter den Ex-Wengländern noch immer herrschte, wurde deutlich, wenn das evangelisch-lutherische Oberwengland einer benachbarten katholischen Grafschaft gegen protestantische Angriffe von außen zu Hilfe kam und wenn katholische Grafschaften umgekehrt aushalfen.
Nun war ein neues Jahrhundert angebrochen, aber ob es Frieden bringen würde, war ungewisser denn je. Man rechnete bereits mit einem europäischen Krieg in Glaubensfragen. Jeder, der sich in Europa mit Politik befasste, erwartete einen großen Konflikt am westlichen Rand des Reiches, in den Niederlanden. Ein Teil der Niederlande hatte sich nach langem und zähem Kampf gegen Spanien 1609 endlich selbstständig machen können und einen Waffenstillstand für zwölf Jahre erreicht. Aber niemand von politischer Bildung in Europa erwartete, dass Spanien auch nur einen Augenblick länger mit der Rückeroberung seiner wertvollen Provinzen an der Nordsee warten würde, als der Waffenstillstand es dazu zwang. Aber als der Konflikt dann kam, brach er ganz woanders aus, als erwartet: am entgegengesetzten Ende des Reiches, in Böhmen.
Kapitel 1
Des Feldherrn Page
Es war im Frühjahr 1617, als ein schmächtiger Jüngling beim Grafen Tilly, einem Feldherrn des Herzogs von Bayern, vorsprach und um Aufnahme in dessen Dienste bat. Johann von Tilly ließ den Jungen eintreten.
„Wer bist du und was willst du?“, fragte der ältere General den Jungen.
„Ich bin Wolf von Steinburg und möchte in Euer Liebden Felddienste treten“, erwiderte der Junge mit einer Stimme, die den Stimmbruch knapp überstanden hatte. Wenn sie sich so weiterentwickelte, wie es jetzt den Anschein hatte, würde es einmal eine volle, recht angenehm klingende Stimme sein. Tilly betrachtete den Knaben genau. Wolf war lang aufgeschossen. Arme und Beine wirkten noch viel zu lang ohne eine entsprechende Muskulatur. Unter einem ungeordneten dunkelbraunen Haarschopf, der sehr kurz geschnitten war, fand der Graf ein noch jungenhaftes Gesicht, das die ersten Ansätze von Bartwuchs zeigte. Im völligen Gegensatz zu der noch jugendlichen Erscheinung standen die braunen Augen, die eine Ernsthaftigkeit ausstrahlten, die der General selten an einem so jungen Menschen gesehen hatte. Aber es war noch mehr darin: Intelligenz und Wissbegierde. Solch einen Augenausdruck kannte Tilly nur von einigen Mönchen. In der Regel waren es Jesuiten gewesen, die ihn so angesehen hatten. Er hätte sich den Jungen gut in einer Mönchskutte vorstellen können – aber seltsamerweise genauso im Lederkoller eines Musketiers.
„Wolf – du weißt, dass ich ein General der katholischen Liga bin, ein Feldherr des Herzogs von Bayern?“, fragte Johann von Tilly, um sicherzugehen, dass der Junge sich nicht in der Adresse geirrt hatte und eigentlich zum Kloster Andechs oder Engelberg wollte.
„Ja, Euer Liebden“, bestätigte Wolf in fast militärischem Tonfall.
„Willst du denn Soldat werden?“, hakte Tilly nach.
„Genau, Euer Liebden.“
Tilly schmunzelte vergnügt, als er an die nicht vorhandenen Muskeln dachte.
„Wenn ich dich so betrachte, Wolf von Steinburg, scheinst du mir für die schwere Arbeit eines Kriegsknechtes nicht recht geeignet“, gab der General zu bedenken.
„Meine Vorfahren waren berühmte Ritter, Euer Liebden. Sie alle haben irgendwann mit dem Gebrauch der ritterlichen Waffen begonnen – und bestimmt ist keiner von ihnen in einer Rüstung oder als Muskelpaket geboren“, erwiderte Wolf mit einem erstaunlichen Selbstbewusstsein. Graf Tilly lachte auf.
„Vielleicht hast du die Muskeln noch nicht, aber auf alle Fälle hast du das Herz eines Löwen, mein Junge“, sagte er lachend. „Aber bevor ich ja sage, möchte ich wissen, was deine Eltern dazu sagen, dass du mir dienen willst.“
„Ich kann sie nicht fragen, Euer Liebden, denn meine Eltern leben leider nicht mehr“, erwiderte der Junge mit einem mühsam beherrschten Anflug von tiefer Trauer.
„Woran sind deine Eltern gestorben und wer waren sie?“, fragte Tilly nach.
„Mein Vater war Graf Karl von Steinburg, meine Mutter Gräfin Juliane von Steinburg. Als ich sieben Jahre alt wurde, gaben meine Eltern mich zur Schule in das Kloster Wachtelberg. Vor zwei Jahren erhielt ich die Nachricht, dass meine Eltern umgebracht wurden. Es gibt keine Erklärung, weshalb meine Eltern sterben mussten. Wir sind arm, bei uns gab es nichts zu stehlen. Mein Vater war zwar ein reichsunmittelbarer Graf, aber er war ohne Einfluss. Sein Tod konnte niemandem nützen, der meiner Mutter schon gar nicht. Der oder die Mörder wurden nicht gefunden. Aber eines Tages will ich meine Eltern rächen, Euer Liebden“, erwiderte der Junge mit mühsamer Selbstbeherrschung. Er war kurz davor, in Tränen auszubrechen. Tilly nickte.
„Ich nehme dich an, mein Junge. Du wirst mir zunächst als Page dienen und dann sehen wir weiter.“
Wolf trat also in die Dienste des katholischen Generals, der die Truppen der katholischen Liga befehligte. Die Gründung dieser Vereinigung von katholischen deutschen Fürsten war eine Antwort auf die protestantische Union evangelischer Fürsten des Reiches, welche zur Verteidigung der Religionsfreiheit der Protestanten gegründet worden war. Maximilian von Bayern, das Haupt der Liga, war ein Eiferer für den katholischen Glauben, und es hieß, dass seine Besitzungen am wenigsten vom Protestantismus erfasst waren, der seit Luthers Reformation hundert Jahre zuvor in Europa heftig um sich griff. Die katholische Liga sollte den Katholiken ihre Rechte sichern – und nach Möglichkeit verirrte Schäfchen zum ihrer Ansicht nach rechten Glauben zurückführen, nötigenfalls mit Gewalt. Diese Aufgabe bedingte eine gute Ausbildung und Ausrüstung; Dinge, die der reiche Herzog von Bayern gut finanzieren konnte.
Graf Tilly stellte bald fest, dass sein neuer Page in seiner knappen Freizeit bei einem der Fechtmeister seiner Truppen Unterricht nahm. Der Unterricht fand meist in einer abgelegenen Ecke im Hof statt, die Tilly vom Fenster seines Arbeitskabinetts aber einsehen konnte. Er konnte nicht umhin, die Zähigkeit des Jungen zu bewundern, der offensichtlich keinen größeren Wunsch hatte, als fechten zu lernen. Es war auch deutlich, dass Wolf kein ahnungsloser Anfänger war. Er brachte gute Voraussetzungen mit, die der Fechtmeister vervollkommnete.
Schon im Jahr darauf, am 23. Mai 1618, geschah in Prag Entsetzliches: Die protestantischen Stände und Fürsten revoltierten gegen die Verletzung des Majestätsbriefes von 1609, in dem ihnen Religionsfreiheit und ständische Privilegien zugesichert worden waren. Jetzt, im Frühjahr 1618, hatten die kaiserlichen Statthalter Martinitz und Slavata einen Erlass unterschrieben, der eben diese Privilegien zu bedrohen schien. Der Erlass bezog sich darauf, in zwei zweifelhaften Fällen, die beide zu Lasten von Protestanten entschieden waren, jeden Widerstand im Keim zu ersticken und Unbotmäßige gleich hinter Gitter zu bringen. Der Erlass war kaiserlich gebilligt. Tatsächlich war eine Reihe von Leuten, die die Entscheidung nicht hinnehmen mochten, eingesperrt worden. Die Protestanten, an der Spitze ihr Wortführer Graf Thurn, fühlten sich in ihren Privilegien verletzt, durch die katholische Obrigkeit herausgefordert und handelten mit ähnlicher Grobheit: Graf Thurn und seine Getreuen brachen zornentbrannt mit solcher Macht in den Hradschin ein, die Prager Burg, auf der die kaiserlichen Statthalter residierten, dass die Wachen sie nicht aufhalten konnten. Den Statthaltern wurde ihr Erlass vorgehalten und die Herren samt ihrem Schreiber aus dem Fenster befördert. Zwar bremste ein unter dem Fenster befindlicher Misthaufen den tiefen Sturz der kaiserlichen Statthalter, aber der Würde der hohen Herren diente das Bad im Mist gewiss nicht. Damit nicht genug, feuerten die Aufständischen noch einige Schüsse auf die Fliehenden ab, die jedoch zu deren Glück nicht trafen.
Der Prager Fenstersturz von 1618 wäre sicher nur eine Episode mit unangenehmen Folgen für die unmittelbar Beteiligten gewesen, wären Graf Thurn und die mehrheitlich protestantischen Adligen nicht noch einen Schritt weitergegangen: Sie wollten keinen König, der den Majestätsbrief verletzte. So erklärten sie Erzherzog Ferdinand, den im Vorjahr auch von ihnen selbst gewählten König, Neffe des Kaisers und dessen voraussichtlicher Nachfolger auf dem Thron des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, für abgesetzt und seiner böhmischen Rechte für ledig. An seiner Stelle wählten sie den jungen Kurfürsten Friedrich von der Pfalz zu ihrem König, einen erklärten Protestanten calvinistischer Prägung. Dieser Vorgang war der Tropfen, der das übervolle Fass der Konflikte in Europa zum Überlaufen brachte.
Mit dem Titel des Königs von Böhmen war die Kurfürstenwürde im Reich verbunden. Gerade der König von Böhmen konnte ausschlaggebend sein, welcher Konfession der nächste Kaiser sein würde. Mit einem katholischen König von Böhmen wäre die Wahl eines Habsburgers auf den Kaiserthron sicher gewesen. Mit einem protestantischen böhmischen Kurfürsten wäre der nächste Kaiser vielleicht protestantisch, mit Sicherheit aber nicht aus dem Hause Habsburg gewesen. Das konfessionelle und in diesem Fall auch politische Gewicht des böhmischen Thrones ergab sich daraus, dass die drei geistlichen Kurfürsten des Reiches – die von Köln, Mainz und Trier – Katholiken waren, während drei der weltlichen Kurfürsten – von Sachsen, Brandenburg und der Pfalz – protestantisch waren. Allein an der Person des böhmischen Königs entschied sich damit, wie die Stimmen bei der bevorstehenden Kaiserwahl verteilt sein würden. Und diese Wahl schien nicht mehr fern, denn Kaiser Matthias war 61 Jahre alt und alles andere als gesund.
An der Person des künftigen Kaisers würde aber das Machtgefüge in Europa hängen. Und so wurde aus dem lokalen Aufstand ein Krieg, der sich immer mehr zu einem europäischen Flächenbrand ausweitete, bei dem es um völlig andere Interessen ging, als um die Frage, ob Protestanten Holz von katholischen Gütern nehmen durften.
Erzherzog Ferdinand erhielt zunächst Hilfe von seinen Verwandten in den spanischen Niederlanden, die ein Heer schickten. Die aufständischen Böhmen fanden Hilfe bei der Protestantischen Union und bei dem Berufsfeldherrn Mansfeld, der seine Truppen anbot. Mansfelds Truppen eroberten Pilsen und sicherten damit zunächst den Bestand des protestantischen Königreichs Böhmen. Ferdinands spanische Verwandte begannen, sich von ihm abzuwenden und waren nahe daran, einen anderen Kandidaten für den Kaiserthron zu favorisieren. Aber Kaiser Matthias starb am 20. März 1619, zu früh, um einen neuen Kandidaten zu bestimmen. Die Fürsten des Reiches weigerten sich auch beharrlich, Friedrich von der Pfalz als König von Böhmen anzuerkennen. So wurde der ursprüngliche katholische Kandidat Ferdinand zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gewählt.
Nach der Wahl wollte Ferdinand den böhmischen Aufstand rasch beenden, aber dazu benötigte er mehr Hilfe als bisher. Kaiser Ferdinand hatte nicht die Mittel, seine böhmischen Rechte aus eigener Kraft zu sichern. Er fand in Herzog Maximilian von Bayern einen Helfer, der sowohl die Truppen als auch die Mittel hatte, dem vertriebenen König von Böhmen beizustehen. Maximilian beauftragte seinen Feldherrn Graf Johann von Tilly mit der Führung der Truppen der katholischen Liga, um die Protestanten in Böhmen und ihren nachgewählten König zu bekämpfen.
Wolf war nun zwei Jahre Page bei Johann von Tilly. Aus dem schlaksigen Jungen war ein junger Mann geworden, der sich als entwicklungsfähig und gelehrig erwiesen hatte. Graf Tilly hatte Gefallen an dem klugen, gebildeten und sehr ernsthaften Wolf. Er hielt nichts vom Wettsaufen und Huren, der Lieblingsbeschäftigung der Soldaten in den Lagern. Niemand konnte behaupten, ihn je beim Plündern gesehen zu haben. Wenn der General seinen Pagen mit dem Fouragieren* beauftragte, gab es wahrscheinlich ein Hühnerbein weniger, aber dafür war es den Bauern nicht gewaltsam abgepresst. Es gab Soldaten in Tillys Heer, die von dieser Art des Fouragierens nichts hielten, aber sooft jemand Streit mit Wolf suchte, musste er feststellen, dass sich unter dem stets gepflegten Äußeren des jungen Mannes nicht nur ein Kämpferherz, sondern auch die kräftigen Muskeln eines Kämpfers verbargen. Wenn andere sich in Kneipen und Hurenhäusern amüsiert hatten, hatte Wolf geduldig an seiner fehlenden Kraft gearbeitet. Er hatte Holz in einer Menge gehackt, dass auf Tillys Schloss der Heizvorrat für zwei Jahre nicht ausgehen würde. Er hatte Feldsteine mit dem Hammer zu Geröll zerbröselt. Tillys Schmied hatte Wolf ein Paar handliche Gewichte mit Griffstangen aus Eisen gemacht, mit deren Hilfe Wolf die Armmuskeln gezielt trainieren konnte. Mit dem Fechtmeister hatte er lange Waldläufe gemacht und galt als ausdauernder Läufer und erstklassiger Fechter. Wolf suchte zwar nie Streit, aber er ging auch keinem aus dem Wege, wenn er gefordert wurde. Schon bald hatte er sich den Ruf eines tapferen Soldaten und geschickten Fechters erworben.
Am 23. Juli 1620 überschritt Tillys Ligaheer die Grenze nach Österreich und kämpfte sich nach Prag durch, das böhmische Heer vor sich hertreibend. Anfang November 1620 hatten die Böhmen und die mit ihnen verbündeten Ungarn die Umgebung von Prag erreicht. Aber Herzog Maximilians Ligaheer unter Tilly war ihnen dicht auf den Fersen. Durch den Feuerschein von geplünderten Häusern sichteten Soldaten des Ligaheeres die böhmische Armee, die sich auf dem Weißen Berg verschanzte, einem Kalkberg, der Prag überragt und – hinter einem Flüsschen gelegen – für eine passable Verteidigungsstellung dienen konnte. Das Ligaheer war gewarnt, während die Protestanten von der Nähe ihrer Gegner noch nichts ahnten.
An einem nebligen 8. November war Wolf morgens mit einigen Leuten auf Kundschaft. Sie stöberten einige ungarische Reiter auf, die eilig ins Lager der Böhmen flüchteten und Alarm gaben. Fast gleichzeitig griffen die Ligatruppen unter heftigem Artilleriefeuer an. Zunächst sah es so aus, als würden Tillys Truppen auf dem linken Flügel scheitern, da sie die Stellung, die sie angriffen, nicht nehmen konnten und immer wieder zurückgeschlagen wurden. Unter den immer wieder anrennenden Ligasoldaten am linken Flügel war auch Wolf, der in dem verzweifelten Stürmen keinen rechten Sinn sehen konnte, kostete es doch mehr als genug Menschenleben. Er wollte seinem Herrn den Vorschlag machen, sich irgendwie von hinten heranzumachen, um die Seele des Widerstandes am linken Flügel, Christian von Anhalt junior, außer Gefecht zu setzen, den Sohn des kurfürstlich-pfälzischen Kanzlers Christian von Anhalt senior. Doch bevor er dazu kam, hatten die Herren eine Kampfpause angeordnet und berieten über das weitere Vorgehen. Nach Stunden der Beratung, als die Protestanten schon glaubten, die Bayern würden keinen weiteren Versuch unternehmen, den Weißen Berg zu stürmen, wurde unten die Parole „Salve Regina!“ ausgegeben, die für den entscheidenden Angriff gelten sollte.
Erneut unter starker Artillerieunterstützung griffen die Ligatruppen an, wobei der linke Flügel unter General Tilly wieder arg ins Wanken geriet. Der Einsatz der Reserven kam für die Kaiserlichen zum rechten Zeitpunkt. Mit dieser Unterstützung gelang es den ersten Ligasoldaten, in die Stellung der Protestanten einzudringen. Wolf ignorierte, dass er eigentlich Musketier war, zog sein Rapier und griff mit der Fechtwaffe an. Schon nach wenigen Schritten in der Stellung geriet er an den bereits verwundeten Christian junior und verwickelte ihn in ein hartes Gefecht, dem der geschwächte Anhalter nicht standhalten konnte. Christian fiel, durchbohrt von Wolfs Rapier. Der Tod ihres Anführers löste bei den Böhmen Panik aus. Sie flohen und zerschlugen dabei noch den hinteren Verteidigungsring. Den siegreichen Kaiserlichen fielen das große königliche Banner, hundert Standarten der Böhmen und sämtliche Geschütze in die Hände. Christian von Anhalt senior konnte gerade noch entkommen und seinen Herrn davon überzeugen, dass es besser war, Prag auf der Stelle zu verlassen.
Wolfs Rolle bei der Erstürmung des Weißen Berges sprach sich schnell herum. Tilly beförderte ihn noch auf dem Schlachtfeld zum Fähnrich, was vorzeitig war, denn Wolf war noch nicht volljährig. Später am Abend, als der Hradschin von Maximilians Truppen besetzt war, stellte der General seinen Pagen und neuen Fähnrich dem Herzog von Bayern vor.
„Komm näher, mein Sohn“, winkte der Herzog Wolf heran. Gehorsam trat er näher und verneigte sich tief.
„General Tilly sagt mir, du seiest ein tüchtiger und tapferer Soldat, mein Sohn. Sag’ mir deinen Namen.“
„Wolf von Steinburg ist mein Name, Hoheit“, antwortete Wolf.
„Steinburg in der Grafschaft Bogen an der Donau? Du klingst nicht nach Niederbayern“, hakte Maximilian nach.
„Nein, Herr. Steinburg in der Grafschaft Steinburg im ehemaligen Königreich Wengland“, korrigierte Wolf.
„Bist du mit den Grafen von Steinburg verwandt, mein Junge?“
„Graf Karl war mein Vater.“
„War?“ fragte der Herzog.
„Ja, Hoheit. Meine Eltern leben leider nicht mehr. Ich wurde im Kloster Wachtelberg erzogen.“
„Wirst du dein Erbe antreten?“
„Ja, Hoheit. Der Grafentitel ist alles, was meiner Familie – oder besser: mir – geblieben ist.“
„Hältst du das für zu wenig?“, fragte Maximilian mit tadelndem Unterton.
„Nun, solange es das Königreich Wengland gab, waren die Grafen von Steinburg die Träger der Krone. Aber das Königreich existiert nicht mehr und meine Familie ist verarmt. Deshalb sage ich, dass der Titel alles ist, was mir geblieben ist.“
„Würdest du dir wünschen, dass es Wengland wieder als Königreich gibt?“, forschte der Herzog. Wolf wurde misstrauisch. Wenn Maximilian seinen Wunsch nach einer Wiederherstellung Wenglands falsch deutete, wertete er das als Verrat. Wolf zuckte mit den Schultern.
„Selbst wenn ich es mir wünschen würde, Hoheit: Es ist nicht möglich. Mein Wunsch ist hier ohne Belang“, erwiderte Wolf. Maximilian gab sich mit Wolfs Erklärung zufrieden und entließ den jungen Mann.
Kapitel 2
Die Last des Krieges
Kurz vor seinem einundzwanzigsten Geburtstag erbat Wolf sich etwas Urlaub.
„Und was hast du vor, Wolf?“, fragte Tilly interessiert.
„Ich möchte mein Erbe antreten, Euer Liebden. Ich werde bald volljährig und kann den Titel des Grafen von Steinburg annehmen“, erklärte Wolf.
„Ist dein Erbe sonst noch etwas wert – außer dem Titel?“
Wolf schüttelte ernst den Kopf.
„Nein, Euer Liebden. Ihr wisst ja, meine Familie ist verarmt. Alles, was ich besitze, ist mein Pferd, der Sattel darauf und das, was ich am Leibe trage.“
„Habe ich dich so schlecht entlohnt?“, fragte der General, der sich ein Schmunzeln nicht verkneifen konnte.
„Nein“, lächelte Wolf. „Aber ich werde wohl alles, was mir von der Löhnung geblieben ist, brauchen, um den Notar zu bezahlen.“
„Seltsam“, murmelte Tilly. „Ich habe einmal gehört, die Grafen von Steinburg seien sehr reich.“
„Das waren sie auch, Euer Liebden. Jedenfalls hält sich diese Sage beharrlich in Steinburg. Angeblich soll Graf Ralf, der sich sogar für einige Jahre die Reichsunmittelbarkeit verscherzte, das Geheimnis des Reichtums mit in das Grab genommen haben – und seither sind wir arm wie die Kirchenmäuse.“
„Wir sollten darüber noch einmal reden, wenn du wieder hier bist, mein Junge“, sagte Tilly und warf seinem Fähnrich eine Geldbörse zu. „Nimm einstweilen den Beutel, Wolf. Das sollte für die Reise genügen. Wann wirst du zurück sein?“
„Ich hoffe, alles in einem Monat geregelt zu haben.“
„Geh’ mit Gott, mein Sohn.“
Pünktlich wie angekündigt, kehrte Wolf einen Monat später mündig, volljährig, erwachsen, als Graf von Steinburg betitelt zu Tilly zurück. Sein Erbe hatte er angetreten, auch wenn der mit der Testamentsvollstreckung beauftragte Notar ihm nicht allzu viel Hoffnung gemacht hatte, dass der Königsschatz eines Tages auftauchen würde. Er hatte einen Verwalter für die Belange seiner Grafschaft eingesetzt, ohne dem Mann viel Lohn versprechen zu können. Für den Verwalter war der karge gräfliche Lohn mehr ein Zubrot zu seiner sonstigen Tätigkeit als Advokat.
Als er bei Tilly eintrat, wog er einen kleinen Geldbeutel in der Hand.
„Gott zum Gruße, Euer Liebden“, grüßte er freundlich.
„Gott zum Gruße, Wolf, Graf von Steinburg. Ich beglückwünsche Euch zu Eurem Erbe“, erwiderte der General höflich. Wolf war verwirrt.
„Euer Liebden, sonst habt Ihr mich geduzt“, bemerkte er. Tilly sah ihn lange an.
„Jetzt seid Ihr ein Graf, wir sind also gleichgestellt, auch wenn ich wesentlich älter bin als Ihr, Graf Steinburg“, erklärte er.
„Euer Liebden, ich bin nach wie vor Euer Fähnrich. Nennt mich bitte weiter beim Vornamen. Ihr seid mir ein väterlicher Freund; bitte, erweist mir diese Ehre.“
„Wenn Ihr wollt, gern. Doch dann mache ich Euch das Gegenangebot, mich gleichfalls beim Vornamen zu nennen. Und lasst bloß Euer Liebden weg! Wenn ich eine Bezeichnung nicht leiden kann, dann diese!“
Wolf lachte auf.
„Ich diene Euch jetzt seit vier Jahren, Graf Tilly, aber das habt Ihr mir noch nie gesagt!“
„Kommt, Wolf, setzt Euch. Ich habe noch mehr mit Euch vor“, entgegnete Tilly und bot Wolf Platz an.
Der junge Graf nahm den mit weißen und blauen Federn geschmückten breitkrempigen Hut ab und setzte sich.
„Wolf, Ihr seid mir in den vier Jahren, die Ihr jetzt in meinem Dienst steht, ans Herz gewachsen. Ihr erfüllt das, was ich von Euren Vorfahren gehört habe. Irgendwann waren Eure Vorfahren Könige, oder?“
Wolf nickte.
„Ja, aber das ist schon fast dreihundert Jahre her. Seither ist viel Wasser den Alvedra hinab geflossen“, erwiderte der junge Graf.
„Wolf, ich möchte Euch zu meinem Adjutanten machen. Ihr könnt lesen und schreiben, Ihr könnt mit Zahlen umgehen, was wahrhaft nicht jeder kann. Ihr seid ein gebildeter junger Mann, ein vorbildlicher Soldat und die Ritterlichkeit in Person. Mir ist noch kein Mann wie Ihr begegnet: Arm wie eine Kirchenmaus, aber stets vornehm und vor allem sauber gekleidet. Ihr versteht Euch auszudrücken, was mir altem Soldaten manchmal schwer fällt. Ich denke, Ihr könnt Euch auf politischem Parkett bewegen.“
„Oh, verschätzt Euch nicht … Johann“, gab Wolf zurück, vorsichtig vom Angebot seines Dienstherrn Gebrauch machend. „Der letzte meiner Vorfahren, der es riskierte, sich auf politischem Parkett, wie Ihr es nennt, zu bewegen, hat es mit zehn Jahren Kerkerhaft und für fünfzehn Jahre mit der Reichsunmittelbarkeit bezahlt.“
„Habt Ihr Angst, Euren Titel einzubüßen?“, lächelte Tilly. Wolf nickte.
„Oh, Wolf – Ihr seid katholisch, der Herzog von Bayern ist es auch und der Kaiser ist einer der gläubigsten Katholiken, die mir je begegnet sind. Ihr seid ein tapferer Kämpfer für den Herzog und den Kaiser. Wie sehr Maximilian Euch schätzt, zeigt das edle Pferd, das er Euch nach der Schlacht am Weißen Berge geschenkt hat.“
„Ich bin vorsichtig, Johann. Bei wirklich hohen Herren ist man sich der Gunst nie ganz sicher. Gerade wir Steinburger haben das in den letzten dreihundert Jahren allzu oft erfahren. Zeitweise gehörten wir zum Fürstentum Schwarzenstein, das davor nie etwas mit Wengland zu tun hatte. Der Fürst von Schwarzenstein hat keine Gelegenheit ausgelassen, auch das Grafenhaus kräftig zu pressen.“
„Verwechselt mir meinen allergnädigsten Herrn, den Herzog Maximilian von Bayern, nicht mit dem Schwarzensteiner!“, lachte Tilly auf. „Aber davon abgesehen: Ihr seid jetzt vier Jahre mein Page, und Ihr habt nicht die niedrigsten Arbeiten getan. Ihr seid eigentlich mehr mein Sekretär als mein Page gewesen. So ähnlich wird Eure Aufgabe als mein Adjutant sein, nur, dass ich noch Euren militärischen Sachverstand nutzen möchte. Ich habe noch immer Euer Gebrummel in den Ohren, wie man eine Stellung nur bergauf berennen kann, ohne den Versuch zu machen, den Feind zu umgehen und ihm von hinten in die Waden zu beißen. Vielleicht hätte der Versuch ein paar hundert Leute weniger gekostet.“
„Nun, wenn Ihr es wünscht, will ich Euer Adjutant sein“, erwiderte Wolf lächelnd.
„Euch muss man fast zu Eurem Glück zwingen, Wolf. Außerdem bin ich der Meinung, dass Ihr allmählich Leutnant werden solltet. Als Adjutant geziemt sich dieser Rang. Nehmt Ihr an?“
„Ihr würdet es nicht vorschlagen, wärt Ihr nicht der Meinung, dass ich diesen Posten ausfülle. Ja, ich nehme an, Graf Tilly.“
Tilly schob Wolf ein Pergament hin, das ihn als Leutnant in Diensten der katholischen Liga auswies und einen Vertrag darstellte, der zunächst für fünf Jahre galt. Das entsprach der Übung, nach der sich ein Soldat seinem Feldherrn persönlich verdingte und schriftlich versprach, ihm eine gewisse Zeit als Soldat zu dienen. Der Vertrag konnte aber auch vorzeitig enden, etwa, wenn ein Soldat in Gefangenschaft geriet oder seine Fahne erobert wurde. In diesen Fällen konnte der Soldat sich auch für die Gegenseite entscheiden, was oft genug vorkam, wenn der Gegner besser zahlte. Wolf unterschrieb den Vertrag, Tilly zeichnete dagegen, womit der Vertrag gültig wurde. Der alte General sah seinen Adjutanten eine Weile nachdenklich an.
„Wisst Ihr“, sagte er dann, „Ihr habt mir zwar gerade nur einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben, aber ich glaube, Ihr gehört nicht zu der wetterwendischen Sorte von Soldat, der sich nach Ablauf des Vertrages beim Gegner anbietet.“
Wolf grinste freundlich.
„Auf die Idee wäre keiner meiner Vorfahren gekommen. Mir würde die Ritterehre so etwas verbieten“, versetzte er. „Oh, bevor ich es vergesse: Dieses Beutelchen Gold habt Ihr mir gegeben, als ich fortritt. Ich danke fürs Ausleihen“, sagte er dann und schob Tilly den Beutel zu.
„Das war nicht als Darlehen, sondern als Geschenk gedacht, mein Junge“, erwiderte der alte Graf lächelnd und zwirbelte den weißen Schnurrbart.
„Das kann ich nicht annehmen, Graf Tilly“, wehrte Wolf ab. Tilly lehnte sich zurück.
„Doch, das könnt Ihr, Graf Steinburg. Ihr seid jung und braucht eine gute Grundlage für Eure Zukunft. Ihr seid nicht mein erster Page. Ich habe es immer so gehalten, dass meine Pagen, wenn sie erwachsen wurden, so ein Beutelchen Gold als Geschenk bekamen. Außerdem könnt Ihr es bestimmt gut gebrauchen.“
Wolf versenkte das Ledersäckchen in seinem Wams.
„Dank Euch, Graf Tilly. In der Tat, ich kann es gebrauchen. Als Euer Leutnant brauche ich wohl ein eigenes Rapier*.“
„Dann sucht Euch etwas Gutes aus und nehmt keinen Ramsch. Wartet noch eine Weile. Es könnte sich ergeben, dass wir nach Westfalen kommen. In Solingen gibt es die besten Klingenschmiede. Meister Balduin macht besonders gute Klingen.“
„Es wäre mir ein Vergnügen, mit Balduin zu feilschen“, grinste Wolf.
Doch bis sich Wolfs Wunsch erfüllte, bedurfte es noch verschlungener Pfade durch die deutschen Lande – und auch eines heftigen Streites mit seinem Dienstherrn. Tillys Ligaheer hatte am 6. Mai 1622 den mit Friedrich von der Pfalz verbündeten Markgrafen von Baden und dessen Truppen geschlagen und zog wieder gen Bayern, in die Oberpfalz, die Maximilian von Bayern außer Oberösterreich für seine Hilfeleistung vom Kaiser verpfändet worden war. Es blieb umstritten, ob der Kaiser Gebiete verpfänden durfte, die nicht sein Kronland waren – und die Oberpfalz an der Grenze zu Böhmen war kein Kronland, sondern das Land des Kurfürsten Friedrich von der Pfalz. Kaiser Ferdinand hatte ohne Bedenken Ländereien der Aufständischen zur Deckung seiner Kosten eingezogen. Nun sollten Tillys Truppen dem neuen Landesherrn in der Oberpfalz Respekt verschaffen, einem Gebiet, das im Norden etwas nördlich von Waldsassen an den Fränkischen Reichskreis grenzte, im Süden zwischen Hilpoltstein und Cham lag und dessen westlichsten Rand die Umgebung der freien Reichsstadt Nürnberg bezeichnete.
Weil der Sold schon frühzeitig, nämlich schon im Laufe des Jahres 1621, nur unpünktlich und teilweise unvollständig gezahlt worden war, war aus den ursprünglich disziplinierten Truppen der Liga ein beutegieriger Soldateskahaufen geworden. Erschwerend kam hinzu, dass die Bauern in der Oberpfalz den Katholiken unter Tilly nicht selten Unterkunft und Verpflegung verweigerten. Nur allzu oft fielen die Männer hungrig über Dörfer und Städte her, plünderten, brandschatzten, hinterließen nicht wieder gutzumachende Verwüstungen. Wolf von Steinburg brachte Plünderei in Wut. In der Nähe von Cham hatte er einen plündernden bayerischen Hauptmann derartig verprügelt, dass der Mann für Tage ans Bett gefesselt war. Tilly ließ seinen Adjutanten vom Profos* verhaften.
„Was bildet Ihr Euch eigentlich ein, Graf Steinburg?“, herrschte Tilly Wolf an. „Wie könnt Ihr es wagen, Hauptmann Eggner lazarettreif zu schlagen?“
„Ich kam dazu, wie Eggner eine schon am Boden liegende Bäuerin mit der Reitgerte weiter schlug, um von ihr das Versteck ihres Geldes zu erfahren. Ich habe eingegriffen, und weil Eggner sich dagegen sträubte, musste ich Gewalt anwenden“, erklärte Wolf mit erzwungener Ruhe.
„Das ist nicht Eure Sache, sondern die des Profos!“, wetterte Tilly zornig.
„Der Teufel soll mich holen, wenn ich je zulasse, dass ein ausgewachsener Mann mit einer Gerte auf eine zierliche Frau losgeht, Euer Gnaden! Bis unser Profos auf einen Alarm reagiert, hat eine alte Sau sieben Mal geferkelt! Außer, man verhaftet ehrbare Leute!“, rief Wolf erbittert.
„Der Teufel wird Euch holen, wenn Ihr weiter Eure Kompetenzen überschreitet!“, donnerte Tilly.
„Sagt, Johann: Gegen wen führen wir eigentlich Krieg? Gegen den falschen König von Böhmen oder gegen seine hilflosen Untertanen? Wir pressen die Bauern bis zum letzten Blutstropfen aus und wundern uns, dass sie uns die Unterkunft verweigern …“
„Wir sollen das Land für den Herzog sichern!“, wies Tilly Wolf zurecht. „Wir müssen hier hart durchgreifen.“
„Hart durchgreifen? Indem unsere Männer straflos Frauen vergewaltigen? Indem unsere Soldaten die Bauern erbarmungslos foltern, um an ein paar Pfennige Geldes heranzukommen, das für die Soldaten eher ein Taschengeld ist, den Bauern aber das Überleben sichert? Ist das unser Krieg, Johann? Wenn das so ist, hoffe ich, dass meine fünf Jahre bald um sind, damit ich nach Steinburg zurück kann, um meinen Bauern ein ähnliches Schicksal zu ersparen!“
„Wolf! Ihr seid Soldat! Ihr habt zu gehorchen!“, fuhr Tilly seinen Adjutanten an.
„Heißt das, dass Ihr Hauptmann Eggner den Befehl gegeben habt, diese Bauern so zu quälen? Was ist das für eine Welt, in der man sich an den Schutzlosesten vergreift? Kennt Ihr noch den Rittereid, Graf Tilly? Sei ohne Furcht im Angesicht deiner Feinde! Sei tapfer und aufrecht, auf dass Gott dich lieben möge! Sprich immer die Wahrheit, auch wenn es deinen eigenen Tod bedeutet! Beschütze die Wehrlosen – und tue kein Unrecht! Der Ritter schwört, dass er Unterdrückten und Hilflosen seinen Schutz gewährt. Nichts anderes habe ich getan, als eine hilflose Frau zu schützen, getreu meinem Rittereid! Ich habe ihn noch geschworen, diesen Eid. Zwar nicht einem Landesherrn, aber Gott. Und mir als gläubigem Katholiken bedeutet das etwas, Graf Tilly!“
„Schweigt! Ich verbiete Euch, so mit mir als Eurem Dienstherrn zu reden, Graf Steinburg! Profos, Graf Steinburg hat drei Tage scharfen Arrest bei Wasser und Brot! Und sollten Euch solche Flausen wieder einfallen, endet es das nächste Mal mit Stockhieben, verstanden?“
„Nur zu! Mit den Methoden vergrätzt Ihr nicht nur das Volk, sondern die letzten ritterlich denkenden Soldaten!“, versetzte Wolf ätzend.
„Profos, Graf Steinburg bekommt drei Stockhiebe!“, knurrte Tilly.
Zornbebend verließ der alte General das Zelt des Profos. Das Schlimmste war, dass Wolf Recht hatte. Tilly selbst war auch gegen Plünderei, aber es war die einzige Chance, noch die Gewalt über das Heer insgesamt zu behalten, wenn er seinen Soldaten die Plünderungen mit all ihren Scheußlichkeiten erlaubte. Wenn die Soldaten hungerten und keine Unterkünfte hatten, würden sie bald meutern und nicht nur den Bauern zu schaffen machen, sondern auch den Heerführern. Da fiel die Wahl nicht schwer, die Unannehmlichkeiten auf das Volk zu übertragen, zumal, wenn man damit argumentieren konnte, man strafe die Bauern nur dafür, dass sie den Soldaten des Landesherrn keine Unterstützung gegeben hatten.
Der Profos war nicht zimperlich. Wolf bekam drei Hiebe mit einer starken Weidenrute auf das bloße Gesäß und konnte nach der Bestrafung nicht mehr sitzen. Er ging in dem offenen Pferch zornig auf und ab, was aber beinahe genauso schmerzhaft war, wie sich zu setzen. Wolf versuchte, seine wütenden Gedanken zu ordnen. Er erkannte Tilly nicht wieder. Diese Verwüstungen waren mehr als unnötig. Vor allem würden sie das Volk der Oberpfalz gewiss nicht für den Herzog einnehmen. Wolf wünschte sich, dass Tilly ihm mehr Freiheiten geben möge, damit er die Bauern und Bürger diplomatisch überzeugen konnte, dass Max von Bayern kein so unangenehmer Herr war. Andererseits waren die Bewohner der Oberpfalz eher dem Protestantismus zugeneigt als dem katholischen Glauben – und Maximilian von Bayern duldete kein Abweichen von dem Glauben, den er als den richtigen ansah. Bayern war nicht die Grafschaft Steinburg, wo Wolf seinem Verwalter ausdrücklich religiöse Toleranz befohlen hatte und nicht das Königreich Wengland, in dem jeder glauben konnte, was ihm beliebte, solange er nicht den Teufel anbetete.
Wolf musste einsehen, dass er keine Chance hatte, die Bewohner eines Landes zu schützen, solange er ein Offizier und Adliger niederen Ranges war. Es bedurfte schon des Ranges eines Obersten, um mäßigend einwirken zu können – und einer Menge Geld, denn wer das Geld gab, konnte Weisung geben, was damit zu geschehen hatte. Aber Wolf war arm und wollte nicht selbst zum Plünderer werden, um den Krieg zu beeinflussen.
Die Verstimmung zwischen Graf Tilly und seinem Adjutanten hielt gute drei Wochen an, dann entspannte sich ihr Verhältnis wieder. Johann Terclaes von Tilly hatte keine Freude an Plünderungen, aber er sagte es nicht so geradeheraus wie Wolf. Immer wieder schrieb er um die fälligen Löhnungen, immer wieder wurde er vertröstet.
„Wolf“, sagte er schließlich, „ich gebe zu, dass ich mit meinem Latein am Ende bin. Die Oberpfalz ist leergeräumt, der Herzog schickt keine Löhnungen, keinen Nachschub. Was soll ich tun? Gebt mir einen Rat.“
„Täusche ich mich, oder sind wir nur wenige Meilen von niederbayerischem Gebiet entfernt?“, fragte Wolf.
„Niederbayern ist nur einen Katzensprung von hier. Worauf wollt Ihr hinaus?“
„Nun, der Herzog von Bayern unterhält die Truppen der katholischen Liga. Was läge näher, als die Truppen nach Niederbayern zu führen, wo sie sowohl mit Unterkunft als auch Verpflegung rechnen könnten?“, schlug Wolf vor.
„Wolf, das meint Ihr nicht ernst!“, entfuhr es Tilly entsetzt. „Die Armee in dem Zustand nach Niederbayern zu führen, würde bedeuten, dass sie Niederbayern bis zum letzten Grashalm plündert!“
Wolf grinste in einer Weise, die nur zynisch zu nennen war.