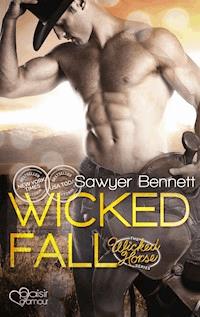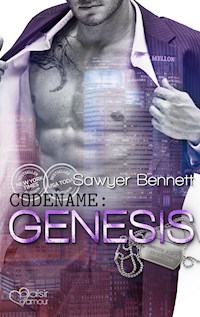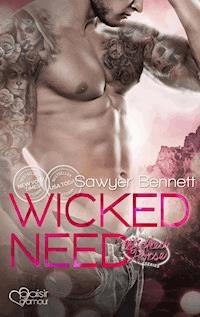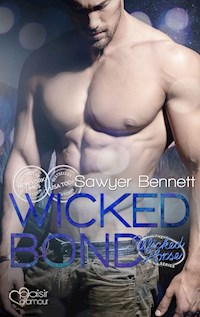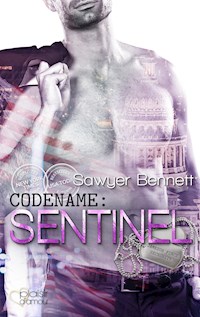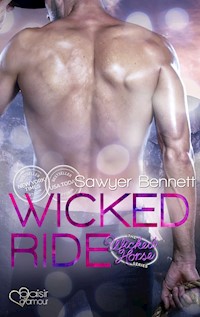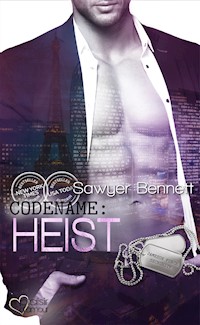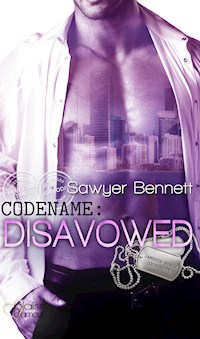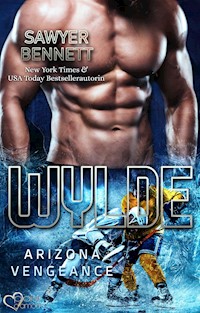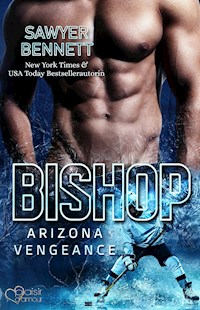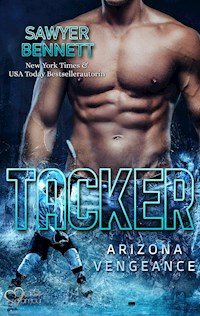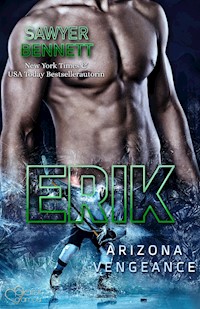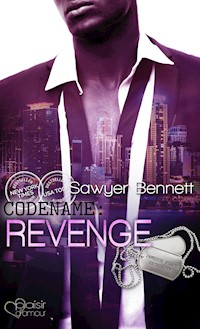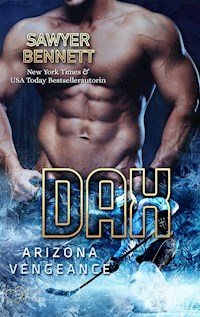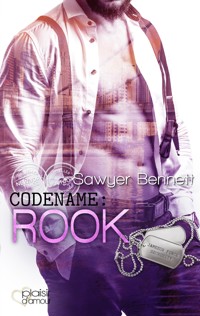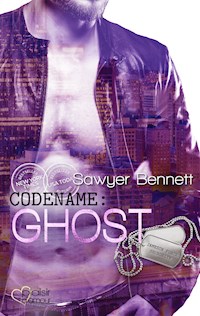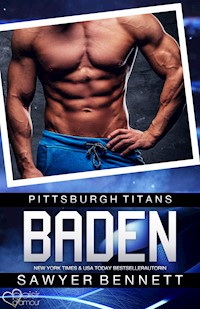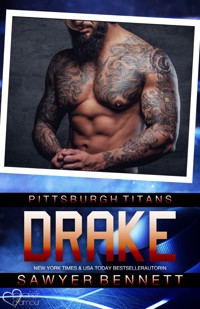Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plaisir d'Amour Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pittsburgh Titans
- Sprache: Deutsch
Boone Rivers nutzt seinen Ruhm und sein Vermögen als Eishockeyspieler zu seinem Vorteil, aber nicht so, wie es die meisten Leute erwarten würden. So oft es sein voller Terminkalender zulässt, engagiert sich Boone ehrenamtlich und trifft dabei auf einen tapferen Jungen, der Boones Welt auf den Kopf stellt. Als Spieler der Pittsburgh Titans bin ich begeistert vom Nervenkitzel des Spiels. Ich lebe für den Geruch des Eises, den Jubel der Menge und das Herzklopfen, wenn ich die Arena betrete. Aber sobald ich meine Schlittschuhe ausgezogen habe, konzentriere ich mich darauf, der Stadt Pittsburgh etwas zurückzugeben. Ich treffe Aiden bei einem Besuch im Kinderkrankenhaus und bin beeindruckt von der inneren Stärke dieses zwölfjährigen Jungen, der um sein Leben kämpft. Bei meinen weiteren Besuchen unterhalten wir uns über Videospiele und Eishockey, bis eines Tages Aidens ältere Schwester in sein Zimmer kommt und mir klar wird, dass hinter dieser Bekanntschaft eine tiefere Bedeutung steckt. Auf den schmalen Schultern von Lilly Hoffman ruht das Gewicht der Welt. Aidens Krankheit wird nicht besser, sie ist in Gefahr, ihren Job zu verlieren, und ihr Vater ertränkt seine Sorgen in Alkohol. Ich ertappe mich dabei, wie ich Lilly die Last abnehmen möchte, und was als einfacher Akt der Freundschaft beginnt, wird zu so viel mehr. Als wir uns näher kommen, kann ich nicht anders, als mich in diese fürsorgliche und unabhängige Frau mit dem zarten Herzen und dem verletzten, aber noch nicht gebrochenen Geist zu verlieben. Während wir einer Zukunft voller Ungewissheit entgegensehen, gelobe ich, Lillys Quelle der Stärke und des Trostes zu sein. Lilly und Aiden haben mir erneut gezeigt, wie wichtig es ist, selbst in den dunkelsten Zeiten bedingungslos Liebe zu geben und zu empfangen. Und egal, was als Nächstes passiert, niemand kann uns das nehmen. Der überaus emotionale elfte Teil rund um das Team der Pittsburgh Titans von New York Times-Bestsellerautorin Sawyer Bennett.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Sawyer Bennett
Pittsburgh Titans Teil 11: Boone
Aus dem Amerikanischen ins Deutsche übertragen von Oliver Hoffmann
© 2024 by Sawyer Bennett unter dem Originaltitel „Boone: A Pittsburgh Titans Novel“
© 2024 der deutschsprachigen Ausgabe und Übersetzung by Plaisir d’Amour Verlag, D-64678 Lindenfels
www.plaisirdamour.de
info@plaisirdamourbooks.com
© Covergestaltung: Sabrina Dahlenburg
(www.art-for-your-book.de)
ISBN Print: 978-3-86495-730-7
ISBN eBook: 978-3-86495-731-4
Alle Rechte vorbehalten. Dies ist ein Werk der Fiktion. Namen, Darsteller, Orte und Handlung entspringen entweder der Fantasie der Autorin oder werden fiktiv eingesetzt. Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Vorkommnissen, Schauplätzen oder Personen, lebend oder verstorben, ist rein zufällig.
Dieses Buch darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Autorin weder in seiner Gesamtheit noch in Auszügen auf keinerlei Art mithilfe elektronischer oder mechanischer Mittel vervielfältigt oder weitergegeben werden. Ausgenommen hiervon sind kurze Zitate in Buchrezensionen.
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Autorin
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
das Schreiben dieses Buches ist mir sehr schwergefallen. Aber am Ende hat es sich gelohnt.
Zunächst möchte ich meinem Freund Mark Yoffe danken. Er hat mir bei so vielen Büchern bei den medizinischen Fragen geholfen, und ich habe ihn endlich als Figur in diese Geschichte eingebaut. Mark hat sich diesen Sommer aus der Onkologie zurückgezogen, aber ich habe ihn weiter beschäftigt, um Boones Geschichte so genau wie möglich zu erzählen.
Mark ist für mich mehr als nur eine Quelle. In den letzten drei Jahren hat er meine Mutter behandelt, die metastasierenden Darmkrebs im Stadium IV hat, und war ein Quell der Hoffnung und des Trostes für unsere Familie. Er ist immer noch an unserer Seite, nur inzwischen als Freund, und er wird immer einer der besten Menschen bleiben, die ich kenne.
Lassen Sie mich betonen, dass alle Ungenauigkeiten bei den medizinischen Details sehr spezifische Änderungen sind, die ich vorgenommen habe, damit meine Chronologie stimmt. Ich habe aber versucht, so authentisch wie möglich zu bleiben.
Auch meiner lieben Freundin Lori Kelly möchte ich danken. Sie ist ein wunderbarer Mensch und hat meiner Familie während der Krankheit meiner Mutter sehr geholfen. Ich habe Aidens Krankenschwester in diesem Buch nach ihr benannt, um sie zu ehren.
Zurück zu diesem Buch, das mir so auf der Seele gelegen hat. Es enthält einige schwer verdauliche Dinge, und ich habe mir beim Schreiben der letzten paar Kapitel regelrecht die Augen ausgeheult. Es tut mir leid, falls ich Sie zum Weinen bringe, aber ich hoffe, Sie wissen, dass es nicht anders ging. Herausgekommen ist eine Liebesgeschichte, die meiner Meinung nach alle anderen in den Schatten stellt.
Kapitel 1
Boone
Konzentriert betrachte ich das Raster aus gelben und roten Pflöcken und entscheide mich für ein besonders leeres Gebiet. Mit selbstsicherem Lächeln sage ich: „D-6.“
Ich imitiere das Pfeifen der Rakete, die von meinem Zerstörer auf Aidens Seite segelt, wo der Junge die Soundeffekte zu unserem Spiel übernehmen und mir definitiv einen Treffer ansagen soll.
Stattdessen grinst er. „Vorbei.“
„Was zum Teufel …?“, murmle ich und markiere das D-6-Loch mit einem gelben Stift. Misstrauisch schaue ich zu ihm hinüber. „Du hast doch alle deine Schiffe auf dem Brett, oder?“
Aiden verdreht die Augen, etwas, das nur ein Elfjähriger in absoluter Perfektion beherrscht. „Versuch nicht, mir in die Schuhe zu schieben, dass du bei diesem Spiel schlecht bist.“
„Schon recht“, sage ich mit einer Handbewegung. „Du bist dran, Kumpel.“
„J-2.“ Ich muss ihm nicht ins Gesicht sehen, um zu wissen, dass er weiß, dass es ein Treffer ist. Man hört es an seinem selbstgefälligen Tonfall.
Aiden gibt das zischende Geräusch seiner Rakete von sich und beschreibt mit der Hand einen Bogen über dem Brett, um die theoretische Flugbahn nachzuahmen. Ich verziehe das Gesicht, während ich ein nicht ganz so enthusiastisches Bombengeräusch mache. „Volltreffer“, nörgele ich.
Mit erhobener Faust ruft Aiden: „Ja!“
„Du musst übersinnlich begabt sein oder so.“
„Ich habe einfach ein gutes logisches Denkvermögen“, antwortet er achselzuckend und schaut auf die Uhr. „Zum Beispiel müsste jetzt gleich eine Krankenschwester kommen, um einen neuen Beutel anzuhängen.“
Als ob Aiden wüsste, dass sie direkt vor seiner Zimmertür steht, kommt besagte Krankenschwester herein. Eine fröhliche Frau mittleren Alters mit burgunderrot gefärbtem Haar, das sie superkurz geschnitten trägt, schaut auf die Tafel, dann zu mir und dann zu Aiden. „Wie sehr hast du ihm heute in den Arsch getreten?“
„Heftig“, sagt Aiden.
„Ich glaube, er bescheißt, Lori.“ Ja, ich weiß, dass sie Lori heißt, seit zweiundzwanzig Jahren als Krankenschwester arbeitet, verheiratet ist und drei adoptierte Kinder hat.
Wenn man sich oft genug im Kinderkrankenhaus aufhält, lernt man die Leute kennen, und Lori ist eine der Krankenschwestern in der Kinderonkologie.
„Nicht mein süßer Aiden“, trällert sie, während sie einen Infusionsbeutel auswechselt. Er bekommt viele verschiedene Medikamente.
Aiden hat akute lymphoblastische Leukämie.
Genauer gesagt, refraktäre Leukämie.
Ich weiß einiges über dieses Kind und seinen unglaublich langen Weg im Kampf gegen diese Krankheit. Als er die Diagnose im Alter von fünf Jahren bekam, unterzog er sich einen Monat lang einer Induktionstherapie. Dabei handelt es sich um eine Kombination von Chemotherapeutika, die möglichst viele Leukämiezellen im Blut und im Knochenmark abtöten sollen. Danach erhielt er eine Konsolidierungstherapie, bei der er über Monate hohe Dosen von Medikamenten nehmen musste, um die verbleibenden Zellen abzutöten, die in Tests nicht zu erkennen waren. Es folgte eine über zwei Jahre andauernde Erhaltungs-Chemotherapie, um alles abzutöten, was die ersten beiden Phasen überlebt hatte, und um zu verhindern, dass die Leukämie zurückkehrt.
Mit acht Jahren galt er als krebsfrei und lebte unbeschwert.
Als er elf Jahre alt war, kehrte die Krankheit zurück. Ich lernte Aiden Anfang März kennen, als er für eine weitere Runde Chemotherapie in die Klinik kam. Die Ärzte versuchten, ihn wieder in Remission zu bringen. Leider sprach sein Krebs auf die Behandlung nicht mehr so gut an wie zuvor, und es stellte sich heraus, dass seine beste Chance eine allogene Knochenmarktransplantation war.
Das war vor drei Wochen, und ich konnte ihn bis diese Woche nicht sehen, da ein erhöhtes Infektionsrisiko bestand und die Anzahl seiner Besucher daher begrenzt war. Noch heute muss ich Kittel, Handschuhe und Maske tragen, wenn ich bei ihm im Zimmer sitze, denn die Chemotherapie tötet nicht nur den Krebs, sondern auch seine roten und weißen Blutkörperchen. Die braucht er aber – vor allem die weißen – zur Bekämpfung von Infektionen. Das macht seine Situation prekär, da er sehr anfällig für viele Arten von Komplikationen ist, was bedeutet, er wird eine Weile im Krankenhaus bleiben müssen. Das ist keine Behandlung, von der man sich zu Hause erholen kann.
Jetzt heißt es abwarten, ob sich sein Knochenmark erholt, seine Blutzellen regenerieren und die Leukämie besiegt ist.
„Ist dein Vater noch nicht da?“, fragt Lori Aiden.
Ich schaue auf die Uhr. Steven Hoffman ist normalerweise tagsüber hier bei seinem Sohn, ich habe ihn schon ein paarmal getroffen. Er ist ein netter Kerl, der trotz der traurigen Situation, in der sich der Junge befindet, recht aufgeräumt ist. Stets zu Späßen aufgelegt, bringt er den Kleinen immer wieder zum Lachen.
Aiden schaut erneut auf die Uhr und runzelt die Stirn. „Ich weiß nicht, wo er bleibt. Sonst ist er um diese Zeit schon hier.“
„Ich habe heute nichts vor“, sage ich und studiere mein Schlachtschiffgitter für meinen nächsten Zug. „Weißt du was? Ich warte, bis er kommt.“
Beim Blick in Aidens Gesicht sehe ich Erleichterung. Von der intensiven Chemotherapie, die er vor der Transplantation bekommen hat, ist er immer noch fast kahl, aber es bildet sich ein leichter, pfirsichfarbener Flaum. Irgendwie bedeutet das für mich Hoffnung, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob es viel zu sagen hat.
Aiden lächelt dankbar. „Ja? Kannst du das?“
„Logo“, antworte ich achselzuckend, als wäre das keine große Sache. Eigentlich habe ich noch eine Menge zu erledigen, weil wir morgen früh zu einem Auswärtsspiel aufbrechen, aber das ist nicht so wichtig wie das hier. „Darfst du dein Zimmer verlassen?“
„Klar.“
„Er braucht einen Kittel und eine Maske“, mahnt Lori, und ihr Blick geht zu Aiden hinüber. „Willst du laufen oder fahren?“
„Heute ist eher ein Tag für eine Fahrt“, entgegnet er und deutet damit an, dass er müde ist und wahrscheinlich nicht weit laufen kann.
Ich zwinkere Aiden zu. „Wir setzen dich in den Rollstuhl und rasen den Flur entlang, sobald Lori sich umdreht.“
Die Schwester wirft mir einen spöttischen Blick zu, und ich zwinkere Aiden erneut zu, was ihn zum Lachen bringt.
„Oder … eine gemütliche Spazierfahrt ins Café, um ein Eis zu essen“, ergänze ich.
Lori grinst. „Schon besser.“
„Komm, Junge“, sage ich und rutsche vom Ende des Bettes, auf dem ich gesessen habe. Ich schiebe den Rolltisch mit dem Spiel in die Ecke. „Lass uns ein paar Leute ärgern.“
Nachdem sie seine neue Infusion angehängt hat, löst Lori die Bremse von Aidens Infusionsständer, und ich verlasse sein Zimmer, um einen Rollstuhl zu holen. Am Ende des Flurs gibt es einen großen Schrank, in dem zusätzliche Roll- und Besucherstühle lagern.
Bis ich wieder bei Aiden bin, hat Lori ihm einen Papierkittel, eine Maske und Handschuhe angezogen, um ihn auf unser Abenteuer vorzubereiten.
„Wir sind Zwillinge“, stelle ich fest, als er sich langsam in den Stuhl setzt.
Ich versuche, zu ignorieren, wie viel dünner er seit der Transplantation aussieht und wie er schon aufgrund der minimalen Anstrengung leicht hechelt. Lori befestigt die Infusionspumpe an einer Halterung und den Beutel an einer kurzen Stange an der Rückseite seines Rollstuhls. Aus Erfahrung weiß ich, dass die Batterie dieser Pumpe stundenlang hält, aber ich schätze, Aiden wird nur etwa dreißig Minuten durchhalten. Gut, dann müssen wir schnell ein Eis essen.
„Wohin, Sir?“, frage ich dramatisch und schiebe ihn aus dem Zimmer.
„Schauen wir uns die hübschen Krankenschwestern im Café im ersten Stock an“, schlägt er vor, während ich ihn langsam den Flur entlangrolle.
Lachend biege ich in den nächsten Quergang ein, der uns zu den Patientenaufzügen führt. „Wie wäre es, wenn wir im Café ein Eis essen?“
„Wenn es da zufällig hübsche Schwestern gibt … Bonus.“ Aiden verdreht den Hals und grinst mich über die Schulter an.
„Du bist zu jung, um das zu bemerken“, schimpfe ich.
„He, du bist derjenige, der sie dauernd so eingehend mustert, nicht ich“, antwortet er schmunzelnd.
Kopfschüttelnd erreiche ich die Aufzüge und drücke den Abwärtsknopf. „Ich weiß, wir kennen einander erst seit ein paar Wochen, aber bist du immer so ein Klugscheißer?“
„Das sagt man nicht, Mr. Rivers“, tadelt er. Das sage ich gelegentlich auch zu ihm, wenn er flucht. Ich bin allerdings nicht übermäßig streng, denn der Junge hat allen Grund zum Fluchen.
Der Aufzug pingt, und ich umfasse die Griffe des Rollstuhls, um Aiden hineinzuschieben. Die Türen gleiten auf, und eine Frau will aussteigen. Ich ziehe Aidens Rollstuhl ein Stück zurück, um ihr Platz zu machen, halte jedoch inne, als er „Lilly!“ ruft.
Zuvor habe ich ihr nur einen flüchtigen Blick zugeworfen. Nun mustere ich die Frau, von der ich weiß, dass sie seine Schwester ist, da er ständig von ihr spricht. Ich habe sie noch nie getroffen, sie arbeitet viel.
Ihre hellblauen Augen – ein Duplikat von Aidens – begegnen meinem Blick, dann sieht sie mit einem warmen Lächeln wieder Aiden an. „Auf der Flucht?“
„Wir gehen Eis essen“, sage ich, beuge mich vor und reiche ihr die Hand. „Ich bin Boone Rivers, und Sie sollten sich uns anschließen.“
„Nein danke.“ Sie nimmt meine Hand, schüttelt sie kurz und winkt ab. „Ich warte in deinem Zimmer.“
„Komm schon, Lilly“, bettelt Aiden. Die Türen schließen sich hinter ihr. Sie gleiten wieder auf, als sie einen Arm ausstreckt. „Du hast dir eine Pause verdient. Komm mit Eis essen.“
Du hast dir eine Pause verdient?
Das ist ein interessanter Satz, er deutet darauf hin, dass sie eine Frau im Stress ist. Sie scheint eine Arbeitsuniform zu tragen – Jeans und Tennisschuhe –, aber auf der Vorderseite ihres dunkelgrünen T-Shirts prangt ein Namensschild aus Plastik mit einem Logo und der Aufschrift „Moni’s Deli, LILLY“. Außerdem trägt sie eine grüne Baseballkappe mit demselben Logo, und ihr langes braunes Haar ist zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.
„Ja … kommen Sie mit Eis essen“, wiederhole ich Aidens Bitte. „Geht auf mich.“
Lilly überlegt einen Moment, ehe sie lächelt. „Okay. Ja … gut.“
Sie steigt aus dem Aufzug und hält die Türen offen. „Ihr zwei fahrt nach unten, und ich gehe mich umziehen.“
Ich schiebe Aiden hinein, während Lilly zu seinem Zimmer geht, an dessen Tür ein Metallregal mit Kitteln, Masken und Handschuhen hängt. Schweigend fahren wir in die Lobby hinunter, obwohl ich ein Dutzend Fragen zu seiner Schwester habe. Ich stelle sie aber nicht, sondern sorge dafür, dass er sich an den Tisch setzt, und bestelle drei Softeis.
Als ich zurückkomme, sitzt Lilly am Tisch, dicht neben Aiden, ihre Hand auf seiner Schulter. Was auch immer er sagt, sie lacht und scheint etwas entspannter zu sein. Ich weiß nicht, wie alt sie ist, doch ich schätze sie auf Anfang zwanzig, obwohl der Ausdruck in ihren Augen darauf hindeutet, dass sie schon viel erlebt hat. Ich beobachte die Geschwister ein paar Augenblicke lang und merke, dass sie einander unglaublich nahe sind.
„Bitte sehr“, verkünde ich, trete an den Tisch und verteile die Eistüten. „Ich hoffe, alle mögen Schoko. Etwas anderes hatten sie nicht.“
Ich setze mich, und Lilly sagt: „Aiden hat mir erzählt, dass Sie ihn regelmäßig besuchen.“ Also weiß sie, wer ich bin. Ich habe es bei meiner Vorstellung nicht deutlich gemacht, aber ich dachte, sie wüsste es, weil sie nicht gefragt hat, warum ein Fremder ihren Bruder zum Eisessen mitnimmt. „Tun Sie das oft?“
Ich nicke. „Ja, ich versuche, mindestens ein- oder zweimal pro Woche herzukommen, um die Kinder zu besuchen. Heute ist natürlich das erste Mal seit der Transplantation, dass ich ihn sehen kann.“
„Er hat in der Woche vor der Transplantation Drake McGinn und Van Turner mitgebracht“, sagt Aiden und lächelt mit einem kleinen Schnurrbart aus Schokoladeneis. Er hat seine Maske vorübergehend heruntergezogen, um die Leckerei genießen zu können.
„Das habe ich schon gehört.“ Lillys Augen funkeln amüsiert, als sie einen winzigen Bissen von dem Eis nimmt. Ihre Maske hängt von einem Ohr und sieht auf eine alberne Art niedlich aus. „Dad hat es erwähnt.“
„Wo ist er eigentlich?“, fragt Aiden, bevor er lange an seinem Eis leckt.
Da ist er wieder … dieser verkniffene Blick der Sorge auf Lillys Gesicht. Er ist nur für einen Moment da, und Aiden hat ihn nicht gesehen, weil er sich auf sein Eis konzentriert hat. Ihre Miene entspannt sich, als er seine Aufmerksamkeit wieder auf sie richtet.
Doch ihr Lächeln ist matt, und ich merke, dass etwas nicht stimmt. „Ihm geht es nicht so gut, also dachte ich, ich komme und bleibe bei dir.“
„Aber wer steht dann im Deli?“, fragt Aiden.
„Georgie. Der hat alles im Griff.“
Aiden schnaubt. „Du kannst von Glück reden, wenn er das Haus nicht abfackelt.“
Lilly lacht und streicht ihrem Bruder über den Kopf. „Ich kümmere mich um das Deli und um Papa. Du kümmerst dich darum, wieder zu Kräften zu kommen.“
Es ist ein bezauberndes Geplänkel zwischen den beiden. Ich weiß nicht viel über Aidens Familie, nur dass er einen Vater und eine Schwester hat. Es gibt wohl keine Mutter, weil er nie eine erwähnt hat, aber ich stelle keine sehr persönlichen Fragen. Ich richte meine Besuche danach aus, was die Kinder gerade machen und worüber sie reden wollen, und überlasse ihnen die Gesprächsführung. Aiden hat sich damit begnügt, über Eishockey zu fachsimpeln und zu spielen, wenn ich ihn besuche.
Mein Ziel ist es, die Kids von ihrer Krankheit abzulenken und ihnen die Gelegenheit zu geben, der Realität ein wenig zu entfliehen.
Lilly beugt sich vor und drückt ihren Handrücken an Aidens Wange. Er weicht nicht wie viele andere Elfjährige vor körperlicher Zuneigung oder Berührungen zurück.
„Du bist ganz rot im Gesicht“, bemerkt sie.
„Ich freue mich nur über das Eis“, sagt er mit einem schokoladigen Grinsen.
„Fühlt sich das in deinem Mund gut an?“
Seine Augen funkeln, und er nickt. „Total gut.“
Ich runzle die Stirn, und Lilly bemerkt es. „Die Chemo verursacht schmerzhafte wunde Stellen im Mund. Aber sie sind größtenteils abgeheilt.“
„Ich konnte fast zwei Wochen lang nichts essen“, berichtet Aiden nach einem weiteren herzhaften Bissen von seinem Eis. „Sie mussten mich künstlich ernähren.“
Ich schaue Lilly fragend an.
„Er hat seine Nahrung intravenös bekommen, weil es zu schmerzhaft ist, mit den Wunden zu essen.“
O Gott. Ich hatte keine Ahnung, aber anscheinend war die Zeit nach der Transplantation ziemlich beschissen.
„Wie hast du letzte Nacht geschlafen?“, fragt Lilly ihren Bruder.
„Wie ein Stein. Ich habe dich nicht mal weggehen hören.“ Aiden schaut sie stirnrunzelnd an. „Wie lange warst du da?“
Lilly zuckt die Achseln. „Bis kurz vor zwei, glaube ich.“
Zwei Uhr nachts? Ich vermute, dass sie Vollzeit im Deli arbeitet, und offenbar verbringt sie trotzdem einen großen Teil der Nacht bei ihrem Bruder.
Ich lehne mich zurück, esse mein Eis und beobachte das Gespräch zwischen den Geschwistern. Nach ihren anfänglichen Fragen, wie es ihm gehe, spricht sie nun nicht mehr über seine Gesundheit. Stattdessen reden sie über seinen Vormittag, an dem er einen neuen Freund auf dem Flur besucht hat, der ebenfalls an Leukämie erkrankt ist. Es ist faszinierend, wie die Krankheit jetzt ein ganz normaler Teil seines Lebens ist.
„Boone und ich haben heute Morgen Schiffe versenken gespielt“, sagt Aiden.
„Hast du ihm den Arsch aufgerissen, so wie mir immer?“ Sie schmunzelt.
„Schlimmer“, behauptet Aiden schadenfroh, mit einem verschmitzten Blick in meine Richtung. „Du solltest mal gegen ihn spielen … dann hättest du eine Chance, zu gewinnen.“
„Danke“, seufze ich und lege mir die Hand aufs Herz. „Mal sehen, ob ich dir je wieder ein Eis kaufe.“
Aiden lacht, und Lilly lächelt, aber der Humor erreicht nicht ihre Augen. Sie schaut wieder auf die Uhr, und ich frage mich, ob sie irgendwo hinmuss oder ob ich ihre Zeit mit ihrem Bruder störe.
Sobald wir mit dem Eis fertig sind, stehe ich auf und drücke Aidens Schulter. „Ich muss los, Kumpel.“
Lilly steht auch auf und sammelt unsere zusammengeknüllten Servietten ein. Ich gebe ihr ganz automatisch meine, und sie nimmt auch noch die Aidens. Der fragt: „Kannst du morgen wiederkommen?“
„Aiden“, ruft Lilly, die gerade zu einem nahen Mülleimer geht, über die Schulter. „Boone hat sicher Wichtigeres zu tun.“
Ich ignoriere sie. „Morgen habe ich ein Auswärtsspiel. Ich komme vielleicht am Dienstag, aber auf jeden Fall am Mittwoch. Miriam darf wahrscheinlich Ende der Woche heim, und ich habe etwas für sie.“
Miriam ist ein vierjähriges Mädchen mit einem Hirntumor. Nach Aussage ihrer Eltern war ihre OP erfolgreich; nach ihrer Entlassung folgen Chemotherapie und Bestrahlung. Mit ihren vier Jahren ist sie nicht sonderlich beeindruckt von der Tatsache, dass ich Eishockeyspieler bin, doch das Stofftier, das ich ihr bei meinem ersten Besuch geschenkt habe, hat ihr gefallen. Wahrscheinlich mögen ihre Eltern meine Besuche am meisten, weil sie sich dann eine Pause von den Sorgen um sie gönnen und mit einem Erwachsenen reden können.
Mein Blick fällt auf Lilly, die nicht beunruhigt zu sein scheint, aber an ihrer Unterlippe nagt. Ich vermute, sie ist der Typ, der sich nicht gern auf jemanden verlässt, doch sie wird auch nicht verhindern, dass Aiden Besuch bekommt, wenn es ihn glücklich macht.
„Es macht mir wirklich nichts aus“, versichere ich ihr.
Ihr Lächeln ist erleichtert und wirkt echt. Sie nickt, während sie sich anschickt, Aidens Rollstuhl zu schieben, und gibt zähneknirschend zu: „Er liebt Ihre Besuche und spricht immerfort von Ihnen. Ich weiß das sehr zu schätzen.“
Wir verlassen das Café, und ich lasse sie durch die Tür in die Lobby vorgehen. Ich wende mich nach links, zum Parkhaus. Sie müssen nach rechts zu den Patientenaufzügen.
Ich strecke die Faust aus, um mich mit einer Gettofaust von Aiden zu verabschieden, aber ich erschrecke, als ich einen Mann brüllen höre: „Lilly! Aiden!“
Wir drehen uns alle zur Eingangstür um, und da steht Aidens Vater. Er schwankt, ein dämliches Grinsen im Gesicht. „Meine Kinder“, ruft er. „Meine Babys.“
„O Gott“, stöhnt Lilly, und ich sehe, wie sie ihren Vater den Bruchteil einer Sekunde lang nur entsetzt anstarrt, ehe sie in Aktion tritt. „Bleiben Sie bei Aiden“, befiehlt sie, während sie durch die Lobby auf ihren Vater zustürmt.
Mehrere Leute gaffen, und die Empfangsdame erhebt sich zögernd hinter ihrem Schreibtisch, das Telefon in der Hand, als wollte sie den Sicherheitsdienst rufen. Lilly streckt im Vorbeieilen die Hand nach der Frau aus. „Ich übernehme das. Keine Angst, ich bringe ihn dazu, zu gehen.“
Ich schaue auf Aiden hinunter, der ruhig im Rollstuhl sitzt. Seine Augen glitzern feucht, und ich begreife, dass ihn die Situation schmerzt, denn sein Vater ist offensichtlich sehr betrunken. Für ihn ist das offenbar keine Überraschung, für mich hingegen schon – ich habe ihn schon oft getroffen, und er war noch nie alkoholisiert.
Lilly ergreift den Arm ihres Vaters und versucht, ihn mit leiser Stimme dazu zu bringen, wieder hinauszugehen.
Er reißt sich von ihr los. „Ich gehe nicht“, schreit er. „Mein Kind hat Krebs, und bei Gott, ich werde Zeit mit ihm verbringen.“
„Dad“, höre ich Lilly klagen. Sie greift erneut nach seinem Arm.
Ich weiß nicht, wie betrunken Steven Hoffman ist, aber als er versucht, sich aus der Umklammerung seiner Tochter zu befreien, stößt er sie versehentlich zur Seite, und sie stolpert.
„Hilf ihr“, sagt Aiden, und ich schreite zur Tat.
Kapitel 2
Lilly
Dads Arm trifft mich an der Schulter, als er sich losreißen will, und ich stolpere zur Seite.
„Ich rufe den Sicherheitsdienst“, verkündet die Empfangsdame.
„Nein“, entgegne ich und werfe ihr einen flehenden Blick zu. Ich will nicht, dass Aiden mit ansehen muss, wie man unseren Vater verhaftet. „Ich schaffe ihn raus.“
„Schon okay, ich kümmere mich darum.“ Boone Rivers drängt sich an mir vorbei. „Steven … schön, Sie zu sehen.“
Boones Stimme klingt freundlich, nicht bedrohlich. Er hält meinem Vater, der ihn mit trüben Augen anstarrt, die Hand hin. Dad ist betrunken, und ich bin mir nicht sicher, ob er den berühmten Eishockeyspieler der Pittsburgh Titans erkennt.
Dann dämmert es ihm, und ein schiefes Grinsen huscht über sein Gesicht, während er Boones Hand ergreift und sie heftig schüttelt. „Wie zum Teufel geht es Ihnen, mein Sohn? Sind Sie hier, um meinen Jungen zu besuchen?“
Die Stimme meines Vaters dröhnt, und ich werfe einen Blick auf Aiden, der den Kopf gesenkt hat, damit er das Spektakel nicht mit ansehen muss.
„Ja, ich besuche Aiden“, sagt Boone in einem beruhigenden, mitfühlenden Ton. Er legt meinem Vater die Hand auf die Schulter, nicht um ihn zu bedrängen, sondern als wollte er signalisieren, dass er die Bedrohlichkeit von Aidens Krankheit und das Gewicht, das durch sie auf uns allen lastet, versteht. „Im Moment sind Sie ein bisschen zu betrunken, um hier zu sein. Sie wollen doch nicht, dass Ihr Sohn Sie so sieht, oder? Er hat schon genug um die Ohren, also bitte, machen Sie es ihm nicht noch schwerer.“
Dad schwankt ein wenig, wirkt völlig verwirrt. Er wirft einen Blick in den Flur, blinzelt Aiden in seinem Rollstuhl zu und grient wieder stolz und albern. „Das da ist mein Junge. Er ist so stark, nicht wahr?“
„Sehr stark“, stimmt Boone zu und dreht meinen Vater sanft in Richtung Ausgangstür. „Aber Sie machen es ihm schwer, wenn Sie hier so auftauchen. Kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause, dann können Sie ausnüchtern und später wiederkommen.“
Wie durch ein Wunder lässt mein Vater zu, dass Boone ihn hinausführt. Ich schaue zurück zu Aiden und bedeute ihm mit dem Finger, dass ich eine Minute brauche. Er nickt, und ich eile ihnen hinterher.
Wenn mein Vater so betrunken ist, kann man normalerweise nicht mit ihm reden. Er ist kein bösartiger oder gar gewalttätiger Alkoholiker, aber er handelt dann unlogisch und ist schwer zu kontrollieren.
Boone geht mit meinem Vater weiter, den Arm um seine Schultern gelegt, während Dad von Aiden schwärmt. „Er wird diese Krankheit besiegen, merken Sie sich meine Worte. Der Junge ist so stark. Genau wie seine Schwester. Ich habe die besten Kinder der Welt.“
„Ich weiß, wie stolz Sie sind“, sagt Boone leise und geht mit meinem Dad den überdachten Durchgang zum Parkhaus entlang. Ich habe keine Ahnung, wohin er ihn führt, und folge ihnen zögernd.
„Aber es ist so schwer“, klagt mein Vater missmutig. „Ich tue mein Bestes. Wirklich.“
„Ihr Bestes ist doch hoffentlich nicht, betrunken hierher ins Krankenhaus zu kommen, oder?“
Nicht nur Boones offene Worte überraschen mich, sondern auch die Tatsache, dass er meinen Vater so mühelos unter Kontrolle hat. Hätte ich allein mit ihm zu tun gehabt, hätte wahrscheinlich der Sicherheitsdienst eingreifen müssen, denn für solche Auftritte fehlt mir die Geduld. Ich werde furchtbar wütend, wenn er sich so verhält, und will dann unbedingt Aiden beschützen.
Dad senkt den Kopf. „Ich weiß, ich bin ein schrecklicher Vater. Nichts kann ich richtigmachen. Ich bin absolut peinlich.“
Er redet immer weiter, während Boone ihn die Rampe ins Erdgeschoss des Parkhauses hinaufführt, wo er vor einem eisengrauen Porsche Cayenne anhält. Boone drückt meinem Vater die Schulter. „Ich bringe Sie nach Hause, okay?“
Mit unsicherem Blick nickt Dad zustimmend, und ich schaue nur fassungslos zu.
Boone entriegelt die Beifahrertür und hält sie ihm auf. „Steigen Sie ein, Steven.“
Mein Vater fällt fast in den Sitz und hat Mühe, die Beine ins Auto zu bekommen. Er kämpft mit dem Sicherheitsgurt, und Boone beugt sich vor, um ihm zu helfen. Mir geht das Herz auf, weil er so nett ist.
Als Dad angeschnallt ist, schließt Boone vorsichtig die Tür. Mein Vater sackt sofort dagegen, schließt die Augen und lehnt den Kopf an die Scheibe, gleitet ins Traumland.
Boone dreht sich zu mir um und lächelt, während er Handschuhe und Maske abstreift und sich dann den Papierkittel vom Körper reißt. Er knüllt ihn zusammen und klemmt ihn sich unter den Arm, dann zieht er sein Handy aus der Tasche. „Wie ist Ihre Telefonnummer?“
Ich bin so verwirrt, dass ich sie, ohne nachzudenken, herunterrattere. Boones Finger fliegen über das Display. „Ich schicke Ihnen jetzt eine Nachricht, damit Sie meine Nummer haben. Schicken Sie mir seine Adresse, und ich bringe ihn nach Hause. Ich rufe Sie an, wenn er sicher dort ist.“
„Mein Handy ist in meiner Handtasche, und die liegt auf Aidens Rollstuhl“, sage ich und deute mit dem Daumen über die Schulter in Richtung Krankenhaus.
Boone nickt und öffnet Google Maps. „Wie lautet die Adresse?“ Ich nenne sie ihm, und er gibt sie ein. Er studiert die Karte einen Moment, dann schaut er mich an. „Gehen Sie wieder rein. Aiden wird Sie brauchen.“
„Aber … Sie können nicht … ich meine, das ist nicht Ihr Problem. Ich sollte …“
„Sie müssen sich um Ihren Bruder kümmern“, antwortet Boone ruhig und drückt sanft meinen Ellbogen. „Das ist nicht meine erste Begegnung mit Betrunkenen, also kümmere ich mich um Ihren Vater und Sie kümmern sich um Ihren Bruder.“
„Ich …“ Mir fehlen die Worte, und ich schüttle den Kopf. „Warum tun Sie das?“
„Weil ich Ihren Bruder verdammt gernhabe und einen Vater hatte, der genauso war. Ich weiß, wie das ist.“
„Oh.“ Ich seufze gequält und blinzle, um die Tränen zu stoppen. „Aber trotzdem …“
„Lilly“, lenkt Boone meine Aufmerksamkeit wieder auf sich. Er drückt noch einmal meinen Arm. „Gehen Sie zu Aiden. Ich rufe Sie an, sobald ich Ihren Vater nach Hause gebracht habe.“
Boone lächelt mitfühlend und dreht mich in Richtung Krankenhaus. „Gehen Sie. Los.“
Ich entferne mich von Boone … von meinem Vater, der besinnungslos in dessen Auto liegt. Doch dann bleibe ich stehen, denn ich kapiere nicht, was zum Teufel hier passiert. Ich beobachte, wie Boone seinen Porsche startet und rückwärts aus der Parklücke fährt. Ehe er den Gang einlegt, sieht er mich dastehen, zeigt mit dem Finger auf mich und wiederholt: „Los.“
Also mache ich auf dem Absatz kehrt und laufe in Richtung Krankenhaus, weil ich unbedingt zu Aiden zurückwill, um ihm zu versichern, dass alles in Ordnung ist.
Nur ist nichts in Ordnung.
Aiden wartet dort auf mich, wo ich ihn zurückgelassen habe, eine Krankenschwester steht neben ihm. Als sie mich sieht, nickt sie verständnisvoll. Aiden muss ihr erzählt haben, was geschehen ist.
„Geht es Dad gut?“, fragt Aiden, nachdem die Schwester gegangen ist.
Mit zitternden Händen umklammere ich die Griffe seines Rollstuhls und drehe ihn zum Aufzug. Das Eis gerinnt in meinem Magen. „Ja. Boone bringt ihn nach Hause.“
„Aber was hält Dad davon ab, gleich wieder herzukommen?“, will Aiden wissen.
Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Tatsächlich bin ich mir nicht einmal sicher, wie er überhaupt hierhergekommen ist. Vermutlich ist er betrunken hergefahren, und sein Auto steht im Parkhaus. Ich erschaudere bei dem Gedanken an die Zerstörung, die er hätte anrichten können, als er alkoholisiert am Steuer saß. Normalerweise wäre er nicht so dumm und würde den Bus nehmen, aber er hat sich in den letzten Wochen in eine Abwärtsspirale hineinmanövriert, während Aiden sich von der Transplantation erholt hat. Mein Vater konnte noch nie gut mit Stress umgehen, und Trost fand er schon immer im Alkohol.
Schweigend kehren wir in Aidens Zimmer zurück. Ich habe im Laufe der Jahre so viel Zeit mit ihm im Krankenhaus verbracht, dass ich Profi darin bin, seine Infusionspumpe von der Rückseite des Rollstuhls zu entfernen und wieder an der Stange am Bett zu befestigen. Dann helfe ich Aiden, den Papierkittel, die Maske und die Handschuhe auszuziehen, damit er ins Bett gehen kann. Den Rollstuhl stelle ich draußen auf den Flur, weil ich weiß, dass ihn jemand wegräumen wird.
Schließlich nehme ich seine Hand und drücke sie. „Geht es dir gut?“
„Ja. Ich mache mir nur Sorgen um Dad.“
„Klar.“ Ich muss mir jeden weiteren Kommentar verkneifen. Am liebsten hätte ich geantwortet: „Ich weiß, aber Dad hat deine Sorgen nicht verdient. Er sollte das nicht auf deine schwachen Schultern bürden.“
Aber das tue ich nicht, denn damit würde ich Aiden praktisch sagen, er solle aufhören, unseren Vater zu lieben, und das kann ich nicht. Genauso wenig, wie ich aufhören kann, ihn zu lieben. Ich liebe ihn sogar noch mehr, weil er schwach und abhängig ist und zu kämpfen hat. Doch ich will nicht, dass Aiden diese Last trägt. Ich versuche, das meiste davon von ihm fernzuhalten, heute jedoch ist es außer Kontrolle geraten.
Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich meinen Vater an unserem kleinen Küchentisch vorgefunden, besinnungslos, mit einer leeren Wodkaflasche vor sich. Normalerweise verbringt Dad einen Teil des Tages bei Aiden im Krankenhaus, während ich den Feinkostladen manage. Ich besuche meinen Bruder dann nach der Arbeit und bleibe so lange wie möglich. Oft schlafe ich auf dem Stuhl neben Aidens Bett ein und schleiche mich in den frühen Morgenstunden leise hinaus.
Heute Morgen war Dad nicht in der Lage, irgendwohin zu gehen. Ich bekam ihn kaum von seinem Stuhl hoch, und dann stolperte er den kurzen Flur hinunter in sein Zimmer, wo er mit dem Gesicht voran aufs Bett fiel. Er murmelte etwas von Aidens Tod, aber ich konnte es nicht ertragen, das zu hören, also ließ ich ihn dort liegen, damit er seinen Rausch ausschlafen konnte.
Ich konnte Aiden nicht allein lassen. Er ist schon über fünf Wochen im Krankenhaus, und jetzt warten wir darauf, ob die Transplantation funktioniert. Es ist wichtig, dass einer von uns bei ihm ist. Ich habe den Feinkostladen aufgemacht, alles für den Tag vorbereitet und ihn Georgie überlassen, auf den man sich gelegentlich sogar verlassen kann. Er wird den Laden hoffentlich nicht abfackeln, wie Aiden es prophezeit hat.
Woher hätte ich wissen sollen, dass mein Vater nicht umfallen und seinen Rausch ausschlafen, sondern sich dazu entscheiden würde, ins Krankenhaus zu gehen? Wieder erschaudere ich beim Gedanken daran, wie katastrophal das alles hätte enden können. Er hätte einen Unfall bauen, verhaftet werden oder eine noch größere Szene machen können. Zum Glück war Boone da. Er hat die Katastrophe abgewendet.
„Er braucht Hilfe“, meint Aiden und reißt mich aus meinen Erinnerungen.
„Ja“, bestätige ich seufzend und setze mich auf die Bettkante. „Ich suche schon nach Plätzen in Entzugskliniken …“
„Nein, ich meine Boone“, unterbricht Aiden.
Ich runzle verwirrt die Stirn. „Was?“
„Er wird Hilfe dabei brauchen, Dad zu beruhigen, wenn sie nach Hause kommen. Jetzt mag Dad noch gefügig sein, so betrunken, wie er ist, aber sobald er wieder nüchtern ist, wird er versuchen, hierher zurückzukommen, weil er sich so schuldig fühlen wird, und du kannst nicht erwarten, dass Boone auf ihn aufpasst.“
„O Scheiße“, flüstere ich, springe auf und suche nach meiner Handtasche. Aiden hat recht, und es ist traurig, dass er die Handlungen unseres Vaters so genau vorhersehen kann, weil wir das alles schon einmal erlebt haben. Rasch beuge ich mich über das Bett und küsse ihn durch die Papiermaske hindurch auf die Stirn. „Ich kümmere mich darum und bin gleich wieder da.“
„Das musst du nicht“, sagt er ernst, und ich weiche ein Stück zurück, um ihm in die Augen zu sehen.
Ein unfassbar reifes, liebevolles Kind starrt mich an. Mein Partner durch dick und dünn. Ich kümmere mich vielleicht neunzig Prozent der Zeit um Aiden, aber er hält mir den Rücken frei, wenn ich ihn brauche.
„Bis gleich“, wiederhole ich mit scharfem Blick. „Ich kümmere mich um Dad, schaue nach Georgie und komme dann zurück, um dir bei Schiffe versenken in den Arsch zu treten. Soll ich dir was mitbringen?“
„Käsepopcorn“, antwortet er lächelnd.
„Alles klar.“ Damit beuge ich mich noch einmal über ihn und küsse ihn auf den Kopf. „Ich liebe dich.“
„Ich liebe dich auch.“
***
Wir haben das Glück, dass wir höchstens etwa zwanzig Minuten von der Klinik entfernt wohnen. Mein Arbeitsweg ist noch kürzer, da unsere Wohnung über dem Feinkostladen liegt. Es ist ein Familienbetrieb, den meine Eltern gegründet und nach meiner Mutter Monica Moni’s genannt haben. Ich bin nicht nur in unserer Wohnung über dem Laden aufgewachsen, sondern habe einen Großteil meines Lebens unten an der Theke verbracht, während meine Eltern dicke Sandwiches zubereiteten und mit ihren langjährigen Kunden lachten. Mit zehn Jahren konnte ich schon das perfekte italienische Sandwich zubereiten und die Kunden ganz allein bedienen.
Das war auch gut so, denn als meine Mutter zwei Jahre später an einem unerkannten Herzfehler starb, konnte ich einspringen und meinem Vater helfen, das Geschäft am Laufen zu halten. Außerdem kümmerte ich mich um den erst zweijährigen Aiden. Wir waren nur zu dritt, und der Verlust war schwer zu verkraften, aber wir hielten zusammen und schafften es.
Hinter dem Deli gibt es eine Gasse mit drei Privatparkplätzen. Ich stelle meinen Wagen neben Boones Porsche und bin erleichtert, dass dort auch das Auto meines Vaters steht, was bedeutet, dass er nicht zum Krankenhaus gefahren ist. Noch immer bin ich mir nicht sicher, wie ich mich dabei fühle, einen völlig Fremden in dieses Chaos zu lassen, um uns zu helfen, aber der Zug ist abgefahren.
Ich steige die steile Treppe zur Wohnungstür hinauf, trete ein und lege meine Handtasche auf den halbhohen Raumteiler, der den kleinen Essbereich auf der rechten Seite abschirmt. Von dem langen Flur geradeaus gehen die drei Schlafzimmer ab, das Wohnzimmer liegt auf der linken Seite und eine Küche gleich hinter dem Essbereich.
Kaum habe ich den ersten Schritt in die Wohnung gemacht, kommt Boone aus dem Zimmer meines Vaters und zieht die Tür hinter sich zu. Er zuckt leicht zusammen, als er sich umdreht und mich sieht.
„Ist alles in Ordnung?“, frage ich.
„Er schläft und wird wohl noch eine Weile weggetreten sein.“
Ich weiß nicht recht, was ich sagen soll, aber eine Entschuldigung scheint angebracht. „Es tut mir so leid, dass wir Sie in diese Sache hineingezogen haben. Das ist mir peinlich …“
Boone hebt die Hand, während er auf mich zukommt. „Halt. Sie brauchen sich für nichts zu entschuldigen. Es hat mir nichts ausgemacht, zu helfen.“
Er bleibt ein Stück von mir entfernt stehen und steckt die Hände in die Taschen.
„Sie sagten, Sie hätten Erfahrung damit“, hake ich nach.
Ein Lächeln huscht über sein Gesicht – ein bisschen bitter, ein bisschen süß. „Mein Vater ist Alkoholiker. Er ist jetzt seit fünfzehn Jahren trocken, aber ich war damals etwas jünger als Aiden jetzt, also weiß ich ungefähr, wie er sich fühlt. Ich habe auch gesehen, wie meine Mutter und meine älteren Geschwister mit meinem Vater umgehen mussten, wenn er betrunken war – wir sind Leidensgenossen.“
Ich nicke verständnisvoll. „Es tut mir leid, dass Sie das durchmachen mussten, doch heute war es ein Glücksfall für uns.“
Boone lacht. „Ich bin froh, dass ich da war.“
„Das bin ich auch. Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?“
„Nein danke. Ich muss jetzt los.“
„Klar.“ Ich öffne die Tür und trete zur Seite. „Nochmals vielen Dank.“
Auf dem Treppenabsatz fragt Boone: „Was hat es mit dem Feinkostladen unten auf sich? Arbeiten Sie dort?“
„Er gehört unserer Familie. Ist nach meiner Mutter benannt. Sie ist vor fast zehn Jahren gestorben.“
Mitgefühl spiegelt sich in Boones Augen. „Das tut mir leid.“
„Danke. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber noch mal vielen Dank auch für die Hilfe mit meinem Vater. Das war unglaublich nett.“
„Nichts zu danken.“ Boone winkt und ist die halbe Treppe hinunter, ehe er sich umdreht und zurückschaut. „Wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie mich hoffentlich an.“
Mir bleibt leicht der Mund offen stehen. Ich weiß nicht einmal, was das heißen soll. Er ist ein völlig Fremder, und ich würde nie auf die Idee kommen, ihn um Hilfe zu bitten. „Das ist wirklich nett, aber …“
„Sie haben meine Nummer“, fällt mir Boone ins Wort. „Benutzen Sie sie, und vielleicht sehen wir uns irgendwann im Krankenhaus, okay?“
Ich ringe die Hände und denke, dass dies einer der merkwürdigsten Tage ist, die ich je erlebt habe. „Ähm … okay.“
„Okay“, bekräftigt er mit einem Lächeln, und zum ersten Mal erlaube ich mir, zu registrieren, wie gut er aussieht. Ich betrachte sein langes dunkelblondes Haar und seine blauen Augen, die etwa zehn Nuancen dunkler sind als meine, aber sehr ausdrucksstark. Sein gepflegter Bart verdeckt weder seine vollen Lippen noch das strahlende Lächeln, das er mir schon mehr als einmal geschenkt hat. Warum habe ich das noch nie bemerkt? „Es war schön, Sie kennenzulernen, Lilly.“
„Hat mich auch gefreut“, bringe ich hervor.
Nicht nur gutaussehend, sondern dazu noch ein verdammter berühmter Eishockeyprofi.
Der gerade meinen betrunkenen Vater nach Hause gebracht hat.
Wieder überkommt mich tiefe Verlegenheit, und ich flüchte mich in die Wohnung. Mit klopfendem Herzen lehne ich mich an die Tür und überlege, ob mein Leben noch komplizierter werden kann.
Kapitel 3
Boone
Unruhig tigere ich in meiner Wohnung in der Innenstadt von Pittsburgh auf und ab. Ich habe alles gepackt und bin bereit, morgen früh nach Detroit zu fliegen. Es ist ein Hin- und Rückspiel, und ein Sieg würde uns den ersten Platz in der Division sichern. Danach noch ein Heimspiel, und dann beginnt am Samstag die erste Runde der Play-offs.
Den Rest des Abends sollte ich damit verbringen, mich zu entspannen, was für mich bedeuten kann, dass ich Gitarre spiele oder zeichne, um auf andere Gedanken zu kommen.
Das muss ich dringend, denn ich kann nicht aufhören, an Aiden und Lilly zu denken. Und an Steven.
Ich habe jetzt eine Verbindung zu allen dreien.
Aiden ist ein sehr kranker kleiner Junge, der alle Liebe, Unterstützung und Freundschaft braucht, die er kriegen kann, und ich bin dankbar, Zeit mit ihm verbringen zu können.
Steven ist in vielerlei Hinsicht wie mein Vater. Die Gründe für das Trinken sind vielleicht nicht dieselben, aber beide hassen sich für ihre Schwäche. Wie mein Vater verleugnet Steven seine Schwäche nicht, und das bedeutet, dass es Hoffnung gibt, dass er trocken werden kann.
Dann ist da noch Lilly. Sie erinnert mich an meine älteren Geschwister Damien und Claire. Beide waren da, um mich zu beschützen und vor den Auswüchsen der Alkoholsucht meines Vaters zu bewahren. Ich habe einiges gesehen, doch ich frage mich, wie viel mir erspart blieb, weil sie mich konsequent davor beschützt haben.
Aber Lilly ist weit mehr für Aiden. Sie ist seine wichtigste Bezugsperson, während er sich durch die Behandlung seiner Krankheit kämpft. Das habe ich von Steven erfahren, nachdem ich ihn nach Hause gebracht hatte, und es hat mich überrascht, denn ich habe immer nur Steven im Krankenhaus getroffen, wenn ich den Jungen besucht habe. Zugegeben, das war nicht so oft, aber heute bin ich zum ersten Mal Lilly dort begegnet.
Als ich zu der Adresse kam, die Lilly mir gegeben hatte, war ich verwirrt, weil es sich um einen Feinkostladen und nicht um eine Wohnung handelte. Ich musste Steven schütteln, um ihn dazu zu bringen, mir zu sagen, dass sie über dem Deli wohnen und ich hinten parken soll.
Es gelang mir, ihn aus dem Auto zu holen, und obwohl er ziemlich wackelig auf den Beinen war, war er zumindest wach und gesprächig, als ich ihm die Treppe hinaufhalf.
Seine Worte waren etwas verwaschen, aber ich verstand ihn gut. „Tut mir wirklich leid, dass Sie das tun mussten, Boone. Ich schäme mich so.“
„Ja, nun … das ist definitiv ein berechtigtes Gefühl“, antwortete ich und legte den Arm um seine Taille, um ihn auf dem Weg die Treppe hinauf zu stützen.
„Meine Kinder haben etwas Besseres verdient“, klagte er.
„Stimmt.“
„Aiden braucht einen Vater, auf den er sich verlassen kann.“
„Auch richtig.“
„Meine arme Lilly.“ Steven blieb auf halbem Weg stehen und drehte sich zu mir um. „Sie trägt die Last der Welt auf ihren Schultern. Lilly reißt sich den Arsch auf, um den Laden am Laufen zu halten, verbringt ihre Abende mit Aiden und muss sich dann auch noch mit mir herumschlagen. Sie hasst mich jetzt bestimmt.“
„Sie liebt Sie“, antwortete ich. Obwohl ich Lilly überhaupt nicht kannte, war ich mir dessen sicher, denn ich hatte gesehen, wie besorgt sie im Krankenhaus um ihn gewesen war. Ja, sie war entsetzt und verlegen gewesen, aber vor allem hatten in ihrem Blick eine aus tiefer Liebe geborene Sorge gelegen.
Ich bugsierte Steven den Rest des Weges nach oben. Die kleine Wohnung der Familie beachtete ich kaum, sondern half ihm in sein Schlafzimmer und brachte ihn auf der Bettkante in eine sitzende Position. Er starrte mich schweigend an, als ich in die Hocke ging, um ihm die Schuhe auszuziehen, und ließ den Kopf hängen. Dann legte ich seine Beine auf die Matratze und schob ihm das Kissen unter den Kopf, damit er bequemer lag. Ich hatte oft genug beobachtet, wie meine Mutter das für meinen Vater tat.
Beobachtet hatte ich auch, wie meine Mutter die schwierigen Gespräche mit ihm führte, aber sie zeigten größere Wirkung, wenn er nüchtern war. Andererseits wusste ich nicht, ob ich Steven je wiedersehen würde, also nutzte ich die Gelegenheit.
Ich stellte mich an sein Bett und vergewisserte mich, dass seine blutunterlaufenen Augen auf mich gerichtet waren. „Sie müssen aufhören, zu trinken, und ich bin mehr als bereit, Ihnen dabei zu helfen. Lilly und Aiden brauchen Ihre Unterstützung, und die können Sie ihnen nicht geben, wenn Sie betrunken sind. Die Belastung ist zu groß für die beiden.“
„Ich weiß“, sagte er missmutig. „Es ist nur … ich kann nicht aufhören. Ich hab’s versucht.“
Es wäre so einfach gewesen, zu sagen: „Strengen Sie sich an!“, doch so funktioniert Alkoholismus nicht. „Sie brauchen professionelle Hilfe. Ich kann Ihnen einen Platz in einer Entzugsklinik besorgen, aber Sie sollten sich zumindest eine AA-Gruppe suchen, zu der Sie gehen können. Am besten noch heute, wenn Sie wieder nüchtern sind. Ich habe eine Freundin, die einen guten Sponsor für Sie ausfindig machen könnte.“
Steven nickte, aber ich war nicht sicher, ob er dem zustimmte, was ich sagte. Ich weiß, ich kann ihn zu nichts zwingen, und es steht mir nicht zu, mich einzumischen, doch ich machte ihm das Angebot trotzdem. Steven gab mir seine Telefonnummer, ich versprach ihm, ihm einige Infos zu schicken, und bald darauf schlief er ein.
Ich erzählte Lilly nichts von meinem Hilfsangebot, hauptsächlich, weil ich sie nicht überfordern wollte. Sie hatte diesen Blick, der deutlich machte, dass sie an diesem Tag nicht noch mehr Komplikationen verkraften konnte, und außerdem merkte ich, dass ihr meine Beteiligung an alldem unangenehm war.
Nicht, dass ich ihr eine Wahl gelassen hätte. Ich sah, dass Lilly Hilfe brauchte, also bin ich eingesprungen, und ich bereue es nicht. Aber als ich ihre Wohnung verließ, wirkte sie nicht hundertprozentig begeistert.
Mein Handy klingelt, und ich gehe in die Küche, um es vom Tresen zu nehmen. Es ist der Anruf, auf den ich gewartet habe. „Hallo.“
„Hey … ich bin’s, Harlow.“
„Danke für den Anruf. Ich habe hier jemanden, der Hilfe braucht.“
Harlow Alston ist die Verlobte meines Mannschaftskameraden Stone Dumelin. Sie ist Anwältin hier in Pittsburgh, aber was mir im Augenblick noch wichtiger ist: Sie ist Alkoholikerin. Seit ein paar Jahren ist sie trocken, geht regelmäßig zu den Anonymen Alkoholikern und scheut sich nicht, über ihre Probleme zu sprechen. Sie ist immer bereit, anderen zu helfen, und sie war genau die Person, von der ich wusste, dass ich mit ihr reden musste, als ich heute die Wohnung der Hoffmans verließ. Also schickte ich Stone eine Nachricht, dass er sie bitten möge, mich anzurufen, wenn sie Zeit hat.
Ich erzähle ihr von Steven und wie ich ihn kennengelernt habe. Dann berichte ich ihr, was heute passiert ist, und schlage eine Entzugsklinik oder die AA vor. Harlow lauscht schweigend. Ich höre, wie sie einatmet, als ich sage: „Ich habe das schon mal mit meinem Vater durchgemacht.“
„Davon hatte ich keine Ahnung“, sagt sie leise.
„Er ist seit fünfzehn Jahren trocken.“ Der Stolz in meiner Stimme ist nicht zu überhören. „Mein Vater hat eine dreißigtägige Entziehungskur gemacht, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob Steven das kann, vor allem, weil Aiden im Krankenhaus ist. Ich bin auch nicht sicher, ob ich verstehe, was mit ihm los ist.“
„Die Krankheit seines Sohnes ist ein Stressfaktor“, erklärt sie. „Je nach den Umständen kann Zeit ein kostbares Gut sein. Es gibt hervorragende ambulante Programme in der Gegend, aber vielleicht braucht er eine medizinische Entgiftung. Ich werde eine Liste zusammenstellen und einen Vorschlag für eine gute stationäre Einrichtung machen, falls das eine Option ist, und wenn du mir sagst, wo er wohnt, kann ich eine AA-Gruppe und einen Sponsor für ihn raussuchen.“
„Das wäre toll. Ich weiß das wirklich zu schätzen.“
„Du bist ein Supertyp, Boone.“
„Nein“, wehre ich das Kompliment ab. „Ich versuche nur, etwas zurückzugeben.“
Harlow verspricht, mir die Informationen zu schicken, sobald sie sie hat, und nach dem Auflegen erwarte ich, mich zufrieden zu fühlen, weil ich etwas getan habe, um Steven zu helfen. Doch ich bin zappelig, als hätte ich noch mehr Arbeit vor mir.
Ich überlege, ob ich Aiden anrufen soll, um mich nach seinem Befinden zu erkundigen, aber ich verwerfe den Gedanken. Das ist es nicht, was mich tief in meinem Inneren beunruhigt.
Mein Blick fällt auf die Küchenuhr, während ich mich an den kleinen Küchentresen lehne, der das Wohnzimmer von der Küche trennt. Ist es zu spät, um Lilly anzurufen?
Soll ich sie überhaupt anrufen, um mich zu melden?
Ich erinnere mich, dass ich noch nie vor Dingen zurückgeschreckt bin, die ich nicht tun sollte, scrolle durch meine Kontakte und wähle ihre Nummer. Es klingelt viermal, und ich rechne schon damit, dass ihre Mailbox gleich drangehen wird, meldet sie sich flüsternd. „Hallo?“
„Boone hier. Störe ich?“
„Nein“, antwortet sie leise, und ich höre ein Rascheln. „Ich bin in Aidens Zimmer, und er ist gerade eingeschlafen. Lassen Sie mich rausgehen.“ Ich warte ein paar Sekunden, dann sagt sie: „Okay … jetzt kann ich reden. Was kann ich für Sie tun?“
Was sie für mich tun kann? Ich muss spontan lächeln. „Ach, ich wollte nur fragen, wie es mit Ihnen, Aiden und Ihrem Vater läuft.“
Sie seufzt müde. „Alles in Ordnung. Ich bin zurück ins Krankenhaus gefahren, um den ganzen Tag mit Aiden zu verbringen. Mein Vater hat vor ein paar Stunden angerufen und ist nüchtern. Es tut ihm sehr leid, doch wie Sie sicher wissen, ist das normal, wenn man so etwas abgezogen hat.“
„Ja, das Bedauern ist immer da, aber wird es für eine Veränderung reichen?“
„Keine Ahnung, wie viel schlimmer es noch werden muss, damit er aufhört, zu trinken.“ Frustration und Wut liegen in ihrer Stimme, und das nicht zu Unrecht.
„Ich habe heute kurz mit Ihrem Vater darüber gesprochen, dass er Hilfe braucht. Er schien offen dafür zu sein. Seit wann trinkt er?“
Lilly antwortet nicht sofort, und ich fürchte schon, ich wäre zu weit gegangen. Dann seufzt sie noch einmal. „Ich erinnere mich, dass er nach dem Tod meiner Mutter getrunken hat, allerdings nicht so, dass es seine Fähigkeit beeinträchtigt hätte, sich um mich und Aiden zu kümmern.“
„Wie alt waren Sie da?“ Ich lasse mich auf dem Sofa nieder und lege die Füße auf den Couchtisch.
„Zwölf. Aiden war zwei.“ Ihre Stimme bleibt leise, ist kaum lauter als ihr ursprüngliches Flüstern. „Wir hatten eine Weile zu kämpfen. Dad stürzte sich in die Arbeit. Er hatte das Deli zusammen mit Mom geführt, also war er plötzlich auf sich allein gestellt, wobei ich glaube, genau das half ihm, nicht in Trauer zu versinken. Nachdem Aidens Krankheit ausgebrochen war, verschlimmerte sich sein Alkoholkonsum. Trotzdem schaffte er es, aufzustehen und den Laden zu öffnen, und ich half nach der Schule ein paar Stunden lang aus. Wenn Aiden im Krankenhaus war, bin ich mit dem Bus hingefahren, um bei ihm zu übernachten.“
„Mein Gott … wie alt waren Sie da?“
„Fünfzehn zum Zeitpunkt der Diagnose. Achtzehn, als er wieder krebsfrei war.“
„War Ihr Vater in dieser Zeit je trocken?“
„Nachdem Aiden in Remission war und die Dinge besser aussahen, hat er deutlich weniger getrunken. Nur noch so viel wie kurz nach Moms Tod. Ein paar Drinks am Abend, die allerdings jeden Abend.“
„Seit Aidens Krebs zurückgekommen ist, trinkt er wieder mehr?“, vermute ich.
Ihre Stimme wird eine Oktave tiefer. „Er betrinkt sich nicht jeden Abend, aber immer häufiger.“
Ich reibe mir den Nacken, während ich über die Umstände nachdenke. „Hören Sie, Lilly … ich würde gerne helfen. Bitte sagen Sie mir, ich soll mich raushalten, wenn Sie das wollen. Ich weiß, wir haben einander gerade erst kennengelernt, doch ich empfinde echte Sympathie für Ihren Bruder und ehrlich gesagt auch für Sie, weil ich das selbst schon durchgemacht habe.“
„Es kommt mir nur etwas seltsam vor, dass Sie helfen wollen“, gesteht sie mit einem nervösen Lachen.
Das bringt mich zum Schmunzeln. „Weshalb?“
„Ähm … weil Sie ein berühmter Eishockeyspieler sind, der sicher Wichtigeres zu tun hat.“
„Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als jemandem zu helfen.“ Das ist die Wahrheit, so haben meine Eltern meine Geschwister und mich erzogen. „Mein Angebot ist ehrlich gemeint, und ich hoffe, Sie nehmen es an.“
„Ich bin nicht gut darin, um Hilfe zu fragen. Wissen Sie, ich habe die Dinge so lange allein geregelt, dass ich glaube, das müsste so sein.“
„Nun, ich gebe Ihnen die Erlaubnis zu fragen und befehle Ihnen, sich nicht schlecht zu fühlen, wenn Sie Hilfe bekommen, okay?“
Wieder ein langer Moment des Schweigens, und ich weiß, sie ringt mit sich. Aber dann flüstert sie das Wort, auf das ich warte: „Okay.“
„Sehr gut“, rufe ich aus, erleichtert, dass sie an Bord ist. „Ich habe heute mit einer Freundin gesprochen – eigentlich ist sie die Verlobte eines Mannschaftskollegen. Sie ist Alkoholikerin und seit einiger Zeit trocken. Harlow wird ein paar Adressen für Ihren Vater heraussuchen. Ich kann sie entweder direkt an ihn weiterleiten oder sie Ihnen geben, damit Sie mit ihm darüber sprechen können.“
„Was halten Sie für das Beste?“, fragt sie zögernd.
„Ich denke, beides. Er soll es von uns beiden hören. Aber wenn er einer Behandlung zustimmt, bin ich gerne bereit, ihm dabei zu helfen, dorthin zu kommen, wo er hinmuss. Sie haben mit dem Deli und Aiden schon genug zu tun.“
„Äh …“
„Machen Sie sich keine Gedanken“, befehle ich streng. „Hören Sie auf, sich wegen meiner Hilfe den Kopf zu zerbrechen.“
Wieder ein leises Lachen – es tut gut, es zu hören. „Okay. Akzeptiert.“
„Ich habe morgen ein Auswärtsspiel in Detroit, werde aber übermorgen zurück sein. Dann will ich im Krankenhaus vorbeischauen, um Aiden zu sehen. Sobald ich Informationen von Harlow habe, können wir darüber sprechen, wie wir sie Ihrem Vater am besten präsentieren.“
„Gut.“ Sie hält inne, atmet ein und, wie ich höre, langsam wieder aus. „Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen dafür danken soll.“
„Das ist nicht nötig.“
„Sie kriegen trotzdem Dank, in großen Portionen“, scherzt sie.
Ich muss lachen. „Na gut. Und … Lilly?“
„Ja?“
„Fahren Sie nach Hause und schlafen Sie sich aus. Sie haben heute lange genug für Ihre Familie gearbeitet.“
Sie antwortet mir mit meinen eigenen Worten: „Na gut. Dann gute Nacht, Boone.“
„Gute Nacht, Lilly.“
Nachdem wir aufgelegt haben, klopfe ich mit dem Handy auf meinen Oberschenkel, lege den Kopf in den Nacken und starre an die Decke. Es fühlt sich … richtig an, dieser Familie zu helfen. Ich möchte Lilly den Stress von den Schultern nehmen, und ich will nicht, dass Aiden sich Sorgen um seinen Vater machen muss. Ich möchte, dass Steven gesund wird, damit er seine beiden wunderbaren Kinder unterstützen kann.
Außerdem möchte ich Lilly lächeln sehen. Ihr Lachen war wie Musik in meinen Ohren. Es klang sanft und ließ mich an eine Frühlingsbrise denken.
Ich schnaube leise, aber es ist mir nicht peinlich, für Lilly zu schwärmen. Sie ist eine faszinierende Frau. Stark und doch sensibel. Wenn ich ehrlich bin, ist sie auch sehr attraktiv. Ihre hellblauen Augen und die vollen Lippen haben mich zum Staunen gebracht, und sie hat tolle Kurven.
Nicht, dass ich etwas mit ihr anfangen möchte. Es ist nur … sie ist wunderschön, süß und bezaubernd, und ich freue mich darauf, sie besser kennenzulernen.
Kapitel 4
Lilly
Während Georgie die Vitrinen mit Fleisch, Käse, Nudelsalat und Obst auffüllt, putze ich den Speisebereich gründlich. Ich versprühe Reinigungsmittel, wische Tische und Stühle mit einem Tuch ab und trockne sie mit einem anderen. Alle Krümel, die auf den Boden gefallen sind, fege ich weg. Charles ist hinten und schrubbt die Küche, so schließen wir immer den Mittagsansturm ab. Wir haben noch etwa zwei Stunden Zeit, bis das Geschäft wieder anzieht, wobei unsere Abendkundschaft in der Regel eher Speisen zum Mitnehmen als zum im Deli essen kauft.
Ich räume alles auf mit Ausnahme eines einsamen Bereichs am Tresen, wo Stu an einem Kreuzworträtsel arbeitet, während er zu Mittag isst: Geflügelsalat auf Roggenbrot mit hausgemachten Pommes. Er wohnt gleich um die Ecke und kommt regelmäßig dienstags und donnerstags her, allerdings meist erst nach dem großen Ansturm.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: