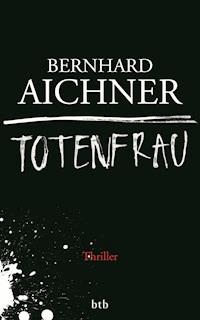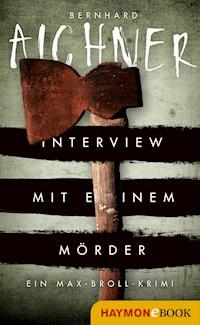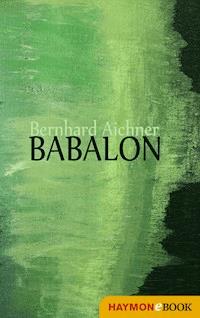2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Mit Bösland ist Bernhard Aichner ein Kabinettstück des Psychothrillers gelungen." (Marc Elsberg)
Sommer 1987. Auf dem Dachboden eines Bauernhauses wird ein Mädchen brutal ermordet. Ein dreizehnjähriger Junge schlägt sieben Mal mit einem Golfschläger auf seine Mitschülerin ein und richtet ein Blutbad an. Dreißig Jahre lang bleibt diese Geschichte im Verborgenen, bis sie plötzlich mit voller Wucht zurückkommt und alles mit sich reißt: Der Junge von damals mordet wieder …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Sommer 1987. Auf dem Dachboden eines Bauernhauses wird ein Mädchen brutal ermordert. Ein dreizehnjähriger Junge schlägt sieben Mal mit einem Golfschläger auf seine Mitschülerin ein und richtet ein Blutbad an. Dreißig Jahre lang bleibt diese Geschichte im Verborgenen, bis sie plötzlich mit voller Wucht zurückkommt und alles mit sich reißt: Der Junge von damals mordet wieder …
Zum Autor
Bernhard Aichner (1972) lebt als Schriftsteller und Fotograf in Innsbruck. Er schreibt Romane, Hörspiele und Theaterstücke. Für seine Arbeit wurde er mit mehreren Literaturpreisen und Stipendien ausgezeichnet, zuletzt mit dem Burgdorfer Krimipreis 2014, dem Crime Cologne Award 2015 und dem Friedrich Glauser Preis 2017.
Seine Totenfrau-Thriller standen monatelang an der Spitze der Bestsellerlisten. Die Romane wurden in 16 Länder verkauft, u.a. auch nach USA und England. Eine US-Verfilmung ist in Vorbereitung.
Bernhard Aichner
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlaggestaltung: semper smile, München
in Zusammenarbeit mit Bernhard Aichner Umschlagmotiv: © shutterstock/lapas77; STILLFX; Picsfive; I WALL; Valentine Agapov
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-17205-3V002www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Ferdinand.Danke für deine Freundschaft.Ich liebe dich, Mann.
Ich kann mich wieder an alles erinnern.
Er hing an dem Gürtel, mit dem er mich immer geschlagen hat. Ich starrte sein Gesicht an, seinen offenen Mund, seine weiße Haut. Und die Hände, die still an seinen Armen herunterhingen. Da war nichts mehr, das mir Angst machte. Ich war glücklich, vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben.
1984. Der kleine Ben und der tote Mann. An einem Samstagmorgen war ich aufgewacht und hatte ihn gesucht. Mein zehnter Geburtstag war es. Ich wollte, dass er mich in den Arm nimmt, mir gratuliert. Ich machte Frühstück für ihn, Eierspeise, Orangensaft, ich deckte den Tisch für uns beide. Aber egal, wie laut ich nach ihm rief, er kam nicht. Ich dachte, er wäre ins Dorf gegangen, um ein Geschenk für mich zu besorgen. Eine Überraschung für dich, Ben. Ich hoffte, dass er sich zu diesem Tag etwas Besonderes für mich einfallen ließ. Ein neues Fahrrad für dich, Ben. Der Kassettenrekorder, den du dir schon so lange gewünscht hast. Du hast es dir verdient, Ben. So fleißig, wie du bist. Doch nichts.
Zwei Wochen war ich allein mit ihm gewesen. Zwei Wochen lang hatte er täglich seine Wut an mir ausgelassen. Deine Mutter ist schwach, sagte er. Ich werde dafür sorgen, dass du nicht so wirst wie sie.Dreckskuh nannte er sie. Weil sie zur Kur gefahren war, weil ihr Kreuz kaputt war und auch sonst alles. Sie hatte es nicht mehr ausgehalten. Es tut mir leid, Ben, ich muss kurz für mich sein. Sie hatte mich zurückgelassen bei ihm und war verschwunden. Da waren nur mehr seine Hände auf mir. Keine Geburtstagstorte für mich. In drei Wochen bin ich wieder da. Du schaffst das schon, hat sie gesagt.Obwohl ich nur ein Kind war.
Der Kühlschrank war voll, Mutter hatte vorgekocht, Eintopf, Knödel, Braten, sie wollte nicht, dass er Hunger hat. Dass er wütend wird. Sie wollte immer so tun, als wäre alles in bester Ordnung, als gäbe es kein Problem, keine Gewalt. Kein Kind, von dem sie täglich mit traurigen Augen angestarrt wurde. Sie wollte Augen, die strahlen. So wie an diesem Tag, an dem ich ihn fand. Tot am Dachboden der alte Mann.
Irgendwie fühlte es sich so an, als wäre ich der Sieger nach einem langen ungleichen Kampf. Auch wenn ich kurz Angst hatte, dass sein Mund wieder aufgehen würde, dass er seine Hand wieder heben, dass ich seinen Gürtel wieder auf meinem Rücken spüren könnte, es passierte nicht. Er bewegte sich keinen Zentimeter mehr. Erst als ich ihn mit einem Stock berührte, ihn vorsichtig an seinem Oberschenkel stupste, da begann er ganz langsam hin- und herzuschwingen. Wie ein kleines Kind auf einer Schaukel. Harmlos, friedlich, er konnte mir nichts mehr tun. Keine Schläge mehr. Keine Nächte mehr, in denen ich wach lag, weil ich wusste, dass er kommen würde. Betrunken aus dem Wirtshaus, direkt in mein Zimmer, weil der Weg zu mir der nächste war, weil es ihn besänftigte, wenn er sich um mich kümmerte, wenn er mir zeigte, wie stark er war. Wahrscheinlich ging es ihm besser, wenn er mich schlug, seine Welt war für kurze Zeit wieder in Ordnung, wenn er mich zwang, mit ihm nach oben zu gehen.
Komm mit mir ins Bösland, hatte er immer gesagt. Mitten in der Nacht, morgens, nachmittags, immer wenn ihm danach war. Ich hatte keine Wahl, nie hatte ich eine gehabt. Und meine Mutter hatte es geduldet. Sie hatte nichts getan, um es zu verhindern. Sie half mir nicht, hielt ihn nie davon ab, mich vor sich her die Treppe nach oben zu treiben. Ins Bösland. Um mich zu bestrafen. Weil ich den Stall nicht sauber genug gemacht hatte. Weil ich mich nicht um die Hühner gekümmert hatte.Irgendetwas fiel ihm immer ein, es gab immer einen Grund. Du lässt mir keine andere Wahl, Ben. Dann schlug er zu mit seinem Gürtel. Immer wieder auf meinen Rücken, auf mein Hinterteil. Komm mit mir ins Bösland, Ben. Seit ich denken kann. Seit ich alt genug war, die steilen Treppen mit ihm nach oben zu steigen.
Er war Lkw-Fahrer, Nebenerwerbsbauer und Trinker. Man hatte ihm gekündigt, weil er Benzin aus dem Tank seines Wagens abgezapft und verkauft hatte. Über die Jahre sollen es über zehntausend Liter gewesen sein. Man redete darüber im Dorf, hinter vorgehaltener Hand lästerten sie. Nur knapp sei er dem Gefängnis entgangen damals, nur der gute Wille des Speditionsunternehmers habe ihn gerettet. Der Junge braucht einen Vater, hatte es geheißen. Deshalb ließen sie ihn ziehen, deshalb konnte er auf mich losgehen, jahrelang. Sein Hass auf die Welt in meinem Gesicht. Einfach weil ihm danach war, regelmäßig die Abdrücke seiner Finger auf meiner Wange. Wie ich vor dem Badezimmerspiegel stand und darauf wartete, bis es verging. Aber es verging nicht. Es begann immer wieder von vorne. Wie ein Stempel war es, mit dem er mich markierte. Ein Brandzeichen, das sagte, dass ich ihm gehörte, dass er mit mir machen konnte, was er wollte. Ich werde dir so lange wehtun, bis du machst, was ich sage. Er brüllte, er trank, er schlug zu. Ich will, dass du dich besser um den Hof kümmerst, wenn ich nicht da bin. Um deine Mutter. Er bestrafte mich für sein Unglück. Er zog mich mit in seinen Abgrund, da war nichts Leichtes, keine unbeschwerten Tage im Sommer, kein schönes Wort. Nur Kux.
Mein Freund, der Grund, warum ich trotz allem immer wieder aufwachen wollte. Felix Kux. Der Sohn des Dorfarztes. Ich will nicht, dass du dich mit diesem reichen Schwachkopf triffst, hatte der Alte immer gesagt. Ich machte es trotzdem und bekam Schläge dafür. Aber Kux war es wert. Er war der einzige Mensch, mit dem ich reden konnte. Kux war meine Insel, er bewahrte mich vor dem Untergehen, dem Ertrinken. Verwundet und traurig ging ich an sein Land, wenn der Alte mit mir fertig war. Kux war für mich da, er nahm mich auf, er war so etwas wie Heimat. Er kümmerte sich um mich. Und er war auch der Erste, den ich anrief damals.
Bitte komm, habe ich gesagt. Es ist etwas passiert. Und Kux war neugierig. Ob es etwas Gutes sei, fragte er mich. Ich sagte Ja und starrte das grüne Telefon an, das vor mir auf dem Tischchen im Gang stand. Die Wählscheibe, die Zahlen. Kurz hatte ich überlegt, in der Kuranstalt anzurufen, es meiner Mutter zu sagen, den Bestatter anzurufen, Kux’ Vater. Er wäre gekommen und hätte den alten, bösen Mann einfach vom Balken geschnitten. Doktor Kux hätte sich wahrscheinlich widerwillig auch um mich gekümmert, um den ungeliebten Freund seines Sohnes, den Jungen aus armen Verhältnissen. Er hätte keine andere Wahl gehabt, er hätte den Tod feststellen und mich zu meiner Mutter bringen müssen. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte, dass sein Sohn kommt, nicht er. Mein Freund, nicht sein Vater. Beeil dich, sagte ich. Dann legte ich den Hörer auf, wartete. Bis er kam und mit mir wieder nach oben ging.
Kux war fasziniert. Auch er hatte bis dahin noch nie eine Leiche gesehen. Er stand neben mir und starrte genauso lange, wie ich es getan hatte. Auch er bewegte den leblosen Körper, er griff ihn sogar an. Zuerst war es nur ein Finger, den er vorsichtig auf die Leiche legte, dann war es die ganze Hand. Er ist so kalt, sagte Kux. Vielleicht sollten wir die Polizei rufen, sagte ich. Kux wehrte ab. Noch nicht, sagte er. Es ist doch egal, wenn er noch eine Zeit lang hier abhängt. Kux lachte. Und auch ich begann zu lachen. Weil alles in mir wollte, dass der alte Mann genau dort blieb, wo er war.
Ich wollte nicht, dass irgendjemand ihm den Gürtel abnahm. Ich wollte mir sicher sein, dass es vorbei war, dass er mir nie wieder wehtun würde. Der Mann, der mich großgezogen, der mir meinen Arm gebrochen hatte, als ich fünf Jahre alt gewesen war, weil ich nicht aufgehört hatte zu weinen in der Nacht. Er hat das nicht gewollt, sagte meine Mutter damals. Dein Vater steht unter Druck, es geht ihm nicht gut, wir müssen nachsichtig mit ihm sein. Noch fünf weitere Jahre lang schlug er mich, wann immer ihm danach war. Du darfst es niemandem sagen, Ben. Nichts von alledem. Wenn du darüber redest, was er mit dir macht, sperren sie ihn ein. Das willst du doch nicht, oder?
Ich wollte es. Aber ich schwieg. Ertrug es. Ich war nur ein Junge, der geschlagen wurde. Einer von vielen hinter verschlossenen Türen, ein Junge, der es verdient hatte. Weil Mutter mir sagte, dass es richtig war. Und weil da sonst niemand war, der ihr widersprach, mich beschützte. Vor diesem Satz, der immer und immer wieder kam. Dieser Satz, der auf mich einschlug. Komm mit mir ins Bösland, Ben. Ein Satz, den ich vergessen hatte. So lange Zeit war er verborgen gewesen in mir, vergraben war alles, verschüttet. Wie der tote Mann an seinem Gürtel hing. Und wie Kux sich vor Aufregung kaum halten konnte. Plötzlich fühlte sich alles so leicht an. Was wir getan haben, war falsch, und doch fühlte es sich irgendwie richtig an. Lass uns feiern, sagte Kux. Heute ist dein Geburtstag, Ben. Den wird dir der alte Sack nicht verderben. Kux war begeistert von seiner Idee, Geld damit zu verdienen und mit dem Geld eine Torte zu kaufen. Eine Torte und eine Flasche Wein. Das wird wunderschön, sagte er. Und das war es dann auch.
Sie standen Schlange vor dem Haus. Und sie bezahlten. Einer nach dem anderen legte Münzen in Kux’ Hand, sie hatten ihre Sparschweine geplündert, sie waren neugierig und aufgeregt, keiner wollte es verpassen. Der jüngste war acht Jahre alt, der älteste siebzehn. Die halbe Dorfjugend wollte eine Leiche sehen, den Erhängten. Kux war durch das Dorf geradelt und hatte die Werbetrommel gerührt. Er hatte ihnen eine Fahrt mit der Geisterbahn versprochen, sie sollten etwas sehen, das sie noch nie zuvor gesehen hatten. Einen Toten zum Anfassen. Ein großes Geheimnis war es, das alle teilen wollten. Einen ganzen Nachmittag lang. Und wir verkauften Tickets dafür. Sie kamen in Scharen, irgendwann konnten wir es nicht mehr aufhalten. Einer nach dem anderen war auf den Dachboden gestiegen, sie hatten das Bösland gestürmt.
Entsetzte Gesichter waren es, in die wir schauten, als sie ihn da hängen sahen. Sie hatten Angst, gruselten sich, die meisten hielten nur ein paar Augenblicke lang durch, sie ertrugen es nicht, hielten sich die Hände vor die Münder. Sie wurden kleinlaut, obwohl sie noch kurz zuvor damit geprahlt hatten, kein Problem damit zu haben, dem Tod ins Auge zu sehen. Sie stolperten eilig wieder die Treppen nach unten, liefen so schnell sie konnten davon. Kux und ich blieben zurück. Wir lachten, freuten uns, zählten die Münzen. Schnell verdientes Geld. Genug, um beim Konditor eine schöne Torte zu kaufen und unsere erste Flasche Wein.
Für meine Mutter, sagte ich im Supermarkt an der Kasse. Glücklich und zufrieden rannten wir in den Wald. Kux steckte eine Kerze in die Mitte der Torte und zündete sie an. Happy Birthday to you. Er sang für mich. Ich gratuliere dir, Ben. Dann aßen wir die Torte. Mit den Fingern griffen wir hinein und stopften sie in unsere Münder. Wir haben gelacht wie Kinder und Wein getrunken wie Erwachsene. Einen Schluck nach dem anderen, bis die Flasche leer war. Betrunken lagen wir nebeneinander im Moos. Die ganze Nacht lang. Schön war es. Ich kann mich wieder an alles erinnern.
Keine Tabletten mehr. Nie wieder.
– Und was ist dann passiert?
– Sie haben uns bestraft.
– Wie?
– Hausarrest, Belehrungen und Verachtung. Aber alles war besser als das, was vorher gewesen war.
– Ihre Mutter und die Eltern Ihres Freundes haben sich sicher große Sorgen um Sie gemacht.
– Nein, das haben sie nicht.
– Sie beide waren zehn Jahre alt. Sie sind die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Ich nehme an, es wurde Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um Sie zu finden.
– Wir waren nicht wichtig.
– Wie meinen Sie das?
– Es zählte nur, was die Leute im Dorf dachten. Nichts sonst. Meine Mutter wollte im Erdboden verschwinden, sie konnte es nicht ertragen, dass man sich das Maul über uns zerriss. Und auch Kux’ Vater schämte sich. Was passiert war, passte nicht in seine Welt.
– Sie meinen die Sache mit der Leichenschau?
– Ja. Er verbot seinem Sohn den Umgang mit mir, Kux junior musste sich von mir fernhalten, er sollte funktionieren und keine Schwierigkeiten mehr machen. Drei Wochen lang haben wir uns nicht mehr gesehen.
– Und dann?
– Haben wir uns heimlich getroffen.
– Wo?
– Im Bösland.
– Warum dort? Warum haben Sie ausgerechnet diesen Ort gewählt, um Ihre Freundschaft zu pflegen?
– Dieser Ort gehörte nur uns. Meine Mutter hat den Dachboden nach seinem Tod gemieden.
– Nach dem Tod Ihres Vaters?
– Ja.
– Warum sprechen Sie es nie aus?
– Was?
– Das Wort Vater.
– Ist das wichtig?
– Ich denke schon, dass Ihr Vater eine sehr wesentliche Rolle in Ihrem Leben gespielt hat.
– Er hat sich aufgehängt, und man hat ihn eingegraben. Mehr war da nicht.
– Haben Sie geweint bei der Beerdigung?
– Nein.
– Und später?
– Ich war einfach nur froh, dass er nicht mehr da war.
– Und wie hat Ihre Mutter reagiert?
– Sie hat gesagt, dass ich für das alles verantwortlich bin. Sie hat den ganzen Tag geheult, wochenlang. Ihre Welt war zusammengebrochen.
– Und Ihre?
– Ich habe eine neue entdeckt.
– Wie meinen Sie das?
– Wovor ich jahrelang Angst gehabt hatte, wurde plötzlich zu meinem allerschönsten Ort. Es hat sich so angefühlt, als hätte ich gewonnen.
– Gewonnen?
– Ich habe überlebt. Und er ist gestorben.
– Aber der Tod eines Menschen ist doch ein Verlust und kein Gewinn. War da neben der Erleichterung nicht noch etwas anderes?
– Was denn?
– Erinnern Sie sich auch an schöne Momente, die Sie mit Ihrem Vater teilten? Dinge, nach denen Sie sich gesehnt haben? Was ist mit dem, was Sie sich von ihm erwartet und nie bekommen haben?
– Da ist nichts.
– Waren Sie nicht wütend, dass er einfach verschwunden ist? Dass er Sie allein gelassen hat?
– Er hat seine Strafe bekommen, oder?
– Im Bösland?
– Ja.
– Wieso nennen Sie es immer noch so?
– Weil es so heißt. Weil es immer so geheißen hat.
– Erzählen Sie mir, was Sie dort gemacht haben, Sie und Ihr Freund.
– Wir hatten Spaß.
– Alkohol?
– Auch.
– Was noch?
– Hundert schöne Dinge. Kux und ich, wir haben uns gutgetan. Ich hatte nur ihn. Und er hatte nur mich.
– Das klingt schön.
– War es auch. Niemand hat uns gesagt, was wir tun sollen und was nicht. Drei Jahre lang war alles in bester Ordnung. Es hätte immer so weitergehen können.
– Ist es aber nicht, oder?
– Nein.
– Wollen wir jetzt darüber reden?
– Nein.
– Lassen Sie sich Zeit. Wir müssen nichts überstürzen, alles wird Ihnen wieder einfallen, Sie werden sehen.
– Es tut weh, wenn ich daran denke. Was da noch war. Ich will das nicht. Mich erinnern. Ich kann nicht, verstehen Sie?
– Ich werde Ihnen etwas verschreiben.
– Nein. Keine Tabletten mehr. Nie wieder.
– Die Tabletten machen es leichter, glauben Sie mir.
– Ich habe Nein gesagt.
– Wie Sie möchten, Ben.
– Ich werde jetzt gehen.
– Sehen wir uns nächste Woche?
– Ich weiß es nicht.
Es gab keine Grenzen.
Ich ertrug kaum, dass da etwas in mir war, zu dem ich keinen Zugang fand, Dinge, an die ich mich nicht erinnern konnte, ich hasste es. Trotzdem bemühte ich mich, erzählte ihr alles. Auch wenn ich nichts lieber getan hätte als davonzulaufen, ich blieb. Kam wieder. Sitzung für Sitzung. Die Therapeutin half mir, die Dinge wieder von unten nach oben zu holen. Den Tod meines Vaters, das Leiden meiner Mutter, die Freundschaft zu Kux. Und das, was danach kam.
Therese Vanek. Sie meinte es gut mit mir. Sie nahm mich nach so vielen Jahren wieder an der Hand und begleitete mich in Gedanken dorthin, wo alles begonnen hatte. Zurück in das Haus, in dem ich aufgewachsen war, zurück auf den Dachboden. Sie hörte mir zu, ihr konnte ich alles sagen, sie verurteilte mich nicht. Mit keinem Wort, mit keinem Blick, sie half mir, es auszuhalten. Meine Kindheit, die mit Wucht plötzlich wieder auf mich einschlug. Diese Geschichten, die mir einfielen. All diese Bilder, die wiederkamen, weil Frau Vanek mir einen Raum dafür gab. Lassen Sie sich Zeit, Ben. Woran erinnern Sie sich noch, Ben? Was haben Sie mit dieser Katze gemacht?
Ich erzählte ihr, dass wir sie getötet hatten. Eine Katze, die niemandem gehört hatte, abgemagert war sie gewesen, verwahrlost, Kux hatte sie mitgebracht. Was willst du damit, hatte ich ihn gefragt. Er sah mich an und drückte mir ein Messer in die Hand. Du kannst das, sagte er. Trau dich, Ben. Und ich stach in die Katze hinein. Ohne zu überlegen, einfach so. Es war ganz leicht, niemand hat uns gesehen, keiner hat uns dafür bestraft. Es ist nur eine Katze, hat Kux gesagt. Und ich glaubte ihm. Wir verziehen es uns, obwohl wir wussten, dass es falsch war, dass wir grausam waren. Wir taten so, als wäre nichts passiert, wir teilten nur noch ein Geheimnis mehr. Und wir dokumentierten es. Ohne dass jemand davon erfuhr.
Super 8. Wir drehten Filme. Die Kamera gehörte seinem Vater, Kux hatte sie mir mitgebracht irgendwann. Das könnte dir gefallen,hatte er gesagt. Bei uns liegt sie nur herum, es wird niemandem auffallen, dass sie weg ist. Kux wollte mir eine Freude machen, mich trösten, weil ihm wahrscheinlich bewusster war als mir, wie schlimm alles war, was am Dachboden geschehen war. Du kannst sie behalten, sagte er. Mir wird nichts passieren, wenn er herausfindet, dass sie weg ist. Mach dir keine Sorgen, Ben. Mein Vater kann sich eine neue kaufen. Kux erklärte mir, wie alles funktionierte. Die Kamera, der Projektor. Diese Technik war wie ein Wunder. Es war Leidenschaft, die mich von Anfang an gepackt hatte. Ich war fasziniert, begeistert, ich hatte plötzlich etwas, das mich nicht mehr losließ.
Bewegte Bilder. Wir drehten am laufenden Band. Kux besorgte die Filme, er stahl seinem Vater Geld, um sie entwickeln zu lassen. Später kauften wir Chemie, Wannen, Entwickler und Stabilisierer, das kleine Badezimmer in unserem Haus wurde zum Labor, wenn Mutter schlief. Staunend saß ich da und schaute mir an, was wir aufgezeichnet hatten. Auf einem Leintuch flimmerten die Geschichten, die wir erzählten. Das Bösland wurde zum Kino, zum Geheimquartier, zum Filmstudio. Neu war es, schön war es. Auch wenn diese Katze sterben musste, auch wenn es mir leidtat, wenn wir Schuld auf uns luden. Niemand wird je erfahren, was wir hier tun. Kux beruhigte mich, er nahm mir jede Angst. Wir sind Forscher, Ben, Dokumentarfilmer, am Ende geht es doch nur um ein bisschen Spaß. Und er hatte Recht.
Es gab keine Grenzen. Wir tranken, rauchten, schauten uns Pornohefte an. Wir trafen uns nach der Schule, oft auch nachts. Kux schlich sich aus dem Haus, er kam zu mir, wir stiegen nach oben, meine Mutter bemerkte es nicht. Die gebrochene Frau in ihrem Ehebett. Auch von ihr machte ich einen Film. Minutenlang hielt ich die Kamera auf sie, während sie schlief, ich filmte, wie ihr Mund offen stand und wie sie atmete. Sie lebte, und doch war es so, als läge sie auf einem Totenbett, als wäre sie ebenfalls gestorben. Mutter aufgebahrt jede Nacht, zu weit weg von mir. Sie hörte mich nicht. Bekam nichts mit von alledem. Zu sehr war sie beschäftigt mit sich selbst, mit ihren Träumen von dem Monster, das am Friedhof verfaulte. Ihr Mann, der nicht mehr da war, den sie vermisste. Ihr Mann, der mich nicht mehr schlagen konnte, weil er tot war.
1987. Im Grunde hätte alles so bleiben können. Nichts war bedrohlich, eine ganz normale Kindheit, es gab gute und es gab schlechte Tage. Tage, an denen wir viel zu lachen hatten, und Tage, an denen uns dieses Lachen verging, weil Kux’ Vater herausfand irgendwann, dass die Kamera nicht mehr da war, dass sein Sohn sie genommen und verschlampt hatte. Zur Strafe wurde Kux wieder in sein Zimmer gesperrt, Hausarrest für Wochen. Sobald es geht, komme ich zu dir, sagte Kux in der Schule. Lass mich nicht zu lange allein, sagte ich.
Mit einem Bauch voller Sehnsucht saß ich im Bösland und dachte an ihn. Weil da sonst immer noch keiner war, der mir nahe kam. Keine Mitschüler, niemand in meiner Klasse, der in mir mehr sah als einen Freak. Einen Jungen, der aus dem Selbstmord seines Vaters Profit geschlagen hatte. Einen Jungen, der allein in seiner Bank saß und schwieg, auch wenn man ihn beschimpfte, ihn provozierte. Ich ging zur Schule und wieder nach Hause, und ich dachte mir neue Drehbücher aus für meine Filme. Ich zog mich zurück in meine Welt und wartete darauf, bis Kux wiederkam. Weil ich nicht allein sein wollte, weil ich mich wahrscheinlich ebenfalls umgebracht hätte, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Oft habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie einfach es wäre. An manchen Abenden wollte ich es tun. Doch Kux hielt mich davon ab.
Und Matilda. Die neue Mitschülerin in meiner Klasse. Sie war mit ihrer Familie ins Dorf gezogen. Ihre Eltern hatten die Apotheke übernommen, sie waren reich. Trotzdem durfte Matilda mich sehen, mich treffen, Zeit mit mir verbringen. Ihre Eltern verboten es ihr nicht. Wir freundeten uns an, wir verstanden uns vom ersten Tag an, sie füllte die Löcher, die Kux hinterließ, wenn er nicht da war, sie war das Gegenteil von mir. Ich war still, Matilda war laut, ich verbarg mich, sie stellte sich ins Licht. Immer mit diesem Lächeln. Aus irgendeinem Grund beschloss sie, es mir zu schenken. Mir und nicht den anderen. Matilda verzauberte mich, ganz langsam, ohne dass ich es merkte. Sie tanzte mit mir. Bis zum letzten Moment war sie wie ein Geschenk.
Ich weiß nicht, was Liebe ist.
– Es ist wunderschön, wie Sie über Matilda sprechen.
– Aber wem nützt es?
– Ihnen. Es ist gut, dass Sie sich an dieses Gefühl erinnern. Sie lassen es endlich zu, wir machen große Fortschritte.
– Tun wir das? Seit Wochen komme ich zu Ihnen, aber ich weiß noch immer nicht, warum ich es getan habe. Da ist immer noch so viel, das ich nicht verstehe. So viele Dinge, die mir Angst machen.
– Sie sind hier, oder? Sie laufen nicht weg, Sie kommen immer zum vereinbarten Zeitpunkt. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist da ein kleines Stück mehr aus Ihrer Vergangenheit, das Form annimmt.
– Vielleicht ist es besser, wenn wir damit aufhören.
– Ich kann mir vorstellen, wie schwer das alles für Sie ist. Trotzdem bitte ich Sie darum weiterzumachen. Lassen Sie uns über Matilda reden. Erzählen Sie mir alles, was Ihnen einfällt. Was Sie gemeinsam unternommen haben, worüber Sie gesprochen haben. Haben Sie sich ihr anvertraut? Mit ihr darüber geredet?
– Worüber?
– Sie hatten sich doch verliebt, oder?
– Ich weiß nicht, was Liebe ist.
– Sie haben sie gemocht. Es genossen, mit ihr zusammen zu sein.
– Mehr als alles andere.
– Und trotzdem haben Sie sie umgebracht.
– Ja.
– Was genau ist passiert?
– Ich habe sie erschlagen.
– Und warum haben Sie das getan, Ben?
– Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier.
– Laut Polizeibericht haben Sie Ihren Schädel zertrümmert. Sie haben so lange auf Matilda eingeschlagen, bis sie tot war.
– Hören Sie bitte auf damit.
– Aber so war es doch, oder? Ob Sie es wollen oder nicht, wir müssen darüber reden. Ich denke, der richtige Zeitpunkt dafür ist jetzt da.
– Warum tun Sie das?
– Weil Sie mich darum gebeten haben.
– Wie oft soll ich es Ihnen denn noch sagen? Es ist alles dunkel, ich kann das nicht. Ich will nicht. Egal wie oft Sie mich noch fragen, es kommt nicht zurück.
– Es ist alles da, Ben. Sie haben es nur abgespalten, die Erinnerung daran einfach irgendwo in Ihrem Inneren eingesperrt. Wir können die Tür jetzt gemeinsam aufstoßen, wenn Sie wollen.
– Nein.
– Ich bin für Sie da, Ben. Sie sind in Sicherheit, es ist alles lange vorbei, Sie haben nichts zu befürchten.
– Ich wollte das alles nicht.
– Das glaube ich Ihnen.
– Ich wollte nur, dass sie mich wieder anlächelt. Sie hat sich nicht mehr bewegt. Nichts mehr gesagt, egal wie laut ich geschrien habe.
– Sie haben Matilda im Arm gehalten, als Ihre Mutter Sie gefunden hat. Sie wollten das Mädchen nicht loslassen, die Beamten mussten Sie mit Gewalt von ihr wegziehen.
– Da war überall Blut.
– Was noch? Was fällt Ihnen noch ein?
– Es tut mir so leid.
– Was tut Ihnen leid?
– Dass ich es nicht rückgängig machen kann.
– Was hat das Mädchen getan, das Sie so wütend gemacht hat?
– Ich weiß es nicht.
– Der Gerichtsmediziner sagte, dass Matilda bereits nach den ersten beiden Schlägen tot gewesen sein muss. Sie haben aber fünf weitere Male zugeschlagen.
– Nein, nein, nein.
– Sie müssen keine Angst haben, es kann Ihnen nichts mehr passieren.
– Ich will nicht mehr dorthin zurück.
– Wohin?
– In die Psychiatrie.
– Das müssen Sie nicht. Sie wurden damals entlassen, weil man Ihnen zugetraut hat, dass Sie ein normales Leben führen können. Niemand wird Sie mehr einweisen, niemand klagt Sie an, Sie stellen sich nun alldem freiwillig.
– Ich sehe es vor mir.
– Was sehen Sie?
– Wie das Blut aus ihrem Kopf kam. Ich konnte es nicht aufhalten, es schoss einfach aus ihr heraus.
– Hat sie etwas gesagt, das Sie verletzt hat? Sie so aus der Fassung gebracht hat? Was ist passiert, Ben?
– Wie oft fragen Sie das noch?
– So lange, bis es Ihnen wieder einfällt.
– Da ist nichts mehr, bitte glauben Sie mir. Ich erinnere mich nur daran, wie sie in meinen Armen verblutet ist. Und wie sie vorher noch gelacht hatte.
– Worüber hat sie gelacht?
– Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich dieses Lachen kaputtgeschlagen habe.
– Warum hatten Sie einen Golfschläger?
– Es war die Golfausrüstung von Kux’ Vater. Wir haben gespielt damit. Den ganzen Sommer lang. Wir haben das Scheunentor aufgemacht und die Bälle aus dem Bösland hinaus auf das Feld geschlagen, Ball für Ball, einen nach dem anderen. Dann haben wir die Bälle wieder eingesammelt und von vorne begonnen. Es war nur Spaß.
– Und trotzdem ist Matilda seit dreißig Jahren tot.
– Ja. Beide bekommen wir unser Leben nicht wieder zurück.
– Ihres ist noch nicht vorbei, Ben. Ich konnte Ihnen damals nicht helfen. Nicht so, wie ich es gerne getan hätte. Aber ich denke, jetzt kann ich es.
– Ich glaube nicht mehr daran.
– Doch, das tun Sie.
Langsam kam alles wieder.
Sie meinte es gut mit mir. Vor dreißig Jahren schon. Frau Vanek war die Einzige, die sich um mich gekümmert hat. Sie war Psychiaterin damals an dem Ort, an dem sie mich eingesperrt hatten. Und so viele Jahre später dann meine Therapeutin. Meine letzte Hoffnung, weil ich nicht mehr schlafen konnte, weil alles, was ich verdrängt und vergraben hatte, plötzlich zu mir zurückgekommen war. Ob ich es wollte oder nicht, es hatte begonnen mich zu verfolgen, die Bilder von damals bestimmten meinen Alltag. Sie gingen nicht weg, ließen mir keine Ruhe mehr, an keinem Tag der Woche, in keiner Nacht, ich konnte es nicht abwaschen von mir, es nicht wieder vergessen. Nicht so wie damals. Ich konnte nicht mehr so tun, als wäre es nie passiert. Deshalb habe ich sie angerufen. Sie vor fünf Monaten um Hilfe gebeten. Ich möchte reden, habe ich gesagt. Über damals.
1987. Sie hatten mich weggebracht, weg aus dem Dorf, weg von Matilda. Sie hatten sie mir aus den Armen gerissen, mich von ihr weggezerrt. Was hast du getan, schrie meine Mutter. Sie schlug auf mich ein, verstand es nicht, hörte nicht auf mir wehzutun. Dein Vater hatte Recht, brüllte sie. Du bist dumm und zurückgeblieben. Ein Mörder bist du, ein gottverdammter Mörder. Du hättest dich aufhängen sollen, nicht er. Man hatte sie immer wieder daran hindern müssen, auf mich loszugehen. Erst als der Notarzt ihr eine Spritze gab, beruhigte sie sich. Hörte auf, mich zu beschimpfen. Auch ihre Welt ist an diesem Tag zerbrochen. Alles, was noch übrig war, zerfiel. Zu der Trauer um ihren Mann kam der Umstand, dass ihr einziger Sohn die Tochter des Apothekers erschlagen hatte. Ein Skandal war es, ein Schandfleck, der das ganze Dorf zudeckte, Schuld, die meine Mutter auf sich geladen hatte an dem Tag, an dem sie mich zur Welt brachte. Du hast es verdient,sagte sie. Dass er dich verprügelt hat. Totschlagen hätte er dich sollen, dann wäre das alles nicht passiert.
Lange Zeit habe ich gedacht, dass meine Mutter Recht hatte. Matilda würde noch leben, viele Tränen wären nicht geweint worden. Matildas Eltern, die mich anstarrten. Ihr Vater, der mich am liebsten mit bloßen Händen erwürgt hätte. Sie waren verzweifelt, schockiert, sahen mich an, als wäre ich der Teufel, das Böse, das sie im Streifenwagen wegbrachten. An einen Ort, an dem ich niemandem mehr etwas tun konnte. Das kleine Monster, der Mörderjunge, der nur apathisch auf dem Rücksitz des Polizeiautos saß und aus dem Fenster starrte.
Langsam kam alles wieder. Weil Frau Vanek all diese Fragen stellte, die ich nicht hören wollte. Sie half mir dabei zuzusehen, wie ich damals aus dem Bösland verschwand, wie ich den Hof verließ, auf dem ich aufgewachsen war. Ich konnte die Lichter der Einsatzfahrzeuge wieder sehen, die Polizisten, die mich in die Stadt brachten. Ich erinnerte mich an das Verhör, das sie führen wollten, an die Beamten, die sich bemühten, zu mir durchzudringen. Wir möchten nur wissen, was passiert ist. Rede mit uns. Was hast du getan, Junge? Mach endlich dein verdammtes Maul auf. Aber mein Mund blieb zu. Auch am Tag danach, an jedem weiteren, der noch kam. Fünf lange Jahre kein Wort.
Man diagnostizierte eine dissoziative Persönlichkeitsstörung. Ich war traumatisiert. Ich wurde in die Psychiatrie gesperrt, so konnte der Mörderjunge niemandem mehr etwas tun. Festgezurrt an einem Bett, Medikamente in einer kalten weißen Welt. Du kommst hier nie wieder raus, sagte ein Pfleger zu mir. Und es war mir egal. Alles war mir egal, nichts hätte irgendetwas besser gemacht. Nichts, was ich gesagt oder getan hätte. Nichts auf dieser Welt hätte Matilda wieder lebendig gemacht, meine Mutter dazu gebracht, mich zu besuchen, mit mir zu reden, für mich da zu sein. Deshalb blieb ich allein.
All die Jahre ohne Besuch. Weil ich ein Mörder war. Minderjährig, aber gefährlich. Man hatte die Welt vor mir in Sicherheit gebracht, man hatte Matildas Eltern gezeigt, dass es doch Gerechtigkeit gab, dass ich nicht einfach mit dem Mord an ihrer Tochter davonkommen würde. Eine gerechte Strafe war es, die Psychiatrie die beste Lösung. Weil ich nicht strafmündig war. Ein glücklicher Umstand war es für den Rest der Welt, dass ich beschlossen hatte zu schweigen. Dass ich unfähig war zu reden. Hätte ich es getan, hätten sie mich nicht für verrückt erklärt, ich wäre ungestraft davongekommen. Deshalb war es gut so, wie es war. Für Matildas Eltern, für Kux’ Vater. Für mich. Der Mörderjunge konnte niemandem mehr etwas tun.
Ich war am richtigen Ort. Gewöhnte mich an mein neues Zuhause. Wollte bleiben. Ich drückte meine Gefühle nach unten und hörte auf, mir zu wünschen, dass jemand kommen würde. Keinen Tag lang wollte ich mehr die Enttäuschung spüren, dass die Tür zu meinem Zimmer nicht aufging, dass da kein schönes Wort mehr für mich war. Ich habe sie vergessen, meine Mutter und auch Kux. Sein Vater war froh darüber, dass ich endlich verschwunden war, dass sein Sohn sich nicht mehr mit dem Abschaum des Dorfes abgab. Doktor Kux fühlte sich bestätigt. Hab ich nicht schon immer gesagt, dass mit diesem verdammten Bauernjungen etwas nicht stimmt? Er hatte gewonnen. In Gedanken konnte ich ihn hören, er hatte seinen Sohn beschützt vor mir, ihn davor bewahrt, zu mir in diesen Abgrund zu steigen. Ich habe meinen Freund nie wieder gesehen. Da war nur das Krankenhauspersonal. Und die anderen, die so waren wie ich.
Unendlich lange Tage und Monate. Ein taubes Gefühl, Zeit, die einfach verging. Tabletten, die sie in mich hineinstopften, eine nach der anderen. Sie lassen uns keine Wahl, wir müssen Sie ruhigstellen, es ist das Beste für Sie, glauben Sie mir. Der Psychiater, der immer wieder vor mir saß und zu mir durchdringen wollte. Wenn Sie nicht endlich mit mir reden, kann ich nichts für Sie tun. Helfen Sie uns doch herauszufinden, warum Sie das getan haben. Er sah mich pflichtbewusst an. Das sind wir den Eltern des Mädchens doch schuldig, oder? In den ersten beiden Jahren nickte er noch freundlich. Jetzt reden Sie doch endlich. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Später grinste er. Sie werden hier verrotten, wenn Sie nicht endlich Ihren Mund aufmachen. Irgendwann wurde er wütend. Sie sind nur ein kleines Stück Dreck. Und der Dreck sollte bleiben, wo er hingehörte.
1992. Ich war achtzehn, als ich von der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf die Erwachsenenstation verlegt wurde. Weil man immer noch nicht wusste, wohin mit mir. Weil ich es selbst auch nicht wusste. Ein neuer Pfleger, ein neues Bett, neue Mitpatienten. Und dann die neue Ärztin. Die Frau, die mich endlich zum Reden brachte. Therese Vanek. Alles an ihr war anders, sie war zurückhaltend und geduldig, sie hörte mir zu, auch wenn ich schwieg. Sie saß vor mir und wartete, sie drängte mich nicht. Da war plötzlich jemand, der es gut mit mir meinte. Deshalb öffnete ich meinen Mund, begann wieder zu sprechen.
Weil sie Angst vor mir hatten.
– Ohne Sie hätte ich das damals nicht überlebt.
– Doch, das hätten Sie. Egal was Sie getan haben, Sie haben eine zweite Chance verdient.
– Habe ich das?
– Sie dürfen nicht so streng zu sich selbst sein, Sie waren dreizehn Jahre alt, als es passiert ist.