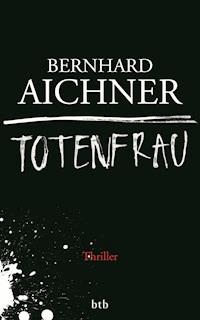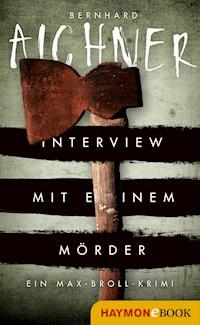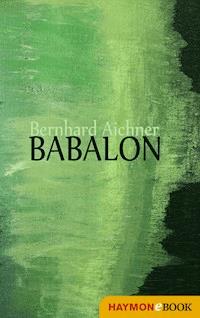Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grafit Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mord am Hellweg
- Sprache: Deutsch
›Himmel und Erde‹ kennen viele, aber wer kennt schon die ›Schwerter Schwarte‹? – Tja, das ist kein lecker Nachkochgericht, sondern blutiger Ernst! Die bekanntesten deutschsprachigen Krimiautorinnen und -autoren sind an den Hellweg gereist und auf mörderische Spezialitäten gestoßen. Die Gastgeber sind: Bernhard Aichner: Pink Box Erwitte, Max Annas: Friktion in Fröndenberg, Alex Beer: Mordsglas aus Wickede, Simone Buchholz: Dortmund, das Herz hämmert, Franz Dobler: Amen in Ahlen, Wulf Dorn: Holzwickeder Perlenhochzeit, Monika Geier: Fluggans an Sumpfgras in Hamm, Frank Goldammer: Iserlohner Potthexe, Stefanie Gregg: Blau in Grau in Soest, Ule Hansen: Kunigunde beschwert sich nicht mehr über den Regen in Lüdenscheid, Elisabeth Herrmann: Die Gelsenkirchener Rose, Bernhard Jaumann: Oelder Waldgeister, Krischan Koch: Hagener Zwiebackleichen, Thomas Krüger: Aber bitte mit Sahne in Bad Sassendorf, Kristin Lukas: Gefährliches Nachspiel in Kamen, Sunil Mann: Die Lichter von Bergkamen, Gisa Pauly & Martin Calsow: Schwerter Schwarte, Thomas Raab: Todeskreis Unna, Martin Schüller: Lünen – unterschätzt, Sven Stricker: Bönen sehen und sterben, Arno Strobel: Wittener Geschmortes à la Roburit, Klaus-Peter Wolf: Das Jahrestreffen der glücklichen Witwen in Unna
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
H. P. Karr, Herbert Knorr & Sigrun Krauß (Hg.)
Henkers.Mahl.Zeit
Mord am Hellweg IX
Kriminalstorys
© 2018 by GRAFIT Verlag GmbH Chemnitzer Str. 31, D-44139 Dortmund Internet: http://www.grafit.de E-Mail: [email protected] Alle Rechte vorbehalten. Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Irina Mosina (Tisch mit Brotzeit), Lesya_ya (Messer) E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck eISBN 978-3-89425-744-6
Inhalt
Henkers.Mahl.Zeit. Lukullische Genüsse und schaurige Abgründe am Hellweg
Thomas Krüger: Aber bitte mit Sahne in Bad Sassendorf
Bernhard Aichner: Pink Box Erwitte
Klaus-Peter Wolf: Das Jahrestreffen der glücklichen Witwen in Unna
Arno Strobel: Wittener Geschmortes à la Roburit
Krischan Koch: Hagener Zwiebackleichen
Alex Beer: Mordsglas aus Wickede
Kristin Lukas: Gefährliches Nachspiel in Kamen
Sven Stricker: Bönen sehen und sterben
Elisabeth Herrmann: Die Gelsenkirchener Rose
Monika Geier: Fluggans an Sumpfgras in Hamm
Ule Hansen: Kunigunde beschwert sich nicht mehr über den Regen in Lüdenscheid
Simone Buchholz: Dortmund, das Herz hämmert
Max Annas: Friktion in Fröndenberg
Franz Dobler: Amen in Ahlen
Stefanie Gregg: Blau in Grau in Soest
Thomas Raab: Todeskreis Unna
Sunil Mann: Die Lichter von Bergkamen
Martin Schüller: Lünen – unterschätzt
Frank Goldammer: Iserlohner Potthexe
Bernhard Jaumann: Oelder Waldgeister
Gisa Pauly & Martin Calsow: Schwerter Schwarte(Kein lecker Nachkochgericht)
Wulf Dorn: Holzwickeder Perlenhochzeit
Autorinnen & Autoren
Herausgeberin & Herausgeber
Motto
Wissen Sie, wie die mich nennen? Die Dinner-Mörderin von Holzwickede … Als ob ich der Star in irgendeiner makabren Kochshow wäre!
Wulf Dorn, aus Holzwickeder Perlenhochzeit
Henkers.Mahl.Zeit
–
Lukullische Genüsse und schaurige Abgründe am Hellweg
Es ist angerichtet! Mord à la carte und crime à la minute, kredenzt von den Spitzenkräften des Genres.
Denn zum neunten Mal wird die Hellwegregion zum Eldorado namhafter deutschsprachiger Krimistars, die voller kreativer mörderischer Ideen die Region zwischen Ahlen und Witten, Hamm und Iserlohn unsicher machen. Dieses Mal steht – fast immer – der ›letzte Bissen‹ im Mittelpunkt ihrer Geschichten, der letzte lukullische Genuss, bevor Opfer oder auch Täter das Zeitliche segnen. Und – ebenfalls fast immer – schmeckt ihnen diese ganz besondere Kost sogar!
So wird im Gelsenkirchener Musiktheater im Revier ein russischer Ballettstar erstochen, nachdem er sich noch vor der Aufführung genüsslich in der Theaterkantine ein paar Löffel ›Borschtsch‹ gegönnt hat. In ›Methusalem City‹ Bad Sassendorf stirbt ein Journalist an einem vergifteten Stück köstlicher Sahnetorte und zu den Hagener Zwiebackleichen wird stilechter Doppel-Wachholder (der mit zwei H, ganz wichtig!) serviert. Die Schwerter Schwarte aus der Küche der Rohrmeisterei entpuppt sich allerdings nicht als lecker Nachkochgericht, sondern als blutiger, gefrorener Ernst. Die Dinner-Mörderin von Holzwickede schließlich weiß ihre Familie mit besonderen Gerichten zu verwöhnen und räumt damit gleich ihre Rivalin aus dem Weg. Zu guter Letzt wird in Kamen einem Fußballspieler vom BVB ausgerechnet das westfälische Nationalgericht ›Himmel und Erde‹ buchstäblich zum letzten Imbiss. Schaurige Abgründe tun sich auf.
Was sich wie die besten Schlagzeilen einer schlechten Boulevardzeitung liest, ist jedoch nur eine kleine Auswahl der bösartigen Fälle unserer neuen Geschichtensammlung, die – wie gewohnt für ›Mord am Hellweg‹-Bände – ausschließlich aus den Federn hochkarätiger Autorinnen und Autoren stammen. Elisabeth Herrmann, Sven Stricker, Bernhard Jaumann, Gisa Pauly, Arno Strobel und viele andere servieren Opfern und Tätern stets das letzte Mahl, sozusagen die Henkersmahlzeit am Hellweg, mit dem beim größten Krimifestival Europas, dem Mord am Hellweg IX, die Liebhaber von Krimis und Thrillern, von Mord und Totschlag, von Hinterlist und Heimtücke verwöhnt werden.
Für weitere kriminell-kulinarische Höhepunkte sorgen Superstar Bernhard Aichner mit seiner Pink Box Erwitte und Klaus-Peter Wolf, der sich um das Jahrestreffen der glücklichen Witwen in Unna kümmert, während sich Österreichs Star-Autor Thomas Raab dem Todeskreis Unna widmet. Und literarisch zupackend und geschmacklich versiert tischen Simone Buchholz, Max Annas und Franz Dobler ein Dreierlei vom neuen deutschen Krimi mit tödlichen Spezialitäten aus Dortmund, Fröndenberg und Ahlen auf.
Damit ist die Mannschaft des Festivals der exklusiven Morde aber noch längst nicht komplett. Monika Geier, Thomas Krüger, Stefanie Gregg, Martin Calsow, Ule Hansen, Kristin Lukas, Frank Goldammer, Wulf Dorn, Alex Beer, Sunil Mann und Martin Schüller runden das Mords-Menü mit kleinen feinen Leckereien ab. Wir als Küchenchefs … äh … Herausgeber dieser Krimianthologie empfehlen jedenfalls Storys wie Fluggans an Sumpfgras in Hamm oder Wittener Geschmortes à la Roburit. Und ansonsten wird gelesen, was auf den Tisch kommt!
Stellen Sie sich ihre Menüfolge selbst zusammen: Ob lustig, grotesk oder einfach nur spannend – gute Unterhaltung ist mit diesen zweiundzwanzig Geschichten von dreiundzwanzig Autorinnen und Autoren jedenfalls sicher.
Mörderisch guten Appetit wünschen
H. P. Karr, Herbert Knorr und Sigrun Krauß
Nach Diktat auf kulinarische Entdeckungstour ab- und seitdem nie wieder aufgetaucht
Thomas Krüger
–
Aber bitte mit Sahne in Bad Sassendorf
»Ras nicht so, Henning. Beim EDEKA hättest du abbiegen müssen.«
»Scheiße, Hajo, sag das doch eher!«
Hatte ich, aber Henning Kampkötter, dreiundvierzig Jahre alt, voller Hormone und erst seit Kurzem bei der Kreispolizeibehörde Soest, ist am Steuer des Einsatzwagens ein polizeiliches Sicherheitsrisiko. Ich, einundsechzig, Hans-Joachim Varnholt, habe es gern etwas ruhiger. Wir sind auf der Paderborner Landstraße unterwegs. Nach Bad Sassendorf. Ein ungeklärter Todesfall.
Ich kenne die Stadt ein bisschen, habe hier mal gewohnt.
»Nimm die nächste. Die Alleestraße. Da hinter dem Friedhof. Und Vorsicht, Friedhofsbesucher sind nicht die schnellsten.«
Henning sieht mich an.
»Guck nach vorn.«
»Na klar, Hajo. Am Friedhof ist man nicht so schnell. Wann gehst du eigentlich in Rente?«
Manchmal tröste ich mich mit der Überlegung, dass es Henning, weil er aus Bielefeld kommt, gar nicht gibt.
Er biegt nach links ab. Die Straße verläuft parallel zum Friedhof und Henning beschleunigt, als sei er auf der Flucht vor dem Tod. Mir fällt ein, dass das größte Hotel dieser Stadt Schnitterhof heißt. Weiß Henning das?
»STOPP!«
»Meine Güte, kehren die Zombies hier schon am Nachmittag in ihre Gräber zurück?«
»Dies ist ein Kurort, Henning.«
Auch ich habe die Frau fast übersehen. Ihre Bewegungen sind reinste Zeitlupe. Sie schiebt mit ihrem Rollator auf die Friedhofsstraße zu, die das Gräberfeld links von uns in zwei gleich große Flächen teilt. Rechts erheben sich die Skelette von Turmkränen aus einem Gewerbegebiet voller Rohbauten.
»Arthrose in Motion.«
Hennings Aussprache beweist, dass der Ostwestfale nicht so leicht Englisch lernt. Aber das erschüttert ihn nicht. Er lacht und trommelt aufs Lenkrad.
»Vielleicht hat sie ein Date und ist deshalb so in Eile«, unkt er. Sein Kopf ruckt nach links. »Guck mal. Da sind Gräber frei. Schon mal eins besichtigen?«
»Idiot.«
Er lacht und ich erkenne zwischen den Bäumen am Friedhofsrand unbelegte, in Granitrahmen gefasste Grabstellen.
Henning beschleunigt wieder. »Also, wo ist das jetzt?«
»Café Blaubeere. Ortsmitte. Sälzerplatz.«
Ich dirigiere ihn. Am Verkehrskreisel am Ende der Alleestraße zögere ich allerdings. Nach links oder weiter geradeaus? Ich entscheide mich für links, die Bahnhofsstraße runter. Vielleicht, weil mir dieses Fachwerkhaus hinter einem Banner, auf dem Akropolis steht, so bizarr vorkommt. Fachwerk können sie hier gut. Aber es ist weniger geworden in den vergangenen Jahrzehnten.
Der Sälzerplatz mit dem großen Stern darauf, dem Sälzerstern. Vor dem Café parken ein Notarztwagen und ein Polizeiwagen. Vermutlich Walter, der versieht hier in Sassendorf den Bezirksdienst. Er hat Soest benachrichtigt. Die Weißkittel stehen hinter ihrem roten Rettungsmobil und warten darauf, was wir zu der Leiche sagen.
Na, erst mal einen Blick drauf werfen.
»Tod in der Scheune«, brummt Henning, als er das breite Haus mit dem verzierten Dielentorbogen am Rand des Platzes betrachtet. Bei Fachwerk fällt Henning nur Scheune ein.
»Das ist keine Scheune, das Haus gehörte zu einer Siedehütte. Bad Sassendorf ist die Stadt des Salzes. Hier wurden Leute wie du vom Teufel in große Pfannen gesetzt, unter denen Feuer brannte. Mit dem Salz, das ihr ausgeschwitzt habt, wurden Geschäfte gemacht.«
»Was?«
»Komm, wir gehen rein.«
Gut, dass ich Hennings Vorgesetzter bin. Nur so lassen sich die Verhältnisse ertragen.
Im Café Blaubeere ist es schummrig. Massive, dunkle Holzständer und Deckenbalken, Terrakotta-Fliesen. Ein Raum mit Geschichte. Aufregung herrscht. Na ja, das heißt, Neugierige spinxen nach der Leiche und mutmaßen.
Erschüttert wirkt vor allem die Bedienung, und das hat mit dem Kuchen zu tun, denn der Tote, so wird gemunkelt, sei vergiftet worden. Jemand lässt das Wort Tortenmord fallen und erntet gebremstes Lachen.
Walter vom Bezirksdienst ist im Gespräch mit zwei Herren. Das unterbricht er, um uns die Leiche zu zeigen: einen Mann, Mitte fünfzig, Halbglatze, leicht übergewichtig.
»Keiner von hier«, sagt Walter und schüttelt missbilligend den Kopf.
Man hat den Mann außer Sichtweite der Gäste in die Küche gelegt. Ausgerechnet in die Küche, denke ich. Aber vielleicht wäre mir in so einer Situation auch nichts Besseres eingefallen. Hätten sie ihn im Café gelassen, hätten wir jetzt hier eine Gafferei wie bei einem Unfall auf der Autobahn.
Henning macht Handyfotos. Dann streift er wie ein Wildwest-Sheriff umher. Dabei schweigt er, weil er insgeheim weiß, dass er redend seinen Sheriff-Status gefährdet.
Ist mir einerseits ganz recht, dass er sich zurückhält. Andererseits strömen immer mehr Neugierige hier rein. Viele Eltern mit Kindern. Wo kommen die alle her? Das verwirrt mich nun doch. Ich habe immer gedacht, der Alterspräsident des Landes lebe in Bad Sassendorf.
»Walter? Würdest du mal …«
So schnell kannst du gar nicht gucken, wie Kinder ihre Finger in der Torte haben. Unmöglich ist das und womöglich auch ungesund.
»Hallo? Können Sie Ihre beiden Racker mal bitte …? Ach, das sind nicht Ihre? Walter, Henning?«
»Ja, ich mach das schon«, brummt Walter und sorgt dafür, dass es im Café leerer wird. Damit wir uns wieder der Leiche widmen können.
Der Tote trägt eine abgewetzte Lederjacke, fleckige Jeans, Schuhe im Kurz-vor-Löcher-im-Bodenblech-Zustand. Walter hat in der Jacke des Mannes nachgesehen, eine Brieftasche mit Papieren und ein wenig Bargeld gefunden: Martin Piel, Dortmund, vierundfünfzig Jahre alt. Außerdem eine Visitenkarte: MP – Martin Piel. Treffsicherer Journalismus, knallharte Recherche, zielgenaue TV-Produktionen. Eine Festnetz- und eine Mobilnummer.
Ganz dicke Hose, ganz kleine Eier, denke ich.
Walter führt mich zu den beiden Herren, mit denen er vorhin im Gespräch war. Der eine ist Doktor Stephan Oliver, Leiter des örtlichen Salzmuseums. Er kennt Bad Sassendorf wie seine Westentasche, nicht aber den Toten. Doktor Oliver erklärt, dass er von einem anonymen Anrufer hergelockt wurde.
Der andere Mann, Arzt aus der nahen Klinik am Hellweg, war zufällig anwesend, als der jetzt Tote über seinem Stachelbeerkuchen mit Sahnequarkauflage zusammenbrach. An dem Tortenmord-Gemunkel scheint also was dran zu sein. Getrunken hat der Mann nämlich nichts. Vom Kuchen probiert, die vordere Hälfte vertilgt, über Übelkeit geklagt. Dann Exitus. Die Symptome, die Gesichtsfarbe, alles deutet auf ein schnell wirkendes Gift hin. Genaueres wird die Rechtsmedizin herausfinden.
»Mensch, is das ’n Ding!«
Henning sinkt auf den Stuhl am Tat-Tisch und starrt ergriffen auf das Kuchenstück. Das ist, trotz fehlender Vorderhälfte, noch immer groß wie der Bremsschuh für einen Kohlewaggon.
»Henning, lass die Gabel liegen. Sonst muss ich allein zurück nach Soest.«
»Was?«
»Der Kuchen. Das Corpus Delicti. Beweismittel sichern. Einpacken, aber nicht in deine durchtrainierte Körperhülle.«
Rums. Der Stuhl fällt um, weil Henning hastig Distanz zwischen sich und den Todeskuchen zu bringen versucht.
Doktor Oliver sieht jetzt nicht so aus, als würde er glauben, wir könnten den Fall aufklären.
Zusammen mit Walter packt Henning die Beweismittel ein, und während ich ein paar Sätze mit Doktor Oliver und dem Reha-Arzt wechsle, macht Henning erneut Fotos mit seinem Smartphone. Er zielt überall hin. Jetzt will er Umsicht zeigen.
Ich erfahre, dass Doktor Oliver mit den Worten: »Kommen Sie schnell ins Café Blaubeere. Da geht was ab. Man will uns erpressen«, aufgescheucht wurde. Aber wer da wen erpressen wollte und wer der Anrufer war, weiß er nicht.
Die Bedienung sagt aus, dass das Café zum Zeitpunkt der Tat etwa halb voll war. Und dass der Vergiftete allein am Tisch saß.
»Ich hatte das Gefühl, er würde auf jemanden warten«, berichtet sie, fast unter Tränen. »Ich brachte ihm den Kuchen und er hat ihn noch gelobt und dann hat er immer wieder auf sein Handy geguckt und plötzlich stand er auf, stöhnte, wankte zur Toilette und …«
»Verstehe. Aber wie hätte das Gift in den Kuchen gelangen können? Wo bewahren Sie den auf?«
Na, wo bewahrt man in einem Café so was auf? Vor den Augen der Gäste natürlich. Die Frau zeigt zur gläsernen Auslage auf dem Tresen. Die Restkuchenbestand ist gigantisch: Stachelbeere, Marzipanumhülltes, Erdbeertorte, Kirschkuchen, Schokoladentorte und so weiter. Ich denke an die unbelegten Gräber auf dem Friedhof am Ortseingang und erkläre der Frau, dass sämtliche essbare Ware ab sofort einem Verkaufsverbot unterliegt.
»Das muss alles überprüft werden«, sage ich und fühle mich überfordert. Eine Mordkommission soll hier bitte schön übernehmen. Einen Moment lang denke ich, dass auch die Bedienung gleich kollabiert. Doch dann fängt sie sich. Walter spendet ihr Trost.
Aber meine Frage ist noch immer unbeantwortet: Wie kam das Gift in den Kuchen? Haben wir es mit einem Irren zu tun, der wahllos mordet, oder galt der Anschlag gezielt diesem Martin Piel?
»Hat jemand mit dem Toten gesprochen?«
»Mit dem Toten?«
»Na ja, als er noch nicht tot war.«
Die Bedienung denkt nach.
»Das kann ich nicht sagen. Ich muss ja immer mal wieder in die Küche. In so einem Moment hätte jemand ins Café kommen können, um … nicht wahr?«
Ja, in der Tat. Jetzt denke ich nach. Da unterbricht mich Henning mit der Bemerkung, dass die Leute vom Notarztwagen gern Feierabend machen würden. Mir schwillt der Kamm: »Pass mal auf, Henning. Sag den Herren, sie mögen sämtliches Süßzeug hier einladen und ins Kriminallabor nach Soest bringen. Das muss nämlich alles untersucht werden.«
»Bist du verrückt, Hajo? Im Notarztwagen? Außerdem, das is … ’ne halbe Tonne!«
»Und du kannst helfen. Beeilt euch. Wegen Feierabend. Anschließend packt ihr den Toten ein. Der kann dann auch weg. Nach Dortmund zur Rechtsmedizin. Passt aber auf, dass der euch nicht in die Torten rutscht.«
Hennings Kinnlade klappt sportlich nach unten. Dann zieht er ab. Und ich widme mich der vielleicht letzten Möglichkeit, noch herauszufinden, wer sich diesem Scheißkuchen genähert hat, um ihn zu vergiften.
Ich gehe zu ein paar Rentnern in Anoraks, die an einem Randtisch Kaffee trinken. Zwei Frauen, ein Mann. Sie sitzen schon länger hier. Ältere beobachten ja gern. Die hier geben sich aber extrem erinnerungs- und aussageschwach.
»Nee, hier is keiner rein.«
»Dem is am Tisch plötzlich schlecht geworden.«
»Saß da so, steht auf, klappt zusammen.«
»Schöner Tod. Hätt er aber aufessen sollen, den Kuchen.«
»Is doch schade.«
Sie nicken. Und lächeln.
Ich lasse sie abziehen. Merkwürdige Typen.
Was nun?
Ein plötzlicher Gedanke lässt mich die Visitenkarte des Toten hervorholen und die dort aufgedruckte Dortmunder Festnetznummer wählen. Es tutet eine Weile.
»Martin?« Eine Frauenstimme, klingt weinerlich. »Bist du es?«
»Ähm, nein. Mein Name ist Varnholt. Ich … äh …« Mir bricht der Schweiß aus. Ich sollte auflegen. Doch ein Teufelchen treibt mich an. »Mit wem spreche ich bitte?«
»Monika Piel … Martins Mutter.«
Schluchzen.
»Äh … ich … wollte eigentlich Ihren Sohn sprechen. Er hat mir diese Nummer gegeben. Ich …« – das Teufelchen hat mich jetzt vollkommen in der Gewalt – »… ich hatte einen Termin mit ihm. In Bad Sassendorf.«
Die Frau bricht endgültig in Tränen aus: »Bad Sassendorf? Nein, dass … Nicht schon wieder. Hätte ich ihn damals bloß nicht zur Kur dahin geschickt. Sechs Wochen. Kinderheilanstalt. Ich hab es doch gut gemeint. Er war so dünn und noch so klein. Martin hat mir das nie verziehen. Hat er Sie auch erpresst?«
»Erpresst? Mich? Nein, nein! Gute Frau, ich …«
Scheiße, denke ich. Jetzt schwitze ich wie in einer Siedepfanne. Ich kann die Frau doch unmöglich am Telefon über den Tod ihres Sohnes informieren. Fast empfinde ich es als Glück, dass sie unvermittelt auflegt.
Doktor Oliver tippt mich an: »Ähm, brauchen Sie mich noch?«
Ich will ihn grad fragen, ob die Telefonstimme, die ihn mit dem mysteriösen Verweis auf eine Erpressung ins Café Blaubeere lockte, die einer weinerliche Frau war, da gellt aus der Küche ein Alarmruf: »HAJO? HAJO, SCHNELL!«
Henning. Was zum Teufel …
»HAJO, DER IS WEG!«
Und dann stürmen auch schon die beiden Weißkittel vom Rettungswagen herein. »Der Wagen …«, keucht der Notarzt. Er raucht wohl Filterlose. »Weg! Mit der Leiche. Die war da schon drin.«
»Ihr habt euch den Wagen klauen lassen mitsamt Leiche und Kuchen?«
Henning ist aus der Küche gekommen und antwortet nicht. Das genügt. Ich schalte: »Los, dem Wagen nach. Der Fahrer ist der Tortenmörder!«
Ich eile mit Henning, Walter und Doktor Oliver nach draußen. Walter schwingt sich in seinen Streifenwagen und brettert los. Ich vermute, er will Richtung Autobahn. Walter ist ortskundig und kennt sicher die schnellste Fluchtroute.
Ich informiere die Leitstelle in Soest. Die sollen Straßenkontrollen einrichten. Und Kontakt zu der Mutter von Martin Piel aufnehmen. Dabei können sie ihr auch gleich die schlechte Nachricht überbringen.
Erleichtert stecke ich mein Telefon wieder ein. Und dann ist es tatsächlich mal Henning, dem was auffällt.
»Der Typ da!«, ruft er. »Bei dem Pferd!«
»Pferd?«
»Ähm, das ist ein Esel. Ein Esel und ein Sälzerknecht«, korrigiert ihn Doktor Oliver.
»Esel?«
»Ja, da hinten«, haucht Henning. »Der saß auch im Café. Mit den anderen. Die hatten alle so T-Shirts!«
»So T-Shirts? Henning, bisschen genauer bitte.«
Henning zeigt rüber zu einer Bronzeskulptur am Rand des Sälzerplatzes, direkt gegenüber des monströsen Sechzigerjahre-Kurmittelhauses mit seinem gläsernen Eingangsdreieck. Ein Typ, der einen Packesel anschiebt – so wie ich manchmal Henning anschieben muss.
Los, rein da, ab in Behandlung, denke ich. Könnte der Titel der Skulptur sein.
Der Typ allerdings, den Henning meint, ist ein alter Mann mit salzweißer Kapitänsmütze. Er hat sich halb hinter dem Esel versteckt und grinst uns an. Er trägt ein dunkles T-Shirt mit einem Spruch, den ich wegen der Lichtverhältnisse nicht entziffern kann.
Doktor Oliver verdreht die Augen. »Der Läutnant.«
Henning holt derweil sein Handy hervor. Bevor ich Doktor Oliver fragen kann, was er meint, sagt Henning: »Hier, die Bilder. Da muss was dabei sein.«
Hennings Finger zittern, als er sich durch die Fotos wischt, die er im Café gemacht hat, bevor die Neugierigen rauskomplimentiert wurden.
»Da! Wusste ich doch. Alle mit diesen T-Shirts.«
Das Foto ist nicht gut, aber zweckmäßig. Der Mann mit dem T-Shirt und der weißen Mütze gehört zu der Rentnertruppe, die ich verhört habe. Auf dem Foto sitzen vier Personen. Ich habe aber nur mit dreien gesprochen. Und die T-Shirts habe ich nicht gesehen, weil die Typen inzwischen Anoraks trugen.
Die Shirts ziert ein verwirrender Schriftzug: METOO.
Darunter steht etwas kleiner: Salami.OderSabine.
Henning lacht. »Me too? DIE hat man belästigt?«
Jetzt glaubt er tatsächlich, er habe die Lizenz zu Geistesblitzen.
Doktor Oliver räuspert sich: »Also den Mann da drüben, den kenne ich«, sagt er. »Horst Hecker. Fast neunzig und ziemlich … eigenwillig. Eine Nervensäge, die gern rumkommandiert. Sie nennen ihn den Läutnant. Mit ÄU. Kommt von LÄUTEN. Die ehemalige Glocke vom Siedehaus, das hier stand, nannte man so. Hecker ist extrem schwerhörig und schon deshalb extrem laut.«
»Aha«, sage ich. »Und Hecker und seine Mit-Me-Too-Sabinen sind Opfer von genau was geworden? Übergriffiger Bauernlümmel?« Ich weise zur Bronzeskulptur, diesem von einem Sälzerknecht am Hintern angeschobenen Esel.
Jetzt lacht sogar Doktor Oliver, wird aber gleich wieder ernst.
»Nein«, sagt er, »dieses Me Too bezieht sich auf … nun ja … also Bad Sassendorf gilt ja als Methusalem City. Verstehen Sie? ME-TOO-Salem. Die Stadt der Alten. Hieß es mal in einem Fernsehbericht. Ja, die Gemeinde ist alt. Aber Methusalem City, das geht dann doch in Richtung Fake News. Egal. Auf den T-Shirts steht übrigens METOO Saline. So nennen sie ihren Treffpunkt in Heckers Altenwohnung. Die vier sind rabiate Wutbürger, haben massiv gegen den Fernsehbericht und diverse Zeitungsartikel gewettert und in der Lokalpolitik Rabatz gemacht. Aber jetzt scheinen sie endgültig durchzudrehen.«
»Zumindest Hecker«, sage ich. »Ihm nach, Henning, der hat den Journalisten vergiftet!«
Henning und ich stürmen los. Doktor Oliver lässt es sich nicht nehmen, mitzujoggen. Hecker lacht und nimmt Reißaus. Wir hetzen hinterher.
Heiliger Himmel, ich denke, der ist fast neunzig?
»Früher war mehr Rheuma«, stöhnt Henning, als er die örtliche Einkaufsstraße, die Kaiserstraße, hochschnauft. Hecker, mit Kapitänsmütze, eilt davon. Vorbei an den Flaneuren, die sich umdrehen und applaudieren. Vor allem die Jüngeren. Das heißt: Ihm applaudieren sie, wir werden ausgelacht.
Seitenstiche lassen mich hecheln. Leichtfüßig eilt der Läutnant auf die Fußgängerbrücke am Ende der Kaiserstraße zu, flitzt dann aber rechts die Bahnhofstraße runter. Bergab wird er noch schneller und wir sehen ihn verschwinden. Ich kann nicht mehr.
Als wir schon glauben, er sei uns endgültig entkommen, verrät uns eine mitleidige Passantin, dass der joggende Alte laut lachend im halbgläsernen Seitenanbau einer Scheune verschwunden sei. Sie zeigt auf das Gebäude.
»Die Kulturscheune«, keucht Doktor Oliver. »Da findet grad eine Lesung statt.«
»Lesung?« Ich keuche ebenfalls. »Da schnappen wir ihn. Los – und den Ausgang sichern!«
Die Kulturscheune ist proppevoll. Die Schauspielerin Marie-Luise Marjan liest aus Pumpernickelblut, dem Krimi eines westfälischen Autors. Steht auf einem Plakat am Eingang. Henning postiert sich dort, und ich …
»Polizei!«, rufe ich. »Wir suchen einen älteren Mann mit weißer Mütze. Der ist hier rein!«
»Mann mit weißer Mütze? Ich sehe zwei. Einer hat grad Polizei gerufen«, kommt es lachend aus der Mitte der Zuhörer. Unsere Dienstmützen. Man denkt zu selten an solche Dinge. Marie-Luise Marjan und der neben ihr sitzende westfälische Autor gucken sich grinsend an. Ich werde rot. Hecker hat mit Sicherheit seine Mütze abgenommen. Versteckt er sich hier irgendwo oder ist er gleich hinter der Bühne verschwunden?
Meine Hoffnung sinkt. Aber dann kommt mir Marie-Luise Marjan – mit Adleraugen – zu Hilfe. Plötzlich weist sie in die Zuhörermenge und ruft: »Me Too? SIE? Das glaub ich jetzt nicht!«
Der Mann, auf den sie zeigt, wird rot.
Tja, Horst, versuch nie, eine Frau zu verarschen.
Hecker hat sich auf einen Platz in der dritten Reihe gemogelt, wo ein breiter Durchgang verläuft. Ich schlussfolgere spontan, dass man ihm dort was frei gehalten hat. Henning und ich schreiten zur Festnahme, wobei ich mich über meine Nachlässigkeit ärgere. Das Gesicht von Heckers Nebenmann kommt mir bekannt vor. Ich hätte im Café sorgfältiger die Personalien aufnehmen sollen.
Die Lesung geht weiter, Henning, Doktor Oliver, ich und der mit Handschellen fixierte Hecker verlassen das Gebäude. Draußen atme ich durch.
Doch Hecker will mir die gute Laune versalzen. »Sie können mir gar nichts nachweisen!«, krächzt er. Meine Ohren schmerzen.
»Freuen Sie sich nicht zu früh«, entgegne ich. »Wir werden Ihre Wohnung durchsuchen. Irgendwo werden wir Spuren des Giftes finden, mit dem Sie …«
»Dazu brauchen Sie aber eine Leiche!«, krakeelt Hecker.
Doktor Oliver nickt. Er ist Akademiker und geht die Sache rational an. Ich bin Polizist, stehe kurz vor dem Hörsturz und habe die Nase von diesem Fall gestrichen voll.
»Die werden wir finden!«, schnauze ich.
»Ha!«, trompetet Hecker – und als wäre er diesmal eine Spur zu weit gegangen beziehungsweise zu laut gewesen, etwa wie ein unvorsichtiger Skifahrer in einer – ich bin fast versucht zu sagen: salzweißen – Schneelandschaft, kracht es in der Ferne.
Lawinenabgang.
»Ach du je«, haucht Doktor Oliver.
Ich schaue ihn fragend an. Er will sich grad erklären, da klingelt mein Handy. Walter meldet sich. Der Notarztwagen ist gefunden. Man hat ihn mitten in einem riesigen Rhododendron im Kurpark abgestellt.
»Im Laderaum ist alles voller Sahnezeug«, sagt Walter.
»Was ist mit dem Fahrer?«
»Von dem fehlt jede Spur.
»Und die Leiche?«
»Tja … Kommt mal schnell.«
»Wohin denn?«, frage ich.
»Zum Gradierwerk.«
»Gradierwerk?«, wiederhole ich laut. Doktor Oliver schließt die Augen.
Henning holt den Streifenwagen. Was mir Doktor Oliver in der Zwischenzeit und auf dem Weg zum Kurpark erklärt, kann ich erst glauben, als ich es sehe. Während der Fahrt klingelt noch einmal mein Handy. Die Polizei aus Dortmund hat mit der Mutter Piels gesprochen. Der hatte als nicht sehr sauber arbeitender Journalist Material über die militanten Wutbürger um Hecker gesammelt und versucht, sie zu erpressen. Frei nach dem Motto: Ich sitze grad an einem Bericht über Methusalem City. Aber ich lasse mit mir reden …
Das hat sich der Läutnant mit seinen MeToo-Gesellen nicht gefallen lassen. Tja, die Leiche wäre jetzt das letzte Puzzlestück, um sie dranzukriegen.
Wir parken nah dem Thermalbad. Und dann stehen wir vor dem Gradierwerk. Mir stockt der Atem. Ich kenne Gradierwerke: hoch wie die Chinesische Mauer, aber nicht ganz so lang. Also, ein paar Dutzend Meter sind es meist schon. Hohe Wände aus Schwarzdorn-Reisern, durch die Salzsole nach unten rieselt, zerstäubt, zum Teil verdunstet. So steigt der Salzgehalt der Sole, sie ist leichter zu verarbeiten. Nach dem Wegfall der Salzgewinnung wurden aus Salzstädten Kurstädte. Reste von Gradierwerken wurden zu Freiluftinhalatorien. Gesunde salzhaltige Luft und so. Imposant sind die Dinger nach wie vor.
Aber dieses hier …
Die Lichtkegel von LED-Taschenlampen zucken umher. Ein riesiges Stück der wie ein Festungswall wirkenden Anlage ist zusammengesackt. Eine Lücke klafft dort, wo die von Ablagerungen gebräunten Schwarzdornbündel zu Boden gekracht sind. Immer mehr Leute strömen herbei, sich das Malheur anzusehen. Walter hält sie auf Distanz, denn der Rest des Gradierwerks scheint einsturzgefährdet.
»Zu schwer geworden«, sagt ein Passant. »Aber sollte eh abgerissen werden.«
Es stellt sich heraus, dass der Mann Siedemeister im Salzmuseum ist und sich mit der Materie auskennt: »Sind bestimmt siebzig Tonnen dazugekommen. Ablagerungen aus der Sohle, Mangan, Eisen, Calcium und so, wissen Sie?«
Ich nicke.
»Hätte man längst auswechseln müssen, den Schwarzdorn. Das letzte Mal ist schon über zwanzig Jahre her. In Bad Rothenfelde ist mal so ein Gradierwerk nach einem Düsenjägerüberflug zusammengekracht.«
Und hier war’s womöglich ein schriller Alter, denke ich.
»Tja«, sagt der Mann. »Irgendwann ist das kritische Gewicht überschritten.«
Wieder nicke ich, denn ich bin nun neben Walter getreten, ganz nah heran. Und wir erkennen mithilfe seiner Taschenlampe, welcher Art dieses kritische Gewicht war: ein Toter. Man hat versucht, die Leiche im Inneren des Gradierwerks zu verstecken. Martin Piel sieht unter all dem tonnenschweren Material ziemlich mitgenommen aus, ist gar nicht mehr zu erkennen. Aber es fällt mir leicht, ihn zu identifizieren. Denn das, was da unter dem Schwarzdorn-Abbruch hervorlugt, ist voller Sahne.
Bernhard Aichner
–
Pink Box Erwitte
Ich habe acht Käse gewonnen an dem Abend, an dem ich Igor Polski kennenlernte. Der alte, stille Mann saß neben mir an der Bar im Posthof. Er trank und beobachtete, wie wir spielten. Seine Augen folgten jeder unserer Bewegungen, er starrte auf die Würfel, er versuchte, die Regeln zu verstehen. Immer wieder schaute er freundlich in meine Richtung.
Am Anfang war er nur ein wortloser Fremder, der sich in unsere Bar verirrt hatte, einer, der es vorzog, bei den einfachen Leuten zu sitzen, bei den Verlierern.
Was ist das für ein Spiel?, hat er mich irgendwann gefragt.
Schocken, habe ich gesagt. Und es ihm erklärt. Dass wir es schon seit vierzig Jahren spielten, ein ganzes Leben lang, dass es uns die Zeit vertrieb.
Wir spielen normalerweise um Schnaps, habe ich zu ihm gesagt. Dass ich jedoch an diesem Abend genug hätte und den Käse vorzöge. Man kann ja nicht immer saufen, habe ich gesagt. Und Igor Polski lächelte.
Ich weiß nicht, ob er verstanden hat, wie das Spiel funktioniert. Ich glaube, es war ihm auch gar nicht wichtig. Er wollte einfach nur irgendwo ankommen an diesem Abend, jemanden in dieser Stadt finden, dem er vertrauen konnte. Dass ich das war, war Zufall. Dass ich an diesem Abend da war, dass auch ich dafür dankbar war, mich mit ihm unterhalten zu dürfen. Weil die Einsamkeit wie so oft unerträglich war. Weil da nur mehr die Würfel waren in meinem Leben, die anderen Männer an der Bar, die irgendwann aufstanden und nach Hause zu ihren Familien gingen. Nur ich nicht. Ich blieb. Mit Polski.
Er war großzügig. Er bezahlte die Wirtin dafür, dass sie länger für uns offen ließ, dass sie Bier zapfte. Polski genoss es. So wortkarg er anfangs auch war, mit dem Verstreichen der Stunden öffnete sich sein Mund. Er erzählte, fragte, staunte, hörte zu. Alles über Erwitte wollte er wissen, über die Menschen, die hier lebten, über den Kalkmergel, die Landschaft.
Dass er Künstler sei, erzählte er mir. Einigermaßen erfolgreich, ergänzte er. Wunderbar bescheiden war er und liebenswert, wenn man wusste, wie bekannt er wirklich war, wie erfolgreich, wie viel seine Werke kosteten, dass sie weltweit für Unsummen gehandelt wurden, dass sie in jedem großen Museum standen. Igor Polski war ein Star. Und er trank Bier mit mir im Posthof statt Sekt mit dem Bürgermeister und den anderen wichtigen Menschen der Stadt im Königshof. Er zog eine schummrige Kneipe dem feierlichen Empfang mit anschließendem Abendessen im Gasthof Büker vor.
Das hier ist mir wesentlich lieber. Gebrochenes Deutsch sprach er. Aber ich habe alles verstanden. Und er hat mich verstanden. Schön, dass du so viel Käse gewonnen hast, hat er gesagt.
Schön war auch das, was kommen sollte. Seine Gesellschaft. Ich war neugierig, fasziniert. Kunst hatte bis zu diesem Abend keinen Platz in meinem Leben gehabt, als Lagerarbeiter im Zementwerk hatte man kein Geld, keine Zeit, keinen Sinn für so etwas. Fünfundvierzig Jahre lang hatte ich im Schichtbetrieb gearbeitet, ich hatte ein kleines Haus gehabt, eine Frau, zwei Kinder, ein glückliches Leben. Jetzt bin ich im Ruhestand, die Kinder sind erwachsen und weggezogen. Meine Frau ist tot. Auch wenn ich mir jeden Tag wünsche, dass es anders wäre, sie ist einfach nicht mehr da. Sie lag nicht im Bett neben mir, als ich nach dem ersten Abend mit Polski nach Hause kam. Ich konnte ihr nicht mehr erzählen, dass ich mit dem Mann getrunken hatte, der Erwitte ein Kunstwerk schenken sollte, der sich unfassbarerweise für unsere schöne Stadt entschieden hatte, um sein neuestes Projekt zu verwirklichen.
Polski schwärmte. Ich bin fasziniert von diesem Stein, hat er gesagt. Dieses Material ist einzigartig auf der Welt, der Stein kommt aus diesem Boden und er soll auch hier verbaut werden. Polski meinte, dass er immer schon nach Erwitte kommen wollte, dass er es bereits jahrelang vorgehabt, es aber immer wieder hinausgezögert hätte. Jetzt ist es so weit, sagte er. Mein Kunstwerk ist eine Liebeserklärung an diese Region. Was ich hier hinterlasse, soll für immer daran erinnern.
Ich wusste damals noch nicht, was er damit meinte. Woran wir uns erinnern sollten. Ich hinterfragte es nicht, hörte ihm weiter zu, wie er Brandreden auf unseren Kalkmergel hielt. Er bat mich, ihm alles darüber zu erzählen, was ich wusste. Wie man ihn abbaue, wie man ihn zermahle.
Ich beschrieb ihm die Arbeitsabläufe, Polski war beglückt, dass er an einen Mann vom Fach geraten war. Was ist das für ein schöner Zufall, sagte er. Vielleicht hast du ja Lust, mir morgen die Gegend zu zeigen?, fragte er mich. Ich habe Ja gesagt. Wir verabschiedeten uns, er wankte zum Gasthof Büker und ich nach Hause.
Wie ein Kind freute ich mich darauf. Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich habe seinen Namen in die Suchmaschine eingegeben. Ich habe alles über ihn gelesen. Bis es hell wurde, saß ich vor dem Computer, ich war überrascht und begeistert zugleich. Seine Kunstwerke waren mir fremd, trotzdem mochte ich, was er schuf. Was er sagte. Und was er nicht sagte. Ich wusste vom ersten Abend an, dass Igor Polski kein Mörder war, dass sie ihn zu Unrecht beschuldigten, dass alles, was sie in den nächsten Tagen und Wochen behaupteten, nicht wahr sein konnte.
Ich zweifelte nie an seiner Unschuld. Er spielte nur mit ihnen, führte sie an der Nase herum, und er genoss es vom ersten Augenblick an. Polski sprach es mir gegenüber zwar nie aus, aber ich wusste es, ohne dass er ein Wort darüber verlieren musste. Von Tag zu Tag verstand ich mehr, ich begriff langsam, was dahintersteckte. Ich sah die Traurigkeit, die in ihm war, und die Wut, die aufblitzte, als ich zum ersten Mal über Paul Lenzen sprach. Über den Russen-Paul, wie sie ihn hier nannten.
Ein Zweiundneunzigjähriger, der von einem Tag auf den anderen aus Erwitte verschwand. Wie vom Erdboden verschluckt war er. In seinem kleinen Haus in Eikeloh ist er nie wieder aufgetaucht, eine Nachbarin hatte ihn wenige Tage nach Polskis Ankunft als vermisst gemeldet, tagelang suchte man nach ihm. Vier Streifenwagen, ein Hubschrauber, Polizisten aus Lippstadt kamen und haben jeden Stein umgedreht. Der Russen-Paul war einfach weg.
Igor Polski hat ihn umgebracht, flüsterten sie. Sie machten Polski dafür verantwortlich, irgendwann schrien sie es laut in die Welt hinaus. Igor Polski hat ihn einbetoniert. Ganz sicher waren sie sich, eins und eins hätten sie zusammengezählt. Unheimlich war alles.
Weil Igor Polski schwieg, nichts zu alledem sagte. Nur gelächelt hat er. Und mir zugezwinkert. Nahezu bei jedem Schritt hatte ich ihn in dieser Woche begleitet. Ich war es, der ihm gezeigt hatte, wo der Russen-Paul wohnte, vor dem Haus habe ich gewartet, bis Polski wieder herauskam. Warum er unbedingt mit ihm reden wollte, habe ich ihn gefragt, doch Polski hat mir nicht geantwortet. Stattdessen lud er mich ein, sein Begleiter zu sein, er erkor mich aus, sein Freund zu sein in diesen Tagen.
Du bist ein guter Mann. Ich würde mich freuen, wenn du mir hilfst, sagte er.
Wobei?, fragte ich ihn.
Das Kunstwerk. Ich möchte, dass wir es gemeinsam machen. Etwas Unvergessliches soll es werden, sagte er. Etwas, über das die ganze Welt sprechen wird. Käse kannst du auch dann wieder gewinnen, wenn ich weg bin. Er lachte.
Ich nickte und erwiderte sein Lachen. Ich war aufgeregt und neugierig, für kurze Zeit tauchte ich in seine Welt ein, in seine Geschichte, sein Leben. Wie ein Märchen war es.
Der einfache Arbeiter aus Erwitte, der dem internationalen Künstler assistierte. Niemand verstand es. Warum gerade ich. Ein einsamer Alkoholiker, dem Polski den Vorzug vor allen anderen gab. Er behandelte mich so, als wäre auch ich ein Künstler. Gemeinsam errichteten wir sein Kunstwerk, gemeinsam standen wir stundenlang auf der Baustelle am Marktplatz und schufteten.
Es ist wichtig, dass man selbst Hand anlegt, sagte Polski. Hinter Absperrungen und Sichtschutzwänden werkten wir. Niemand durfte sehen, was wir machten, Polski wollte der Welt erst zeigen, was er sich ausgedacht hatte, wenn es fertig war. Dann erst sollte Erwitte staunen, sehen, welches Geschenk er der Stadt gemacht hatte.
Der Bürgermeister brannte vor Neugier. Er war so stolz darauf, dass er den großen Künstler dafür hatte gewinnen können, sein Werk in das Zentrum seiner Stadt zu stellen, er konnte sich kaum zurückhalten. Lassen Sie mich doch einen Blick auf Ihr Werk werfen, sagte er immer wieder.
Nein, antwortete Polski. Sie haben die Entwürfe gesehen, das muss einstweilen reichen. Aber verlassen Sie sich darauf, es wird wunderschön.
Und der Bürgermeister gab sich gezwungenermaßen zufrieden damit. Er stand unter Druck, musste die Wogen glätten. Während wir Beton in die Schalungen gossen, begeisterte und beruhigte er alle anderen in der Stadt, er schlug die kritischen Stimmen nieder, sprach von der wahnsinnigen Werbung, die das Kunstwerk für Erwitte bringen würde. Er war es gewesen, der die Baugenehmigung besorgt, der den Beschluss zur Finanzierung der Baukosten erwirkt hatte. Er hatte zwar selbst Zweifel, aber er verteidigte Polski, ließ ihm bis zum Schluss freie Hand. Erwitte sollte strahlen. Und es strahlte auch. Nur in einer völlig anderen Farbe als erwartet.
Auf dem vorgefertigten Fundament entstand etwas, das alle entsetzen sollte, das die internationalen Medien mit Begeisterung auf das kleine Erwitte schauen lassen würde. Dutzende Lkw-Ladungen Beton wurden auf den Marktplatz gekarrt, Polskis angeblich geliebter Kalkmergel rann aus den Schläuchen, etwas Unverrückbares entstand, etwas Bleibendes. Igor Polski wollte, dass man es nicht mehr auslöschen konnte, er wollte, dass es für immer blieb. Ein massiver Würfel. 6 x 6 x 6 Meter. 43 Tonnen Stahl, 500 Tonnen Beton. Zement, Wasser, Zuschlag und Sand aus dem Boden der Region. Im Herzen der Stadt wuchs etwas Großes. Alles klappte wie am Schnürchen, Polski war zufrieden. Die Traurigkeit in seinen Augen verschwand genauso wie seine Wut. Und wie der Russen-Paul.
Ob ich wirklich immer dabei gewesen sei, haben sie mich nachher gefragt. Ob er manchmal allein auf der Baustelle gewesen sei. Ob Polski die Möglichkeit gehabt hätte, den Russen-Paul ungesehen einzubetonieren, ihn irgendwie zwischen all dem Stahl zu verbergen und seine Leiche verschwinden zu lassen?
Wahnwitzig war, was sie sagten, die Polizei war überfordert, sie wussten nicht mehr, was sie glauben sollten und was nicht. Sie redeten auf mich ein, trieben mich in die Enge. Also sagte ich die Wahrheit.
An einem Abend war ich nicht dabei, erzählte ich ihnen. Ich war im Posthof, habe gewürfelt. Polski meinte, ich solle mich entspannen, er müsse das Ganze auf sich wirken lassen. Also habe ich ihn alleine auf der Baustelle zurückgelassen. Ich weiß nicht, was er in dieser Nacht gemacht hat. Nicht, weil ich wirklich daran geglaubt hätte, dass er etwas mit dem Tod vom Russen-Paul zu tun hatte, ich habe das nur gesagt, weil ich nicht lügen wollte.
Das ist in Ordnung, flüsterte Polski mir am nächsten Tag verschwörerisch zu. Du hast das Richtige getan. Ich habe nichts anderes von dir erwartet.
Er war mir nicht böse, im Gegenteil, er hat sich darüber gefreut. Er wollte, dass sie ihn verdächtigen, er wollte, dass alles so kam, wie es am Ende gekommen ist. Es war so, als hätte er alles von langer Hand geplant. Nachdem sie herausgefunden hatten, dass Polski im Haus vom Russen-Paul gewesen war, kurz bevor der verschwand, konzentrierten sie die Ermittlungen ausschließlich auf ihn. Und auf mich.
Worüber haben die beiden geredet?, haben sie mich gefragt. Ich weiß es nicht, habe ich geantwortet. Niemand weiß das. Bis heute nicht. Ich wusste nicht, was sich zwischen den beiden Männern abgespielt hatte, ich ahnte es nur. Polski sprach nicht darüber, aber er verbarg es auch nicht vor mir, er führte mich sogar langsam dorthin. An den Punkt, an dem ich es begreifen konnte. In all seinem Schweigen darüber schrie er es laut hinaus, was ihn umtrieb.
Es war nach dem großen Empfang in der Feierhalle, als ich begann zu verstehen. Dass das alles einen Grund hatte. Die Medien waren eingeladen, ein gigantischer Auflauf war es, die ehemalige Horst-Wessel-Halle war prall gefüllt. Der Ministerpräsident war da, alles, was Rang und Namen hatte, hatte sich eingefunden. Sie wollten ihm noch vor der fulminanten Enthüllung des Kunstwerks einen Ehrenabend bereiten.
Sollen sie Kaviar essen und Champagner trinken, hat er zu mir gesagt. Aber ohne mich. Er stand mit mir vor der Feierhalle und rauchte, ein Glas Wodka in seiner Hand. Ich drängte ihn dazu, dass er endlich hineingehen solle, ich sagte ihm, dass alle nur noch auf ihn warten würden, aber er wehrte ab.
Ich werde dieses Gebäude nicht betreten, sagte er.
Warum nicht?, fragte ich ihn.
Und er schaute zu dem Reichsadler hinauf, der über dem Eingang thronte. Nach so vielen Jahren immer noch. Nur das Hakenkreuz haben sie entfernt. Der Adler ist immer noch da.
In diesem Moment war Hass in Polskis Augen. Vielleicht war es aber auch nur Enttäuschung. Lass uns gehen, sagte er.
Das können wir nicht machen, entgegnete ich.
Doch er ließ sich nicht aufhalten, er winkte einen Stadtrat zu sich und entschuldigte sich. Richten Sie bitte allen die besten Grüße von mir aus. Eine Magenverstimmung macht ein Bleiben unmöglich. Ich muss gehen. Und er ging. Polski war der Star, dem man nicht widersprach. Man bedauerte es, aber man nahm es hin. Er leerte den Wodka und ließ all die geladenen Gäste, die darauf brannten, den berühmten Künstler kennenzulernen, zurück. Sie feierten ohne ihn, während wir gemeinsam in den Posthof gingen. Und er Schocken mit mir spielte.
Während wir würfelten, dachte ich wieder an meine Frau. An die Geschichten, die sie mir immer erzählt hat. Diese Legenden, die sich rund um den Russen-Paul rankten, alte, vergessene Geschichten vom Krieg, die niemand mehr hören wollte, von denen sie aber berührt war. Von russischen Zwangsarbeitern, die aus dem Arbeitslager geflüchtet waren. Ein paar Tage, bevor der Krieg zu Ende war. Die Amerikaner waren bereits in Lippstadt. Hungrige, ausgezehrte Russen, die einfach nur nach Hause wollten. Russen, die aber bis heute in Erwitte geblieben sind.
Hingerichtet hat man sie. An der großen Kreuzung im Frühling vor dreiundsiebzig Jahren. Dort, wo die Ampeln heute immer auf Rot stehen, standen damals ein paar junge Männer mit den Waffen in der Hand. Sie schossen die Russen über den Haufen. Meine Frau hat immer wieder davon angefangen, immer wenn sie von ihrem Vater sprach, wenn sie sich an ihn erinnerte. Sie wiederholte, was er ihr erzählt hatte, als sie noch ein Kind gewesen war. Dass er alles beobachtet hatte, hatte er ihr erzählt. Weil er zufällig da gewesen war. Dass er nichts dagegen tun konnte, hatte er gesagt. Die Leichen der Russen lagen einfach mitten auf der Straße. Um ihr Leben hätten sie gebettelt, geschrien hätten sie. Aber einer nach dem anderen sei hingerichtet worden. Die Leichen wurden auf einen Karren gepackt und hinter dem Sportplatz vergraben. Erst später hat man sie auf den Friedhof gebracht und dort bestattet. Männer aus der Umgebung haben das getan. Sie sind ungestraft damit davongekommen. Männer wie der Russen-Paul. Er war einer von denen, hat meine Frau immer gesagt. Deshalb nannten sie ihn auch so. Russen-Paul.
Alles ergab nun einen Sinn. Der Nazi-Adler, die Feierhalle, die er nicht betreten wollte, sein Erscheinen in der Stadt, das Verschwinden vom Russen-Paul. Und diese Sache am Friedhof.
Ich möchte gerne sehen, wo deine Frau begraben liegt, hat Polski zu mir gesagt. Er stand mit mir an ihrem Grab, hörte mir zu, ließ mich reden. Dann schlenderten wir über den Friedhof. Kurz vor dem Ausgang blieb Polski stehen, dort, wo normalerweise alle schnell vorübergehen. Polski starrte auf einen Grabstein. Er las die Namen, die da standen. Und ich las mit. Seiner stand ganz oben. Sein Familienname. Wie eine Offenbarung war es, ein Geheimnis, das er für mich lüftete.
Alles spitzte sich langsam, aber beharrlich zu. Der Russen-Paul blieb verschwunden und Igor Polski tat weiterhin nichts, um den Offiziellen der Stadt zu gefallen, um sie zu beruhigen. Obwohl er die großzügige Einladung der Stadt, sich gebührend feiern zu lassen, ausgeschlagen, die Leute gekränkt, sie zurückgewiesen hatte. Die Ungeduld wurde immer größer, sie wollten endlich sehen, was Polski auf dem Marktplatz gebaut hatte, sie wollten die Lorbeeren ernten, endlich die internationalen Blicke auf Erwitte lenken. Sie ertrugen es nicht mehr, dass Polski sie ignorierte. Es brodelte im Hintergrund, man befürchtete, dass das Kunstwerk zum Zankapfel werden könnte, dass es nicht in die Stadt passen, dass es das historische Stadtbild verschandeln würde. Bereits vor der Enthüllung kletterten sie in der Nacht über die Absperrungen und die Sichtschutzwände, gaben dem Wachdienst Geld, damit er wegsah.
Die Stimmung war mehr als aufgeheizt, als es so weit war. Die einen wollten sich und Polski feiern, die anderen liefen Sturm, sie wollten alles rückgängig machen, brüllten herum, beschimpften Polski, spuckten in seine Richtung, weil sie bereits wussten, was auf sie zukommen würde. Der Marktplatz von Erwitte war feierlich geschmückt, ein Volksfest sollte es werden, ein feierlicher Moment, die Weltpresse sollte mit Fotos und Filmbeiträgen der Enthüllung versorgt werden, Igor Polski präsentierte seine neueste Installation.
Die Sichtschutzwände waren entfernt worden, nur noch ein schwarzes Tuch verbarg, was dahinter war. Überall waren Kameraleute und Fotografen, die Schützen standen Spalier, der Bürgermeister drängte Polski, es endlich wegzuziehen, den Blick auf das Jahrhundertkunstwerk freizugeben. Erwitteist stolz, sagte er noch. Dann blieben ihm die Worte im Halse stecken.
Auf gewisse Art und Weise ist es ein Mahnmal, hat Polski irgendwann einmal gesagt. Doch es war viel mehr als das. Es war spektakulär, eine Installation, wie man sie in New York erwarten würde. Es war eine Unterbrechung dieses Lebens, das wir alle führten. Polski drückte einen Augenblick lang auf die Stopptaste, er wollte, dass wir innehielten, zurückschauten. Er raubte allen den Atem. Dem Bürgermeister, der gesamten Stadtregierung, den Schützen, den verstörten Bürgern von Erwitte und auch dem Rest der Welt. Ein Blitzlichtgewitter war es, die Kameras fingen alles ein. Igor Polski, der zurückhaltende, die Kunstwelt überstrahlende Star, hatte sich für die Provinz entschieden.
Eine Intervention war es, schrieben sie, ein Werk, das mehrere Millionen wert war, ein Glücksfall für dieses kleine Städtchen. Doch das stimmte nicht.
Pink war es, viel zu groß, es widersprach jeder Regel, jedem Gefühl. Das Kunstwerk war wie eine Wunde, die Polski dem Platz zugefügt hatte, eine Narbe. Mitten auf dem Marktplatz stand dieser hässliche Würfel. 500 Tonnen, spiegelglatte Wände, kein Relief, kein Muster, keine aufgesetzten Figuren, kein Bild, keine Skizze, nur eingefärbter Beton, ein Quader, der wie ein überdimensionales Geschenkpaket aussah. Die Schleife hatte Polski bereits abgenommen. Pink Box Erwitte, stand auf dem kleinen Metallschild, das wir am Vorabend angeschraubt hatten. Eine Erwiderung. Von Igor Polski.
Ich muss mich ausruhen, hatte er gesagt. Aus einem Fenster im zweiten Stock des Gasthofs Büker beobachteten wir, was unten vor sich ging. Wir sahen zu, wie der Bürgermeister mit allen Mitteln einen Volksaufstand niederkämpfte.
Freibier für alle, rief er. Und auch das Essen war umsonst. Spanferkel, Würste, Steaks, er fütterte die wilde Horde, er stellte sie ruhig, ließ sie fressen und saufen, weil er spürte, wie wütend sie alle waren. Der Platz war zerstört, jeder musste sich dieses Monstrum ansehen, ob er wollte oder nicht. Man machte sich Gedanken. Über Igor Polski. Und über den Russen-Paul.
Er ist da drin, sagten sie. Am selben Tag, am nächsten und am übernächsten immer noch. Weil auch sie es begriffen irgendwann, dass Polski der Sohn eines Zwangsarbeiters war, dass er nur deshalb nach Erwitte gekommen war, um am Friedhof am Grab seines Vaters zu stehen. Um daran zu erinnern. Der Russen-Paul hatte seinen Vater umgebracht, und deshalb hat Polski ihn verschwinden lassen. Sie waren sich sicher. Sie begannen, den Russen-Paul zu suchen. Mit Schremmhämmern kamen sie und wollten ihn da herausholen, die Polizei konnte nicht verhindern, dass sie Löcher in das Kunstwerk schlugen, dass sie das sündteure Kunstwerk kaputt machten. Mit Gewalt beschädigten sie es, versuchten, es abzutragen. Doch da war zu viel Beton, zu viel Stahl. Die Pink Box blieb stehen. Und der Russen-Paul blieb verschwunden. Eine Zeit lang noch.
Erst zwei Monate später haben sie ihn gefunden. Als Igor Polski längst nicht mehr da war und die letzten Reste der Pink Box vom Marktplatz verschwunden waren, sind Fossiliensucher über seine Leiche gestolpert. In einem aufgelassenen Steinbruch. Auch einen Abschiedsbrief hat man gefunden. Es tut mir leid, was ich getan habe, stand da. Ein ganzes Leben lang schon tut es mir leid. Und man erzählte es weiter, jeder sollte es wissen. Der Russen-Paul hatte sich umgebracht, er habe es nicht mehr ertragen, mit seinem schlechten Gewissen zu leben. Eine tragische Geschichte war es, die endlich fertig erzählt werden konnte. Igor Polski hatte auf ungewöhnliche Art dafür gesorgt, dass man sich wieder an all das erinnerte.
Man legte Kränze nieder am Grab von Polskis Vater, es gab eine Gedenkmesse für die Opfer von damals. Immer wieder zündet nun jemand Kerzen an für die Zwangsarbeiter, die damals ermordet worden sind. Ich sehe sie brennen, wenn ich meine Frau besuche. Und ich denke an ihn. Ich lächle und warte. Darauf, dass Igor Polski vielleicht eines Tages nach Erwitte zurückkommt. Um mit mir zu würfeln. Und den einen oder anderen Käse zu gewinnen.
Klaus-Peter Wolf
–
Das Jahrestreffen der glücklichen Witwen in Unna
Ach du Scheiße, dachte ich. Unna! Ausgerechnet Unna! Das hört sich an, als wolle man da nicht tot überm Zaun hängen. Ich war noch nie da und glaub mir, ich hatte auch nicht vor, jemals dorthin zu fahren.
Ich saß während der Mandelblüte auf Malle, in meinem Garten mit unverbaubarem Meerblick, als mir der Einsatzort genannt wurde: »Unna!«
Sie stolziert vor dem Bett auf und ab. Bei jedem Klacken ihrer Stöckelabsätze zuckt er zusammen, als würde ein Stich seinen Körper treffen.
»Ja, da liegst du jetzt, mit Handschellen ans Bett gefesselt. Nackt und völlig ausgeliefert. So hast du es dir doch immer gewünscht, stimmt’s?
Wer die Macht hat, unterwirft sich gerne mal so zum Spaß, um auch einmal in das Gefühl zu kommen, wie das so ist: rumzuzappeln und zu flehen. Aber das macht nur Spaß, wenn man sonst im Leben alles im Griff hat und die anderen nach seiner Pfeife tanzen lässt. Das ist jetzt für dich vorbei, mein Lieber. Diesmal läuft gar nichts nach deiner Regie.«
Sie geht zu dem kleinen runden Tisch und fischt das Foto aus ihrer Handtasche. Sie hält es ihm vors Gesicht, als habe er es noch nie gesehen.
»Aber es kam noch schlimmer. Die Zielperson!« Sie schnippt mit dem Finger gegen das Bild: »Michael Janischewski. Neunundsechzig Jahre alt. Glatze, Bierbauch, rot geäderte Weintrinkernase.«
Sie liest vor, was hinten draufsteht: »Seine Frau ist vor vier Jahren gestorben, seine Tochter ein halbes Jahr später bei einem Autounfall. Bewohnt das große Haus im Bornekamptal ganz alleine und hat noch zwei Eigentumswohnungen in der Innenstadt. Eine vermietet an eine WG, die andere wird gerade frei. Er besitzt eine Lebensversicherung, eine Münzsammlung, hat ein paar durchaus wertvolle Bilder an den Wänden – und er ist einsam.«
Sie ohrfeigt ihn mit dem Foto und steckt es wieder in die Tasche. »Ja! Der ideale Kandidat.«