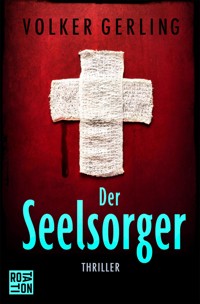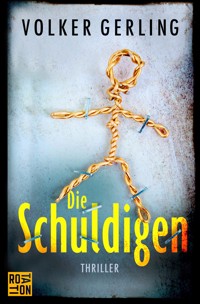4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Saskia-Wilkens-Reihe
- Sprache: Deutsch
Er mordet im Verborgenen. Herzstillstand lautet die offizielle Diagnose, als die Frau tot in ihrem Bett aufgefunden wird. Nur ein unscheinbares Brandmal lässt den Rechtsmediziner aufmerksam werden. Die Frau war nicht das erste Opfer, doch der Täter bleibt ein Unbekannter. Die junge LKA-Beamtin Saskia Wilkens schreckt nicht vor unkonventionellen Methoden zurück und ist neu in der Sondereinheit 303, die sich des Falls annimmt. Das neu gegründete Team ermittelt ganz ohne offizielle Genehmigung. Und so nähern sie sich dem Serienkiller, der immer brutaler tötet. Ein packender und rasanter Thriller um einen eiskalten, berechnenden Serienkiller. «Gerling weiß, wie es geht, und schreibt für das klassische Thriller-Vielleser-Publikum.» Heike Schmidtke, Verlagsleitung ARGON VERLAG AVE GmbH
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Volker Gerling
Brandmale
Sondereinheit 303
Thriller
Über dieses Buch
Er mordet im Verborgenen.
Herzstillstand lautet die offizielle Diagnose, als die Frau tot in ihrem Bett aufgefunden wird. Nur ein unscheinbares Brandmal lässt den Rechtsmediziner aufmerksam werden. Die Frau war nicht das erste Opfer, doch der Täter bleibt ein Unbekannter. Die junge LKA-Beamtin Saskia Wilkens schreckt nicht vor unkonventionellen Methoden zurück und ist neu in der Sondereinheit 303, die sich des Falls annimmt. Das neu gegründete Team ermittelt ganz ohne offizielle Genehmigung. Und so nähern sie sich dem Serienkiller, der immer brutaler tötet.
Ein packender und rasanter Thriller um einen eiskalten, berechnenden Serienkiller.
Vita
Volker Gerling lebt mit seiner Frau und seiner Tochter im beschaulichen Braunschweig. Wenn er nicht gerade kocht oder reist, beschäftigt er sich gern mit Psychopathen und Serienkillern. Unter dem Namen V. S. Gerling schreibt er seit 2005 Spannungsliteratur. Sein erster Roman erschien 2009.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Lektorat Katharina Naumann
Covergestaltung bürosüd, München
Coverabbildung Anja Weber-Decker/plainpicture
ISBN 978-3-644-01157-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Isabel.
Seit du bei uns bist, strahlt die Sonne viel heller.
Prolog
Einem wütenden Drachen gleich raste der Schmerz von ihrem linken Bein hinauf bis in den Kopf. Sie riss die Augen auf und wollte schreien. Sie konnte aber nicht. Die Lunge voller Sauerstoff verkrampfte sich schmerzhaft in genau diesem Moment, sodass sie nicht in der Lage war auszuatmen.
Was ist das? Die Frage schoss ihr durchs Hirn.
Es hört nicht auf. Warum hört es nicht auf?
Sie begann, am ganzen Körper zu zittern.
Oh mein Gott, es ist ein Schlaganfall …
Ihr Herz raste und schlug unregelmäßig. Sie hatte das Gefühl, es wollte aus ihrer Brust ausbrechen. Eine neue Welle der Panik durchflutete ihren Körper. Mit reiner Willenskraft durchbrach sie die Schockstarre, für einen kurzen Augenblick wurde sie wieder Herrin über ihren Körper und zog ruckartig die Beine an. Der Schmerz ließ augenblicklich nach. Tränen der Erleichterung liefen ihr über das Gesicht.
«Verdammt», sagte eine männliche Stimme verärgert.
Tobias? War er hier? Hatte er sie gerade gerettet? Aber warum klang er dann so zornig?
Langsam hob sie den Kopf und blickte zum Fußende des Bettes.
Sie erkannte Tobias und lächelte.
Aber dann sah sie, dass er etwas in den Händen hielt: einen länglichen Gegenstand, aus dem am unteren Ende ein Kabel herauskam, das zu einem Kasten führte, der auf dem Bett lag.
Tobias warf ihr einen flüchtigen Blick zu. Anstatt etwas Beruhigendes zu sagen, konzentrierte er sich wieder auf seine Tätigkeit. Mit weit aufgerissenen Augen beobachtete sie, wie er sich vorbeugte und ihr den länglichen Gegenstand an ihren linken Fuß drückte.
Augenblicklich war der wütende Drache zurück, und der Schmerz setzte wieder ein.
Dieses Mal jedoch gab es für sie kein Entkommen.
Sämtliche Muskeln in ihrem Körper zogen sich zusammen und hielten sie so gefangen. Ohne Unterlass jagte der Drache durch ihren geschwächten, siebenundsiebzig Jahre alten Körper. Sie verlor die Kontrolle über ihre Blase. Ihr Herz versuchte, den schnelleren und stärkeren Impulsen von außen zu folgen.
Das Letzte, was sie dachte, ehe es schwarz um sie wurde, war: Warum?
Herzrhythmusstörungen und Herzkammerflimmern verursachten den Zusammenbruch ihres Kreislaufs. Aufgrund des Sauerstoffmangels kam es zu massiven Hirnschäden und schließlich zum Tod. Tobias roch das verbrannte Fleisch. An der Fußsohle der toten Frau entdeckte er eine Wunde, in etwa so groß wie eine Ein-Euro-Münze. An den Rändern hatte sie Wülste gebildet. Das war nichts Neues für ihn.
Er lüftete das Schlafzimmer und zog der Frau anschließend Socken an. Dann wählte er den Notruf.
Die Rettungssanitäter blickten sich betroffen an. Der Notarzt hatte gerade den Tod der alten Dame namens Hannelore Klose festgestellt. Der Kriminaldauerdienst war verständigt und würde in wenigen Minuten eintreffen. Alles lief nach Vorschrift – selbst im Tod konnte niemand der Bürokratie entkommen.
Schließlich betraten zwei Beamte des Kölner KDD – eine Frau und ein Mann – das Schlafzimmer. Sie wechselten ein paar Worte mit dem Notarzt, der ihnen mitteilte, dass es keine Würgemale, Stich- oder Schusswunden gab. «Herzversagen», lautete seine Diagnose. Dann untersuchten die beiden erfahrenen Beamten die Leiche oberflächlich. Sie wussten, dass seine Schlussfolgerungen zu neunundneunzig Prozent vom Rechtsmediziner bestätigt wurden.
Die Polizistin wandte sich an den Mann, der den Notarzt verständigt hatte. «Mein Beileid zum Verlust Ihrer Mutter.»
Tobias drehte langsam den Kopf in ihre Richtung und blickte sie aus leblosen Augen an. «Sie war nicht meine Mutter. Sie war meine Ehefrau.»
ERSTER TEIL
1
Damals
«Der kleine Mann ist irgendwann falsch abgebogen.»
Das war die Standardantwort der Mutter des fünfjährigen Tobias, wenn sie gefragt wurde, warum der Junge denn nicht mit den anderen Kindern spielen wollte. Diese Antwort barg die Hoffnung in sich, sein Weg würde irgendwann wieder den seiner Mitmenschen kreuzen und alles würde gut werden. Ein Fünfjähriger jedoch konnte diese Bedeutung nicht verstehen.
Was er verstand und sich ihm einprägte, war das Wort falsch.
Tobias’ Mutter wäre schon mit der Erziehung eines normalen Kindes überfordert gewesen. Sie war mit ihren neunzehn Jahren schlicht zu jung und hatte sich noch nicht genügend ausgetobt, als dass sie ihrer Rolle als Mutter hätte gerecht werden können. Zumal Tobias alles andere als ein Wunschkind gewesen war. Ein Unfall kam der Wahrheit sehr viel näher. Die Pille war eben nur zu neunzig Prozent sicher. Tobias’ Vater war Handelsvertreter und ständig unterwegs. Das hatte ihr gefallen, bot die häufige Abwesenheit ihres damaligen Freundes doch jede Menge Freiraum für ihre eigenen Interessen. Meist verließ er das Haus am Sonntagabend und kehrte erst Freitagnacht zurück. Wenn er zu Hause war, drehte sich alles um ihn, aber das machte ihr irgendwann nichts mehr aus. Als sie schwanger wurde, war er wenigstens so fair und bot ihr an, sie zur Frau zu nehmen. Er verdiente gut und war trotz ihrer Schwangerschaft unter der Woche unterwegs. Als Tobias zur Welt kam, wurde er zu einer Art Dekoration. Zu einem perfekten Familienbild gehörte eben ein Kind. Aber jedes Kleinkind braucht Aufmerksamkeit. Je schlechter das Timing, desto höher war das Bedürfnis danach. Das begriff Tobias’ Mutter nicht. Sie kaufte ihm sprechende Puppen und Bücher, die Geräusche machten, in der Hoffnung, dann Zeit für ihre Maniküre zu haben. Tobias hatte etwas, das zu diesem Zeitpunkt noch relativ unbekannt war: das Asperger-Syndrom, eine leichte Variante des Autismus. Vereinfacht ausgedrückt, hatte Tobias Probleme damit, seine Emotionen einzuordnen. Erschwerend hinzu kam, dass ihm von klein auf ein Anker fehlte. Etwas, das ihm Halt gab. Ohne diese Sicherheit driftete er ab. Er erschuf sich seine eigene kleine Welt und verlor sich im Nirgendwo.
Sobald Tobias in die Schule kam, glänzte er mit recht guten Leistungen. Als Erster in seiner Klasse konnte er fehlerfrei lesen, was bei seinen Klassenkameraden für Neid sorgte und ihn zum Opfer von Hänseleien machte. Er kam immer öfter mit kleineren Wunden nach Hause. Als er eines Tages ein blaues Auge hatte, entschied seine Mutter, mit dem Klassenlehrer zu sprechen.
«Tobias ist anders …», sagte der Lehrer vorsichtig.
«Ich weiß. Er lacht sehr wenig.»
«Er lacht überhaupt nicht. Seine Klassenkameraden finden ihn … unheimlich.»
«Aber er tut ihnen doch nichts, oder?»
«Nein …»
«Was denn? Was tut er denn?»
«Er sieht sie einfach nur an.»
Ihre hilflosen Versuche, mit ihrem Sohn zu reden, scheiterten. Sie drang nicht zu ihm durch. Schließlich gab sie auf. Sie tröstete sich mit der Gewissheit, dass Tobias schließlich nicht dumm war, denn seine Leistungen wurden immer besser. Vor allem in Mathematik und Physik. Tobias war fasziniert von der unbestechlichen Logik der Zahlen.
Eines Tages, Tobias war da schon zehn, fand seine Mutter im Briefkasten einen Brief von der Schule. Man bat sie und ihren Mann zu einem Gespräch. Da der Vater von Tobias wieder auf Reisen war, erschien sie alleine. Ein verstörter Rektor erklärte ihr, was geschehen war.
Während des Unterrichts war eine Taube gegen eine der Fensterscheiben geprallt und zu Boden gefallen. Die Schüler waren aufgeregt aus dem Klassenzimmer gelaufen und hatten sich um die Taube versammelt. Sie war am Leben, aber offensichtlich schwer verletzt.
Tobias war ohne zu zögern neben dem Vogel auf die Knie gegangen und hatte ihm mit einer entschlossenen Handbewegung das Genick gebrochen. Viele Mädchen hatten vor Schreck zu weinen begonnen, die Lehrerin ihn entsetzt angeschrien. Tobias schien von dem Aufstand um ihn herum unbeeindruckt zu sein.
Als ihr Mann von seiner Reise zurückkehrte, berichtete Tobias’ Mutter ihm sofort davon. Er ging zu seinem Sohn ins Zimmer, setzte sich auf das Bett und sagte:
«Weißt du, warum ich in meinem Beruf so erfolgreich bin?»
Tobias schüttelte den Kopf.
«Weil die Kunden mich mögen. Alle. Auch die, die ich überhaupt nicht ausstehen kann, mögen mich. Weißt du, warum?»
«Warum?»
«Weil ich mich so verhalte, wie sie es erwarten. Machen sie einen Witz, lache ich. Auch, wenn er gar nicht lustig war. Erzählen sie mir etwas Trauriges, höre ich ihnen einfach zu und tröste sie. Gleichgültig, ob ich sie mag oder nicht. Verstehst du, worauf ich hinauswill?»
Tobias bemühte sich, seinen Vater zu verstehen, aber es misslang ihm. «Ich weiß nicht …» Dass er nicht begriff, was sein Vater ihm sagen wollte, machte ihn traurig und wütend zugleich. Er kam sich schrecklich dumm vor. Dabei war er doch schon zehn!
«Die Menschen glauben, dass es wichtig ist, wenn man die Gefühle anderer nachempfinden kann. Ich halte das für Blödsinn. Ich denke, es ist viel besser, wenn man die Gefühle anderer erkennt und sie zu seinem eigenen Vorteil nutzt. Und das Schöne ist, dass es niemand merkt.»
«Ich muss also nur erkennen, ob jemand traurig oder wütend ist. Ich muss nicht verstehen, warum das so ist …?»
Sein Vater lächelte ihn stolz an. «So ist es. Glaubst du, dass du das hinkriegst?»
Tobias, der immer versucht hatte zu begreifen, aus welchem Grund seine Mitschüler oder Lehrer wütend oder traurig waren, daran aber jedes Mal scheiterte, weil er ihre Empfindungen schlicht nicht nachvollziehen konnte, nickte heftig. «Ja. Ganz bestimmt.»
«Deine Mutter sagte mir, dass deine Klassenkameraden Angst vor dir haben. Weißt du, warum das so ist?»
«Nein.»
«Sie finden dich gruselig, weil du dich anders verhältst als sie. Dabei ist es ganz einfach, dafür zu sorgen, dass das aufhört, mein Sohn. Wenn sie lachen, lach mit ihnen. Wenn sie schreien, dann schrei auch. Wenn sie fortlaufen, renn so schnell wie der Wind. Kannst du das?»
Tobias dachte darüber nach und nickte. «Ja, das kann ich.»
«Gut. Wir suchen dir eine neue Schule. In deiner alten würde es auffallen, wenn du dich plötzlich anders verhältst. Das würde dir keiner glauben. Aber in der neuen Schule tust du genau das, was ich dir gerade gesagt habe. Du wirst sehen, niemand wird mehr Angst vor dir haben. Und keiner wird jemals wieder über dich lachen.»
«Okay.»
«Eine Frage habe ich noch. Warum hast du die Taube getötet?»
«Weil sie sowieso gestorben wäre. Ich habe sie von ihrem Leid erlöst.»
Sein Vater nickte nachdenklich. Tobias war ganz aufgeregt. Es war das erste Mal, dass sein Vater so lange und so ernst mit ihm über seine Probleme in der Schule sprach. Es tat ihm gut. Er fühlte sich verstanden.
«Weißt du, warum deine Lehrerin und deine Mitschüler das für falsch gehalten haben?»
«Nein.»
«Es gibt nur zwei Sorten von Menschen, mein Sohn. Die Lämmer und die Wölfe. Die Lämmer tun nichts. Sie warten ab, weil sie Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Das überlassen sie lieber den anderen: den Wölfen. Du hast eine Entscheidung getroffen, als du die Taube getötet hast. In den Augen der Lämmer war das natürlich die falsche Entscheidung. Aber wir beide wissen, dass es die richtige war. Ich bin stolz auf dich.»
«Aber sie lachen über mich», sagte Tobias zornig.
«Ich kann dir sagen, warum sie über dich lachen: weil du anders bist. Aber wir lachen über sie, weil sie alle gleich sind.»
2
Als Tobias Wiegand neunzehn war, starb sein Vater. Seine Mutter heiratete kurz darauf wieder. Seinen Stiefvater hasste er vom ersten Moment an, was allerdings weder seine Mutter noch ihr neuer Ehemann jemals wahrnahmen. In seinen Augen waren beide dumm. Seine Mutter versuchte wiederholt, Kontakt zu ihm aufzunehmen, aber er reagierte nicht darauf. Tobias brauchte niemanden, er war sich selbst genug. Am liebsten wollte er irgendwo weit abseits von allen und allem in der Wildnis leben. In Kanada oder Alaska. Aber das kostete Geld. Sehr viel Geld. Und arbeiten war nicht unbedingt seine Stärke. Mehr aus Ermangelung einer echten Alternative, und weil er schließlich irgendetwas machen musste, studierte Tobias Betriebswirtschaft. Er machte seinen Abschluss und erhielt in einem großen Konzern eine Anstellung als Controller. Er verlor aber schnell das Interesse an dieser Aufgabe und kündigte nach wenigen Monaten. Es folgten über die Jahre Jobs in verschiedenen Banken, bis er schließlich sein Glück in einem Versicherungskonzern versuchte. In seinem Lebenslauf verschwieg er viele kurze Beschäftigungen einfach. Denn bis zum Alter von achtundvierzig Jahren hatte er sechzehnmal seine Arbeitsstelle verloren.
Der große Verschleiß an Jobs hatte mehrere Gründe: Wiegand war hochintelligent, hatte aber extreme Schwierigkeiten mit Vorgesetzten, die nicht so klug waren wie er. Da das jedoch auf die meisten zutraf, geriet er immer wieder in Konflikte, die in der Auflösung seines Arbeitsvertrages endeten. Der zweite Grund war, dass ihn seine Aufgaben nach kurzer Zeit langweilten, woraufhin seine Leistungen nachließen. Das führte meist zu Gesprächen mit seinen Vorgesetzten, in denen er mehr als deutlich machte, was er von ihnen hielt.
Tobias Wiegand war eine stattliche Erscheinung: groß, schlank, dunkles, halblanges Haar, schmales Gesicht mit kleiner Nase. Wenn er lächelte, flogen ihm die Herzen seiner Mitmenschen zu. Niemand bemerkte, dass sein Lächeln nie seine Augen erreichte. Und wenn er mit seiner ruhigen, tiefen Stimme zu sprechen begann, hingen die Menschen an seinen Lippen. Dies fiel dem leitenden Direktor der Versicherungsgesellschaft auf, für die Tobias im Rechnungswesen arbeitete. Er schlug ihm vor, in den Außendienst zu wechseln. Hier fand er endlich so etwas wie eine Berufung. Obwohl er kein angenehmer Zeitgenosse war. Er hatte keine Freunde und wollte auch keine haben, da diese nur Aufmerksamkeit forderten. Zu seiner Familie hatte er den Kontakt abgebrochen. Allerdings war er ein hervorragender Versicherungsverkäufer, denn er konnte gut schauspielern. Über die Jahre hatte er gelernt, anderen Menschen absolut glaubhaft Empathie vorzutäuschen. Er hatte die Lektion seines Vaters nie vergessen und zur Perfektion gebracht. Oft weinte er gemeinsam mit Kunden, nachdem sie ihm ihre traurige Geschichte erzählt hatten. Unter Tränen unterschrieben sie anschließend den Vertrag.
Nachdem er sicher war, dass der Außendienst mit all seinen Freiheiten das Richtige für ihn war, befreite er sich von den Ketten einer Festanstellung und entschied sich, in Zukunft als selbständiger Handelsvertreter Versicherungen zu verkaufen. Obwohl er von Natur aus sehr faul war, gab Wiegand nun richtig Gas und verdiente gutes Geld.
Er hatte ein Ziel vor Augen. Das hatte ihm die ganze Zeit geholfen, seinen unsteten Lebenswandel zu ertragen. Im Grunde war der Verkauf von Versicherungen weit unter seinem Niveau. Aber man verdiente gutes Geld. Vor allem dann, wenn man keinen moralischen Kompass besaß.
3
Oktober 2018
Es gab für alles einen Grund. Einen Auslöser. Manchmal sogar eine Art Initialzündung. Tobias Wiegand erlebte diesen Moment bei einem Kundenbesuch.
Ein Handwerker, der schon viele Jahre Kunde der Versicherung war, für die Wiegand arbeitete, wollte eine Lebensversicherung abschließen. Erst vor kurzem Vater geworden, hatte er abends keine Zeit für einen Vertreterbesuch. Deshalb bat er Wiegand, das Beratungsgespräch auf einer Baustelle zu führen. Der Handwerker, ein Elektriker, stand auf einer Leiter, seine Hände waren in einem Loch in der Decke verschwunden, wo er an irgendetwas herumfummelte, als er Wiegand bat, ihm die Möglichkeiten einer Absicherung der Familie zu erläutern.
Wiegand legte los. Etwa nach fünf Minuten blickte der Handwerker zu ihm herunter, um eine Frage zu stellen, als er plötzlich aufschrie. Die Leiter fing an, bedrohlich zu schwanken. Dann stürzte der Elektriker zu Boden, die Leiter landete krachend neben ihm auf dem Beton.
Wiegand warf einen Blick nach oben und versuchte, etwas zu erkennen. Aber das Loch gab sein Geheimnis nicht preis. Er zögerte kurz, dann prägte er sich die Lage der Leiter ein, stellte sie auf und stieg die Sprossen hinauf. Jetzt konnte er in das Loch schauen. Er erkannte frei liegende Kabel.
Der Mann musste einen Stromschlag bekommen haben. Wiegand stieg die Leiter wieder hinab und legte sie in die ursprüngliche Stellung zurück. Er ging neben dem regungslosen Mann in die Hocke, wusste jedoch nicht, was er tun sollte. Schließlich nahm er sein Handy und wählte die 112.
Etwa fünf Minuten später hörte er das Martinshorn des Rettungswagens. Noch einmal drei Minuten später wollten die Rettungssanitäter Erste Hilfe leisten. Einer von ihnen schüttelte nur den Kopf.
«Der ist hinüber», sagte er und stand auf.
Der andere wandte sich an Wiegand. «Was genau ist passiert?»
«Er stand auf der Leiter, während ich mit ihm gesprochen habe. Plötzlich hat er geschrien und ist heruntergefallen.»
Keiner der beiden schaute nach oben.
«Hatte wohl einen Herzinfarkt», meinte der eine.
«Ich ruf den Doc an», sagte der andere.
Zehn Minuten später stand der Notarzt neben der Leiche.
Er bat Wiegand noch einmal zu wiederholen, was geschehen war. Wiegand erzählte dieselbe Geschichte. Auch der Notarzt blickte nicht an die Decke. Stattdessen unterzog er die Leiche einer oberflächlichen Untersuchung. «Ich tippe auf Herzinfarkt», lautete seine Diagnose.
Wiegand fand das sehr interessant. Nicht einmal dachte er daran, den Arzt darauf hinzuweisen, dass der Handwerker an offen liegenden Kabeln gearbeitet und möglicherweise einen Stromschlag erlitten hatte. Er hielt den Mund, während es in seinem Hirn begann zu arbeiten.
Er rief vom Auto aus seinen Arbeitgeber an und erzählte ihm, was sich ereignet hatte. Sein Chef hatte Verständnis dafür, dass Wiegand wegen des Schocks ein paar Tage freinahm.
Während der gesamten Fahrt nach Hause kreisten seine Gedanken um eine einzige Sache: Es war ja möglich, dass der Handwerker tatsächlich an einem Herzinfarkt gestorben war – aber die Ursache für den Infarkt war der Stromschlag. Der Elektriker war dreiunddreißig Jahre alt und kerngesund. Das wusste Wiegand, da er ihm Angebote für seine Altersversorgung erstellt und zuvor am Telefon schon einiges mit ihm geklärt hatte. Unter anderem auch die Gesundheitsfragen.
Ein kerngesunder junger Mann konnte also durch einen Stromschlag sterben. Das war nicht gerade eine bahnbrechende Erkenntnis. Doch es sah so aus, als wäre er an einem Herzinfarkt gestorben. Das war über alle Maßen interessant. Man könnte also jemanden auf die Art töten und es wie eine natürliche Todesursache aussehen lassen.
Genau an dieser Stelle des Gedankenspiels trennte sich die Spreu vom Weizen. Der überwiegende Teil der Menschen, die über diesen Sachverhalt nachdachten, würde nur mit den Schultern zucken und etwas anderes tun. Ein verschwindend kleiner Rest würde diesen Gedanken weiterspinnen. Von diesem kleinen Rest würde vielleicht 0,1 Prozent beschließen, die Idee in die Tat umzusetzen.
Tobias Wiegand gehörte in diese Gruppe.
In diesem Moment beschloss er, einen Menschen zu töten. Nicht des Tötens wegen. Vielmehr glaubte er, eine Methode entdeckt zu haben, mit der er ohne großen Aufwand an viel Geld kommen konnte. Sein Gedanke war recht simpel: Wenn ein junger kerngesunder Mann an einem Herzinfarkt sterben konnte, ohne dass irgendwelche Zweifel oder Fragen aufgeworfen wurden, wie wäre es dann, wenn eine ältere Frau dieses Schicksal erlitt? Der Logik nach dürfte es noch weniger Zweifel und Fragen nach sich ziehen. Es wäre der Lauf der Dinge – die natürlichste Sache der Welt.
4
Dezember 2020
Saskia Wilkens raste die A7 in Richtung Süden entlang. Fast hätte sie die Ausfahrt Schnelsen-Nord verpasst. Sie wechselte schnell auf die rechte Spur und sauste auf die Ausfahrt, was ihr ein wütendes Hupen vom Wagen hinter ihr einbrachte. Saskia lachte und winkte dem Fahrer zu. Der zeigte ihr erbost den Mittelfinger.Sie hatte das Wochenende bei ihren Eltern im Norden verbracht und Sonntag spontan entschieden, noch eine Nacht zu bleiben. Um den Pendlern aus dem Weg zu gehen, war sie früh am Montagmorgen aufgebrochen. Kaum hatte sie die A7 verlassen, reihte sich Baustelle an Baustelle, und sie verlor den zeitlichen Vorsprung, den sie zuvor aufgebaut hatte. Im Vergleich zu Hamburg war Kiel ein Dorf. Hier war alles irgendwie größer. Sogar die Straßen wirkten breiter, obwohl das natürlich Quatsch war.
Leider waren auch die Staus länger.
Nervös warf sie einen Blick auf die Uhr im Armaturenfeld. Laut Navi brauchte sie noch fast eine halbe Stunde bis ins Präsidium am Bruno-Georges-Platz 1. Sie war rechtzeitig losgefahren, und auf der Autobahn war auch alles wie am Schnürchen gelaufen. Aber jetzt … würde sie zu spät kommen.
Das würde ihrem Vorgesetzten nicht gefallen. Seit Saskia vor einem Jahr in das Landeskriminalamt Hamburg gewechselt und Hauptkommissar Eisenach zugeteilt worden war, ließ der sie regelmäßig spüren, was er von ihr hielt: nämlich gar nichts. Das lag noch nicht einmal an ihr selbst. Ihr Partner galt allgemein als äußerst schwieriger Mensch. Ihre Kollegen in Kiel hatten sie vorgewarnt, denn Eisenach eilte ein bestimmter Ruf voraus. Sicher, es war ein großer Karriereschritt für Saskia, ins LKA Hamburg zu wechseln. Womit sie ihrem eigentlichen Ziel, ins Bundeskriminalamt zu kommen, noch einen Schritt näher kam.
Ihrem großen Ziel, dem BKA, ordnete sie alles andere unter. Sogar eine Beziehung hatte sie dafür aufgegeben. Markus hatte ihren Ehrgeiz irgendwie pervers gefunden, nannte es einen Fetisch. Er hatte überhaupt nicht verstanden, warum sie diesen Weg eingeschlagen hatte. Markus wollte nicht begreifen, dass, wenn man wirklich etwas bewegen wollte, man ganz nach oben müsste. Erst dann würden die Leute einem zuhören. Und Saskia hatte eine Menge zu sagen. Das müsste eigentlich auf jeden Menschen zutreffen, der halbwegs bei Verstand war und mit offenen Augen durchs Leben ging. Tat man das, erkannte man auch die Missstände, die einem jeden Tag begegneten. Ungerechtigkeiten waren an der Tagesordnung. Im Kleinen wie im Großen.
Der Tante-Emma-Laden um die Ecke musste schließen, weil der Baulöwe das Gebäude abreißen wollte, um teure Eigentumswohnungen zu bauen, die sich eine normale Familie niemals würde leisten können. Deshalb starben die Innenstädte aus, verkamen zu überteuerten Luxusenklaven, in denen kaum noch Kinder aufwuchsen oder Rentner ihren Ruhestand genossen. Die mussten alle an den Stadtrand ziehen oder ganz woandershin. Im Übrigen war der Baulöwe überschuldet und frisierte seine Liste neuer Mieter, sodass die Banken ihm noch mehr Geld in den Rachen warfen. Schadensbegrenzung nannten die Banker das. Was für ein Irrsinn. Am Ende verschwand der Baulöwe mit Millionen Euro im Koffer ins Ausland, und die kleinen Handwerksbetriebe, die in Vorleistung getreten waren, mussten Insolvenz anmelden.
«Um solche Dinge zu ändern, musst du in die Politik gehen», hatte Markus gesagt. «Was willst du bei der Polizei?»
Er hatte nicht verstanden, dass das nicht funktionieren würde, da die Politiker in diesem Spiel eine tragende Rolle einnahmen. Genau das wollte sie ändern. Auf ihre Weise. Als Polizeibeamtin im BKA wäre ihr das möglich. Da könnte sie ihr bestehendes Netzwerk weiter ausbauen, denn ihr würden fast alle Türen offen stehen. Vor allem die des Innenministeriums. Und dann könnte sie damit beginnen, bundesweit die Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, denen die Menschen Tag für Tag ausgesetzt waren.
Aber erst einmal müsste sie wohl oder übel Eisenach anrufen, um ihm zu sagen, dass sie zu spät kommen würde. Saskia fuhr rechts ran und gab die Telefonnummer ein. Sofort sprang die Mailbox an. Das war typisch für ihn; sein Handy war selten vor zehn Uhr vormittags angeschaltet. Es blieb ihr nichts anders übrig, als im Präsidium anzurufen. Vielleicht saß er ja schon an seinem Schreibtisch. Es war noch früh, sodass ihr Anruf an die Zentrale weitergeleitet wurde.
«Polizeipräsidium Hamburg, was kann ich für Sie tun?»
«Guten Tag, Oberkommissarin Wilkens hier. Ich würde gerne mit Hauptkommissar Eisenach sprechen.»
«Einen Moment bitte, ich verbinde Sie.»
Es entstand eine kleine Pause, die durch langweilige Fahrstuhlmusik nicht erträglicher wurde.
Dann: «Ludwig.»
In ihrer Abteilung arbeitete niemand, der Ludwig hieß. Sie war also immer noch irgendwo im Erdgeschoss, wo sie keiner kannte.
Immerhin arbeiteten fast zweitausend Menschen in dem Gebäude.
«Hallo. Oberkommissarin Wilkens hier. Ich würde gerne mit Hauptkommissar Eisenach sprechen», wiederholte sie ihre Bitte.
«Der ist zu einem Tatort unterwegs.»
«Oh … ich bin seine Partnerin. Könnten Sie mir bitte sagen, wo dieser Tatort ist? Dann könnte ich statt ins Büro gleich dahin fahren.»
Natürlich wollte Herr Ludwig ihre Dienstnummer erfahren, damit er Saskias Angaben überprüfen konnte. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass besonders schlaue Journalisten Tricks anwandten, um an Informationen zu gelangen. Sobald klar war, dass Saskia keine Reporterin war, erhielt sie die Adresse. Sie bedankte sich, unterbrach die Verbindung und gab das neue Ziel ins Navi ein. Als die Route berechnet worden war, hätte sie vor Freude fast geschrien.
Das Ziel war nur fünf Autominuten von ihrem aktuellen Standort entfernt.
Mit ein klein wenig Glück würde sie sogar noch vor Eisenach dort ankommen.
Saskia setzte den Blinker, fädelte sich in den Verkehr ein und fuhr los.
Der Tatort befand sich in einer verkehrsberuhigten Seitenstraße einer ruhigen Wohngegend im Hamburger Stadtteil Hummelsbüttel. Saskia wusste anhand der dort parkenden Einsatzfahrzeuge, dass sie ihr Ziel erreicht hatte. Sie sah einen Krankenwagen und drei Zivilfahrzeuge. Sie vermutete, dass eines der Fahrzeuge dem Kriminaldauerdienst gehörte. Das zweite war mutmaßlich von der Spurensicherung, das letzte vom Rechtsmediziner. Der Leichenwagen war noch nicht eingetroffen.
Saskia stellte ihren Wagen am Straßenrand ab, stieg aus und betrachtete das Haus. Es handelte sich um ein großes einzeln stehendes Gebäude mit gepflegtem Vorgarten. Natürlich hatte Saskia sich über die Immobilienpreise Hamburgs erkundigt, als ihre Versetzung feststand. Schließlich würde sie ein neues Zuhause benötigen. Dieses Anwesen in dieser Gegend hier war locker eine Million Euro wert.
Sie öffnete die Pforte und ging den mit kleinen weißen Kieselsteinen ausgelegten Weg hoch bis zum Eingang des Hauses. Dort empfing sie ein blasser Polizist in Uniform.
Sie zeigte dem Kollegen ihren Ausweis.
«Die Frau liegt im Schlafzimmer. Durch die Eingangstür, dann die zweite rechts. Aber ich muss Sie warnen; es ist kein schöner Anblick. Überzieher liegen übrigens vor der Haustür.»
Saskia bedankte sich und ging zur Eingangstür. Dort fand sie in einem Karton die Plastiküberzieher, die verhindern sollten, dass der Tatort durch Schmutz an den Schuhen verunreinigt wurde. Sie zog sich die Plastikhauben über ihre Schuhe und ging in das Haus.
Als sie im Flur stand, kam ihr ein zweiter Beamter entgegengelaufen. Saskia sah seinen Gesichtsausdruck, und sie beschlich ein ungutes Gefühl.
Der arme Kerl war panisch und kurz davor, sich zu übergeben.
Bevor sie das Zimmer betrat, hörte sie ihn draußen vorm Haus würgen. Saskia atmete tief durch und machte einen Schritt nach vorn.
Jetzt konnte sie in das Wohnzimmer sehen.
Ihr erster Gedanke war: «So viel Blut.»
Die Leiche der Frau lag auf dem Teppich, der sich durch das viele Blut dunkel verfärbt hatte. Ein scharfer metallischer Duft lag in der Luft. Und der Geruch nach menschlichen Exkrementen. Eine teuflische Kombination.
Zwei Männer in weißen Schutzanzügen hatten ihre Arbeit offenbar beendet. Nun standen beide an der Seite und sahen einem dritten Mann, der über die Leiche gebeugt war, bei der Arbeit zu. Bis auf das Rascheln der Schutzanzüge war es totenstill im Zimmer. Was ihr sofort auffiel, waren die vielen kleinen Fähnchen, die von den Beamten immer dann ausgelegt wurden, wenn sie eine Spur entdeckt hatten. Am Kopfende der Frau und sogar noch mehrere Meter davon entfernt gab es jede Menge davon.
Saskia räusperte sich. «Guten Tag.»
Die Köpfe der drei Männer ruckten gleichzeitig in ihre Richtung. Der Mann, der sich um die Leiche kümmerte, richtete sich auf und kam auf sie zu.
«Darf ich fragen, wer Sie sind?»
Erneut zückte Saskia ihren Ausweis. «Oberkommissarin Wilkens. LKA Hamburg. Ich bin die …»
Das Gesicht des Mannes erhellte sich. «Sie sind die neue Partnerin von Eisenach. Etwas spät, aber herzlich willkommen in Hamburg.» Er streckte ihr die behandschuhte Rechte entgegen. «Wolfgang Schubert mein Name. Ich bin der zuständige Rechtsmediziner. Die beiden Kollegen hier gehören zu mir. Sie wollten eigentlich schon damit beschäftigt sein, unsere Ausrüstung in den Wagen zu bringen. Aber sie können sich von dem Anblick einfach nicht losreißen.» Als er merkte, dass er noch den Handschuh trug, grinste er schief und zog ihn aus. Saskia ergriff die Hand. Die zwei Kollegen von Schubert lächelten Saskia freundlich an, schnappten sich ihre Koffer und verschwanden.
Überrascht von so viel Freundlichkeit, lächelte sie Schubert an. «Ganz so neu bin ich zwar nicht mehr, aber dennoch: Vielen Dank für die nette Begrüßung.»
Schubert war etwa Ende fünfzig, klein und drahtig. Sein Haar befand sich auf dem Rückzug, hatte aber um die Ohren herum Reserven gebildet. Er machte eine weit ausholende Geste, die den gesamten Raum einschloss. «Ich bin nicht mehr so oft an Tatorten. Deshalb sehen wir uns auch zum ersten Mal. Und aus diesem Grund sind Sie auch für mich die Neue. Nichts für ungut.»
Saskia machte eine wegwerfende Handbewegung. «Kein Problem.» Sie sah sich im Wohnzimmer um. «Was ist passiert?»
Schubert wandte sich wieder der Leiche zu und seufzte tief. «Sehen Sie selbst.»
Saskia machte einen Schritt nach vorn.
Erst jetzt konnte sie sehen, was der Frau angetan worden war.
«Himmel, sie hat ja keinen Kopf mehr», sagte sie leise.
Dort, wo einmal der Schädel der Frau gewesen war, sah man nur noch einen blutigen Klumpen. Zersplitterte Schädelknochen ragten hervor, rings um die furchtbare Wunde erkannte sie Hirnmasse. Jemand hatte der Frau den Schädel mit fürchterlicher Wucht zertrümmert.
«Wer tut so was …?», fragte sie an niemanden Bestimmtes gerichtet.
Schubert zuckte mit den Schultern. «Das herauszufinden, ist euer Job.»
«Was wissen wir bislang über die Tote?», wollte Saskia wissen.
«Marie Saalfeld, achtundvierzig Jahre alt, verheiratet, getrennt lebend, Unternehmerin, wohlhabend. An der Todesursache gibt es keine Zweifel: Ihr wurde mit einem stumpfen Gegenstand der Schädel eingeschlagen. Sie ist seit ungefähr acht Stunden tot. Die Haushälterin hat die Leiche heute früh um acht Uhr gefunden und sofort die Polizei verständigt.»
«Da war viel Wut im Spiel.»
«Das ist auch mein Eindruck.» Schubert lächelte bitter. «Haben Sie die vielen Fähnchen gesehen? Natürlich haben Sie sie gesehen. Der Typ hat dem Opfer mit solcher Wucht mehrmals auf den Kopf geschlagen, dass Gewebe- und Knochenteile bis zu vier Meter weit geflogen sind. Also ja, da war jemand sehr wütend.»
Saskia musste schlucken, als bei ihr das Kopfkino einsetzte. Sie versuchte, den Vorhang wieder zu schließen, damit die Leinwand verschwand. «Gibt es irgendwelche Spuren vom Täter?»
«Null. Überhaupt gar nichts.»
«Wissen wir, wie der Täter ins Haus gekommen ist?»
«Nicht die allerkleinste Einbruchspur. Wie gesagt, wir haben nichts gefunden, außer der Leiche.»
Saskia schüttelte fassungslos den Kopf und machte mit ihrem Diensthandy jede Menge Fotos vom Tatort und von der Leiche.
5
November 2018
Während Tobias Wiegand ernsthaft darüber nachdachte, einen Menschen zu töten, verspürte er nicht ein einziges Mal Scham oder Reue. Für ihn war das nichts anderes als eine Geschäftsidee. Ein Start-up, das einen Businessplan benötigte. Eine Strategie.
Zuerst überlegte er, wie er den tödlichen Stromschlag verabreichen könnte. Er dachte über verschiedene Szenarien nach und entschied sich, es zu tun, während das Opfer schlief. Die Apparatur, die er für sein Vorhaben benötigte, müsste vollkommen harmlos aussehen, sodass er sich nicht verstecken müsste. Sollte jemand sie sehen, dürfte sie keinen Verdacht erregen. Da er ein recht geschickter Hobbybastler war, würde ihm das Anfertigen dieser Vorrichtung keine Probleme verursachen.
Sobald der Apparat fertig war, müsste er ihn testen. Angefangen bei kleineren Tieren. Mäusen oder Ratten. Mit den Erfahrungswerten aus den ersten Versuchen könnte er schließlich auf größere Tiere umsteigen. Pferde oder Kühe. Möglicherweise würde er sogar Menschenversuche durchführen müssen, bevor er sein erstes echtes Opfer umbrachte.
Er machte sich Notizen.
Die nächste Frage war, welche Voraussetzungen die Frauen erfüllen müssten, die für ihn in Frage kamen. Ihr Alter müsste zwischen Mitte sechzig und Ende siebzig sein. Sie dürften keine Angehörigen haben, die seinen Status als Erben angreifen könnten. Und das Wichtigste überhaupt: Die Frauen müssten vermögend sein. Allerdings nicht zu sehr. Denn das würde eventuell für Aufsehen sorgen. Und das galt es zu vermeiden.
Er setzte sich eine Grenze: nicht mehr als eine Million Euro. Mindestens jedoch eine halbe Million. Sonst würden sich Aufwand und Risiko nicht rechnen. Er hatte für den Bau seines Blockhauses in Kanada rund dreihunderttausend Euro veranschlagt. Vieles zum Leben gab die Natur her: Wild, Kräuter, Wasser. Dennoch müsste er auch Nahrungsmittel kaufen. Er würde einen Generator brauchen. Und der wiederum lief nur mit Diesel. Wiegand schätzte seine Lebenserwartung auf etwa achtzig Jahre. Seine Vorfahren hatten alle ohne schlimmere Krankheiten ein hohes Alter erreicht. Er würde also genug Geld benötigen, um die nächsten dreißig Jahre auszukommen. Zuzüglich einer Reserve für den Fall, dass er neunzig Jahre alt wurde.
Wiegand rechnete alles zusammen. Er bräuchte mindestens drei Millionen Euro.
Nachdem er diese Parameter festgelegt hatte, widmete er sich dem größten Problem: der Frage, wie er an diese Frauen herankommen könnte.
Einige Tage später brachte ihm ein Werbespot im Fernsehen die Lösung: eine Partnervermittlung für Menschen über fünfzig. Er sprang auf und ging mit seinem Laptop, den er eigens für sein Start-up erworben hatte, online. Die Suchanfrage lieferte ihm fünf Agenturen, die sich auf Menschen ab fünfzig spezialisiert hatten. Er recherchierte jede von ihnen und entschied sich für «Lifetime», die teuerste von allen. Genau das gab den Ausschlag.
Wiegand studierte sorgfältig die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Danach meldete er sich ordnungsgemäß an und beantwortete jede der einhundertfünfzig Fragen über seine Persönlichkeit und Vorlieben. Es verstand sich von selbst, dass er dafür diverse Ratgeber zu Hilfe nahm, die ihm die tatsächliche Bedeutung verschiedener Fragen erklärten und Vorschläge für optimale Antworten gaben. Sobald sein Konto freigeschaltet worden war, lud er ein älteres, nichtssagendes Bild von sich hoch. Am liebsten hätte er darauf verzichtet, aber ein Profil ohne Foto hatte keine Chance. Dann durchforstete er die Profile der Frauen. Hierbei achtete er ausschließlich auf deren Alter. Keine sollte jünger als sechzig sein.
Es waren so viele.
Wie sollte er unter der schlicht erschlagenden Anzahl an potenziellen Kandidatinnen die richtige finden? Ihm wurde klar, dass er Hilfe benötigen würde. Über die Profile bekam er einfach zu wenig Informationen. Zumal er selbst gelogen hatte bei der Erstellung seines Kontos und davon ausgehen musste, dass viele Frauen ihre Angaben ebenfalls modifiziert hatten.
Wie könnte er mehr über die potenziellen Kandidatinnen herausfinden?
Er schüttelte den Kopf. Das war nicht die richtige Ausgangsfrage. Wie könnte er alles über sie erfahren?
Es gab nur eine Möglichkeit, an die Informationen zu gelangen, die er dringend benötigte: Er brauchte einen professionellen Hacker. Wiegand öffnete Google und tippte ins Suchfeld: Wie finde ich einen guten Hacker?
Er drückte auf die Enter-Taste. Es gab neunhundertsiebenundzwanzigtausend Suchergebnisse …
Wiegand überflog die ersten zwei Seiten. Anscheinend gab es Online-Portale, auf denen Hacker ihre Dienstleistungen anpriesen. Auch erfuhr er, dass es weiße und schwarze Hacker gab. Die weißen taten nichts Illegales, während die schwarzen wohl zu allen Schandtaten bereit waren. Eine Website wurde immer wieder erwähnt. hackerlist.com.
Als er die Adresse eintippte, war sie jedoch nicht erreichbar. Eine weitere Recherche lieferte ihm den Grund dafür: Die Website war nur zu erreichen, wenn man sie über den TOR-Browser aufrief. Er sammelte Informationen über diesen speziellen Browser. TOR ermöglichte das anonyme Surfen im Internet und bot die Möglichkeit, Seiten im sogenannten Darknet aufzurufen. Den Teil des Internets, der im Verborgenen lag. An diesem Ort gab es alles, was das sündige Herz begehrte: Drogen, Waffen und eben auch Hacker.
Wiegand installierte den TOR-Browser und versuchte erneut, die Seite hackerlist.com zu öffnen. Diesmal mit Erfolg. Und tatsächlich war es hier möglich, einen Hacker zu finden. In einer Art Bewerbungsprofil musste er sich zunächst durch einige Fragen klicken. Unter anderem sollte man angeben, ob ein weißer oder schwarzer Hacker gesucht wurde. Wiegand setzte den Haken bei «schwarz». Nachdem er alle anderen Fragen beantwortet hatte, klickte er auf Absenden.
Schlagartig wurde der Bildschirm schwarz. Er befürchtete schon, einen großen Fehler gemacht zu haben, als der Monitor wieder zum Leben erwachte. Jetzt war er auf einer anderen Seite, deren Name in der Adressleiste nur aus Ziffern bestand. Ein neuer Fragebogen erschien. Hier ging es um die spezifischen Anforderungen. Wiegand beantwortete die Fragen und hinterließ eine Mail-Adresse.
Nun hieß es wieder warten.
6
Dezember 2020
Eisenach erreichte endlich den Tatort. Auch er hatte sich durch den zähflüssigen Stadtverkehr kämpfen müssen. Allerdings war das nicht der einzige Grund für seine verspätete Ankunft. Er hatte auf der Fahrt zum Einsatzort Hunger verspürt und noch einen Stopp zum Frühstücken eingelegt. Als er seinen Wagen verließ, sah er ein BMW-Cabrio mit Kieler Kennzeichen am Straßenrand stehen. Eisenach runzelte die Stirn. Warum zum Henker war die Wilkens schon hier? Und wieso hatte sie ihren scheiß Wagen noch immer nicht umgemeldet?
Mit energischen Schritten stapfte er den Kieselweg hoch zum Haus. Bevor er hineinging, zog er sich die Überzieher an. Wenig später stand er im Türrahmen des Wohnzimmers und starrte die junge Frau an, die dabei war, den Tatort zu fotografieren.
«Sie wissen schon, dass es eine Ordnungswidrigkeit ist, nach dem Umzug sein Fahrzeug nicht umzumelden?», donnerte er in den Raum hinein.
Erschrocken ließ Saskia Wilkens ihr Smartphone sinken und blickte zur Tür. Dann lächelte sie und kam auf ihn zu. «Guten Morgen, Herr Eisenach.»
Er ignorierte die anderen Anwesenden und die Leiche. Stattdessen musterte Eisenach sie mit ausdruckslosem Gesicht. Zugegeben, sie war eine Augenweide. Groß und schlank, ihre hellbraunen Haare sehr kurz, ein hübsches Gesicht mit Stupsnase und ausdrucksstarken, blauen Augen. Obwohl sie mit einer verwaschenen Jeanshose und einer weißen Bluse schlicht angezogen war, war sie eine schön anzusehende junge Frau. Und sie war ihm vom ersten Tag an unsympathisch gewesen.
«Was machen Sie an meinem Tatort?»
«Meinen Job», sagte sie und zog die Hand zurück, die sie ihm entgegengestreckt hatte. Und die von ihm ignoriert worden war.
«Ihr Job ist es, das zu tun, was ich Ihnen sage.»
Eisenach konnte sehen, wie es in ihr arbeitete, und wartete gespannt, ob sie wie immer den Schwanz einziehen würde.
«Wissen Sie, ich hatte mich schon daran gewöhnt, dass Sie ein schwieriger Mensch sind», sagte sie gelassen. «Dass Sie aber auch ein Chauvinist sein können, fällt mir erst jetzt auf.»
Hinter ihr verschluckte sich Schubert und röchelte leise.
Eisenach glaubte, sich verhört zu haben. Es war das erste Mal, dass sie ihn offensiv anging. Und dann auch noch in Gegenwart anderer Kollegen. Allerdings musste er auch zugeben, dass sie Schneid hatte. Irgendwie gefiel ihm das. Es stellte eine neue Herausforderung dar. Er hatte genau zwei Möglichkeiten. Entweder schoss er zurück und riskierte, dass die Situation eskalierte, bis er sie unweigerlich aus dem Haus jagen würde. Das würde hitzige Diskussionen mit Kriminaldirektor Schröder nach sich ziehen, und am Ende würde sich daran, dass sie seine Partnerin war, nichts ändern. Oder aber er tat so, als wäre nichts geschehen, und schluckte seinen Ärger hinunter. Durch ihr eigenmächtiges Handeln hier am Tatort hatte sie wieder einmal unter Beweis gestellt, wie unbedacht sie war. Sie ignorierte ungeschriebene Gesetze. Eines davon sagte nämlich aus, dass ein Vorgesetzter aufgrund seines größeren Erfahrungsschatzes immer als Erster den Ort eines Verbrechens zu betreten hatte. Das hatte sie ganz klar missachtet. Die Retourkutsche dafür würde kommen. Zu einem anderen Zeitpunkt, dafür umso heftiger. Er würde geduldig warten. Früher oder später würde sie einen weiteren Fehler machen. Todsicher.
«Dann berichten Sie mal, Frau Oberkommissarin», forderte er sie auf.
Er sah, wie Schubert erstaunt die Augenbrauen hob. Saskia Wilkens gab sich unbeeindruckt und fasste zusammen. «Das Opfer ist Marie Saalfeld, achtundvierzig Jahre alt, verheiratet, aber getrennt lebend. Sie hat eine eigene Firma, ist wohlhabend und seit circa acht Stunden tot. Jemand hat ihr mit einem stumpfen Gegenstand den Schädel zertrümmert. Es gibt keine sichtbaren Einbruchspuren.»
«Gibt es hier im Haus oder irgendwo draußen Überwachungskameras?», wollte Eisenach wissen.
Zufrieden sah er, wie sich ihre Augen weiteten. Daran hatte sie nicht gedacht.
«Das weiß ich nicht», musste sie zugeben.
«Dann überprüfen wir das mal. Hier drinnen scheint ja so weit alles klar zu sein», sagte Eisenach und erntete erneut einen erstaunten Blick vom Kollegen Schubert. Er zwinkerte ihm zu und wandte sich zum Gehen.
Als er keine Schritte von Wilkens hörte, drehte er sich zu ihr um. «Worauf warten Sie? Kommen Sie mit.»
Sie folgte ihm durch den Flur und zur Haustür hinaus. Mit weit ausholenden Schritten verließ Eisenach das Grundstück und blieb auf der Straße davor stehen.
Er sah Saskia Wilkens prüfend an. «Was sehen Sie?»
Saskia blickte sich um. Das Haus des Opfers befand sich auf einem Eckgrundstück, an dessen Vorderseite große Birken standen. Eingefasst wurde das Grundstück von einer etwa ein Meter sechzig hohen immergrünen Hecke. Von der einfachen Pforte führte ein Kiesweg eine kleine Anhöhe hinauf. Links und rechts davon war grüner Rasen angelegt worden. Es gab keine aufwendig gestalteten Blumenbeete. Das Haus verfügte über ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss mit Dachschrägen. Die Fassade war mit weißem Spritzputz verkleidet. Mittig befand sich die massive Haustür. Rechts und links daneben gab es jeweils zwei Fenster. Der Abstand zu den Häusern der Nachbarn betrug zu beiden Seiten mindestens sechs Meter. Er sah, wie Wilkens’ Blick auf etwas fiel, das er schon beim Betreten des Grundstückes entdeckt hatte: ein weißer Kasten mit rotem Knopf, der am Erkerfenster im Obergeschoss montiert worden war.
Saskia deutete auf das Erkerfenster. «Das Haus hat eine Alarmanlage. Oder das Ding ist ein Fake, und es soll nur so aussehen, als ob. Überwachungskameras kann ich nirgendwo sehen.»
Sie würden noch überprüfen müssen, ob die Häuser der Nachbarn Kameras hatten, die auf die Straße gerichtet waren. Eisenach nickte. «Gut. Unsere Ermittlungen beginnen genau hier. Nicht erst drinnen.»
«Ich verstehe», sagte Saskia Wilkens.
Eisenach sah sich betont langsam um. Er zog eine Show ab. Extra für sie. «Als Nächstes müssen wir überprüfen, ob es sich wirklich um eine Alarmanlage handelt. Und ob im Haus vielleicht Kameras installiert worden sind, die man nicht auf den ersten Blick sehen kann. Das übernehme ich. Sie klappern die Nachbarn ab. Versuchen Sie herauszufinden, ob die etwas Auffälliges gesehen haben. Verraten Sie aber nicht, dass Frau Saalfeld ermordet wurde. Wir wollen doch nicht, dass die Angehörigen aus den Medien erfahren, was passiert ist.»
«Alles klar», sagte Saskia Wilkens und machte sich auf den Weg zum Nachbarhaus.
7
November 2018
Tobias Wiegand nutzte die Zeit, bis sich ein Hacker bei ihm melden würde, um sich Gedanken über die technische Methode zu machen. Er hatte schon einiges über Strom und dessen Auswirkungen auf den menschlichen Körper herausgefunden und wusste inzwischen, dass elektrische Impulse im menschlichen Organismus eine wichtige Rolle spielten. Das Nervensystem leitete beispielsweise Befehle vom Hirn an die Muskeln per elektrischer Signale weiter. Das Herz schlug nur, weil der Sinusknoten eigene Stromimpulse erzeugte. Im Gegensatz zu elektrischen Geräten nutzte der menschliche Körper jedoch keine Elektronen. Stattdessen führten Ionen, also positiv geladene Teilchen, dazu, dass Strom floss. Und davon gab es im Menschen jede Menge. Sowohl außerhalb als auch innerhalb der Zellen gab es wässrige Lösungen, die Natrium-, Kalium- oder Chlorid-Ionen enthielten. Diese Flüssigkeiten leiteten den Strom problemlos weiter.
Doch nicht vorgesehen war für den menschlichen Körper, dass Strom von außen kam. Das würde genau die Stellen gefährden, die auf elektrische Impulse reagieren, wie etwa die Muskulatur. Das kann beispielsweise passieren, wenn man unglücklich in eine Steckdose oder an ein offenes Stromkabel fasst. So, wie der Elektriker, der vor seinen Augen ums Leben gekommen war. Und der Strom hat es in diesem Fall in sich: Im Haushalt fließen bei 230 Volt teilweise mehr als 16 Ampere. 300-mal mehr als die Stromstärke, die bereits lebensgefährliches Herzflimmern auslöst.
Wie gefährlich ein Stromschlag wäre, hing von vielen Faktoren ab: Davon, ob Gleich- oder Wechselstrom floss, von der Stromstärke, der Kontaktfläche, der Spannung, der Wirkdauer und dem Weg durch den Körper. Am Ende konnte wenig Stromstärke über einen längeren Zeitraum ähnlich gefährlich sein wie sehr viel Strom in kurzer Zeit. Grundsätzlich galt, dass der in Deutschland typische Wechselstrom schneller zu gesundheitlichen Schäden führte als Gleichstrom.
Ein anderer wichtiger Punkt war der Hautwiderstand. Die obere, keratinhaltige Schicht der Haut des Menschen ist verhornt und schwächt den Stromschlag etwas ab. Je größer der Widerstand, desto stärker ist das Risiko von oberflächlichen Verbrennungen. Ist der Widerstand besonders gering, etwa bei nasser Haut, gelangt der Strom jedoch schnell in den Körper und verursacht im Inneren Schäden, indem er die Systeme stört, die auch auf natürliche Weise mit Stromimpulsen fungieren.