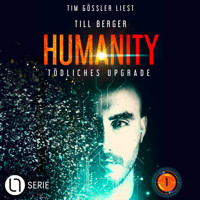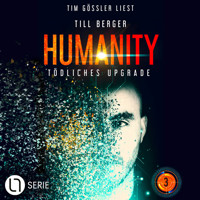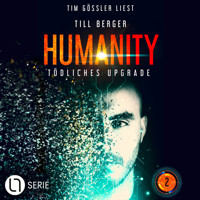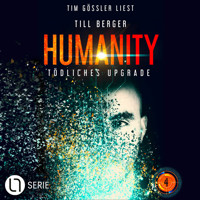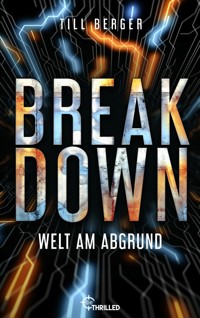
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Bankensystem wird kollabieren - und die Welt ins Chaos stürzen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Radikale Klimaaktivisten haben das weltweite Banken-Kommunikationsnetz infiltriert und drohen, es komplett zu blockieren, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Laura Dupont, Professorin für Klimapolitik, wird von Europol als Expertin eingeholt: Sie erkennt in dem Anschlag die Handschrift ihres Ex-Freundes Dean Lund. Vor zwei Jahren hat dieser sie von einem auf den anderen Tag verlassen und verschwand spurlos. Doch nun überschlagen sich die Ereignisse: Ehe sich Laura versieht, sitzt sie mit Dean in einem von Kugeln durchlöcherten Auto, wird von einem Auftragskiller gejagt und muss sich fragen, wer in diesem katastrophalen Szenario eigentlich die Guten und wer die Bösen sind. Wird sie es schaffen, Freund und Feind zu unterscheiden? Oder wird ein weltweiter Kollaps die Welt ins Mittelalter zurückbefördern?
Ein packender Thriller - erschreckend realitätsnah und aktuell. Für Fans von Marc Elsberg, Andreas Brandhorst und Dirk Rossmann.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverGrußwort des VerlagsÜber dieses BuchTitelWidmungPrologTeil 11234567891011121314151617181920212223Teil 2242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556Teil 357585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990EpilogÜber den AutorWeitere Titel des AutorsLeseprobeImpressumLiebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Das Bankensystem wird kollabieren – und die Welt ins Chaos stürzen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt …
Radikale Klimaaktivisten haben das weltweite Banken-Kommunikationsnetz infiltriert und drohen, es komplett zu blockieren, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Laura Dupont, Professorin für Klimapolitik, wird von Europol als Expertin eingeholt: Sie erkennt in dem Anschlag die Handschrift ihres Ex-Freundes Dean Lund. Vor zwei Jahren hat dieser sie von einem auf den anderen Tag verlassen und verschwand spurlos. Doch nun überschlagen sich die Ereignisse: Ehe sich Laura versieht, sitzt sie mit Dean in einem von Kugeln durchlöcherten Auto, wird von einem Auftragskiller gejagt und muss sich fragen, wer in diesem katastrophalen Szenario eigentlich die Guten und wer die Bösen sind. Wird sie es schaffen, Freund und Feind zu unterscheiden? Oder wird ein weltweiter Kollaps die Welt ins Mittelalter zurückbefördern?
TILL BERGER
WELT AM ABGRUND
Thriller
Für meinen Vater MaxFür Sarah
Die Zukunft flüstert, während die Gegenwart brüllt.
Irgendwie haben wir uns davon überzeugt, dass wir unsere Rechnungen nicht selbst bezahlen müssen.
Al Gore
Prolog
Simi Valley, Los Angeles, USA
Der Milliardär musste vollkommen den Verstand verloren haben.
Leonard Danquist wurde von zwei starken Händen auf die Rückbank des Grand Cherokee gedrückt. Er versuchte krampfhaft, sich seinem Entführer entgegenzustemmen, aber seine Hände waren mit einem dünnen Kabelbinder gefesselt. Wehrlos sackte er auf den Ledersitz. Die Tür neben ihm wurde zugeschlagen, und ein letzter Hauch der kalifornischen Sommerluft streifte seinen Arm.
Trotz der Klimaanlage liefen Danquist dicke Schweißtropfen über die Stirn. Hinter sich hörte er die Schritte des Fremden auf dem Kiesboden des stillgelegten Stahlwerks knirschen. Verängstigt wandte er sich dem Geräusch zu, aber der Sack, den ihm der Mann über den Kopf gezogen hatte, machte ihn so gut wie blind. Seine Sicht war auf Hunderte kleine Lichtpunkte beschränkt, die schwach durch den grob gefaserten Stoff drangen.
Danquist hatte das Gefühl zu ersticken. Stoßweise atmete er durch den Mund, wodurch seine Brille beschlug. Er hätte niemals hierherkommen dürfen. Das Stahlwerk befand sich am nördlichen Rand von Simi Valley, einem kleinen Vorort von Los Angeles. Das Gelände war menschenleer, die nächste Hauptstraße mindestens eine Meile entfernt.
Er hatte von Beginn an ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache gehabt und hätte dem Treffen unter keinen Umständen zugesagt, wenn Bloom ihn nicht ausdrücklich darum gebeten hätte.
Der Milliardär hatte von einer »einzigartigen Gelegenheit« gesprochen. Eine Art Projekt, das den Zielen ihrer Stiftung zum Durchbruch verhelfen könnte. Ein Vorhaben, wie er betonte. Mehr hatte er jedoch nicht verraten wollen. Danquist konnte sich aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass Bloom sich wirklich bewusst war, worauf er sich dabei eingelassen hatte. Er kannte ihn inzwischen seit vier Jahren, und es war praktisch ausgeschlossen, dass er mit solchen Leuten Geschäfte machte. Es musste sich ganz eindeutig um einen Irrtum handeln.
Die Vordertür des Wagens wurde geöffnet, und sein Entführer stieg ein.
»Hören Sie«, setzte Danquist mit zitternder Stimme an, »das Ganze ist ein Missverständnis! Ich bin nicht der Mann, den Sie suchen. Was auch immer Sie vorhaben, ich habe nichts damit zu tun!«
Der Mann schloss die Tür und startete den Motor. Das Radio sprang an, und der Jeep wurde durch ein im Presto gespieltes Violinkonzert erfüllt. Perplex stellte Danquist fest, dass es sich dabei um den dritten Satz von Vivaldis L’estate aus den Vier Jahreszeiten handelte. Die dramatischen Streicherklänge, die das Bild eines aufziehenden Sommergewitters heraufbeschworen, hätten kaum besser zu seiner Situation passen können.
Der Wagen setzte sich in Bewegung und fuhr in einem Bogen den Weg zurück, den Danquist gekommen war. Er sah nach links, wo der gelbe Toyota seiner Frau stehen musste, den er nur fünf Minuten zuvor neben einem alten Backsteingebäude abgestellt hatte. Er glaubte, durch die Fasern des Sacks etwas Helles zu entdecken, aber es war mehr eine vage Ahnung als ein wirkliches Erkennen. Der helle Fleck zog schemenhaft und unerreichbar an ihm vorbei. Der Toyota erschien ihm auf einmal wie aus einer anderen Welt.
»Ihr Name ist Leonard Danquist«, sagte der Mann schließlich. Seine Stimme war tief und rau. »Sie sind der Geschäftsführer der Global Warming League und wohnen mit Ihrer Familie in einem Haus in Santa Ana. Ihre Frau ist Lehrerin an der Madison Elementary School in Lakewood. Sie haben eine dreijährige Tochter und einen fünfjährigen Sohn, den Sie eine Stunde vor diesem Treffen in den Kindergarten gebracht haben.«
»Woher wissen Sie das?«, fragte Danquist entsetzt. »Haben Sie mich beobachtet?«
»Das spielt keine Rolle«, drang die Stimme seines Entführers durch das Violinkonzert.
Danquist wurde von einer panischen Angst erfasst. »Bitte, Sie können mit mir machen, was Sie wollen, aber tun Sie meiner Familie nichts!«
»Um Ihre Familie müssen Sie sich keine Sorgen machen. Für uns sind nur Sie von Interesse.«
Danquists Hände verkrampften sich. Der Kabelbinder schnitt ihm in die Haut, aber das war ihm inzwischen egal. »Ich weiß nicht, was das für ein Projekt ist, das Sie mit Bloom vorhaben, und ich will es auch gar nicht wissen. Lassen Sie mich einfach gehen, und ich werde vergessen, dass wir uns je begegnet sind. Bitte …«
»Entspannen Sie sich«, unterbrach ihn der Fremde. »Wir werden in etwa zwanzig Minuten am Ziel sein.«
»Wohin bringen Sie mich?«
Die einzige Antwort, die Danquist auf seine Frage erhielt, waren Vivaldis leichte Streicherklänge, als das Konzert in L’autunno, den Herbst, überging.
Als der Jeep wieder anhielt, konnte Danquist nicht sagen, wie lange und in welche Richtung sie gefahren waren. Der Sack über seinem Kopf und die laute Musik hatten ihm jede Orientierung genommen. Sie konnten inzwischen überall sein. Im Zentrum von Long Beach oder mitten im Angeles National Forest.
Die Musik verstummte, und der Mann stieg aus. Einen Augenblick später wurde neben Danquist die Tür aufgerissen. Er wurde grob am Oberarm gepackt und aus dem Wagen gezogen.
Es war etwas kühler als beim Stahlwerk, und es roch leicht nach Tannennadeln und Torf. Es konnte gut sein, dass sie tatsächlich in den National Forest gefahren waren.
»Kommen Sie!«, sagte der Mann und führte ihn vom Auto weg.
Der Boden war weich und gab unter Danquists Schuhen etwas nach. Nach einigen Metern trat er auf Beton, und sie blieben stehen. Er hörte, wie ein Schloss geöffnet wurde und eine Tür quietschend aufging.
Danquist versuchte mit aller Kraft, die aufkeimende Panik zu unterdrücken. »Was haben Sie mit mir vor?«
Der Mann erwiderte nichts. Er schob ihn durch die Tür, und Danquist hörte alte Holzdielen unter seinen Füßen knarren. Mit festem Griff wurde er vorwärtsgedrängt und eine Treppe hinuntergeführt. Ein feuchter und modriger Geruch drang in seine Nase. Die abgestandene Luft ließ ihn unvermittelt an ein Grab denken. Danquist fragte sich, ob das vielleicht das Letzte war, was er jemals riechen würde. Der Gedanke ließ ihn am ganzen Körper zittern.
»Bleiben Sie stehen!«, befahl der Mann.
Ein Schalter wurde umgekippt, und weiße Lichtstrahlen drangen durch die Fasern des Sacks. Mit einem Ruck wurde er weggezogen. Durch die plötzliche Helligkeit geblendet musste Danquist blinzeln.
Sein Entführer stand direkt vor ihm und starrte ihn eindringlich aus dunklen Augen an. In dem weißen Neonlicht wirkten seine Züge noch härter und militärischer als zuvor auf dem Parkplatz des Stahlwerks. Unter anderen Umständen hätte Danquist ihn wahrscheinlich für einen altgedienten Offizier gehalten. Der schlichte dunkelgraue Anzug, den er trug, konnte nicht verbergen, dass sich darunter ein muskulöser Körperbau befand. Und die verblasste Narbe, die sich von seiner Stirn über den kahlen Kopf hinweg zog, ließ vermuten, dass er durchaus auch dazu bereit war, seine Interessen mit Gewalt durchzusetzen.
Selbst wenn Danquist nicht gefesselt gewesen wäre, hätte er keine Chance gehabt, dem Mann zu entkommen. Er selbst war eher schmächtig und dazu noch ziemlich außer Form. Seine sportlichen Aktivitäten beschränkten sich auf einen gelegentlichen Spaziergang am Huntington Beach, und er hatte in seinem ganzen Leben noch nie eine handfeste Auseinandersetzung gehabt. Er musste sich eingestehen, dass er seinem Entführer vollkommen ausgeliefert war.
»Ich werde jetzt Ihre Fesseln lösen«, sagte dieser und zog ein Messer aus der Tasche. »Wenn Sie versuchen zu fliehen, werde ich sie wieder festmachen. Haben Sie das verstanden?«
Danquist nickte und beobachtete, wie der Kahlköpfige den engen Plastikriemen durchschnitt. Als sich das Band löste, betastete er instinktiv die schmerzenden Handgelenke.
»Es tut mir leid, dass das nötig war«, erklärte der Mann. »Aber Bloom hatte mir schon gesagt, dass Sie unter den gegebenen Bedingungen vermutlich nicht freiwillig ins Auto steigen würden.«
Danquist löste den Blick von seinem Entführer und sah sich um. Sie befanden sich in einem Kellerraum mit nackten, grauen Wänden. Es gab nur einen einzelnen Holzstuhl und einen Tisch, auf dem sich eine Art medizinischer Apparat und ein Laptop befanden. Mehrere Kabel führten von dem Gerät zu einer Gruppe von Elektroden, die sorgfältig nebeneinander aufgereiht und mit kleinen Zetteln beschriftet auf dem Tisch lagen.
»Setzen Sie sich«, sagte der Mann.
Danquist blieb wie angewurzelt stehen. Es gelang ihm nicht, seinen Blick von den Elektroden zu lösen. »Was ist das?«
Der Fremde packte ihn am Arm und drängte ihn zum Stuhl. »Ein Polygraf. Er wird einige Ihrer physiologischen Parameter messen, während wir uns ein bisschen unterhalten.« Danquists Peiniger verstärkte seinen Griff und drückte ihn auf den Stuhl.
»Ein Polygraf?«, fragte Danquist mit zitternder Stimme und sah zu der massigen Gestalt auf.
»Ein Lügendetektor. Ich werde Ihnen gleich einige Fragen stellen. Das Gerät wird mir dabei helfen, Ihre Antworten zu beurteilen.«
»Was für Fragen?«
Der Mann griff nach den Elektroden. Mit der Sorgfältigkeit eines Arztes, der sein Operationsbesteck ordnet, legte er die Kabel eines nach dem anderen über die flache Hand. »Fragen, die Ihre Zukunft bestimmen werden, Herr Danquist.«
Danquist räusperte sich, seine Kehle war völlig ausgetrocknet. »Und was ist, wenn Ihnen meine Antworten nicht gefallen?«
Der Mann trat wieder vor ihn und beugte sich leicht zu ihm herunter. »Nun, ich will es mal so ausdrücken. Es wäre in unser beider Interesse, wenn Sie meine Fragen richtig beantworten.«
Teil 1
Common Ground
Der Mensch ist klug, aber nur selten weise.
Ronald Wright
1
Delft, Niederlande
Laura öffnete ihre Augen und blinzelte schläfrig in die Dunkelheit. Sie glaubte, ein Geräusch gehört zu haben, konnte aber nicht mit Sicherheit sagen, was es gewesen war. Deans Fachwerkhaus am Rande von Delft war mehr als hundert Jahre alt, und Laura hatte sich inzwischen daran gewöhnt, dass gelegentlich die Dielen knarrten oder die Wasserleitungen in den Wänden ein metallisches Knacken von sich gaben. Dennoch blieb sie für einige Sekunden still liegen und horchte. Um sie herum war nichts zu hören, und sie brauchte einen Moment, bis sie begriff, was sie daran störte. Es war zu still. Langsam schob sie ihren Arm unter der Decke hervor und betastete vorsichtig die andere Bettseite. Sie spürte ein zerwühltes Laken, aber Deans Matratze war leer und kalt.
Sie drehte sich zur Seite und sah zum Wecker auf dem Nachttisch. Die roten Ziffern zeigten kurz nach fünf Uhr. Sie schaltete die Leselampe an und schlüpfte aus dem Bett. Als sie die Schlafzimmertür öffnete, sah sie, dass der Gang dahinter im Dunkeln lag. Aus Deans Arbeitszimmer am Ende des Gangs drangen leise Geräusche. Laura machte Licht im Flur, um nicht gegen die gestapelten Kartonkisten zu stoßen, die Dean in den letzten Tagen von der Universität mitgebracht hatte. Jede von ihnen war datiert und beschriftet. Der Inhalt der meisten Kisten war mit »Intelligente Systeme« ausgewiesen.
Laura erreichte die Tür und klopfte leise. Aus dem Arbeitszimmer kam keine Reaktion. Sie drehte den Knauf und schob die Tür langsam auf. Im Innern brannte nur schwaches Licht. Dean saß am Schreibtisch und war selbstvergessen in seine Arbeit am Computer vertieft. An seinen Wangen klebten noch Reste von Rasierschaum, die kurzen hellbraunen Haare wirkten zerzaust, und das Hemd war erst bis zur Hälfte zugeknöpft. Die Krawatte hing ihm ungebunden um den Hals. Der Schreibtisch sah ähnlich chaotisch aus. Technische Geräte wie Spannungsmesser und Transformatoren teilten sich den Platz mit unordentlich gestapelten wissenschaftlichen Zeitschriften, einem Lötkolben sowie lose herumliegenden Drähten und Schrauben.
Laura lehnte sich mit verschränkten Armen gegen den Türrahmen und sah ihn amüsiert an. »Hey, Professor«, sagte sie mit weicher Stimme.
Dean blickte überrascht auf. »Oh, hi, Schatz, hab ich dich etwa geweckt?«
»Du warst nicht mehr im Bett.« Sie lächelte ihn an. »Flirtest du etwa wieder mit einem deiner intelligenten Systeme?«
Dean schob die Tastatur von sich weg und ließ sich in den Sessel sinken. »Manchmal glaube ich, die Systeme sind um einiges cleverer als ich.« Er seufzte.
Lauras Lächeln verschwand, als sie die Niedergeschlagenheit in seiner Stimme bemerkte. »Wie meinst du das?«
Er fuhr sich ratlos durch die Haare. »Ich habe hier eine Technologie in der Hand, die den weltweiten Stromverbrauch um ein Drittel senken könnte – ohne dass irgendjemand dabei auch nur auf das Geringste verzichten müsste. Und trotzdem schaffe ich es nicht einmal, genügend Unterstützung für die Entwicklung zu erhalten.«
Laura löste sich vom Türrahmen und ging auf ihn zu. »Dean, es ist nicht dein Fehler, dass dich die Universität entlassen hat. Und du weißt das. Das hätte niemand vorhersehen können.«
Sie setzte sich auf seinen Schoß und legte die Arme um seinen Hals. »Die TU Delft ist nicht die einzige Universität, an der du forschen kannst. Wir könnten zum Beispiel nach Boston ziehen. Das MIT hat doch bereits großes Interesse an deiner Arbeit gezeigt.«
Dean sah sie lange an. Schließlich zeichnete sich auf seinem Gesicht ein Lächeln ab. »Womit habe ich dich eigentlich verdient?«
Laura lächelte zurück. »Red keinen Unsinn.« Sie griff nach seiner Krawatte, zog ihn zu sich und gab ihm einen langen Kuss.
»Lass uns die Option mit Boston in der Bretagne weiterdiskutieren«, schlug er vor, als sie sich wieder voneinander gelöst hatten. »Dann haben wir mehr Zeit, darüber nachzudenken.«
Laura nickte. »Das ist eine gute Idee. Außerdem hast du die Ferien dringend nötig. Du brauchst jetzt mal eine Auszeit.«
Deans Blick wurde abwesend. »Ja, da hast du vermutlich recht.«
»Natürlich hab ich recht«, lachte Laura. Sie nahm von seiner Wange etwas Rasierschaum und tupfte ihn auf seine Nase. »Und komm nicht auf die Idee, unser Rendezvous am Freitagabend zu vergessen. Ich habe mir etwas ganz Besonderes für uns ausgedacht.«
Dean machte keine Anstalten, den Schaum wieder zu entfernen. Er lächelte sie an und sagte: »Bei dem Geheimnis, das du bisher darum gemacht hast, würde ich das um nichts in der Welt verpassen wollen.«
2
Technische Universität Delft, Niederlande
Aufgebracht zwitscherte eine Kohlmeise auf der Birke vor Deans Büro. Irgendwo auf dem Universitätsgelände antwortete ein Artgenosse mit fast derselben Melodie. Mit eiserner Hartnäckigkeit pfiffen sie einander an, jeder darum bemüht, sein Territorium gegen den anderen zu verteidigen.
The struggle for life, dachte Dean und griff einen weiteren Stapel Bücher aus dem grauen Institutsregal. Dass der Mensch dieses Kampfgeschrei als schön empfand, blieb für ihn eines der vielen Rätsel der Evolution. Er verstaute die Bücher in der Kiste, die auf seinem leer geräumten Schreibtisch stand. Wahrscheinlich war es eine Art Schutzmechanismus des Gehirns, vermutete er, eine stammesgeschichtliche Errungenschaft der menschlichen Biologie, damit man bei dem ganzen Lärm nicht die Nerven verlor. Ganz ähnlich wie das Gehirn auch fähig war, bestimmte Einflüsse aus der Umwelt einfach aus der Wahrnehmung auszublenden. Wie das Rauschen des Verkehrs oder das Ticken einer Uhr. Oder aber, dachte er mit einem bitteren Gefühl, wie die vielen subtilen Attacken seiner Gegner, die er sich mit seiner Arbeit geschaffen hatte. Er hatte sie mit der Zeit einfach ignoriert. Sie waren zu einem ganz normalen Hintergrundrauschen geworden.
Er hatte ja keine Ahnung gehabt, wozu sie fähig waren.
Das Wetter in Delft hatte beschlossen, sich an Deans letztem Tag an der Technischen Universität noch einmal von der schönsten Seite zu zeigen. Die Sonne ließ die Bäume auf dem Campus in den prächtigsten Herbstfarben erstrahlen. Selbst die strengen geometrischen Züge des Vorplatzes, die durch schmale Rasenstreifen in scharfkantige Formen gezeichnet wurden, wirkten irgendwie weicher. Ein richtiger indian summer! Auf dem begrünten Dach der Bibliothek, nur knapp fünfzig Meter von der Fakultät für Industriedesign entfernt, wimmelte es von Studenten, die es sich zum Lunch gemütlich gemacht hatten.
Dean stellte die gefüllte Kiste zu den anderen auf den Boden. Dort türmte sich schon ein beachtlicher Haufen, doch die Regale waren noch mehr als halb voll. An zwei Wänden stapelten sich Fachbücher, technische Berichte, wissenschaftliche Zeitschriften und die Arbeiten seiner Studenten und Doktoranden. Auf der dritten Seite stand ein Regal mit elektrischen Geräten, die er mit seinem Team hier an der Universität entwickelt hatte. Aufgeschraubt und hüllenlos umfasste seine Sammlung eine Reihe trivialer, seltsam entstellter Alltagsgegenstände wie Lampen, Staubsauger, Mixer, Kaffeemaschinen, Bohrmaschinen oder Computer. Die kantigen Elektronikteile, von denen die meisten mit verworrenen Drähten, Platinen, Spulen und Motoren vor ihm lagen, sahen aus wie verschüchterte kleine Tiere. Kaum ein äußeres Merkmal ließ erahnen, dass darin modernste Mikrosystem-Technologien steckten, die Nanotechnologie, Sensortechnik und künstliche Intelligenz vereinten. Eine technologische Entwicklung, die klein genug war, um für das ungeübte Auge vollkommen unsichtbar zu sein, aber dennoch bedeutend genug, um die Industrie auf den Plan zu rufen und einen Vernichtungsfeldzug gegen ihn zu führen.
In seine Gedankten vertieft bekam Dean nur am Rande mit, wie sich jemand hinter ihm räusperte. Frau Schmidt stand in der Tür. Sie hatte die Hände verlegen vor sich zusammengefaltet und sah betroffen auf die Umzugskisten.
»Entschuldigen Sie, wenn ich Sie störe, Herr Professor. Aber jemand möchte Sie sprechen.«
»Frau Schmidt, bitte sagen Sie doch einfach Herr Lund zu mir, ich bin kein Professor mehr.«
»Ach, Herr Professor …« Sie sah ihn mit fast flehendem Blick an, als ob er etwas daran hätte ändern können, was geschehen war.
»Wer will mich denn sprechen?«
»Es sind zwei Herren. Sie haben nicht gesagt, wer sie sind.«
Dean hatte in den letzten Wochen eine ganze Reihe von Besuchern gehabt, die ihm ihr Beileid und ihre Entrüstung darüber ausdrückten, was geschehen war – natürlich nur inoffiziell, um dann rasch wieder durch die Hintertür zu verschwinden. Er war ein Ausgestoßener, eine Persona non grata. Es wurde Zeit, dass er das hier endlich hinter sich brachte.
»Ist gut, dann bringen Sie sie doch bitte herein.«
Frau Schmidt nickte und machte den Besuchern Platz, die sich schon bis zu Deans Büro vorgearbeitet hatten. Sie bedachte sie mit einem strafenden Blick, da sie nicht beim Sekretariat gewartet hatten, und stemmte sich an den beiden Männern vorbei.
»Ah, Professor Lund! Wie schön, dass wir Sie noch erwischen. Ich hatte schon befürchtet, Sie könnten bereits gegangen sein.« Der ältere Herr kam auf Dean zu, setzte dabei einen eleganten Stock schwungvoll auf und streckte ihm die Hand entgegen. Er war fast einen Kopf kleiner als Dean und trug einen edlen hellbeigen Leinenanzug. Auf seinem Gesicht, das von einem weißen, sorgfältig gestutzten Bart umrandet wurde, lag ein strahlendes Lächeln. Hinter den feinen Brillengläsern funkelten energische Augen.
Zögerlich schüttelte Dean die ausgestreckte Hand und beobachtete, wie der andere Besucher die Tür des Büros schloss.
»Guten Tag, Herr …«
»Ach, wo ist nur mein Anstand geblieben! Mein Name ist Richard Bloom.«
Dean sah ihn fragend an. »Der Richard Bloom?«
Der alte Mann lächelte erneut. »Wie er leibt und lebt!«
Der Name Richard Bloom war für jeden im Energiegeschäft ein Begriff. Dean versuchte, sich zu erinnern, was er über seinen unerwarteten Besucher wusste. Bloom war in den Achtzigern und Neunzigern einer der einflussreichsten Männer in der Ölindustrie gewesen. Wenn er sich nicht täuschte, war Bloom damals Verwaltungsrat und Großaktionär bei British Petroleum und Miteigentümer von Ölfeldern im Golf von Mexiko gewesen. Dean konnte sich noch an einen Artikel im De Telegraaf erinnern, in dem Bloom dafür kritisiert worden war, riskante Ölbohrungen in der Tiefsee voranzutreiben, durch die es immer wieder zu Havarien mit großflächigen Ölverschmutzungen gekommen war. Die damaligen Umweltschutzbewegungen hatten ihn deshalb auch el barón negro genannt, den schwarzen Baron. Umso überraschender war, dass er vor einigen Jahren der Ölindustrie plötzlich den Rücken gekehrt und sämtliche Anteile von BP und seinen Ölfeldern verkauft hatte.
Noch verblüffender war allerdings, dass er sein Vermögen, das auf mehr als eine Milliarde US-Dollar geschätzt wurde, daraufhin für den Klimaschutz einzusetzen begann. Er hatte die Global Warming Leaguegegründet, mit der er Kampagnen und Projekte für den Klimaschutz finanzierte und in den Staaten Wahlkampagnen grüner Politiker unterstützte. Letztlich gab es niemanden, der genau sagen konnte, wie es bei ihm zu dieser Kehrtwende kam. Einige behaupteten, er sei auf seine alten Tage schwach geworden. Andere, er sei endlich aufgewacht und habe gesehen, was er angerichtet hatte.
Bloom wies auf seinen Begleiter: »Darf ich Ihnen Aaron Celler vorstellen?«
Der zweite Besucher war das pure Gegenteil von Bloom. Er hatte kantige Gesichtszüge und eine ausladende Glatze, über die sich eine lange Narbe zog. Sein Blick strahlte militärische Strenge aus. Er trug einen maßgeschneiderten, dunkelblauen Anzug, der an ihm jedoch nicht ganz stimmig wirkte. Wie ein gealterter Boxer, der jetzt auf der Trainerbank saß. Sein Händedruck war trocken und fest, und er musterte Dean abschätzend.
Bloom ließ einen kurzen Blick über die Umzugskisten schweifen. Dean fühlte sich plötzlich ein wenig unbehaglich. Das halb ausgeräumte Büro wirkte irgendwie beschämend.
»Ich hoffe, wir stören Sie nicht zu sehr.«
»Überhaupt nicht«, entgegnete Dean. »Bitte, nehmen Sie doch Platz.«
Er befreite die beiden Besucherstühle von seinen Unterlagen und setzte sich ihnen gegenüber an den Schreibtisch. Die leere Tischplatte lag wie eine Einöde zwischen ihnen.
»Wie Sie sehen, haben Sie mich in einem schlechten Moment erwischt. Heute ist mein letzter Tag.«
Der Milliardär faltete die Hände vor sich auf seinem Stock. Der verzierte Perlmuttgriff glänzte wie frisch polierte Perlen. »Ich habe bereits davon gehört. Was ist passiert?«
Dean überlegte, wie viel er seinen Gästen erzählen sollte. Seine Geschichte warf kein gutes Licht auf die Universität. Allerdings gab es nichts, was er ihr noch schuldete. Also gab es auch keinen Grund, noch ein Blatt vor den Mund zu nehmen.
Schicksalsergeben zog er die Augenbrauen hoch. »Das ist das Interessante an meiner Geschichte. Das Problem ist eigentlich weniger das, was ich bisher gemacht habe, sondern das, was ich noch tun könnte.«
»Geht es um Ihre Forschung?«
»Allerdings. So wie es aussieht, hat nicht allen gefallen, was ich hier mache.«
»Wie meinen Sie das?«
»Kennen Sie sich mit intelligenten Systemen aus?«
»Ein bisschen«, sagte Bloom. »Ich habe einige Ihrer Artikel gelesen. Sie verfolgen da ein paar äußerst faszinierende Thesen, was die Potenziale Ihrer Technologie anbelangt.«
»Sie irren sich«, entgegnete Dean. »Das sind keineswegs nur Thesen.«
Blooms Begleiter sah ihn fragend an. »Wie weit sind Sie denn mit Ihren Entwicklungen?« Seine Stimme war fest und leicht heiser, als ob er ein starker Raucher wäre.
Dean schaute zu Bloom, der ihn ebenfalls erwartungsvoll musterte. Die Global Warming League war eine sehr wohlhabende Organisation. Wenn es ihm gelang, den Milliardär von seinen Entwicklungen zu überzeugen, konnte er sich womöglich neue Unterstützung für seine Arbeit sichern.
»Ich denke, das lässt sich am besten an einem Beispiel zeigen.« Dean stand auf und holte eine silberne Tischlampe aus dem Regal. »Wie Sie ja sicher wissen, haben die meisten unserer Alltagsgeräte einen viel höheren Energieverbrauch, als sie für ihren eigentlichen Zweck benötigen würden. Der größte Teil der Energie geht ungenutzt als Wärme verloren.« Er stellte die Lampe auf den Schreibtisch. »Oder einfach gesagt, unsere Geräte sind dumm. Sie verbrauchen immer gleich viel Energie, ob diese nun genutzt wird oder nicht.« Er verband das Kabel mit der Steckdose und schaltete die Lampe an. Sie fing schwach zu glühen an.
Celler starrte auf das kaum wahrnehmbare Licht und runzelte die Stirn. »Ich glaube, ich verstehe nicht ganz, was Sie uns damit zeigen wollen.«
Dean hatte die Reaktion bereits erwartet. »Sehen Sie, manchmal sind es die unspektakulären Dinge, die die Welt verändern können.«
»Wie meinen Sie das?«
»Die Lampe, die Sie hier sehen, ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet«, erklärte Dean. »Sie verfügt über Prozessoren, Sensoren und Kontrollelemente, die zu einem intelligenten System verbunden sind. Damit ist sie in der Lage, auf ihre Umwelt zu reagieren und nur so viel Energie zu verbrauchen, wie sie für ihre eigentliche Aufgabe benötigt.«
Er ging zum Fenster und griff nach der Schnur der Jalousie. »Über ihre Sensoren nimmt die Lampe wahr, dass es im Moment taghell ist. Deshalb leuchtet sie nur schwach.« Er zog die Jalousie herunter, und der Raum verdunkelte sich. Die Schreibtischfläche unter der Lampe blieb unverändert hell beleuchtet, als wäre die Jalousie nie heruntergelassen worden.
»Die Lampe passt abhängig vom Tageslicht die Stärke und Farbe ihres Lichts an, damit immer die optimale Beleuchtung für die Arbeit vorherrscht. Sie reagiert auch auf die Art des Untergrunds, den sie beleuchtet. Bei dunklen Flächen wird das Licht stärker, bei hellen schwächer. Und wenn man das Zimmer für mehr als drei Minuten verlässt, schaltet sie sich automatisch aus.«
Dean zog die Jalousie wieder hoch. »Mit dieser Technologie sparen Sie neunzig Prozent des Energieverbrauchs.«
»Gibt es das nicht schon?«, fragte Celler skeptisch.
Dean hatte die Frage erwartet. »In viel einfacheren Ausführungen, ja. Aber die Lampe ist nur als Beispiel gedacht. Dasselbe Prinzip gilt auch für die anderen Geräte, die wir mit intelligenten Systemen ausgestattet haben. Wir haben beispielsweise Staubsauger entwickelt, die ihre Saugleistung nach der Art des Untergrunds und der Verschmutzung regulieren, oder Bohrer, die ihre Leistung dem Widerstand in der Wand anpassen. Auch bei solchen Geräten lässt sich der Stromverbrauch auf einen Drittel reduzieren, ohne dass der Nutzer etwas davon bemerkt.«
»Das klingt wirklich sehr beeindruckend«, sagte Bloom anerkennend. »Aber was hat das mit Ihrer Entlassung zu tun?«
Dean setzte sich wieder. »Intelligente Systeme sind im Grunde nichts Neues. Es gibt bereits einige primitive Versionen davon auf dem Markt. So ähnliche Lampen wie diese hier sind beispielsweise schon recht verbreitet. Aber mein Team und ich haben vor einem Jahr einen Durchbruch erzielt, der die Technologie beinahe sämtlicher elektronischer Geräte revolutionieren könnte. Das Kernstück jedes intelligenten Systems ist die Software, die die Informationen der Sensoren aufnimmt, verarbeitet und die beste Lösung für das Gerät berechnet. Wir haben eine Programmstruktur mit künstlicher Intelligenz entwickelt, die mit einer minimalen Anzahl Algorithmen praktisch jede Art von Dateninputs verarbeiten kann. Damit lässt sich die Software ohne großen Aufwand in jedes erdenkliche Gerät einbauen und ist durch seine einfache Programmstruktur auch extrem kostengünstig. Die Geräte, die Sie hier sehen, sind nur der Anfang. Wir haben bereits intelligente Systeme für die Industrie entwickelt, mit denen sich der Energieverbrauch von Fertigungsprozessen um mehr als die Hälfte reduzieren lässt.« Dean sah zu Bloom. »Sie haben eben über das Potenzial solcher Systeme gesprochen. Ich will es mal so sagen, wenn man alle Anwendungsbereiche dieser Technologie zusammennimmt, ließe sich damit so viel Energie einsparen, dass allein in Europa auf achtzig durchschnittliche Kohlekraftwerke verzichtet werden könnte.«
Der Milliardär schien einen Moment lang zu überlegen, dann blickte er Dean verblüfft an. »Wenn das stimmt, dann würde das bedeuten, dass damit jedes Jahr mehrere Hundert Millionen Tonnen Treibhausgase vermieden werden könnten. Das wäre ein absoluter Meilenstein im Klimaschutz!«
»Es ist etwas mehr als eine halbe Milliarde Tonnen pro Jahr«, präzisierte Dean. »Das entspricht etwa derselben Menge an Treibhausgasen, die Spanien und die Niederlande zusammen erzeugen. Aber leider ist eine solche Effizienzsteigerung nicht in jedermanns Interesse.«
Bloom schürzte die Lippen. »Das kann ich mir vorstellen. Die Stromindustrie dürfe herzlich wenig Freude daran haben.«
»Ich denke, das ist auch der Grund, warum ich entlassen wurde. Hier an der Technischen Universität werden einige Institute durch die Industrie finanziert. Darunter befinden sich auch Stromkonzerne, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Jede Kilowattstunde, die sich mit unserer Technologie einsparen ließe, könnten sie weniger verkaufen. Meine Forschung ist ihnen also ein ziemlicher Dorn im Auge. Natürlich kann ich nicht nachweisen, dass sie es sind, die hinter meiner Entlassung stecken, aber ich nehme an, sie haben Druck auf die Universität ausgeübt. Ohne die finanziellen Mittel der Konzerne müsste die Hochschule ganze Forschungszweige schließen. Also hat die Universitätsleitung lieber nur mich geopfert.«
»Das tut mir wirklich sehr leid für Sie«, sagte Bloom. »Aber das ist nicht das erste Mal, dass ich so etwas höre.«
»Haben Sie schon Pläne, wie es weitergehen soll?«, schaltete sich Celler ein.
Dean sah ihn forschend an. Er spürte, dass sie sich langsam dem Grund für den unerwarteten Besuch näherten. Etwas in Cellers Blick ließ ihn aber daran zweifeln, dass die beiden Männer hier waren, um ihm ihre Unterstützung anzubieten. »Ist das der Grund, warum Sie mich aufgesucht haben?«
Cellers Gesicht blieb ungerührt. »Das kommt darauf an. Wie genau funktioniert die künstliche Intelligenz, die Sie verwenden?«
»Inwiefern?«
Celler legte den Kopf leicht schief, was den Eindruck des gealterten Boxers verstärkte. »Was muss ich mir genau unter ›Intelligenz‹ in diesem Zusammenhang vorstellen?«
Dean lehnte sich zurück. Er wunderte sich, worauf die Frage hinauslaufen sollte. »Es handelt sich dabei nicht um die Art von Intelligenz, wie sie zum Beispiel für eigenständig denkende Roboter entwickelt wird, wenn es das ist, was Sie wissen wollen. Die Programme, die mein Team und ich für die intelligenten Systeme entwerfen, verfügen eher über eine Form rationaler Intelligenz. Das heißt, sie können auf Grundlage von hinterlegten Informationen eigene logische Schlüsse ziehen. Bei unseren Geräten bestehen diese Informationen aus gespeichertem Wissen und aus den Signalen der Sensoren, die das Programm über den Zustand seiner Umwelt informieren.«
»Das Programm kann also unabhängig und flexibel auf seine Umwelt reagieren«, folgerte Celler.
»Ja, genau.«
Celler warf einen Blick zu Bloom, der ihm leicht zunickte. »Könnte man Ihre Programme auch für andere Anwendungen benutzen?«
»Worauf wollen Sie hinaus? Von welcher Art Anwendungen sprechen Sie?«
»Herr Lund«, übernahm Bloom das Wort. »Sie werden vielleicht schon ahnen, dass wir nicht zu Ihnen gekommen sind, weil wir uns speziell für die intelligenten Systeme interessieren – auch wenn ich Ihre Technologie wirklich als sehr unterstützenswert empfinde. Wir sind vielmehr hier, weil wir Ihnen ein Angebot machen möchten.«
»Ein Angebot?«, fragte Dean.
Bloom beugte sich vor, um den kommenden Worten Nachdruck zu verleihen. »Nun, es ist vielleicht weniger ein Angebot im eigentlichen Sinne. Es ist vielmehr eine Chance. Wir möchten Sie für ein Projekt gewinnen. Für etwas, das auch in Ihrem Interesse liegt.«
»Wovon sprechen Sie?«
Bloom fixierte ihn mit festem Blick. »Wir brauchen Ihr Know-how über künstliche Intelligenz. Sie sind mit weitem Abstand der Beste auf diesem Gebiet. Und Sie haben die nötige Motivation.«
»Die nötige Motivation?«, fragte Dean verwundert. »Was meinen Sie damit?«
»Sie haben eine beeindruckende Karriere hinter sich, Herr Lund, das muss man schon sagen.« Bloom ließ sich von Celler eine dünne Aktenmappe geben. Er warf einen kurzen Blick hinein und schaute dann wieder Dean an. »Ein Abschluss als Jahrgangsbester am MIT und eine Auszeichnung mit dem Economists-Innovationspreis für Ihre Masterarbeit über künstliche Intelligenz in der Robotik. Und das mit zwanzig. Wie ich sehe, haben Sie für die NASA ein völlig neues System entwickelt, mit dem sich der Energieverbrauch des Erkundungsroboters K10 Rover halbiert hat. Sie hätten eine vielversprechende Karriere in der Weltraumbehörde vor sich gehabt. Aber Sie haben es vorgezogen, am MIT ein PhD zu machen, um mit Ihrem Ansatz an energieeffizienten Geräten zu forschen. Mit vierundzwanzig hatten Sie bereits Ihren Doktortitel und mehrere bahnbrechende Erkenntnisse in der Intelligenzforschung gemacht. Mit achtundzwanzig eine Assistenzprofessur an der Lawrence Technological University in Michigan und nur ein paar Jahre später eine ordentliche Professur an der TU Delft.«
Bloom klappte die Mappe wieder zu. »Mit Ihren Fähigkeiten hätten Sie jederzeit in die Wirtschaft gehen können, wo Sie locker das Dreifache verdient hätten. Trotzdem setzen Sie sich jetzt schon seit über fünfzehn Jahren für die intelligenten Systeme ein, obwohl Sie ständig dafür angegriffen werden. Sie kämpfen für Ihre Sache, Herr Lund. Genau das brauchen wir.«
»Ich verstehe«, erwiderte Dean. »Ich fühle mich auch wirklich sehr geschmeichelt. Aber wenn Sie darauf hinauswollen, dass ich jetzt mein Pferd wechseln soll, muss ich Sie leider enttäuschen. Was auch immer Sie mir anbieten wollen, ich werde meine Forschung auf keinen Fall aufgeben.«
Bloom schenkte Dean einen väterlichen Blick. »Ich habe mir schon gedacht, dass Sie das sagen würden. Aber schauen Sie sich an, was Ihre Forschung Ihnen gebracht hat. Sie schwimmen seit fünfzehn Jahren gegen den Strom, und nun, nachdem Ihre Systeme marktreif geworden sind, stellt man Sie einfach kalt. Glauben Sie wirklich, dass dies das letzte Mal gewesen ist? Man wird Sie immer wieder bekämpfen. Glauben Sie mir, ich weiß genau, wie das funktioniert. Wenn Ihre Technologie wirklich so gut ist, wie Sie sagen – und davon gehe ich aus –, dann stehen für die Konzerne Milliarden auf dem Spiel. Sie werden alles tun, um Ihre Forschung zu behindern und Ihren Ruf zu ruinieren. Und ganz gleich, wie gut Sie sind, irgendwann wird es keine Universität mehr geben, die Sie nehmen will. Sie kämpfen eine Schlacht, die Sie nur verlieren können, mein Freund. Es wird Zeit, dass Sie den Spieß umdrehen.«
Dean betrachtete den Milliardär eindringlich. »Was genau haben Sie vor?«
Bevor Bloom antworten konnte, hob Celler die Hand, um ihn zu stoppen. »Wer ist das auf dem Foto hinter Ihnen?«, fragte er mit einem misstrauischen Ton in der Stimme.
Irritiert folgte Dean seinem Blick. Auf dem Institutsregal stand ein zwischen Fachzeitschriften eingeklemmtes Bild, das ihn mit Laura in einem Strandkorb an der Nordsee zeigte. Laura schmiegte sich eng an ihn und strahlte aus ihren wunderschönen Katzenaugen in die Kamera. Sie hatte einen Blick, der jeden in ihren Bann ziehen musste. Und auch er, der eigentlich eher ein stiller, nachdenklicher Typ war, wirkte sichtlich ausgelassen. Es war ihr erster gemeinsamer Wochenendausflug gewesen, einige Monate, bevor ihn die Universität entlassen hatte.
»Das ist Laura Dupont. Sie arbeitet als Politologin in der Abteilung für Klimapolitik ganz in der Nähe. Warum?«
Celler warf einen finsteren Blick zu Bloom. »Was soll das? Sie wissen ganz genau, dass wir für diese Aufgabe nur eine Person ohne Bindungen nehmen!«
Bloom hob beschwichtigend die Hand. »Ich weiß, Herr Celler. Aber manchmal muss man eben Kompromisse eingehen.«
»Was für Kompromisse?«, wollte Dean wissen. »Was spielt das für eine Rolle, ob ich eine Beziehung habe?«
Celler schüttelte den Kopf. Er war sichtlich verärgert. »Sie kennen unsere Regeln. Sie hätten mir das nicht vorenthalten dürfen.«
»Vertrauen Sie mir«, entgegnete Bloom. »Lassen Sie uns den Test machen, dann werden Sie sehen, dass ich recht habe.«
Celler sah Bloom kühl an, erwiderte jedoch nichts.
Dean wurde die Sache langsam zu bunt. »Herr Bloom, würden Sie mir endlich sagen, was hier gespielt wird?«
»Hören Sie, ich verstehe Ihre Verwirrung. Doch unsere Vorsicht hat ihren Grund. Unser Vorhaben birgt gewisse Risiken. Aber Sie werden sehen, dass es sich lohnt. Sie werden damit alles erreichen, worauf Sie immer hingearbeitet haben. Und noch bedeutend mehr!«
Dean verschränkte die Arme vor der Brust. Er war kein Freund von Geheimniskrämerei. Und Blooms Verhalten war mehr als rätselhaft. Die ganze Sache klang höchst dubios. »Also, was genau wollen Sie von mir?«
»Sie werden sich einem Test unterziehen müssen«, sagte Celler.
»Einem psychologischen Test«, ergänzte Bloom. »Wir müssen sichergehen, dass Sie geeignet sind.« Er reichte Dean einen Zettel. »Kommen Sie übermorgen zu dieser Adresse. Dort werden wir den Test durchführen. Falls er positiv verläuft, werden wir Sie über alles Notwendige informieren. Dann können Sie sich entscheiden. Wäre das für Sie annehmbar?«
»Und was ist, wenn ich den Test nicht bestehe?«
»Dann sollten Sie vergessen, dass dieses Gespräch jemals stattgefunden hat«, sagte Celler.
Dean wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Er griff seine Agenda aus der Aktentasche neben dem Schreibtisch, nur um der Situation wieder etwas mehr Normalität zu geben.
Er blätterte im Kalender, bis er die richtige Woche fand. In zwei Tagen war Freitag. Laura hatte ihm dort mit fetten Rotbuchstaben »Abendessen im Le Vieux Jean« eingetragen. Da das Essen aber erst um acht Uhr stattfinden würde, gab es nichts, was gegen das Treffen sprach.
Draußen stimmte die Kohlmeise zu einer neuen Serie zorniger Gesänge an. Dean musste sich eingestehen, dass der Milliardär trotz seines merkwürdigen Auftritts seine Neugier geweckt war. Wenn ein Mann wie Bloom ein solches Aufheben um ein Projekt machte, musste schon etwas dran sein. Er wollte sich wenigstens anhören, worum es ging.
»Na gut, ich werde kommen«, sagte er und klappte das kleine Buch wieder zu.
Blooms Mund umspielte ein zufriedenes Lächeln. »Danke, Herr Lund.« Er erhob sich aus seinem Stuhl. »Sie werden es nicht bereuen.«
3
Innenstadt Delft, Niederlande
Laura öffnete die kleine Schatulle und strich über die beiden geschwungenen Ringe aus feinstem Sterlingsilber. Ein Lächeln huschte über ihre Lippen, und sie sah zu Sophie, die neben ihr auf der Rückbank des Wagens saß.
»Wie findest du sie?«
Ihre Tante warf einen kurzen Blick auf die Ringe und verzog missbilligend den Mund. »Denkst du nicht, dass es ein bisschen früh für eine Heirat ist? Du kennst ihn noch nicht einmal ein halbes Jahr.«
Laura spürte einen Stich in der Magengrube, erwiderte jedoch nichts. Sie verstaute die Schatulle in ihrer Handtasche und ließ sich wieder zurück in den schwarzen Ledersitz sinken. Ihr Strahlen war verflogen. »Was hast du eigentlich gegen Dean?«
Sophie machte eine ausweichende Geste. »Ach, Liebes, darum geht es doch nicht.« Sie ignorierte ihren Sekretär, der vom Beifahrersitz der Limousine einen Blick nach hinten warf und auf die Uhr deutete.
»Worum geht es dann?«, hakte Laura nach.
»Ich finde, du solltest dir noch etwas Zeit lassen. Eine solche Entscheidung sollte man nicht unüberlegt treffen. Du kannst doch noch gar nicht sagen, ob er wirklich zu dir passt.«
Laura sah ihre Tante forschend an. Der dunkelgraue Blazer, den sie bis unter den Hals geschlossen trug, ließ sie wie einen reservierten Eunuchen wirken. Dieses Bild traf nicht nur auf ihr Äußeres zu. Seit Laura denken konnte, kannte sie ihre Tante als zugeknöpften und nur schwer durchschaubaren Menschen. Seitdem sie vor zwei Jahren als Umweltministerin in das niederländische Regierungskabinett gewählt worden war, mischte sich zu ihrem distanzierten Blick, der immer etwas über den Köpfen hinwegzugleiten schien, auch die für einflussreiche Politiker unverkennbare Aura der Macht. Nur wenigen gelang es, hinter diese beinahe undurchdringliche Fassade zu blicken und den liebevollen und fürsorglichen Menschen zu sehen, der sie eigentlich war.
Als Lauras Mutter an Krebs gestorben war, hatte Sophie Laura bei sich aufgenommen. Laura war damals gerade zehn Jahre alt geworden. Ihren Vater hatte sie nie kennengelernt. Sie war das Produkt einer flüchtigen Beziehung, die lange vor ihrer Geburt geendet hatte. Durch Sophie hatte sie aber trotz des schmerzhaften Verlusts die Chance auf eine ganz normale Kindheit erhalten. Ihre Tante hatte sie wie die eigene Tochter aufgezogen. Sie hatten immer ein sehr inniges Verhältnis gehabt und sich gegenseitig unterstützt. Umso mehr erstaunte Laura jetzt ihre ablehnende Haltung, wenn sie auf Dean zu sprechen kamen.
»Wenn du wenigstens auch nur eine einzige Einladung von uns angenommen hättest, würdest du jetzt nicht so reden. Aber du bist nie zu uns gekommen.«
»Du weißt doch, dass ich momentan viel um die Ohren habe«, verteidigte sich Sophie. »Außerdem …«
»Außerdem was?«
Lauras Tante seufzte. »Ich finde trotzdem, du solltest noch etwas warten und sehen, wie sich die Dinge entwickeln.«
Jetzt waren sie beim eigentlichen Thema angelangt. »Geht es etwa um seine Entlassung?«
Sophie sah Laura nachdenklich an. »Das war erst der Anfang, Laura. Solange Dean mit seiner Forschung weitermacht, wird er auch weiterhin auf der Abschussliste der Konzerne stehen. Du solltest dich da nicht mit reinziehen lassen.«
»Wie kannst du so etwas sagen?«, empörte sich Laura. »Ich werde Dean nicht im Stich lassen, nur weil er sich in einer schwierigen Lage befindet.«
»Bitte versteh mich nicht falsch, Laura, aber ich glaube, du unterschätzt die Situation. Ich habe in meiner politischen Karriere schon vieles erlebt. Solche Konzerne kämpfen mit harten Bandagen, wenn es darum geht, ihre Milliarden zu schützen. Es ist nicht auszuschließen, dass auch du ins Schussfeld gerätst, wenn sie Dean damit unter Druck setzen können.«
Laura schüttelte den Kopf. »Das kann schon sein, aber das ist nicht der Punkt. Ich liebe Dean. Außerdem werde ich mir mein Leben nicht von irgendwelchen Konzernen bestimmen lassen. Ich werde zu Dean halten, egal, was kommt. Und ich erwarte von dir, dass du mich in dieser Entscheidung unterstützt.«
Das Auto vibrierte, als sie in den Oude Delft einbogen und über das Kopfsteinpflaster fuhren. Auf der linken Seite lag der von Linden gesäumte Stadtbach, und auf ihrer Rechten strichen gepflegte, mittelalterliche Backsteingebäude an ihnen vorbei. Der Oude Delft war einer der schönsten Flecken in der Innenstadt von Delft.
Laura bedachte Sophie mit einem langen Blick. Sie sah müde aus. Außerdem bemerkte Laura, dass sich in ihre gelockten hellbraunen Haare in letzter Zeit einige graue Strähnen eingeschlichen hatten. Auch auf ihrer hohen Stirn zeichneten sich Spuren des Alters ab, die Laura noch vor einigen Monaten nicht aufgefallen waren. Seit ihre Tante zur Umweltministerin gewählt worden war, schien sie mindestens um ein halbes Jahrzehnt gealtert zu sein. Laura konnte nicht sagen, ob es am zermürbenden Kampf mit dem konservativen Flügel des Parlaments lag, der im Umweltschutz nur eine Einschränkung der Wirtschaft sah, oder ob es auch andere Gründe gab. Sie hatten durch Sophies vollen Terminkalender in letzter Zeit kaum Gelegenheit gehabt, miteinander zu sprechen. Auch das heutige Treffen hatte sich ihre Tante nur auf der Fahrt zwischen zwei Sitzungen einrichten können.
»Was habt ihr jetzt vor?«, fragte Sophie schließlich. »In den Niederlanden gibt es nicht viele andere Universitäten, die sich für Deans Forschung eignen würden.«
»Wir wissen es noch nicht«, gab Laura zu. »Aber ich habe meine Stelle an der TU Delft gekündigt. Das MIT hat sich bereits für Deans Arbeit interessiert, und ich bin im Gespräch mit dem Lehrstuhl für Klimapolitik in Harvard.«
»Ach, Liebes«, sagte Sophie bedauernd. »Bist du sicher, dass Dean auch dasselbe für dich tun würde?«
Laura nahm Sophies Hand und drückte sie leicht. »Ja, das würde er. Mach dir keine Sorgen um mich, Sophie. Ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen.«
Ihre Tante schüttelte den Kopf. »Du bist genauso stur, wie deine Mutter es war! Weißt du das?«
Laura lächelte. »Sturer.«
Der Wagen hielt am rechten Straßenrand. Sie waren am Ende des Weges angekommen, der in einer scharfen Biegung auf der anderen Kanalseite zurückführte. Vor ihnen ragte das südliche Seitenschiff der gotischen Oude Kirche empor.
Aus den Augenwinkeln sah Laura, wie sich der Sekretär wieder mit besorgtem Blick nach hinten wandte.
»Ja, ja, ich weiß«, schnauzte Sophie ihn scharf an, bevor er etwas sagen konnte. Dann seufzte sie und schenkte Laura einen entschuldigenden Blick. »Es tut mir leid, Liebes, aber der nächste Termin ruft schon wieder.«
»Kein Problem. Danke fürs Mitnehmen.« Laura küsste ihre Tante auf die Wange.
Sophie sah Laura mit verkniffenem Gesicht an, dann wurden ihre Züge versöhnlich. »Laura, du bist alles, was ich habe. Ich möchte, dass du glücklich bist. Aber ich finde, du solltest noch mal eine Nacht darüber schlafen. Du hast doch alle Zeit der Welt. Warte mit den Ringen wenigstens, bis sich Deans Situation etwas geklärt hat.«
*
Die Dämmerung war hereingebrochen und im Innern des Restaurants Le Vieux Jean brannte bereits gedämpftes Licht. Das Restaurant lag gleich gegenüber der Oude Kirche und gehörte in dieser Lage zu den exquisitesten Lokalen der Stadt. Mit einem Gefühl der Vorfreude öffnete Laura die Tür und wurde augenblicklich von den feinen Gerüchen der französischen Küche umgeben. Es lag eine Note von Rosmarin und Salbei in der Luft. Sie blieb im Empfangsbereich stehen und wartete auf den Kellner. Das Restaurant war bereits fast voll, und in das gedämpfte Murmeln der Gäste mischte sich das Klingen von Besteck und Gläsern. Im Hintergrund lief leise Nocturne von Chopin.
Als Laura ihren Mantel auszog, kam der Oberkellner mit erfreutem Gesicht auf sie zugelaufen, die Arme ausgestreckt, als würde er einen alten Freund begrüßen.
»Madame Dupont, wie schön, Sie zu sehen!«
»Guten Abend, Monsieur Durant.«
Durant nahm ihr den Mantel ab und warf ihr einen anerkennenden Blick zu. »Sie sehen heute Abend absolut bezaubernd aus.«
Sein Lächeln trieb Laura das Blut in die Wangen. Sie hatte extra das kleine Schwarze angezogen, das sie sich vor einigen Jahren für einen Studienball gekauft hatte. Sophie hatte sie damals fast nicht damit gehen lassen wollen, obwohl das Kleid bis zu den Knien reichte und trotz des hautengen Schnitts nichts Anzügliches an sich hatte. Laura bevorzugte es eigentlich eher casual und tauschte ihre Jeans nur selten gegen einen Rock ein. Doch für heute Abend war das kleine Schwarze genau das Richtige.
»Wie geht es Madame Delacroix? Wird sie auch noch kommen?«
»Nein, heute nicht. Ich bin mit meinem Freund verabredet. Ist er noch nicht da?«
»Tut mir leid, es ist noch niemand gekommen.«
Durant führte Laura an den Tisch, den sie reserviert hatte. Er befand sich in der Mitte des Raumes und war mit einem weißen, mit Mustern bestickten Tuch bedeckt. Bauchige Wein- und Wassergläser waren adäquat über einer Reihe von Gabeln und Messern platziert. Ein Besteck für jeden der fünf Gänge, die Laura zur Feier des Tages bestellt hatte. In der Mitte des Tisches brannte eine einzelne weiße Kerze.
»Möchten Sie einen Aperitif, während Sie warten?«
»Bringen Sie mir bitte einen Champagner mit zwei Gläsern. Er muss jeden Augenblick kommen.«
»Sehr gern.«
Als der Kellner gegangen war, nahm Laura die Schatulle mit den Ringen aus der Tasche und betrachtete sie im Kerzenschein. Das Metall glänzte wie ein verheißungsvolles Versprechen. Laura musste an Sophies Worte denken. Sie kannte Dean erst seit einem halben Jahr, und es gab sicher vieles, was sie noch nicht über ihn wusste. Außerdem war ihre Zukunft alles andere als absehbar. Es konnte gut sein, dass Sophie recht hatte, und Dean weiterhin Steine in den Weg gelegt wurden. Laura konnte nicht sagen, wie weit sie bereit war, ihre eigene Karriere für Dean aufs Spiel zu setzen. Aber das war nicht der entscheidende Punkt. Probleme waren da, um gelöst zu werden. Sie liebte ihn, und das war das Einzige, was zählte. Jede Faser ihres Körpers sagte ihr, dass die Entscheidung richtig war.
»Das sind zwei ganz bezaubernde Ringe.«
Laura sah auf. Durant war mit einem Servierwagen zurückgekommen und stellte den gekühlten Champagner auf den Tisch. Bewundernd zeigte er auf die Schatulle in Lauras Hand.
»Danke«, sagte sie.
Der Kellner blieb einen Augenblick stehen und blickte Laura zögerlich an.
»Ist etwas nicht in Ordnung?«, fragte sie.
»Nein, die Ringe sind wunderschön! Aber vielleicht bin ich etwas altmodisch. Dort, wo ich herkomme, ist es die Aufgabe des Mannes, um die Hand anzuhalten.«
Laura lachte. »Wir leben in einer emanzipierten Welt, Monsieur Durant.«
Der Kellner wirkte wenig überzeugt. »Ja, das mag schon sein, aber …« Er hob in einer ausweichenden Geste die Schultern, ließ den Rest des Satzes jedoch unausgesprochen. Dann stellte er die beiden Champagnergläser auf den Tisch und fragte: »Sind Sie sicher, dass Sie nicht schon etwas trinken möchten? Ich würde es nur ungern sehen, wenn Sie auf dem Trockenen sitzen, während Sie warten.«
Laura konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. »Ja, Sie haben recht. Ein Glas kann bestimmt nicht schaden.«
Während Durant einschenkte, sah Laura auf die Uhr und stellte fest, dass Dean bereits zehn Minuten zu spät war. Sie bedankte sich beim Kellner und nahm einen Schluck. Die kühle, prickelnde Flüssigkeit war eine Wohltat nach dem aufreibenden Gespräch mit Sophie. Trotzdem nistete sich allmählich ein beklemmendes Gefühl in ihr ein. Sie fragte sich, wo Dean nur stecken konnte. Es war überhaupt nicht seine Art, zu spät zu kommen.
Nachdem Laura weitere zehn Minuten gewartet hatte, ließ sie sich von Durant ein zweites Glas einschenken. Dieses Mal nur bis zur Hälfte, für den Fall, dass Dean jeden Augenblick erscheinen sollte.
Aber er kam nicht.
Als er nach weiteren fünf Minuten immer noch nicht aufgetaucht war, schlug Lauras Unbehagen in Sorge um. Durant war in der Zwischenzeit mit bedauerndem Blick zu ihr an den Tisch gekommen und hatte ihr zur Überbrückung der Wartezeit ein Amuse-Bouche gebracht. Mit einem flauen Gefühl im Magen zog Laura schließlich ihr Handy aus der Tasche und wählte Deans Nummer. Aber es kam nur seine Mailbox.
Eine halbe Stunde und etliche Anrufversuche später gab sie es auf und bestellte die Rechnung.
»Das geht aufs Haus«, sagte Durant mit betroffener Miene.
»Danke«, erwiderte Laura. Sie konnte die Bedrückung in ihrer Stimme nicht verbergen. Inzwischen war sie sich sicher, dass etwas passiert sein musste. Dean hätte sich sonst schon längst bei ihr gemeldet.
Sie nahm sich ein Taxi zu ihrer Wohnung nördlich des Zentrums und klammerte sich an der Hoffnung fest, dass Dean vielleicht eine Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter hinterlassen hatte. Vielleicht war sie in einem Empfangsloch gewesen, als er sich bei ihr melden wollte. Auch wenn das nicht erklären konnte, warum er es später nicht nochmals auf ihrem Handy versucht hatte.
Die Mietwohnung befand sich in einem schmucklosen Mehrfamilienhaus aus den Sechzigerjahren, wie sie in Delft häufig vorkamen. Sie hielt sich hier nur noch selten auf, da sie faktisch bereits bei Dean eingezogen war. Falls sie auf dem Anrufbeantworter keine Nachricht vorfand, könnte sie es noch in seinem Haus oder bei der Universität versuchen. War es möglich, dass er ihr Abendessen einfach vergessen hatte?
Laura schloss die Haustür auf und eilte die Treppe zu ihrer Wohnung hinauf. Im Eingang ließ sie die Handtasche neben die Garderobe fallen und wollte schon zum Telefon im Schlafzimmer gehen, als ihr auf der Kommode im Gang ein Umschlag auffiel. In geschwungenen Zügen war ihr Name darauf notiert. Es war Deans Handschrift.
Mit einem unguten Gefühl legte sie die Schatulle mit den Ringen ab, die sie während der ganzen Taxifahrt umklammert hatte. Sie konnte sich nicht erinnern, dass der Umschlag das letzte Mal schon dagelegen hätte.
Sie öffnete ihn und zog einen Brief heraus. Etwas in ihrem Inneren sagte ihr, dass er nichts Gutes zu bedeuten hatte. Schon nach der ersten Zeile stockte ihr der Atem.
»Nein«, flüsterte sie erstickt.
Erstarrt vor Entsetzen las sie die Nachricht zu Ende, ohne den Inhalt wirklich begreifen zu können. In der Hoffnung, dass sie irgendetwas falsch verstanden oder übersehen hatte, las sie den Brief nochmals und nochmals. Doch der Inhalt blieb derselbe.
Wie paralysiert stand sie da und umklammerte das Stück Papier so fest, dass sie es fast zerriss.
»Nein!«, stieß sie erneut mit erdrückter Stimme hervor und schluchzte.
Eine Träne lief ihr über die Wange und tropfte auf den Brief. Deans Handschrift begann vor ihr zu verschwimmen, und ihr wurde schwindlig. Als wäre sie auf ein Karussell gestiegen, fing sich alles vor ihr zu drehen an.
Halt suchend griff sie nach der Kommode und streifte dabei die Schatulle. Als hätte sich die Zeit verlangsamt, sah sie die Verlobungsringe wie in Zeitlupe durch die Luft fliegen und laut klirrend auf den Steinboden fallen. Das Schallen des aufschlagenden Metalls dröhnte wie ein stechendes Stakkato in ihren Ohren.
Es klang, als würden sie zerbrechen.
4
Zwei Jahre später
Warschau, Polen
Sam Bauer sah in sein müdes Gesicht im Badezimmerspiegel und fragte sich, wie er den Tag überleben sollte. Es war Montagmorgen, und ihm stand wieder eine ewig lange Woche Wachdienst beim Supermarkt bevor. Ein echter Scheißjob, aber er brauchte das nötige Kleingeld für die Miete. Immerhin hatte er sich für den Abend mit seiner Gilde Adolons Union im Online-Game World of Warcraft verabredet, um den Mount Hyjal zu stürmen. Das würde den Tag retten. Aber bis dahin brauchte er unbedingt etwas, womit er den dämlichen Wachdienst überstehen konnte.
Er griff nach seinem Handy, um auf Spotify durch seine Playlists zu scrollen. Ein bisschen Sepultura könnte die Düsternis seines Tags bestimmt erhellen. Oder vielleicht auch mal wieder Slayer, die alten Metal-Titanen. Beim Gedanken daran, wie ihm Tom Araya God hates us all ins Ohr schrie, während er mit seriöser Miene dabei zusehen würde, wie die Hausmütter gelangweilt ihre Einkaufswagen durch den Laden schoben, zog sich ein schiefes Grinsen über sein Gesicht.
Als sich die App öffnete, erschien eine Meldung auf dem Bildschirm. »Softwareupdate. Aktualisierung erforderlich.«
Sam sah verwirrt auf das Display. Normalerweise machte sein Handy solche Updates von alleine. Wieso brauchte es auf einmal seine Bestätigung? Skeptisch betrachtete er die Meldung für einige Sekunden. Es sah alles so aus, wie er es von der App kannte.
In diesem Moment klingelte sein Wecker.
»Mist!«, fluchte er und sah hektisch auf die Uhr: kurz nach sieben. Er musste los. Er knallte die Zahnbürste ins Waschbecken und packte seine Sachen zusammen. Dann stülpte er sich seine Uniform der Wala Security AG über, schnappte sich das Handy und stürzte in den Keller zum Fahrrad.
Eine Minute später war er vor der Haustür und checkte nochmals die Zeit auf dem Handy. Noch immer zeigte Spotify die Meldung mit dem Softwareupdate.
Verdammt, das hatte er ganz vergessen. Ohne weiter darüber nachzudenken, gab er seine Bestätigung ein. Einen Tag ohne Musik würde er nicht überleben. Dann steckte er das Gerät ein und schoss los. Er war zwar ein bisschen spät dran, aber mit einem kurzen Spurt und eine Abkürzung durch den Łazienki-Park hatte er die Zeit wieder aufgeholt und erreichte kurz vor acht den Hintereingang des Supermarktes. Bevor er eintrat, zog er aus seiner Jackentasche eine der besten Investitionen hervor, die er je getätigt hatte: einen weißen Ohrhörer mit geringeltem Kabel, völlig identisch mit den Steckern, die die meisten Sicherheitsdienste verwendeten. Nur dass sein Brötchengeber viel zu wenig Mitarbeiter hatte, als dass sich diese Dinger gelohnt hätten. Sam steckte sich den Hörer ins Ohr und startete den Player. Einfach genial. Während jeder glauben würde, dass er mit dem Stecker pflichtbewusst irgendwelche Befehle entgegennahm, dröhnten in Wahrheit die erlösenden Gitarren von Slayer in sein Ohr.
Sam trat in den Supermarkt, grüßte freundlich den Filialleiter hinter dem Kundendienstschalter und stellte sich an seinen Platz am Eingang. Er grinste leicht, als die ersten Riffs der Metal-Altmeister ertönten. Vielleicht würde es doch gar kein so schlechter Tag werden.
*
Punkt acht, als sich die Türen des Supermarkts für die Kundschaft öffneten, wurde auf Sams iPhone ein Programm aktiv, das mit dem Spotify-Update übertragen wurde. Es war ein winziger Code von wenigen Kilobytes Größe, der sich unbemerkt auf dem Speicher des Smartphones eingenistet hatte.
Nach wenigen Augenblicken hatte das Programm über das Handysignal Verbindung zum Internet aufgenommen, stellte Kontakt zu Sams Provider her und fing im Sekundentakt an, Signale in den Äther des World Wide Web zu senden.
Punkt neun stellte das Programm seinen Versand unvermittelt wieder ein und kehrte in den inaktiven Modus zurück.
5
Culpeper, Virginia, USA
Das Telefon auf Ben Johnsons Schreibtisch im Operating Center der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication klingelte nur selten mitten in der Nacht. Wenn es dies allerdings tat, bedeutete das fast nie etwas Gutes. Schon gar nicht, wenn es von Übersee kam.
»Swift Operating Center, Chief Security Officer Ben Johnson«, nahm er den Anruf auf seinem Headset entgegen.
»Ben, hier ist Peter Hardwald, vom Operating Center Diessenhofen.«
»Pete, was für eine seltene Ehre, vor allem um diese Zeit. Was gibt’s denn?«
»Ich fürchte nichts Gutes. Wir haben hier gerade ziemliche Probleme, die wir uns nicht erklären können. Gibt es auf eurer Seite irgendwelche auffälligen Aktivitäten?«
»Nein, was ist denn los?«
»Wir haben hier einen massiven Overload an Transaktionen. Das ist eine richtige Flut von Nachrichten, und es werden immer mehr.«
»Seit wann?«
»Es hat kurz nach acht angefangen, also vor fünf Minuten. Danach haben die Nachrichten explosionsartig zugenommen.«
»Welche Art von Nachrichten?«, wollte Ben Johnson wissen.
»Die meisten sind Standardüberweisungen, aber auch Devisengeschäfte, Wertpapiertransaktionen und Akkreditiveröffnungen. Die Protokolle sehen alle normal aus und verfügen über die notwendigen Authentifizierungen, aber inzwischen müssen es Millionen sein. Wir kommen gar nicht mehr mit dem Zählen nach.«
»Millionen?« Johnson runzelte die Stirn. »Das muss ein Fehler sein, Pete. Eine solche Menge an Transaktionen ist völlig unmöglich.«
»Ich weiß, deshalb rufe ich dich an. Auf unserem Bildschirm zeigt es nämlich auch eine Transaktionszunahme auf eurer Seite an. Wenn aber nur wir das sehen, muss der Fehler irgendwo bei uns im System liegen. Sieh dir mal eure Transaktionsdichte an.«
Johnson schob das Mikrofon des Headsets zur Seite. »Forster, wie sieht unser Datenverkehr aus? Gibt es irgendwas Unübliches?«, rief er dem Operator an einem Terminal vor ihm zu.
»Leicht erhöht für diese Uhrzeit, würde ich sagen. Aber nicht ungewöhnlich.«
»Danke, Forster.« Er schob das Mikrofon wieder zurück. »Pete, bei uns scheint alles im grünen Bereich zu sein. Könnte es sein, dass ihr vielleicht ein Softwareproblem …«
»Warten Sie«, unterbrach ihn der Operator. »Hier ist doch etwas seltsam.«
»Was haben Sie?«
»Einige der Transaktionen kommen von Finanzinstituten aus den Vereinigten Staaten.«
»Das kann nicht sein«, widersprach Johnson. »Schalten Sie das auf den Hauptmonitor.«
»Ja, Sir.«
Auf einer Bildschirmwand am Kopfende des Raums erschien ein Datenstrang mit den eingehenden Transaktionen. Darauf waren tatsächlich verschiedene Buchungsnachrichten amerikanischer Banken aufgeführt.
»Sind Sie sicher, dass die Anzeige stimmt? Es ist mitten in der Nacht. Die Finanzinstitute sind geschlossen. Da dürfte rein gar nichts laufen.«
»Ich fürchte die Anzeige stimmt, Sir. Und es werden immer mehr Finanzinstitute, die Transaktionen ausüben.«
Im Operating Center wurde es unruhig. Die Operatoren begannen wild miteinander zu diskutieren und scharten sich in Gruppen um die Bildschirme. Johnson beobachtete fassungslos, wie die Geschwindigkeit der Transaktionen plötzlich zunahm. War es vor wenigen Sekunden noch möglich gewesen, einzelne Nachrichten zu entziffern, so verschwammen sie inzwischen zu einem unscharfen Textfluss.
»Siehst du das auch, Pete?«
»Ja, wir sehen es hier auch. Dasselbe passiert gerade weltweit. Wir werden in diesem Moment mit einer Welle von Transaktionen aus Asien überschwemmt. Das ist ein richtiger Tsunami.«
»Wir müssen herausfinden, was hier passiert, und zwar schnell!«
»Einen Augenblick, Ben. Ich glaub, wir haben da was.« Johnson hörte, wie Pete am anderen Ende der Leitung aufgeregt mit jemandem sprach. Im Operating Center war der Geräuschpegel inzwischen deutlich angestiegen. »Ben«, meldete sich Pete nach wenigen Sekunden zurück. »Unsere Techniker haben eine der Nachrichten genauer analysiert. Sie haben herausgefunden, dass die Nachrichten zwar einen korrekten Identifizierungscode und auch eine Authentifizierung enthalten, aber es gibt keinen Transaktionsauftrag.«
»Es gibt keinen Auftrag?«
»Nein, die Nachrichten sind bloß leere Hüllen.«
»Also sind es Fälschungen.«
»Scheint so. Es soll nur so aussehen, als würden sie von echten Finanzinstituten kommen.«
Ein Operator löste sich aus einer Gruppe und kam auf Johnson zu. »Sir, wir haben inzwischen eine solche Nachrichtenmenge erreicht, dass wir nicht mehr in der Lage sind, die Transaktionen zu verarbeiten. Unserer Server sind völlig blockiert.«
»Wie sieht’s bei euch aus, Pete?«, fragte Johnson durch das Headset.
»Dasselbe. Bei uns läuft gar nichts mehr. Im Moment kann weltweit keine einzige Bank mehr internationale Zahlungen vornehmen.«
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte der Operator.
Johnsons Blick wanderte auf den immer schneller rasenden Nachrichtenfluss. »Dass wir ein verdammt großes Problem haben«, murmelte er und rief dann ins Headset: »Pete, informier sofort den Direktor. Wir sind gerade das Ziel einer Cyber-Attacke geworden.«
6
Universität St. Gallen, Schweiz