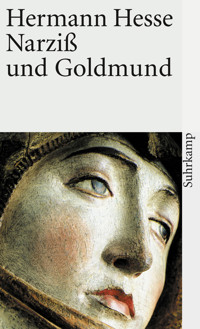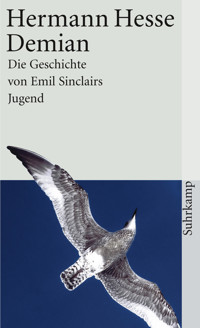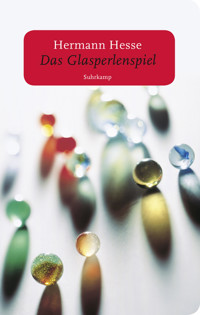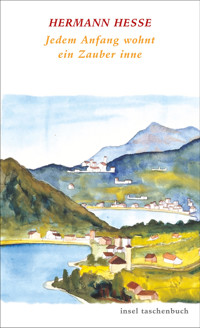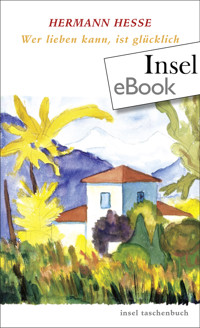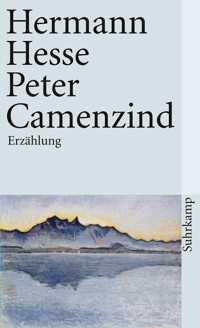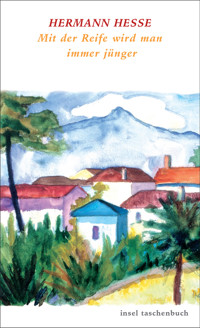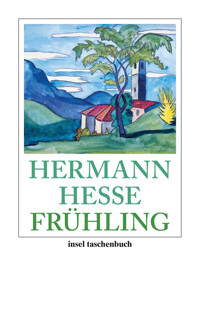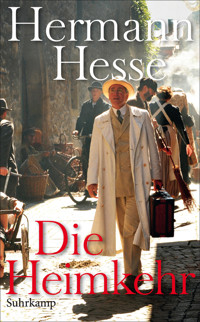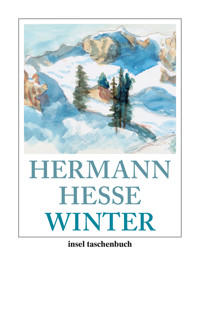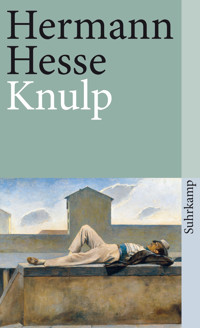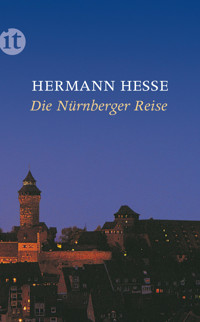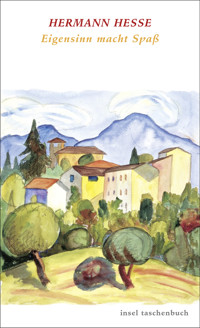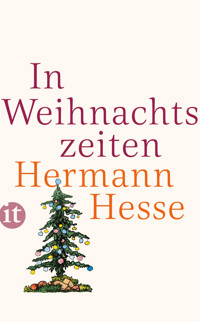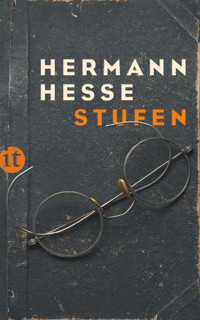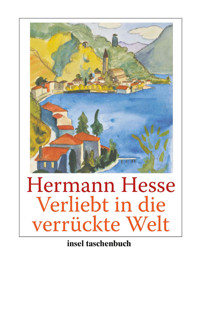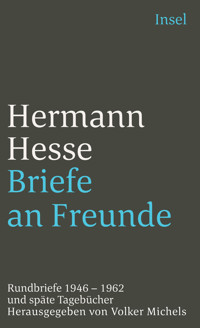
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Kein anderer deutschsprachiger Schriftsteller des 20.Jahrhunderts ist so sehr mit Leserbriefen überschüttet worden wie Hermann Hesse, und kein anderer hat diese oft genug lästige Herausforderung so ernst genommen wie er. Seine Bücher hatten diese Briefe provoziert, also fühlte er sich auch verpflichtet, den Fragen nicht auszuweichen, die in mehr als fünfunddreißigtausend Briefen an ihn gerichtet wurden. Er hat sich ihnen gestellt, individuell und ohne jede Hilfskraft. Denn »einen Kanzleiapparat aufzubauen gegen den täglichen Ansturm«, das wäre, wie er sagte, für ihn, »der zeitlebens die Routine gehaßt und ihr in seinem Leben keinen Platz eingeräumt hat, geradezu Kapitulation und Verrat«. Doch seit 1946, seit der Verleihung des Nobelpreises, nahm der tägliche Posteingang solche Dimensionen an, daß er einen Ausweg finden mußte, der es ihm ermöglichte, diesem seinem Grundsatz treu zu bleiben, ohne ihm doch die ganze Arbeitskraft zu opfern. So half er sich von 1946 bis zu seinem Lebensende mit einer neuen literarischen Gattung, seinen »Rundbriefen«, die es ihm erlaubten, sowohl auf die am häufigsten wiederkehrenden Leserfragen zu reagieren, zeitgenössische Bücher zu empfehlen als auch seine neuen Erlebnisse und Erfahrungen festzuhalten und zu gestalten. Diese Rundbriefe erschienen zunächst als Privatdrucke, die Hesse seinen notgedrungen immer knapperen Antworten auf Leserbriefe beilegte. Einige davon wurden einer größeren Öffentlichkeit 1955 in der Sammlung Beschwörungen vorgelegt, einem Fortsetzungsband seiner Späten Prosa. Unsere Ausgabe vereinigt diese ebenso autobiographisch wie zeitgeschichtlich bedeutsamen Rundbriefe und Tagebuchnotizen erstmals vollständig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Hermann Hesse
Briefe an Freunde
Rundbriefe 1946-1962 und späte Tagebücher
Herausgegeben von Volker Michels
Inhalt
Ein Brief nach Deutschland
Statt eines Briefes
Geheimnisse
Antwort auf Bittbriefe
An einen jungen Kollegen in Japan
Nicht abgesandter Brief an eine Sängerin
Das gestrichene Wort
Nächtliche Spiele
An einen jungen Künstler
Stunden am Schreibtisch
Rundbrief an einige Freunde in Schwaben
Antwort auf Briefe aus Deutschland
Weihnacht mit zwei Kindergeschichten
Aus einem Brief an Freunde
Begegnungen mit Vergangenem
Allerlei Post
Ahornschatten
Großväterliches
Aprilbrief
Geburtstag
Herbstliche Erlebnisse
Über das Alter
Engadiner Erlebnisse
Notizblätter um Ostern
Beschwörungen
Yin und Yang
Rundbrief aus Sils-Maria
Weihnachtsgaben
Leser und Dichtung
Brief an den Verfasser eines Kriegsromans
Ein paar indische Miniaturen
Bericht an die Freunde
Sommerbrief
An einen Musiker
Yüan Wu’s Niederschrift von der smaragdenen Felswand
Josef Knecht an Carlo Ferromonte
Schreiben und Schriften
Brief im Mai
Quellennachweise
Namenregister
Zeittafel
Ein Brief nach Deutschland
(An Luise Rinser)
Merkwürdig ist das mit den Briefen aus Ihrem Lande! Viele Monate lang bedeutete für mich ein Brief aus Deutschland ein überaus seltenes, und beinahe immer ein freudiges Ereignis. Er brachte die Nachricht, daß irgendein Freund noch lebe, von dem ich lange nichts mehr erfahren und um den ich vielleicht gebangt hatte. Und er bedeutete eine kleine, freilich nur zufällige und unzuverlässige Verbindung mit dem Lande, das meine Sprache sprach, dem ich mein Lebenswerk anvertraut hatte, das bis vor einigen Jahren mir auch mein Brot und die moralische Rechtfertigung für meine Arbeit gegeben hatte. Ein solcher Brief kam immer überraschend, immer auf wunderlichen Umwegen, er enthielt kein Geschwätz, nur Wichtiges, war oft in großer Hast während der Minuten geschrieben, in denen ein Rotkreuzwagen oder ein Rückwanderer daraufwartete, oder er kam, in Hamburg, Halle oder Nürnberg geschrieben, nach Monaten auf dem Umweg über Frankreich oder Amerika, wohin ein freundlicher Soldat ihn bei seinem Heimaturlaub mitgenommen hatte.
Dann wurden die Briefe häufiger und länger, und hinzu kamen sehr viele aus den Kriegsgefangenenlagern aller Länder, traurige Papierfetzchen aus den Stacheldrahtlagern in Ägypten und Syrien, aus Frankreich, Italien, England, Amerika, und unter diesen Briefen waren schon viele, die mir keine Freude machten und die zu beantworten mir bald die Lust verging. In den meisten dieser Gefangenenbriefe wurde sehr geklagt, es wurde auch bitter geschimpft, es wurde Unmögliches an Hilfe verlangt, es wurde höhnisch an Gott und Welt Kritik geübt und zuweilen geradezu mit dem nächsten Krieg gedroht. Es gab edle Ausnahmen, doch waren sie selten. Im übrigen sprachen sie nur von dem, was sie erleiden mußten und klagten bitter über die Ungerechtigkeit der langen Gefangenschaft. Vom anderen, von dem, was sie als deutsche Soldaten jahrelang der Welt angetan hatten, war nie mit einem Wort die Rede. Mir fiel dabei immer ein Satz aus einem deutschen Kriegsbuch aus der Zeit des Einmarsches in Rußland ein. Der Autor, im übrigen harmlos und leidlich frei von Nazimentalität, bekannte darin, daß der Gedanke ans Sterbenmüssen freilich jeden Soldaten nicht wenig beschäftige, während das andre, das Tötenmüssen, lediglich eine »taktische« Frage sei. Alle diese Briefschreiber gaben Hitler preis, keiner war mitschuldig.
Ein Gefangener in Frankreich, kein Kind mehr, sondern ein Industrieller und Familienvater, mit Doktortitel und guter Bildung, stellte mir die Frage: was denn nach meiner Meinung ein gutgesinnter, anständiger Deutscher in den Hitlerjahren hätte tun sollen? Nichts habe er verhindern, nichts gegen Hitler tun können, denn das wäre Wahnsinn gewesen, es hätte ihn Brot und Freiheit gekostet, und am Ende noch das Leben. Ich konnte nur antworten: Die Verwüstung von Polen und Rußland, das Belagern und dann das irrsinnige Halten von Stalingrad bis zum bittern Ende sei vermutlich auch nicht ganz ungefährlich gewesen, und doch hätten die deutschen Soldaten es mit Hingabe getan. Und warum sie denn Hitler erst von 1933 an entdeckt hätten? Hätten sie ihn nicht zum mindesten seit dem Münchener Putsch kennen müssen? Warum sie denn die einzige erfreuliche Frucht des ersten Weltkrieges, die deutsche Republik, statt sie zu stützen und zu pflegen, fast einmütig sabotiert, einmütig für Hindenburg und später für Hitler gestimmt hätten, unter dem es dann allerdings lebensgefährlich geworden sei, ein anständiger Mensch zu sein? Ich erinnerte solche Briefschreiber auch gelegentlich daran, daß das deutsche Elend ja nicht erst mit Hitler begonnen habe, und daß schon im Sommer 1914 der trunkene Jubel des Volkes über Österreichs gemeines Ultimatum an Serbien eigentlich manchen hätte aufwecken können. Ich erzählte, was Romain Rolland, Stefan Zweig, Frans Masereel, Annette Kolb und ich in jenen Jahren durchzukämpfen und zu erleiden hatten. Aber darauf ging keiner ein, sie wollten überhaupt keine Antwort hören, keiner wollte wirklich disputieren, wirklich an irgendein Lernen und Denken gehen.
Oder es schrieb mir ein ehrwürdiger greiser Geistlicher aus Deutschland, ein frommer Mann, der unter Hitler sich tapfer gehalten und vieles geduldet hatte: erst jetzt habe er meine vor fünfundzwanzig Jahren geschriebenen Betrachtungen aus dem ersten Weltkrieg gelesen, und müsse ihnen als Deutscher und als Christ Wort für Wort beistimmen. Aber ehrlicherweise müsse er auch sagen: wären diese Schriften ihm damals, als sie neu und aktuell waren, unter die Augen gekommen, so hätte er sie entrüstet weggelegt, denn er sei damals, wie jeder anständige Deutsche, ein strammer Patriot und Nationalist gewesen.
Häufiger und häufiger wurden die Briefe, und jetzt, seit sie wieder mit der gewöhnlichen Post kommen, läuft mir Tag um Tag eine kleine Sintflut ins Haus, viel mehr als gut ist und als ich lesen kann. Doch sind es zwar Hunderte von Absendern, aber im Grunde doch nur fünf oder sechs Arten von Briefen. Mit Ausnahme nämlich der wenigen ganz echten, ganz persönlichen und unwiederholbaren Dokumente dieser großen Notzeit - und zu diesen wenigen gehört als einer der besten Ihr lieber Brief- sind diese vielen Schreiben Ausdruck bestimmter, sich wiederholender, oft allzu leicht erkennbarer Haltungen und Bedürfnisse. Sehr viele von ihren Verfassern wollen bewußt teils dem Adressaten, teils der Zensur, teils sich selber ihre Unschuld am deutschen Elend beteuern, und nicht wenige haben ohne Zweifel gute Ursache zu diesen Anstrengungen.
Da sind nun zum Beispiel alle jene alten Bekannten, die mir früher jahrelang geschrieben, damit aber in dem Augenblick aufgehört hatten, wo sie merkten, daß man sich durch Briefwechsel mit mir, einem Wohlüberwachten, recht Unangenehmes zuziehen könne. Jetzt teilen sie mir mit, daß sie noch leben, daß sie stets warm an mich gedacht und mich um mein Glück, im Paradies der Schweiz zu leben, beneidet hätten, und daß sie, wie ich mir ja denken könne, niemals mit diesen verfluchten Nazis sympathisiert hätten. Es sind aber viele dieser Bekenner jahrelang Mitglieder der Partei gewesen. Jetzt erzählen sie ausführlich, daß sie in all diesen Jahren stets mit einem Fuß im Konzentrationslager gewesen seien, und ich muß ihnen antworten, daß ich nur jene Hitlergegner ganz ernstnehmen könne, die mit beiden Füßen in jenen Lagern waren, nicht mit dem einen im Lager, mit dem andern in der Partei. Auch erinnere ich sie daran, daß wir hier im »Paradies« der Schweiz Während der Kriegsjahre jeden Tag mit dem freundnachbarlichen Besuch der braunen Teufel haben rechnen müssen, und daß in unsrem Paradiese auf uns Leute von der Schwarzen Liste schon die Gefängnisse und Galgen warteten. Immerhin gebe ich zu, daß je und je die Neuordner Europas uns schwarzen Schafen auch lockende Köder hingehalten haben. So wurde ich noch ziemlich spät, zu meinem Erstaunen durch einen Miteidgenossen und Kollegen mit bekanntem Namen, eingeladen, auf »seine« Kosten nach Zürich zu kommen, um mit ihm meine Aufnahme in den vom Ministerium Rosenberg gegründeten Bund der europäischen Kollaborationisten zu besprechen.
Dann gibt es treuherzige alte Wandervögel, die schreiben mir, sie seien damals, so etwa um 1934, nach schwerem innerem Ringen in die Partei eingetreten, einzig um dort ein heilsames Gegengewicht gegen die allzu wilden und brutalen Elemente zu bilden usw.
Andre wieder haben mehr private Komplexe und finden, Während sie im tiefen Elend leben und von wahrlich wichtigeren Sorgen umgeben sind, Papier und Tinte und Zeit und Temperament im Überfluß, um mir in langen Briefen ihre tiefe Verachtung für Thomas Mann auszusprechen und ihr Bedauern oder ihre Entrüstung darüber, daß ich mit einem solchen Manne befreundet sei.
Und wieder eine Gruppe bilden jene, die offen und eindeutig all die Jahre mit an Hitlers Triumphwagen gezogen haben, einige Kollegen und Freunde aus früheren Zeiten her. Sie schreiben mir jetzt rührend freundliche Briefe, erzählen mir eingehend von ihrem Alltag, ihren Bombenschäden und häuslichen Sorgen, ihren Kindern und Enkeln, als wäre nichts gewesen, als wäre nichts zwischen uns, als hätten sie nicht mitgeholfen, die Angehörigen und Freunde meiner Frau, die Jüdin ist, umzubringen, und mein Lebenswerk zu diskreditieren und schließlich zu vernichten. Nicht einer von ihnen schreibt, erbereue, er sehe die Dinge jetzt anders, er sei verblendet gewesen. Und auch nicht einer schreibt, er sei Nazi gewesen und werde es bleiben, er bereue nichts, er stehe zu seiner Sache. Wo wäre je ein Nazi zu seiner Sache gestanden, wenn diese Sache schiefging?! Ach, es ist zum Übelwerden.
Eine kleinere Zahl von Briefschreibern erwartet von mir, ich solle mich heute zu Deutschland bekennen, solle hinüberkommen, solle an der Umerziehung mitarbeiten. Weit größer aber ist die Zahl derer, die mich auffordern, draußen in der Welt meine Stimme zu erheben und als Neutraler und als Vertreter der Menschlichkeit gegen Übergriffe oder Nachlässigkeiten der Besatzungsarmeen zu protestieren. So weltfremd, so ohne Ahnung von der Welt und Gegenwart, so rührend und beschämend kindlich ist das!
Wahrscheinlich kommt Ihnen all dieser teils kindliche teils bösartige Unsinn gar nicht erstaunlich vor, wahrscheinlich kennen Sie all das besser als ich. Sie deuten ja an, daß Sie mir einen langen Brief über die geistige Situation in Ihrem armen Lande geschrieben haben, ihn aber aus Zensurgründen zurückbehielten. Nun, ich wollte Ihnen nur einen Begriff davon geben, womit jetzt die größere Hälfte meiner Tage und Stunden ausgefüllt ist, und wollte damit auch erklären, warum ich diesen Brief an Sie drucken lasse. Ich kann nämlich die Haufen von Briefen, von denen die meisten ohnehin Unmögliches verlangen und erwarten, natürlich nicht beantworten, und doch sind unter jenen Briefen solche, denen mich ganz zu entziehen mir nicht erlaubt schiene. Ihren Verfassern werde ich nun diesen gedruckten Brief schicken, schon weil sie alle so wohlmeinend und besorgt nach meinem Ergehen fragen.
Ihr lieber Brief nun ist in keiner Kategorie unterzubringen, er enthält nicht ein einziges schabloniertes Wort, und enthält–wunderbar im heutigen Deutschland! - nicht ein Wort der Klage oder Anklage. Er hat mir außerordentlich wohl getan, Ihr guter, kluger und tapferer Brief, und was er über Ihr eigenes Schicksal enthält, hat mich tief bewegt. So sind also auch Sie, wie unser treuer Freund Suhrkamp, lange Zeit bewacht, bespitzelt, in die Kerker der Gestapo gesteckt, und sogar zum Tode verurteilt worden! Ich bin beim Lesen tief erschrocken, um so mehr als auch meine Briefe, trotz aller Vorsicht, Sie mitbelastet haben, aber eigentlich überrascht haben Ihre Nachrichten mich nicht. Denn ich hatte mir Sie niemals mit dem einen Fuß im Gefängnis oder Lager, mit dem andern aber in der Partei vorgestellt, sondern habe nie daran gezweifelt, daß Sie tapfer und wach, wie es Ihren hellen Augen und Ihrer Klugheit zukommt, auf der richtigen Seite gestanden. Und da waren Sie freilich in schwerster Gefahr.
Sie sehen, ich kann mit der Mehrzahl meiner deutschen Korrespondenten wenig anfangen. Es ist manches ähnlich wie einst am Ende des ersten Weltkriegs, und ich bin freilich heute auch älter und mißtrauischer als ich damals war. So wie heute alle meine deutschen Freunde in der Verurteilung Hitlers einig sind, so waren sie es damals, bei der Gründung der deutschen Republik, in der Verurteilung von Militarismus, Krieg und Gewalt. Man fraternisierte allgemein, etwas spät aber herzlich, mit uns Kriegsgegnern, Gandhi und Rolland wurden beinahe wie Heilige verehrt. »Nie wieder Krieg!« hieß das Schlagwort. Aber einige Jahre später konnte Hitler schon seinen Münchener Putsch wagen. So nehme ich denn die heutige Einmütigkeit im Verdammen Hitlers nicht allzu ernst, und sehe in ihr nicht die mindeste Gewähr für eine politische Sinnesänderung, oder auch nur für eine politische Erkenntnis und Erfahrung. Ernst, sehr ernst aber nehme ich die Sinnesänderung, die Läuterung und Reife jener Einzelnen, denen in der ungeheuren Not, in dem glühenden Martyrium dieser Jahre sich der Weg nach Innen, zur Selbstkritik, der Weg ins Herz der Welt, der Blick in die zeitlose Wirklichkeit des Lebens geöffnet hat. Diese Erwachten haben das große Geheimnis ganz ähnlich gespürt und erlebt und erlitten, wie ich es einst in den bittern Jahren nach 1914 erlebt habe, nur geschah es unter viel größerem Druck, unter härteren Leiden, und ohne Zweifel sind Unzählige auf dem Weg zu diesem Erlebnis und Erwachen zusammengebrochen und erlegen, ehe sie die Reife erreichen konnten.
Hinter dem Stacheldraht eines Gefangenenlagers in Afrika schreibt mir ein deutscher Hauptmann von Erinnerungen an Dostojewskis »Totenhaus« und an Siddhartha, von seinem Streben, inmitten eines erbarmungslosen Lebens, das kein Alleinsein auch nur für Minuten erlaubt, den Pfad der Versenkungzu gehen und ins Innen zugelangen, »ohne daß der Wille zum Ausscheiden aus allen Vordergründen endgültig würde«. Oder eine ehemalige Gefangene der Gestapo schreibt: »Ich habe durch das Gefängnis viel gelernt, und bürgerliche Kümmernisse bedrücken mich nicht mehr.« Das sind positive Erfahrungen, sind Zeugnisse wirklichen Lebens, und ich könnte solcher Worte noch viele anführen, wenn ich die Zeit und Augenkraft hätte, all diese Briefe nochmals zu durchlesen.
Ihre Frage nach meinem Ergehen ist rasch beantwortet. Ich bin alt und müde geworden, und die Zerstörung meines Werkes, begonnen durch Hitlers Ministerien und restlos vollendet durch die amerikanischen Bomben, hat meinen letzten Jahren den Grundton von Enttäuschung und Kummer gegeben. Daß über diesem Grundton dennoch manche kleine Melodie noch möglich ist, und ich zu manchen Stunden auch jetzt noch im Zeitlosen zu leben vermag, ist mein Trost. Damit etwas von meinem Werk übrig bleibe, mache ich von Zeit zu Zeit von irgendeinem seit Jahren fehlenden Buch einen Schweizer Neudruck; es ist nicht viel mehr als eine Geste, denn diese Drucke existieren natürlich nur für die Schweiz.
Alter und Verkalkung machen Fortschritte, manchmal will das Blut nicht mehr so richtig durchs Gehirn laufen. Aber diese Übel haben schließlich auch ihre gute Seite: man nimmt nicht alles mehr so deutlich und heftig auf, man hört an vielem vorbei, man spürt manchen Hieb oder Nadelstich überhaupt nicht mehr, und ein Teil des Wesens, das einst Ich hieß, ist schon dort, wo bald das Ganze sein wird.
Zu den guten Dingen, für deren Aufnahme und Genuß ich noch Organe habe, die mir noch Freude machen und das Dunkle übertönen können, gehören die seltenen, aber eben doch vorhandenen Zeichen für das Weiterleben eines echten geistigen Deutschland, die ich nicht in der Betriebsamkeit der jetzigen Kulturmacher und Konjunkturdemokraten Ihres Landes suche und finde, sondern in solchen beglückenden Äußerungen der Entschlossenheit, Wachheit und Tapferkeit, der illusionslosen Zuversicht und Bereitschaft, wie Ihr Brief eine ist. Dafür sage ich Ihnen meinen Dank. Hütet den Keim, bleibt dem Licht und Geiste treu. Ihr seid sehr Wenige, aber vielleicht das Salz der Erde.
(1946)
Statt eines Briefes
[Ende Juli 1946]
Die letzten Monate haben mir eine so große Überbürdung gebracht, daß ich mir für eine Weile mit dieser Drucksache helfen muß. Schon seit einem halben Jahr, nämlich seit die ersten Möglichkeiten sich boten, hungernden Freunden in Deutschland je und je etwas senden zu lassen, habe ich, da ich von den großen Organisationen und Maschinen der Wohltätigkeit wenig halte, die Sache so angefaßt, daß ich mir vornahm, eine kleine Zahl von Menschen, die mir teuer sind, regelmäßig zu unterstützen. Um nun diese Sendungen jeden Monat wieder zu ermöglichen, mußte ich, da seit einigen Jahren meine Ausgaben größer sind als die Einnahmen, das Nötige durch Arbeit verdienen, teils durch den Verkauf von Privatdrucken usw., teils durch kleine Bettelgänge im Kreis meiner Schweizer Freunde, teils durch Herstellen von Bilderhandschriften für wohlhabende Besteller. Damit und mit der seit einem Jahr stark angewachsenen Aufgabe, eine große Zahl von deutschen Kriegsgefangenen mit Lektüre, zum Teil auch mit Rat und Zuspruch zu versorgen, war nun eigentlich meine nicht mehr große Arbeitskraft jeden Tag reichlich in Anspruch genommen, es blieb für Privates, namentlich für Briefe, kaum noch ein Restchen übrig.
So stand es, als mit dem 1. April der Briefverkehr von und nach Deutschland sich wieder öffnete. Seither sind zu meiner täglichen Post Haufen und Haufen von Briefen hinzugekommen, viele Hunderte, und kommen weiter Tag für Tag, und die Mehrzahl dieser Briefe verdiente eine Antwort, sie kommen von alten treuen Lesern, von Ratsuchenden, von Verzweifelnden oft, ich habe in diesen paar Monaten weit mehr als tausend zum Teil erschütternde Berichte von deutschen Schicksalen der letzten Jahre zu lesen bekommen, und jeder dieser Berichte forderte nicht nur die stets überanstrengten Augen, den stets übermüdeten Kopf, sie setzten auch Herz und Gemüt unter eine nie endende Flut von mitleidfordernden Klagen, Fragen, Bitten, Anklagen, Hilferufen.
Ich wäre, auch wenn ich kräftig und um Jahrzehnte jünger wäre, diesem Ansturm nicht gewachsen. Ich habe zur Aufklärung und Mahnung für Leser, die dessen bedürfen, den »Brief nach Deutschland« drucken lassen, und für Trostbedürftige die Neujahrsansprache und den »Brief an Adele«, und muß ihnen nun dieses gedruckte Blatt folgen lassen, als Gruß für die, die mir in ihren Briefen so viel Vertrauen schenken, und als Auskunft auf die paar Fragen, die sich in den Briefen am häufigsten wiederholen:
Die geringen Möglichkeiten, deutschen Freunden materiell zu helfen, werden von mir so gut wie möglich ausgenützt. Ich kann und darf diese Möglichkeiten nicht vergeuden, indem ich all den hundert Bitten durch einen einmaligen Mitleidsakt, eine bloße Gebärde, antworte.
Unnütz ist es auch, mich als Vermittler zwischen Hilfesuchenden und den Schweizer Fürsorgestellen, wie Rotes Kreuz, Intellektuellenhilfe usw., anzurufen; ich gehöre keiner dieser Organisationen an, kenne die meisten gar nicht, und habe in keiner mitzureden.
Sehr häufig werde ich nach dem Schicksal meines Werkes gefragt. Nun, es war in Berlin verlegt, und was die Goebbels und Rosenberg davon übrig gelassen hatten, es war nicht mehr viel, ist samt dem ganzen Verlag durch Bomben vernichtet. Das Werk existiert seit einigen Jahren nicht mehr. Daß es wieder erstehen werde, irgend einmal, daran habe ich nie gezweifelt; aber materiell ist es vorläufig vernichtet, und bis heute konnte auch nicht das kleinste Büchlein durch eine Neuauflage ersetzt werden.
Inzwischen habe ich einige meiner frühern Bücher in Schweizer Lizenzausgaben erscheinen lassen, und auch einige neue. Diese Ausgaben haben nur kleine Auflagen und es besteht keine Möglichkeit, diese Bücher, sei es auch geschenkweise, nach Deutschland auszuführen. Es kommen jeden Tag Bitten um Bücher, und keine kann erfüllt werden. Dagegen habe ich von diesen Schweizer Ausgaben eine große Anzahl im ganzen manche hundert Bände, an deutsche Kriegsgefangene verschenkt, denn an sie ist die Ausfuhr erlaubt.
Ich bitte meine Freunde, für eine Weile mit diesem mageren Blatt vorlieb zu nehmen. Die Fragen nach meinen Gedanken über den Frieden in der Welt, über die nächste Zukunft Deutschlands, der Menschheit und der Kultur könnte ich ohnehin nicht beantworten, auch wenn ich junge Augen und Zeit genug hätte. Ich mache mir solche Gedanken gar nicht. Die Springflut von Jammer und Not, erst viele Jahre lang aus der Emigration und den von Deutschland vergewaltigten Ländern, jetzt aus Deutschland selbst, drückt mich an die Wand, will erlitten und irgendwie bestanden sein, fordert das Letzte an Kraft, und macht das Nachdenken über die Zukunft unmöglich und damit unnütz. Wenn wir uns heute, den heutigen Nöten und Forderungen gegenüber, einigermaßen menschlich und anständig halten, wird auch die Zukunft menschlich sein können. Mehr ist darüber nicht zu sagen. Die andre Frage: wie sich der Deutsche heute all der Kritik, der Verachtung, des Hasses erwehren solle, denen er nicht ohne gute Gründe ausgesetzt ist, habe ich schon einmal beantwortet: er soll zunächst einmal sich um sich selbst und seine Seele kümmern, in sich aufräumen, und sich nicht bei jeder Kritik an Deutschland persönlich mitgekränkt fühlen. Aber man hat diesen Rat nicht gerne gehört, und auch dies wird gute Gründe haben.
Meine Freunde bitte ich sehr, diese Mitteilung ja nicht als eine Aufforderung zu betrachten, mir nicht mehr zu schreiben. Im Gegenteil, diese ganze Briefflut wird mir gerade dadurch erträglich und erleichtert, daß auch immer wieder Grüße meiner alten Freunde und Leser dabei sind.
Geheimnisse
Hie und da fühlt der Dichter, und vermutlich auch mancher andre Mensch, das Bedürfnis, sich für eine Stunde von den Vereinfachungen, Systemen, Abstraktionen und andern Halb- oder Ganzlügen abzuwenden und die Welt so zu betrachten wie sie wirklich ist, also nicht als ein zwar kompliziertes, aber schließlich doch übersehbares und verstehbares System von Begriffen, sondern als den Urwald von schönen und schauerlichen, immer neuen, vollkommen unverstehbaren Geheimnissen, die sie ist. Wir sehen jeden Tag zum Beispiel das sogenannte Weltgeschehen in der Zeitung dargestellt, flach, übersehbar, auf zwei Dimensionen reduziert, von den Spannungen zwischen Ost und West bis zur Untersuchung des japanischen Kriegspotentials, von der Kurve des Index bis zur Versicherung eines Ministers, daß gerade die ungeheure Dynamik und Gefährlichkeit der neuesten Kriegswaffen dazu führen müsse, diese Waffen niederzulegen oder in Pflugscharen zu verwandeln, und obwohl wir wissen, daß dies alles keine Wirklichkeiten sind, sondern teils Lügen, teils fachmännische Jonglierspiele mit einer amüsanten, erfundenen, unverantwortlichen Surrealisten-Sprache, so macht uns dies täglich wiederholte Weltbild, auch wenn es sich von einem Tag zum andern noch so kraß widerspricht, doch jedesmal wieder ein gewisses Vergnügen oder gibt uns eine gewisse Beruhigung, denn für einen Augenblick scheint in der Tat die Welt flach, übersehbar und geheimnislos zu sein und sich jeder Erklärung, die den Wünschen des Abonnenten entgegenkommt, willig zu fügen. Und die Zeitung ist ja auch nur eines von tausend Beispielen, sie hat weder die Entwirklichung der Welt und die Abschaffung der Geheimnisse erfunden, noch ist sie deren einziger Praktikant und Nutznießer. Nein, so wie der Abonnent, wenn er die Zeitung überflogen hat, für einen Augenblick die Illusion genießt, er wisse nun in der Welt für vierundzwanzig Stunden Bescheid und es sei im Grunde nichts passiert, als was kluge Redakteure schon in der Donnerstagsnummer teilweise vorausgesagt hätten, ganz ebenso malt und lügt sich jeder von uns jeden Tag und jede Stunde den Urwald der Geheimnisse in einen hübschen Garten oder in eine flache, übersichtliche Landkarte um, der Moralist mit Hilfe seiner Maximen, der Religiöse mit Hilfe seines Glaubens, der Ingenieur mit Hilfe seiner Rechenschieber, der Maler mit Hilfe seiner Palette und der Dichter mit Hilfe seiner Vorbilder und Ideale, und jeder von uns lebt so lange leidlich zufrieden und beruhigt in seiner Scheinwelt und auf seiner Landkarte weiter, als er nicht durch irgendeinen Dammbruch oder irgendeine schreckliche Erleuchtung plötzlich die Wirklichkeit, das Ungeheure, schrecklich Schöne, schrecklich Grausige, auf sich einstürzen und sich von ihm ausweglos umarmt und tödlich gepackt fühlt. Dieser Zustand, diese Erleuchtung oder Erweckung, dieses Leben in der nackten Wirklichkeit dauert niemals lang, es trägt den Tod in sich, es dauert jedesmal, wenn ein Mensch von ihm ergriffen und in den furchtbaren Wirbel gestürzt wird, genau so lange, als ein Mensch es eben ertragen kann, und dann endet es entweder mit dem Tode oder mit der atemlosen Flucht ins Nichtwirkliche, ins Erträgliche, Geordnete, Übersehbare zurück. In dieser erträglichen, lauen, geordneten Zone der Begriffe, der Systeme, der Dogmatiken, der Allegorien leben wir neun Zehntel unsres Lebens. So lebt der kleine Mann zufrieden, ruhig und geordnet, wenn auch vielleicht viel schimpfend, in seinem Häuschen oder seiner Etage, über sich ein Dach, unter sich einen Boden, unter sich ferner ein Wissen von der Vergangenheit,von seiner Herkunft, seinen Ahnen, die beinahe alleso waren und lebten wie er selber, und über sich außerdem noch eine Ordnung, einen Staat, ein Gesetz, ein Recht, eine Wehrmacht – bis das alles plötzlich in einem Augenblick verschwunden und zerrissen ist, Dach und Fußboden zu Donner und Feuer geworden sind, Ordnung und Recht zu Untergang und Chaos, Ruhe und Behagen zu würgender Todesdrohung, bis die ganze so althergebrachte, so ehrwürdige und zuverlässige Scheinwelt in Flammen und Scherben zerborsten und nichts mehr da ist als das Ungeheure, die Wirklichkeit. Man kann es Gott nennen, das Ungeheure und Unverstehbare, das Schreckliche und durch seine Wirklichkeit so dringlich Überzeugende, aber es ist mit dem Namen auch nichts an Verständnis, an Erklärbarkeit und Ertragbarkeit gewonnen. Die Erkenntnis der Wirklichkeit, die immer nur eine momentane ist, kann durch den Bombenhagel eines Krieges bewirkt werden, durch jene Waffen also, die nach den Worten manches Ministers gerade durch ihre Furchtbarkeit uns einmal nötigen werden, sie in Pflugscharen zu verwandeln; für den Einzelnen genügt oft eine Krankheit, ein in seiner nächsten Nähe geschehenes Unglück, zuweilen aber auch schon eine momentane Lagerung seiner Lebensstimmung, ein Erwachen aus schwerem Alptraum, eine schlaflose Nacht, um ihn dem Unerbittlichen gegenüberzustellen und ihm für eine Weile alle Ordnung, alles Behagen, alle Sicherheit, allen Glauben, alles Wissen fragwürdig zu machen.
Genug davon, jeder kennt das, jeder weiß, wie es damit beschaffen ist, auch wenn er nur einmal oder nur wenige Male vom Erlebnis gestreift worden ist und es fertig gebracht zu haben meint, das Erlebnis glücklich zu vergessen. Das Erlebnis wird aber nie vergessen, und wenn das Bewußtsein es zudeckt, Philosophie oder Glaube es weglügt, das Gehirn sich seiner entledigt, so wird es im Blut, in der Leber, in der großen Zehe sich verbergen, und unfehlbar eines Tages sich wieder in seiner völligen Frische und Unvergeßbarkeit erweisen. Ich möchte im weiteren nicht über das Wirkliche, über den Urwald der Geheimnisse, über das Numinose und andre Namen des Erlebnisses philosophieren, dies ist der Beruf anderer Leute, denn es ist dem Menschengeist, dem klugen, nicht genug zu bewundernden auch dies gelungen: aus dem schlechthin Unverstehbaren, Einmaligen, Dämonischen, Unerträglichen eine Philosophie mit Systemen, Professoren und Autoren zu machen. Hier bin ich nicht zuständig und habe nicht einmal vermocht, die Spezialisten des Lebensrätsels wirklich zu lesen. Ich möchte nur, weil es so will, weil die Stunde mich dazu anhält, aus dem Alltag meines Berufs ohne Tendenz und Ordnung einiges über das Verhältnis des Dichters zu den Lebenslügen aufzeichnen, und auch über das Wetterleuchten des Geheimnisses durch die Wände dieser Lügen hindurch. Ich füge hinzu: der Dichter als solcher steht dem Weltgeheimnis um nichts näher als jeder andre Mensch, er kann sowenig wie andre leben und arbeiten, ohne einen Boden unter sich und ein Dach über sich zu haben, und um sein Bett ein dichtes Mückennetz von Systemen, Konventionen, Abstraktionen, Vereinfachungen und Verflachungen zu spannen. Auch er, genau wie die Zeitung, schafft sich aus dem donnernden Dunkel der Welt eine Ordnung und Landkarte, lebt lieber im Flachen als im Vieldimensionalen, hört lieber Musik als Bombenexplosionen, und wendet sich mit dem, was er schreibt, an seine Leser meistens durchaus mit der wohlgepflegten Illusion, es bestehe eine Norm, eine Sprache, ein System, das es ihm ermögliche, seine Gedanken und Erlebnisse so mitzuteilen, daß der Leser sie gewissermaßen miterleben und sich tatsächlich aneignen könne. Für gewöhnlich tut er wie alle tun, er treibt sein Metier so gut er kann, und hütet sich darüber nachzudenken, wieweit wohl der Boden trage, auf dem er steht, wieweit die Leser tatsächlich seine Gedanken und Erlebnisse aufnehmen, nachfühlen und teilen können, wieweit seinem Glauben, seinem Weltbild, seiner Moral, seiner Denkart die des Lesers ähnlich sei.
Neulich wurde ich von einem jungen Mann, der mir schrieb, als »alt und weise« angesprochen. »Ich habe Vertrauen zu Ihnen«, schrieb er, »denn ich weiß, daß Sie alt und weise sind.« Ich hatte gerade einen etwas helleren Moment und nahm den Brief, der übrigens hundert anderen von anderen Leuten sehr ähnlich war, nicht in Bausch und Bogen, sondern fischte erst da und dort einen Satz, ein paar Worte heraus, betrachtete sie möglichst genau und befragte sie um ihr Wesen. »Alt und weise«, stand da, und das konnte freilich einen müde und mürrisch gewordenen alten Mann zum Lachen reizen, der in seinem langen und reichen Leben der Weisheit sehr oft unendlich viel näher zu sein geglaubt hatte als jetzt in seinem reduzierten und wenig erfreulichen Zustand. Alt, ja, das war ich, das stimmte, alt und verbraucht, enttäuscht und müde. Und doch konnte ja auch das Wort »alt« ganz anderes ausdrücken! Wenn man von alten Sagen, alten Häusern und Städten, alten Bäumen, alten Gemeinschaften, alten Kulten sprach, so war mit dem »alt« durchaus nichts Entwertendes, Spöttisches oder Verächtliches gemeint. Also auch die Qualitäten des Alters konnte ich nur sehr teilweise für mich in Anspruch nehmen; ich war geneigt, von den vielen Bedeutungen des Wortes nur die negative Hälfte gelten zu lassen und auf mich anzuwenden. Nun, für den jungen Briefschreiber mochte das Wort »alt« meinetwegen auch einen malerischen, graubärtigen, milde lächelnden, einen teils rührenden, teils ehrwürdigen Wert und Sinn haben; wenigstens hatte es diesen Nebensinn für mich in den Zeiten, da ich selbst noch nicht alt war, stets gehabt. Also gut, man konnte das Wort gelten lassen, verstehen und als Anrede würdigen.
Nun aber das Wort »weise«! Ja, was sollte das eigentlich bedeuten? Wenn das, was es bedeuten sollte, ein Nichts war, etwas Allgemeines, Verschwommenes, ein gebräuchliches Epitheton, eine Phrase, nun dann konnte man es überhaupt weglassen. Und wenn es das nicht war, wenn es wirklich etwas bedeuten sollte, wie sollte ich hinter diese Bedeutung kommen? Ich erinnerte mich einer alten, von mir oft angewandten Methode, an die des freien Assoziierens. Ich ruhte mich ein wenig aus, spazierte ein paarmal durchs Zimmer, sagte mir noch einmal das Wort »weise« vor und wartete, was mir als erstes dazu einfallen werde. Siehe da, als Einfall meldete sich ein anderes Wort, das Wort Sokrates. Das war immerhin etwas, es war nicht bloß ein Wort, es war ein Name, und hinter dem Namen stand nicht eine Abstraktion, sondern eine Gestalt, ein Mensch. Was nun hatte der dünne Begriff Weisheit mit dem saftigen, sehr realen Namen Sokrates zu tun? Das war leicht festzustellen. Weisheit war diejenige Eigenschaft, welche von den Schul- und Hochschullehrern, von den vor überfülltem Saale vortragenden Prominenten, von den Autoren der Leitartikel und Feuilletons dem Sokrates unweigerlich als erste zugesprochen wurde, sobald sie auf ihn zu sprechen kamen. Der weise Sokrates. Die Weisheit des Sokrates - oder, wie der prominente Vortragende sagen würde: die Weisheit eines Sokrates. Mehr war über diese Weisheit nicht zu sagen. Wohl aber meldete sich, kaum hatte man die Phrase gehört, eine Realität, eine Wahrheit, nämlich der wirkliche Sokrates, eine trotz aller Legendendrapierung recht kräftige, recht überzeugende Gestalt. Und diese Gestalt, dieser athenische alte Mann mit dem guten häßlichen Gesicht hatte über seine eigene Weisheit ganz unmißverständliche Auskunft gegeben, er hatte sich kräftig und ausdrücklich dazu bekannt, daß er nichts, absolut nichts wisse, und auf das Prädikat Weisheit keinerlei Anspruch habe.
Da war ich nun wieder einmal vom graden Wege abgeirrt und in die Nähe der Wirklichkeiten und der Geheimnisse geraten. So war es: ließ man sich je einmal dazu verführen, es mit den Gedanken und den Worten richtig ernst zu nehmen, dann stand man gleich im Leeren, im Ungewissen, im Finstern. Wenn die Welt der Gelehrten, der Schönredner, der Vortragskünstler, der Katheder und Essays recht hatte, dann war er ein vollkommen Unwissender, ein Mann, der erstens nichts wußte und an kein Wissen und Wissen können glaubte, und der zweitens gerade aus dem Nichtwissen und dem Nichtglauben an das Wissen seine Stärke, sein Instrument zur Befragung der Wirklichkeit machte.
Da stand ich alter weiser Mann denn vor dem alten unweisen Sokrates und hatte mich zu wehren oder zu schämen. Zum Schämen war mehr als genug Ursache; denn ungeachtet aller Schliche und Spitzfindigkeiten wußte ich ja recht wohl, daß der Jüngling, der mich als Weisen ansprach, dies keineswegs nur aus eigener Torheit und jugendlicher Ahnungslosigkeit heraus tat, sondern daß ich ihm dazu Anlaß gegeben, ihn dazu verführt, dazu halb und halb ermächtigt hatte durch manche meiner dichterischen Worte, in denen etwas wie Erfahrung und Nachgedachthaben, etwas wie Lehre und Altersweisheit spürbar wird, und wenn ich auch, glaube ich, die meisten meiner dichterisch formulierten »Weisheiten« nachher wieder in Anführungszeichen gesetzt, angezweifelt, ja umgestoßen und widerrufen hatte, so hatte ich doch, alles in allem, in meinem ganzen Leben und Tun mehr bejaht als verneint, mehr zugestimmt oder doch geschwiegen als gekämpft, hatte oft genug den Traditionen des Geistes, des Glaubens, der Sprache, der Sitte Reverenz erwiesen. In meinen Schriften war zwar unleugbar da und dort ein Wetterleuchten zu spüren, ein Riß in den Wolken und Draperien der hergebrachten Altarbilder, ein Riß, hinter dem es bedrohlich apokalyptisch geisterte, es war da und dort angedeutet, daß des Menschen sicherster Besitz seine Armut, des Menschen eigentlichstes Brot sein Hunger sei; aber alles in allem hatte ich, gerade so wie alle andern Menschen auch, mich lieber den schönen Formwelten und Traditionen zugewandt, hatte die Gärten der Sonaten, Fugen, Symphonien allen apokalyptischen Feuerhimmeln und die zauberhaften Spiele und Tröstungen der Sprache allen Erlebnissen vorgezogen, in denen die Sprache aufhört und zu nichts wird, weil für einen schrecklich-schönen, vielleicht seligen, vielleicht tödlichen Augenblick das Unsagbare, Undenkbare, das nur als Geheimnis und Verwundung zu erlebende Innere der Welt uns anblickt. Wenn der briefschreibende Jüngling in mir nicht einen unwissenden Sokrates, sondern einen Weisen im Sinn der Professoren und der Feuilletons sah, so hatte ich ihm dazu im großen ganzen doch das Recht gegeben.
Immerhin blieb unerforechlich, was in der Vorstellung des Jünglings von Weisheit Klischee und was erlebt war. Vielleicht war sein alter Weiser lediglich eine Theaterfigur, vielmehr eine Attrappe, vielleicht aber war auch ihm jene Reihe von Assoziationen zum Wort »weise« wohlbekannt, die ich eben durchlaufen hatte. Vielleicht dachte auch er beim Wort »weise« zuerst mit Befremdung und Verlegenheit feststellen zu müssen, daß ja gerade Sokrates von Weisheit nichts an sich haben, von Weisheit nichts wissen wollte.
Die Untersuchung der Worte »alt und weise« hatte mir also wenig Nutzen gebracht. Ich ging nun, um doch irgendwie mit dem Brief fertig zu werden, den umgekehrten Weg und suchte nicht von irgendwelchen einzelnen Worten aus Aufklärung zu gewinnen, sondern vom Inhalt, vom Ganzen des Anliegens, das den jungen Mann zu seinem Brief veranlaßt hatte. Dies Anliegen war eine Frage, eine scheinbar sehr einfache, also scheinbar auch einfach zu beantwortende Frage. Sie lautete: »Hat das Leben einen Sinn, und wäre es nicht besser, sich eine Kugel in den Kopf zu schießen?« Auf den ersten Blick scheint diese Frage nicht sehr viele Antworten zuzulassen. Ich konnte antworten: Nein, Lieber, das Leben hat keinen Sinn, und es ist in der Tat besser usw. Oder ich konnte sagen: Das Leben, mein Lieber, hat freilich einen Sinn, und der Ausweg mit der Kugel kommt nicht in Frage. Oder aber: Zwar hat das Leben keinen Sinn, aber darum braucht man sich dennoch nicht totzuschießen. Oder aber: Das Leben hat zwar seinen guten Sinn, aber es ist so schwer, dem gerecht zu werden oder auch nur ihn zu erkennen, daß man doch wohl besser tut, sich eine Kugel usw.
Dies etwa, könnte man beim ersten Hinsehen meinen, wären die auf des Knaben Frage möglichen Antworten. Aber kaum probiere ich es weiter mit Möglichkeiten, so sehe ich bald, daß es nicht vier oder acht, sondern hundert und tausend Antworten gibt. Und doch, möchte man schwören, gibt es für diesen Brief und seinen Briefschreiber im Grunde nur eine einzige Antwort, nur eine einzige Tür ins Freie, nur eine einzige Erlösung aus der Hölle seiner Not.
Diese einzige Antwort zu finden, dazu hilft mir keine Weisheit und kein Alter. Die Frage des Briefes stellt mich ganz und gar ins Dunkle, denn jene Weisheiten, über die ich verfüge, und auch jene Weisheiten, über welche noch weit ältere und erfahrenere Seelsorger verfügen, sind zwar für Bücher und Predigten, für Vorträge und Aufsätze vortrefflich zu verwenden, nicht aber für diesen einzelnen, wirklichen Fall, nicht für diesen aufrichtigen Patienten, der zwar den Wert des Alters und der Weisheit sehr überschätzt, dem es aber bittrer Ernst ist und der mir alle Waffen, Schliche und Kniffe durch die einfachen Worte aus der Hand schlägt: »Ich habe zu Ihnen Vertrauen.«
Wie wird nun dieser Brief mit einer so kindlichen wie ernsten Frage seine Antwort finden?
Aus dem Brief ist mir etwas angeflogen, etwas entgegengeblitzt, was ich mehr mit den Nerven als dem Verstand, mehr mit dem Magen oder Sympathikus als mit der Erfahrung und Weisheit spüre und verarbeite: ein Hauch von Wirklichkeit, ein Blitz aus klaffendem Wolkenriß, ein Anruf von drüben, aus dem Jenseits von Konventionen und Beruhigungen, und es gibt keine Lösung als entweder Sichdrücken und Schweigen, oder aber Gehorsam und Annahme des Anrufs. Vielleicht habe ich noch die Wahl, vielleicht kann ich mir noch sagen: dem armen Knaben kann ich ja doch nicht helfen, ich weiß ja so wenig wie er, vielleicht kann ich den Brief zuunterst unter einen Stoß andrer Briefe legen und so lange halbbewußt für sein Untenbleiben und allmähliches Verschwinden sorgen, bis er vergessen ist. Aber indem ich das denke, weiß ich auch schon: ich werde ihn erst dann vergessen können, wenn er tatsächlich beantwortet, und zwar richtig beantwortet ist. Daß ich das weiß, daß ich davon überzeugt bin, kommt nicht aus Erfahrung und Weisheit, es kommt von der Kraft des Anrufs, von der Begegnung mit der Wirklichkeit. Es kommt also die Kraft, aus der ich meine Antwort schöpfen werde, schon nicht mehr aus mir, aus der Erfahrung, aus der Klugheit, aus der Übung, aus der Humanität, sondern aus der Wirklichkeit selbst, aus dem winzigen Splitterchen Wirklichkeit, das jener Brief mir zugetragen hat. Die Kraft also, die diesen Brief beantworten wird, liegt im Briefe selbst, er selbst wird sich beantworten, der Jüngling selbst wird sich Antwort geben. Wenn er aus mir, dem Stein, dem Alten und Weisen, einen Funken schlägt, so ist es sein Hammer, sein Schlagen, seine Not, seine Kraft allein, die den Funken weckt.
Ich darf nicht verschweigen, daß ich diesen Brief mit dieser selben Frage schon sehr viele Male bekommen, gelesen und beantwortet oder nicht beantwortet habe. Nur ist die Kraft der Not nicht immer die gleiche, es sind nicht nur die starken und reinen Seelen, die zu irgendeiner Stunde solche Fragen stellen, es kommen auch die reichen Jünglinge mit ihren halben Leiden und ihrer halben Hingabe. Mancher schon hat mir geschrieben, ich sei es, in dessen Hand er die Entscheidung lege; ein Ja von mir, und er werde genesen, und ein Nein, so werde er sterben … und so kräftig das klang, spürte ich doch den Appell an meine Eitelkeit, an meine eigene Schwäche, und kam zum Urteil: dieser Briefschreiber wird weder an meinem Ja genesen noch an meinem Nein sterben, sondern weiter seine Problematik kultivieren und seine Frage vielleicht noch an manche andere sogenannte Alte und Weise richten, sich an den Antworten ein wenig trösten und ein wenig belustigen, und eine Sammlung von ihnen in einer Mappe anlegen.
Wenn ich diesem heutigen Briefschreiber solches nicht zutraue, wenn ich ihn ernst nehme, sein Vertrauen erwidere und den Wunsch habe ihm zu helfen, so geschieht dies alles nicht durch mich, sondern durch ihn, es ist seine Kraft, die mir die Hand führt, seine Wirklichkeit, die meine konventionelle Altersweisheit durchbricht, seine Reinheit, die auch mich zur Lauterkeit zwingt, nicht irgendeiner Tugend, einer Nächstenliebe, einer Humanität wegen, sondern dem Leben und der Wirklichkeit zuliebe, so wie man, wenn man ausgeatmet hat, trotz allen Vorsätzen oder Weltanschauungen nach einer kleinen Weile notwendig wieder einatmen muß. Wir tun es nicht, es geschieht mit uns.
Und wenn ich mich nun, von der Not gepackt, vom Wetterleuchten des wahren Lebens angestrahlt, von der schwer erträglichen Dünne seiner Luft zu raschem Tun zwingen lasse, wenn ich den Brief nochmals zu mir sprechen oder schreien lasse, dann habe ich diesem Brief keine Gedanken und Zweifel mehr entgegenzusetzen, ihn keiner Untersuchung und Diagnose mehr zu unterziehen, sondern ich habe seinem Ruf zu folgen und habe nicht meinen Rat und mein Wissen herzugeben, sondern das einzige, was helfen kann, nämlich die Antwort, die der Jüngling haben will, und die er nur aus einem andern Munde zu hören braucht, um zu spüren, daß es seine eigene Antwort, seine eigene Notwendigkeit ist, die er da beschworen hat.
Es braucht viel, daß ein Brief, eine Frage eines Unbekannten den Empfänger wirklich erreicht, denn der Briefschreiber kann sich ja, trotz aller echten und dringenden Not, auch nur in konventionellen Zeichen ausdrücken. Er fragt: »Hat das Leben einen Sinn?«, und das klingt vag und töricht wie ein Knabenweltschmerz. Aber er meint ja nicht »das« Leben, es ist ihm ja nicht um Philosophien, Dogmatiken oder Menschenrechte zu tun, sondern er meint einzig und allein sein Leben, und er will von meiner angeblichen Weisheit keineswegs einen Lehrsatz hören oder eine Anweisung in der Kunst, dem Leben einen Sinn zu geben; nein, er will, daß seine wirkliche Not von einem wirklichen Menschen gesehen, einen Augenblick geteilt, und dadurch für diesmal überwunden werde. Und wenn ich ihm diese Hilfe gewähre, so bin nicht ich es, der geholfen hat, sondern es ist die Wirklichkeit seiner Not, die mich Alten und Weisen für eine Stunde des Alters und der Weisheit entkleidet und mit einer glühend eisigen Welle von Wirklichkeit übergössen hat.
Genug von diesem Brief. Was den Dichter nach dem Lesen von Briefen seiner Leser oft beschäftigt, sind Fragen wie diese: Was habe ich beim Schreiben meiner Bücher, abgesehen vom bloßen Vergnügen am Schreiben selbst, eigentlich gedacht, gewollt, gemeint, erstrebt? Und dann Fragen wie diese: Wieviel von dem, was du mit deiner Arbeit gemeint und angestrebt hast, wird von den Lesern gebilligt oder abgelehnt, ja: wieviel davon wird vom Leser überhaupt bemerkt und zur Kenntnis genommen? Und die Frage: Hat das, was ein Dichter mit seinen Dichtungen meint und will, hat sein Wollen, seine Ethik, seine Selbstkritik, seine Moral überhaupt irgend etwas zu tun mit den Wirkungen, die seine Bücher verursachen? Nach meiner Erfahrung hat es damit sehr wenig zu tun. Auch nicht einmal jene Frage, die dem Dichter meistens die wichtigste ist, die Frage nach dem ästhetischen Wert seiner Arbeit, nach ihrem Gehalt an objektiver Schönheit, spielt in der Realität eine große Rolle. Es kann ein Buch ästhetisch und dichterisch wertlos sein und trotzdem ganz gewaltige Wirkungen tun. Scheinbar sind viele dieser Wirkungen vernünftig und berechenbar, waren vorauszusehen und wahrscheinlich. In Wahrheit aber ist auch hier das Geschehen in der Welt vollkommen irrational und gesetzlos.
Um noch einmal auf das für die Jugend so anziehende Thema des Selbstmordes zu kommen: Mehrmals habe ich Briefe von Lesern bekommen mit dem Bericht, sie seien gerade im Begriff gewesen, sich das Leben zu nehmen, da sei ihnen dies Buch in die Hände gefallen, habe sie befreit und aufgeklärt, und es gehe nun wieder aufwärts. Über das gleiche Buch aber, das so heilend wirken konnte, schrieb mir mit schwerer Anklage der Vater eines Selbstmörders: mein dreimal verfluchtes Buch habe zu denen gehört, die sein armer Sohn in seiner letzten Zeit noch auf dem Nachttisch habe liegen gehabt, und es allein sei verantwortlich zu machen für das Geschehene. Ich konnte zwar diesem empörten Vater erwidern, daß er sich die Verantwortlichkeit für seinen Sohn doch allzu leicht mache, wenn er sie auf ein Buch abschiebe, aber es dauerte doch eine gute Weile, bis ich jenen Vaterbrief »vergessen« konnte, und man sieht ja, was für ein Vergessen es war.
Über ein andres meiner Bücher schrieb mir in der Zeit, als Deutschland beinah den Höhepunkt seiner nationalen Fieberkurve erreicht hatte, eine Frau aus Berlin: ein solches Schandbuch wie das meine müsse verbrannt werden, sie werde dafür sorgen, und jede deutsche Mutter werde ihre Söhne vor diesem Buch zu behüten wissen. Die Frau hat, falls sie wirklich Söhne hatte, diese ohne Zweifel davor bewahrt, mein Schandbuch kennenzulernen, aber vor dem Verwüsten der halben Welt, vor dem Waten im Blut von waffenlosen Opfern und all dem andern hat sie sie nicht bewahrt. Merkwürdig aber war, daß beinah zur gleichen Zeit eine andre deutsche Frau mir über dasselbe Buch schrieb: wenn sie Söhne hätte, würde sie ihnen dieses Buch zu lesen geben, damit sie das Leben und die Liebe mit den Augen dieses Buches anzusehen lernen möchten. Ich aber hatte beim Schreiben meines Buches weder junge Leute verderben noch jungen Leuten Unterricht im Erleben geben wollen, an beides hatte ich auch nicht einen Augenblick gedacht.
Etwas ganz andres, woran vermutlich überhaupt kein Leser jemals denkt, kann dem Dichter zur Sorge und Plage werden, nämlich die Frage: Warum muß ich, allein meinen scheinbar ganz ursprünglichen Empfindungen zum Trotz, meine Gebilde, meine lieben Freuden- und Sorgenkinder, die Gespinste aus der besten Substanz meines Lebens, vor fremde Augen legen und zusehen, wie sie auf den Markt kommen, überschätzt und unterschätzt, belobt und bespien, geachtet oder mißbraucht werden? Warum kann ich sie nicht zurückbehalten, sie höchstens einem Freunde zeigen, ihre Veröffentlichung gar nicht oder erst nach meinem Tode zulassen? Ist es Ruhmsucht, Eitelkeit, Angriffslust oder unbewußte Lust am Angegriffenwerden, was mich dazu brachte, sie immer wieder, meine lieben Kinder, in die Welt hinaus zu schicken und all dem Mißverständnis, all dem Zufall, all der Roheit preiszugeben?
Das ist eine Frage, von der kein Künstler jemals ganz loskommt. Denn die Welt bezahlt uns jazwar für unsre Gespinste, manchmal sogar über Gebühr, aber sie bezahlt uns ja nicht mit Leben, mit Seele, mit Glück, mit Substanz, sondern eben mit dem, was sie zu geben hat, mit Geld, mit Ehren, mit Aufnahme in die Liste der Prominenten. Ja, es sind die unwahrscheinlichsten Antworten der Welt auf die Arbeit des Künstlers möglich. Etwa diese: Ein Künstler arbeitet für ein Volk, das sein natürliches Wirkungsfeld und sein natürlicher Markt ist, das Volk aber läßt das ihm anvertraute Werk verkommen, es versagt dem Künstler Anerkennung sowohl wie Brot. Plötzlich nun erinnert ein ganz anderes, fremdes Volk sich dessen und gibt dem Enttäuschten das, was er mehr oder weniger verdient hat: Anerkennung und Brot. Im selben Augenblick jubelt das Volk, dem jene Arbeit zugedacht und angeboten war, dem Künstler heftig zu und freut sich darüber, daß ein aus ihm Hervorgegangener so ausgezeichnet wird. Und das ist noch lange nicht das Wunderlichste, was zwischen Künstler und Volk geschehen kann.
Es nützt nicht viel, um Unabänderliches zu trauern und eine verlorene Unschuld zu beklagen, aber man tut es doch, wenigstens der Dichter tut es zuweilen. Und so hat auch für mich der Gedanke, ich könnte durch Zauber alle meine Dichtereien wieder zu meinem Privateigentum machen und mich ihrer als ein unbekannter Herr namens Rumpelstilzchen freuen, einen großen Reiz. Irgend etwas im Verhältnis zwischen Künstler und Welt ist nicht in Ordnung, sogar die Welt fühlt das zuweilen, wie sollte es der Künstler nicht sehr viel empfindlicher spüren. Etwas von der Enttäuschung, mit der der Künstler, auch wenn es alle Erfolge hat, bedauert, sein Werk an die Welt hingegeben zu haben, etwas von dem Jammer darüber, daß er etwas Geheimes, Geliebtes und Unschuldiges hergegeben, verkauft und preisgegeben hat, klang mir schon in jungen Jahren aus mancher von mir geliebten Dichtung entgegen, und am meisten aus einem kleinen Grimmschen Märchen, einem von den Unkenmärchen. Ich habe es niemals ohne einen Schauer und leisen Seelenschmerz wieder lesen können. Da man eine solche magische Dichtung nicht nacherzählen darf, setze ich das Märchen im Wortlaut an den Schluß meiner Aufzeichnung.
Ein Waisenkind saß an der Stadtmauer und spann; da sah es eine Unke aus einer Öffnung unten an der Mauer hervorkommen. Geschwind breitete es sein blauseidenes Halstuch neben sich aus, das die Unken gewaltig lieben und auf das sie allein gehen. Alsbald die Unke das erblickte, kehrte sie um, kam wieder und brachte ein kleines goldenes Krönchen getragen, legte es darauf und ging dann wieder fort. Das Mädchen nahm die Krone auf, sie glitzerte und war von zartem Goldgespinst. Nicht lange, so kam die Unke zum zweitenmal wieder: wie sie aber die Krone nicht mehr sah, kroch sie an die Wand und schlug vor Leid ihr Köpfchen so lange dawider, als sie nur noch Kräfte hatte, bis sie endlich tot dalag. Hätte das Mädchen die Krone liegen lassen, die Unke hätte wohl noch mehr von ihren Schätzen aus der Höhle herbeigetragen.
(1947)
Antwort auf Bittbriefe
Die Bittbriefe kommen zu so vielen Hunderten zu mir, daß ich, ohnehin nicht mehr sehr arbeitsfähig und beständig schwer überbürdet, mich zur Beantwortung dieser gedruckten Zeilen bedienen muß.
Gar nicht berücksichtigt werden können die zahllosen Bitten von Unbekannten um Eßwaren und ähnliche Gaben. Ich habe alle Mühe, die in dieser Hinsicht schon übernommenen Verpflichtungen dauernd zu erfüllen, indem ich seit zwei Jahren eine Anzahl mir teurer Menschen in Deutschland durch regelmäßige Sendungen unterstütze. Es müssen, um diese Unterstützungen aufrechtzuerhalten, jeden Monat einige hundert Franken aufgewendet werden, und eine Erweiterung dieses Kreises ist mir unmöglich.
Von allen diesen vielen Bittstellern denkt keiner daran, daß ich als Verfasser von Büchern in deutscher Sprache an dem großen Bankrott Deutschlands voll beteiligt bin. Ich habe mein gesamtes Lebenswerk Deutschland anvertraut, und ich bin darum gebracht worden. Seit vielen Jahren habe ich von meinen Verlegern keinen Pfennig mehr erhalten, noch habe ich Aussicht, daß sich dies ändere, solange ich noch lebe.
In der Zeit des deutschen Größenwahns wurden meine Bücher teils verboten, teils auf andre Weise unterdrückt. Was davon noch übrig geblieben war, ist samt allen Vorräten, den stehenden Schriftsätzen usw. zusammen mit dem Verlag Fischer-Suhrkamp restlos durch Bomben vernichtet worden.
In den letzten Jahren nun habe ich zwar eine Reihe meiner Bücher in Schweizer Neuausgaben herausgebracht. Aber die kleine Schweiz ist ein winziges Absatzgebiet, es sind hier nur ganz kleine Auflagen möglich, und diese Bücher können weder nach Deutschland noch nach Österreich exportiert werden.
In Berlin gibt mein treuer Verleger P. Suhrkamp sich alle Mühe, wieder einige meiner Bücher herauszubringen. So viel nur möglich, bin ich ihm dabei behilflich, diese Bücher wirklich ernsthaften Lesern zuzuführen, da sie sonst zum Spekulationsobjekt von Aufkäufern würden.
Außer den Bitten um Lebensmittel und um Bücher kommen auch viele Bitten an mich, die auf völliger Unkenntnis der wirklichen Lage beruhen: Bitten um Besorgung einer Einreiseerlaubnis in die Schweiz samt Arbeitserlaubnis, ja um sofortige Einbürgerung, um Arbeit, um Stellen und Ämter. Es ist schmerzlich, alle diese oft phantastischen Bitten zu lesen, von denen keine erfüllbar ist.
Meine Freunde wissen, daß ich das mir Mögliche tue und seit Kriegsende den weitaus größten Teil meiner Arbeit und meiner Mittel der deutschen Not gewidmet habe. Sie wissen auch, daß die winzig kleine Schweiz beständig dem großen hungernden Deutschland in erstaunlichem Umfang hilft und schenkt, obwohl noch andre uns befreundete Länder in nicht besserer Lage sind und obwohl aus begreiflichen Gründen noch immer sehr viele Schweizer Deutschland keineswegs wohlgesinnt sind. Daß auf jeden Fall, in dem wir helfen können, Hunderte von unerfüllten Bitten kommen, ist traurig. Wir können es nicht ändern.
(1947)
An einen jungen Kollegen in Japan
Lieber Kollege! Ihr langer Brief vom Januar, der mich zur Zeit der Kirschblüte erreicht hat, war in der Tat nach Jahren des Schweigens der erste Gruß aus Ihrem Lande, der den Weg zu mir gefunden hat. Und aus manchen Zeichen kann ich sehen, daß wirklich, wie Sie sagen, Ihr Gruß und Zuruf aus einer hef