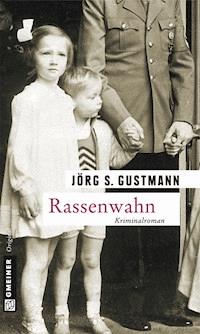Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 110th
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mysteriöse Briefe von einem Unbekannten landen auf geheimnisvolle Weise auf dem alten Dachboden bei der zwölfjährigen Anna. Sie sind immer nur unterzeichnet mit G. Das neugierige Mädchen lässt sich auf das Geheimnis dieser Briefe ein und beginnt die Welt mit neuen Augen zu sehen. Doch leider scheint sie die Einzige zu sein, die nicht an ihrer Echtheit zweifelt. Alle Menschen, die ihr wichtig sind, glauben, dass diese Botschaften ihrer Fantasie entspringen, bis eines Tages ein Wunder geschieht … "Gott als humorvoller Briefeschreiber: Er tröstet nicht nur das Mädchen in der Geschichte, sondern auch uns, den Leser." TITUS MÜLLER - Schriftsteller "In allen Kapiteln schimmert ein positives Gottesbild hindurch, ohne aufdringlich zu wirken. Ein sehr empfehlenswertes Buch." ALBRECHT GRALLE - Schriftsteller und Theologe
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Briefe von Herrn G.
ROMAN
von
Jörg S. Gustmann
Impressum:
Cover: Karsten Sturm, Chichili Agency
Foto: fotolia.de
Redaktion: Monika Elisa Schurr
© 110th / Chichili Agency 2014
EPUB ISBN 978-3-95865-197-5
MOBI ISBN 978-3-95865-198-2
Urheberrechtshinweis:
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur „Chichili Agency“ reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Prolog
Es gibt Zeiten, in denen ich nicht daran denke, was damals geschehen ist. Ich lebe dann mein Leben, bewältige meinen Alltag und verrichte alle Tätigkeiten so, als wäre ich ein ganz normaler Mensch, wie alle anderen auch. Dann wiederum erlebe ich Zeiten, so wie heute, in denen es mir nicht aus dem Sinn will und ich von tiefer Dankbarkeit und Freude erfüllt werde, wo ich mich gedrängt fühle, es aufzuschreiben, es in die Welt hinauszuschreien, unabhängig davon, ob man mir glaubt oder nicht. Ich muss gestehen, es fällt mir schwer, den genauen Augenblick zu benennen, in dem alles anfing, den Moment, der mein Leben verändern sollte. Oft ist es ja so, dass einem der genaue Zeitpunkt nicht mehr bewusst ist, an dem das Schicksal den eigenen Weg gekreuzt hat.
Vom Ticken meines Weckers abgesehen ist es still im Haus. Ich höre nur das gleichmäßige Atmen des Mannes an meiner Seite, mit dem ich seit sieben Jahren verheiratet bin und mit dem ich zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren aufwachsen sehen darf. Ja, ich kann sagen, wir sind glücklich und was mich betrifft, habe ich dieses Glück vor allem jenen mysteriösen Begebenheiten von damals zu verdanken.
Im Inneren hämmert mir das Herz so heftig wie ein afrikanischer Trommler, der sein Dorf wecken will.
Auch für mich ist wohl die Nacht zu Ende. Wenn ich jetzt mein warmes kuscheliges Bett verlasse, die Treppe nach unten schleiche und mich in meinem Arbeitszimmer an den Schreibtisch setze, weiß ich genau, dass der morgige Tag von Kopfschmerzen und Müdigkeit begleitet sein wird; zu ändern allerdings ist es nicht. Irgendwann schließlich muss ich anfangen, all das Geschehene niederzuschreiben. Warum nicht mitten in der Nacht um viertel nach zwölf, wenn man hellwach ist und weiß, dass an Schlaf einmal mehr nicht zu denken ist?
Im trüben Licht meiner Schreibtischlampe erkenne ich meine Schrift von damals kaum wieder. Stets habe ich mir Mühe gegeben, die Tagebucheinträge leserlich zu verfassen. Ohne diese Einträge wäre es nicht leicht für mich, mir das Geschehene der Reihenfolge nach in den Sinn zurück zu rufen. Manche Erinnerungen sind so nebulös wie der Dunstschleier, der am frühen Morgen in unserer Talsenke verharrt. Doch der Nebel lichtet sich, sobald die wärmende Sonne scheint und den Blick auf Verborgenes, Ruhendes freigibt.
Kapitel 1 - Die Hiobsbotschaft
Erwachsene stellen häufig Fragen. Ziemlich wichtige Fragen, die alle mit W anfangen. Warum, woher, wozu, wieso, wohin? Kinder tun dies auch – gelegentlich. Doch was passiert, wenn die Antworten kommen, lange bevor man sie gestellt hat, bevor man sie überhaupt in den gewundenen Winkeln der inneren Räume erdacht hat? Was ist, wenn sie wie ungebetene Gäste einfach auftauchen, an deine Tür klopfen und sagen: „Hallo, ich bin´s. Ich komme ein bisschen früh, ich weiß, doch besser früh als gar nicht“?
Mein Name ist Anna Lena Bachmann, doch zu der Zeit, in der sich alles zugetragen hat, hieß ich noch Anna Lena Fröhlich. Das Schmunzeln auf Ihrem Gesicht ist leicht zu erahnen: Wenn man Fröhlich heißt, sollte man möglichst auch fröhlich sein. Ich hingegen war damals, vor beinahe zwanzig Jahren, alles andere als fröhlich. Ich war nicht nur traurig, sondern verzweifelt, nicht nur wütend, sondern regelrecht erbost. Wo soll ein elfjähriges Mädchen hin mit all seiner Wut, den vielen Fragen im Kopf? Mit Fragen, die mehr einer Anklage gleichen als einem ehrlich gemeinten Versuch, zu verstehen?
Um der Geschichte einen Anfang zu setzen, wähle ich einen Zeitpunkt aus, an dem für mich die Welt noch in Ordnung gewesen ist: Ich war, wie gesagt, elf Jahre alt, wenigstens noch ein paar Tage lang, und ein lebenslustiges Mädchen mit braunen oder eher rötlichen schulterlangen Locken und fürchterlich vielen Sommersprossen auf käseweißer Haut. Ich sah aus, als wäre jemand in dem Moment, als ich vorüberkam, mit beiden Füßen in eine dreckige Pfütze gesprungen und hätte mein ganzes Gesicht mit Hunderten feiner Tröpfchen daraus besprenkelt. Sonst aber war ich wie alle anderen aus meiner Klasse: frech und vorlaut, hatte viele Freundinnen, tanzte und sang gern zur Musik meiner Lieblingsband und machte mir keinerlei Gedanken darüber, ob es einmal einen Tag geben mochte, an dem die Unbeschwertheit aus meinem Leben verschwinden würde.
Die Hausaufgaben waren erledigt, der Schulranzen für Montag gepackt, der Müll rausgetragen und die alten Jeans für Omas Garten angezogen. Wie fast jeden Nachmittag wollte ich zu meiner Großmutter. Natürlich hatte ich viele Freundinnen, mit denen ich spielte, doch war mir das große Glück beschieden, in meiner Großmutter nicht nur eine Oma im klassischen, verstaubten Sinn, sondern - so ungewöhnlich, wie es klingen mag -, meine beste Freundin gefunden zu haben. Sie wohnte schräg gegenüber in unserer Straße, die man überqueren konnte, ohne nach links oder rechts zu schauen, Die wenigen Autos, die sich hierher verirrten, hörte man schon von weitem oder man erspähte sie im Augenwinkel. Oma wohnte in einem uralten rötlichen Backsteinhaus, an dessen Regenrinnen der Efeu bis zum Dach emporwucherte. Dazu hatte sie wilden Wein gepflanzt und nun schien es, als wolle das Gestrüpp eines Tages das Haus ganz verschlingen. Hinterm Haus gab es einen riesigen Garten, zumindest mir kam er damals riesig vor, mit alten Bäumen, die im Mondlicht gespenstische Schatten auf die Wiese warfen.
Nachdem ich mit Purzel, dem Langhaardackel meiner Oma, im Gebüsch gespielt und wir die Hasen bis an den Eingang ihres Baus verfolgt hatten, sah ich entsprechend lehmig aus und roch auch so. Dennoch durfte ich, nachdem ich den gröbsten Dreck von meinem Po abgeklopft hatte, neben Oma auf der Hollywoodschaukel sitzen, wo ich an meinem Eis schleckte. Sie hatte mir drei Kugeln vom Italiener mitgebracht und nach jeder Kugel sollte ich ihr die Zunge herausstrecken. Jedes Mal lachte sie aufs Neue so herzhaft und erfrischend, als würde sie es das erste Mal erleben. Wir schaukelten zusammen und waren fröhlich. Alles an Oma konnte wunderbar herzlich lachen: die klatschenden Hände, die Augen und die Lippen sowieso. Doch auch ihre Nase, die sich in kleine Falten zusammenkräuselte und die Ohren, die feuerrot leuchteten, vermochten laut vernehmlich zu kichern. Und dies wegen gar nichts Besonderem; das ganze mimische Spektakel galt allein meiner Zunge! Erst nämlich hatte sie sich von der Sorte Gummibärchen türkisblau verfärbt, dann nahm meine Zunge die Farbe violettrot von der Brombeere an und schließlich wurde sie wieder sauber von der weißen sauren Zitronenkugel.
Rechts saß Oma mit ihrer neuen, ziemlich schrillen violetten Tönung in den sonst grauen Locken, links von ihr Purzel und in der Mitte ich. Wir sahen den Schmetterlingen beim Tanzen und hörten den Vögeln bei ihrem Gesang zu. Das sogenannte Schicksal hätte sich keinen schöneren Tag aussuchen können, um in mein Leben einzubrechen.
Ich kuschelte mich in Omas Arm und wippte mit meinen Beinen vor und zurück, um die Schaukel in Bewegung zu halten. In meinem Nacken spürte ich das Kraulen der knochigen Finger meiner Oma und ihre Liebe in meinem Herzen. Es war der siebzehnte August, zwei Tage vor meinem zwölften Geburtstag. Es war warm, es war schön und es war für eine ganze Weile das letzte Mal, dass ich meine Kindheit so ungetrübt genossen habe.
Gerade hatte ich die Waffeltüte knackend und knirschend zwischen meinen letzten lockeren Milchzähnen zermahlen, als mein Vater das verwitterte Gartentürchen öffnete und mit hängenden Schultern und betrübter Miene auf uns zukam. Seine Gesichtszüge konnte ich zunächst nur mit Mühe ausmachen, denn die Sonne stand direkt über seinem Kopf und schien mir ins Gesicht. Ich blinzelte und schirmte sie wie ein Indianer mit der rechten Hand ab. Sein hellblondes Haar wirkte eher wie mein zerzauster Flokatiteppich und von seinen Augenwinkeln zogen tiefe Falten bis zu den Ohren hin. Seine geduckte Erscheinung ließ erahnen, welch schwere Last auf ihm ruhte. Er wusste, dass seine Nachricht, die eigentlich eine gute Nachricht war, für Oma und mich eine Katastrophe bedeuten würde. Langsam zog er sich den klapprigen gelben Stuhl mit der abgeblätterten Farbe heran und setzte sich zu uns. Er versuchte zu lächeln, doch seine Mundwinkel bewegten sich nur widerwillig.
Oma sagte nichts, nur ihr Griff um meine Schultern wurde fester, als wolle sie mich nie mehr loslassen.
„Was ist denn, Papa?“, fragte ich. Gespannt und doch arglos grinste ich ihn an, während ich meine klebrigen Finger einen nach dem anderen ablutschte und der Hollywoodschaukel einen neuen Schubs gab. Eine Weile sagte er nichts, sah nur hilfesuchend zu Oma und knetete seine Finger. Dann fasste er sich ein Herz und klatschte in die Hände. „Nun ja“, begann er. „Es ist eigentlich sehr gut gelaufen, mein ... Bewerbungsgespräch.“ Seine Stimme stockte zunächst, doch dann nickte er ermunternd. „Also“, fuhr er fort, klatschte wieder in die Hände und versuchte erneut zu lächeln, „ich habe wieder einen festen Job. Nach einem Jahr Arbeitslosigkeit habe ich endlich was gefunden.“
Ich lehnte mich vor und wand mich aus Omas Arm. „Das ist doch super, Papa. Dann freu dich doch! Das wolltest du doch immer!“ Mein Vater nickte, aber er freute sich nicht. Für sich wahrscheinlich schon, tief im Innern, aber nicht für mich und nicht für Oma. Als er nicht mit der Sprache herausrücken wollte, hakte ich nach. „Gefällt dir die Arbeit denn nicht, die du machen sollst? Wo ist denn das Problem?“
Mein Vater holte tief Luft. „Nun, es ist so ... Wir müssen, ... also ich meine, die Arbeit ist ...“
Mein Rücken versteifte sich und eine jähe Ahnung von dem durchzuckte mich, was er mir so mühsam mitzuteilen versuchte. Der nächste Satz sollte meine schlimmsten Befürchtungen bestätigen.
„Wir müssen nach Hamburg umziehen, Kind. Ich kann nicht jeden Morgen zwei Stunden hin und abends zwei Stunden wieder zurückfahren. Ich bin Ingenieur, Anna, nicht Lagerarbeiter wie in meinem vorletzten Job - oder wie bis vor drei Monaten noch Packer in einem Versandartikelgeschäft. Nichts gegen solche Tätigkeiten, aber jetzt kann wieder in meinem alten, in meinem richtigen Beruf arbeiten. Und es wird obendrein sehr gut bezahlt.“ Er überlegte kurz. „Wir haben schon ein kleines Haus gemietet.“
Dann brach er seine wie Entschuldigungen klingenden Erklärungen ab. Er schaute mich an, sah dann zu seiner Mutter hinüber, dann wieder zu mir und nahm mich schließlich in den Arm.
Konnte es sein, dass ein elfjähriges Mädchen im Bruchteil eines einzigen Herzschlags erfasste, was das Wort Umziehen bedeutete? Ja, das konnte es! Mir wurde schlagartig klar, dass ich die Schule würde wechseln müssen, dass wir weg von unserem heimeligen Dorf in die Großstadt ziehen würden, dass ich dort niemanden kennen würde und vor allem ... dass ich meine Großmutter nicht mehr jeden Tag sehen würde. Vielleicht nur noch einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr - oder gar nicht mehr? Ich wusste nicht, was ich zuerst tun sollte. Meine Augen füllten sich mit Tränen; sie sammelten sich wie in einem kleinen See am Rand des unteren Lides und schwappten dann mit Macht über, klatschten auf das geblümte Polster der Hollywoodschaukel und versickerten dort so schnell, als hätten sie keinerlei Bedeutung. Die Vögel hörten nicht auf zu zwitschern, auch die Bienen verlangsamten nicht ihren Flug.
Wegrennen! Ich wollte wegrennen. Doch wohin? Ich heulte und schluchzte und trommelte mit meinen Fäusten auf die Brust meines Vaters. Er ließ mich gewähren, nahm mich fest in den Arm und strich mir über das wuschelige Haar, so wie immer, wenn man mich beruhigen musste. Ich entspannte mich, doch nur für kurze Zeit. Dann brach sich erneut ein salziger Sturzbach Bahn.
Oma hatte die ganze Zeit nichts gesagt. Was hätte sie auch sagen können? Es hätte doch nichts genützt. Es schien, als hätte sie schon von allem gewusst, als hätte sie mich beim Schaukeln an diesem Nachmittag ein letztes Mal in den Arm nehmen, ein letztes Mal meine violette Zunge sehen und darüber herzlich lachen wollen.
Dann ging alles sehr schnell, denn ich war mit dieser Hiobsbotschaft bis zum letzten Moment verschont worden. Früh am übernächsten Morgen standen vier muskulöse Männer in blauen Latzhosen vor der Tür. Es waren die Möbelpacker, die meinen Eltern beim Herumrücken und Verladen der Möbel helfen sollten. Der ganze Umzug wurde von Papas neuer Firma bezahlt. In mein Zimmer ließ ich sie jedoch nicht herein und hätte dies selbst dann nicht getan, wenn die Firma eine Million dafür gezahlt hätte. Ich hatte mich hinter meiner Zimmertür verschanzt, auch wenn ich genau wusste, dass alles Murren und Klagen nichts am Unausweichlichen ändern würde. Am Mittag waren sie schon fast fertig und hatten alle Möbel und Kartons in zwei großen Möbelwagen verstaut. Dann klopfte es an der Tür und Mama rief mich zärtlich heraus. Widerwillig drehte ich den Schlüssel im Schloss herum und öffnete ihr.
„Lass doch die Männer ihre Arbeit tun, Anna“, sagte sie und es lag fast ein Flehen in ihrer Stimme. „Du kannst dich solange auf die Treppenstufen setzen und ein Stück Kuchen essen.“
Ich folgte ihrer Bitte, ahnte ich doch, wie Kinder so etwas eben ahnen, dass sie innerlich mit mir litt. Ich setzte mich auf die sonnenwarmen Stufen vor unserem schönen Haus, aß ein Stück Marmorkuchen, sah den schwitzenden, ziemlich übelriechenden Möbelpackern zu und ließ die Krümel achtlos auf den Boden fallen. Meinen zwölften Geburtstag hatte ich mir wahrlich anders vorgestellt.
Kapitel 2 - Der Umzug
Den endgültigen Abschied von meinem Zuhause, ja von meiner unbeschwerten Kindheit, erlebte ich nur wie in einem schlechten Traum. Alle meine Freundinnen waren gekommen und hatten Geschenke mitgebracht. Abschieds- und Geburtstagsgeschenke in einem. Sie waren sehr lieb zu mir und versprachen zu schreiben, zu telefonieren, mich zu besuchen, doch irgendwie wusste ich, dass nichts oder nur wenig davon eingehalten werden würde. Aus den Augen, aus dem Sinn, so sagt man doch. Man würde mich vergessen, als hätte es mich nie gegeben.
Dann kamen meine Oma und Purzel über die Straße. Purzel sprang an mir hoch, lud mich ahnungslos zum Spielen und Toben ein, doch diesmal musste ich ihn enttäuschen. Wieder sprach meine Oma nicht viel, sondern nahm mich einfach nur in den Arm. Ich drückte mich vor ihrem weichen Busen an ihre Schürze, roch den Duft frischer Erdbeeren und Äpfel an ihr und verbarg mein Schluchzen, so gut ich konnte, um es nicht noch schlimmer zu machen.
„Wir telefonieren ganz oft, mein Schatz. Und nächste Woche kommt ihr mich vielleicht besuchen, ja?“
„Okay, Omi.“ Omi sagte ich, nicht Oma. Ausdruck meiner größten Zuneigung. Heimlich wischte ich mir eine Träne aus dem Auge. Wie ein zum Strafvollzug abgeführter Häftling stieg ich schließlich in unseren Wagen ein und winkte so lange, bis niemand mehr zu sehen war, der zurückwinkte.
Die Fahrt nach Hamburg verbrachte ich schweigend. Ich sah aus dem Fenster und ließ die Landschaften zwischen Bremen und Hamburg an mir vorüberziehen. Durch heitere Gespräche versuchten meine Eltern mich aufzumuntern, doch es gelang ihnen nicht. Meine Gedanken kreisten um die Anforderungen der kommenden Tage und um den Verlust des Vergangenen.
Nachdem wir die Autobahn über die Ausfahrt verlassen hatten, fiel mir sogleich die Hektik der Großstadt auf.
Noch nie in meinem Leben hatte ich so erschreckend viele Autos gesehen, die kreuz und quer durch die Gegend jagten. Alle schienen in Eile zu sein und die Fahrer - soweit ich sie erkennen konnte - machten verkniffene Gesichter. Ein Hochhaus neben dem anderen säumte unseren Weg; der ruhige Fluss des Lebens in einem Sechstausendseelendorf schien hier unbekannt zu sein. Wir verließen die vierspurige Bundesstraße und schlängelten uns durch den Stadtverkehr. Mama hatte den Stadtplan auf ihrem Schoß ausgebreitet und dessen Knistern und Rascheln ließen erahnen, dass sie mit dem Straßennetz einer 2-Millionen-Stadt hoffnungslos überfordert waren. Heute benutzen wir Navigationssysteme mit freundlichen Automatenstimmen, doch damals wiesen uns die Pläne eines Herrn Falk den Weg.
Als der Stadtplan bereits halb zerfetzt war, fanden wir schließlich die Straße, in der unser Haus stand. Für die kommenden zehn Jahre sollte es unsere Heimat sein: Poppenbütteler Landstraße Nr. 23. Das Auto bog links ein; ich hörte das Knirschen von Schotter unter unseren Rädern. Mein Vater parkte direkt in der Einfahrt. Die Möbelwagen waren noch nicht angekommen, da Lkws für gewöhnlich langsamer fahren. Dies gab mir die Gelegenheit, das Haus zu inspizieren, ohne von miefenden Möbelpackern angepflaumt und umgerannt zu werden. Auf den ersten Blick sah es gar nicht so schlecht aus. Ich stand auf dem Gehweg und blickte mich um. Alle Häuser in dieser Straße wirkten irgendwie gleich, abgesehen von der Farbe, mit der die Bewohner sie gestrichen hatten. Unangenehm fiel mir jedoch eines der Nachbarhäuser auf. Es hatte eine moosgrüne, fleckige Farbe an den Außenwänden. Ich überlegte, ob es tatsächlich eine Farbe war, die absichtlich so gewählt worden oder ob der fortschreitende Verfall für dieses Aussehen verantwortlich war. Meinen Blick vermochte ich von diesem merkwürdigen Haus einfach nicht zu lösen. Dann sah ich, wie eine alte Frau, als sie sich sicher war, dass ich sie bemerkt hatte, schnell die Gardine zuzog.
Ich schüttelte alle sonderbaren Gedanken ab und wandte mich unserem eigenen Haus zu. Es war ein altes, freistehendes, wenn auch kleines Häuschen mit altem Baumbestand ringsumher. Die Außenwände waren in einem zarten, ruhigen Gelbton gestrichen worden. Ein großer Rosenbusch neben dem Eingang trug schwer an vielen üppigen rosaroten Blüten. Sieben unscheinbare Betonstufen führten zu einer knorrigen braunen Holztür mit einem Löwenkopf daran, dem ein Messingring durch die Nase gezogen war. Ich wollte ausprobieren, wie laut man damit anklopfen konnte, doch ich kam nicht an den Ring heran.
Mein Vater schloss die Tür auf. Während ich wachsam durch die leer stehenden Räume schlich, nahm ich eine Menge Eindrücke in mir auf. Meine inneren Fühler wollte ich nach Signalen ausstrecken, die mir mitteilen sollten, ob es sich hier leben ließ. Ich blinzelte in das Sonnenlicht, das durch die Baumwipfel ins Wohnzimmer fiel; ich roch die feuchte Kühle des Holzparketts und ich hörte das leise Rauschen der Heizungspumpen im Keller, die auf niedrigster Stufe ihren Dienst verrichteten. Jeden Raum schritt ich aufmerksam ab und kam schließlich in die Küche, deren Möbel belassen worden waren. Hier entspannten sich meine skeptischen, zusammengekniffenen Stirnfalten, denn ein besonderer Duft umschmeichelte meine Nase. Ein Duft, der mir vertraut war und den ich sehr gern mochte: Der Geruch von Selbstgebackenem haftete noch an den Wänden und hatte sich in den Ritzen verfangen. Der Duft von Keksen und Kuchen und von einer alten Dame, die vielleicht für ihre Enkel eine gute Oma gewesen war. Nachdem ich das Erdgeschoss ohne eine abschließende Bewertung erkundet hatte, stieg ich die knarrenden Stufen ins erste Stockwerk hinauf. Hier gab es drei Räume: ein zukünftiges Gästezimmer zur Linken, wie man mir sagte, das Schlafzimmer meiner Eltern daneben, ein Bad und natürlich mein eigenes Zimmer gleich rechts neben der Treppe. Dort hinein ging ich zuerst. Es hatte eine Dachschräge und das Fenster gab den Blick in den Garten frei. Außerdem konnte ich direkt auf ein mit Gardinen verhangenes Fenster des moosgrünen Hauses auf dem Nachbargrundstück sehen.
Noch immer waren meine Gefühle in Aufruhr und durcheinander; so konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich mich nun freuen oder heulen sollte. Also verharrte ich in einem schwer zu beschreibenden, unbestimmten Zustand und hoffte, dass sich die Wogen meiner Traurigkeit bald glätten würden und ich Frieden mit der neuen Situation würde schließen können. Ich hörte das laute Brummen der Lkws vor der Tür, und bevor ich zu meinen Eltern zurücklief, spähte ich ein letztes Mal durch die schräge ungeputzte Scheibe. Wieder sah ich drüben am Fenster die Alte stehen, die Gardine ein wenig zur Seite haltend. Nun konnte ich auch Einzelheiten an ihr erkennen: den skeptischen, ja beinahe stechenden Blick, die bestimmt fünfzig Jahre alte schwarze Brille auf ihrer Nase. Ich meinte sogar, dunkle Augen dahinter zu erkennen und erschauderte.
Das Quietschen schwerer Bremsen riss mich aus meinem Staunen heraus. Schnell und auch erleichtert löste ich meinen Blick von diesen fremden Augen. Augen wie vom grauen Star gezeichnet, als läge ein feiner Schleier zwischen ihnen und der Welt außerhalb ihres grünen Hauses. Ich verließ mein Zimmer und stand am oberen Treppenabsatz. Einer der Möbelpacker kam auf mich zu. Genaugenommen sah ich nur seine Beine, die unter der Last auf der steilen Treppe einzuknicken drohten. Mit einem schweren Möbelstück auf dem Arm hielt er direkt auf mich zu, ohne seinen Schritt zu verlangsamen. In letzter Sekunde drückte ich mich gegen die Wand und ließ ihn vorbei. Er schnaufte und ächzte und als er über eine Bodenwelle des alten roten Teppichs zu stolpern drohte, stieß er wilde Flüche aus, von denen er glaubte, dass niemand sie gehört hätte. Gerade war der erste wie ein Bulldozer im Schlafzimmer meiner Eltern verschwunden, da polterte auch schon der zweite die Treppe hinauf. Dieser jedoch sah mich ganz genau; er fixierte mich mit den Augen unter den buschigen Brauen, als wollte er mir zu verstehen geben, ihm besser aus dem Weg zu gehen. Zusätzlich raunzte er mich an: „Besser, du suchst dir einen anderen Platz zum Spielen, Kindchen.“ Ja richtig, Kindchen sagte er, obwohl ich schon zwölf war. Ungeheuerlich, wie ich fand.
Langsam ging ich einige Schritte zurück und wich ihm aus. Obwohl ich ihn nicht mochte, musste ich mir eingestehen, dass er wohl Recht hatte. Wohin aber sollte ich fliehen? Ich hätte in den Garten gehen können, doch ohne Purzel ...? Mein Zimmer war noch vollkommen leer und ungemütlich, ebenso das Gästezimmer und all die anderen Räume. Überall würde ich im Weg sein. Plötzlich fiel mir eine Tür auf, die ich bei meinem ersten flüchtigen Rundgang gar nicht bemerkt hatte. Sie war viel schmaler als die anderen Türen, vielleicht sogar nur halb so schmal und besaß nur einen Riegel und keine Klinke. Der dicke Möbelpacker würde da garantiert nicht durchpassen, schoss es mir durch den Kopf. Ich öffnete diese sonderbare Tür und erwartete einen ganz normalen Raum dahinter. Umso mehr überraschte es mich, dass sich dort kein Zimmer im herkömmlichen Sinn verbarg, sondern nur eine abgetrennte Nische, die als Abstellkammer dienen könnte. Es roch nach abgestandener Luft. Ich hatte feine Staubschwaden aufgewirbelt, die nun an meinen Augen vorbei durch die Luft trieben, bevor sie sich wieder auf den Boden fallen ließen. Innerhalb wenige Sekunden sah ich mich nach allen Seiten hin um; da war leider auch nichts, was meine Flucht vor den Eindringlingen begünstigt hätte, bis mein Blick auf eine verschlossene Luke an der Decke fiel, auf eine Dachluke mit einer metallenen Öse an der Unterseite der hölzernen Klappe. Ich blickte mich um und fand in der Ecke der kleinen Kammer eine rostige Eisenstange, die am Ende abgewinkelt war und genau in die Öse der Klappe zu passen schien. Sofort nahm ich die Stange, hob sie hoch und versuchte das abgewinkelte Ende in die Öse zu schieben. Mit einiger Mühe gelang es mir. Ich rüttelte daran herum, dann zog ich, drehte daran. Eine knarrende Bewegung linksherum brachte den erhofften Erfolg. Die Verriegelung löste sich und die Klappe öffnete sich wie ein gieriger Schlund. Eine über zwei Scharniere eingeklappte Treppe hing daran und ich begriff den Mechanismus sofort: Ich stellte mich auf meine Zehenspitzen und erreichte gerade noch die unterste Sprosse, an der ich zog. Man konnte die Treppe nach unten entfalten, da die einzelnen Stufen über verschiedene Gelenke miteinander verbunden waren. Ich legte die Stange beiseite und setzte meinen Fuß auf die unterste Stufe. Knatschend gab sie nach, durch mein Gewicht wurde die Treppe vollends auf den Boden gedrückt. Langsam und mit pochendem Herzen stieg ich hinauf, Stufe für Stufe. Ich wischte mir einige Strähnen aus dem Gesicht und nach kurzer Zeit schon konnte ich mich kaum noch sattsehen an diesem muffig riechenden, in staubige Schwaden eingehüllten Dachboden. Als idealer Zufluchtsort lud er mich ein, jetzt und für alle Zeiten, in denen wir in diesem Haus wohnen sollten. Über die oberste Stufe kroch ich auf den Holzboden und sah mich begeistert um. Zugegeben, es war schmutzig und dämmerig. Ein kleines Dachfenster, mehr eine mit grünem Moos bedeckte quadratische Scheibe, ließ Licht wie aus einer anderen Welt zu mir hinein scheinen. Ich stand auf und konnte in der Mitte des Raumes gerade noch aufrecht stehen. Ich, die zwölfjährige Anna, konnte es und somit sonst niemand anderer. So sollte es bleiben, für immer und ewig, das schwor ich mir hoch und heilig. Dass auch ich mit den Jahren noch wachsen würde, vergaß ich dabei.
Das Poltern der Umzugsmaschinerie war nur entfernt zu hören. Türen gingen auf und wurden wieder zugeschlagen, ich hörte schweres Getrappel und Stimmengewirr wie: „Der Karton kommt nach oben, dieser bleibt unten ... nein, nicht dorthin ... Passen Sie auf, da sind Gläser drin.“
Niemand schien mich zu vermissen, niemand rief nach mir. Man hatte mich vergessen und so paradox es klingt, ich genoss diesen Aufenthalt im Niemandsland unter dem Dach des alten Hauses. Im Schneidersitz setzte ich mich auf den Boden und lehnte mich an die Wand, zeitlos und unbeschwert im trüben grünlichen Schein eines Spätnachmittags. Als ich mich umsah, war da nichts wirklich Schönes oder Interessantes, nur ein räumliches Vakuum innerhalb eines abgesteckten Zeitfensters. Und doch ... Es war mein Raum und mein Geheimnis.
Es begann zu regnen, das Licht verlor an Helligkeit. Graue Hamburger Wolken verwandelten den Raum in eine Höhle, in eine uneinnehmbare Festung gegen die Feinde der Erwachsenenwelt.
Ich ersann Pläne, wie man dieses Zimmer einrichten könne: kuschelige Decken, ein kleines Tischchen vielleicht, eine Lampe und viel Ruhe zum Nachdenken, zum Träumen, zum Trauern. In meinen Gedanken schaukelte meine Großmutter - mit einem Langhaardackel im Arm - in ihrer Hollywoodschaukel, neben ihr ein kleines rothaariges Mädchen mit vielen Sommersprossen und türkisblauer Zunge. Keine Ahnung, wer dieses Mädchen war – ich war es jedenfalls nicht. Schniefend wischte ich mir die Tränen aus den Augen, nicht verstohlen wie am Morgen, sondern ungehemmt und ehrlich.
Eine tiefe Traurigkeit machte sich in mir breit, bis der prasselnde Regen auf dem kleinen Dachfenster plötzlich verstummte und zwei dicke Wolken auseinanderstoben. Ein dünner, aber intensiver Lichtstrahl fiel auf die staubigen Holzbohlen. Erst sah ich nur beiläufig hin, dann etwas genauer. Dort lag etwas, was ich, als ich die Kammer betrat, nicht gesehen hatte. Eigenartig war mir schon zumute, denn ich hatte den Raum genauestens inspiziert und ein Brief, wenn auch nur in einem ungebleichten grauen Umschlag, wäre mir ganz sicher als Erstes aufgefallen. Mit Schwung begab ich mich aus meinem Schneidersitz auf die Knie und kroch langsam auf den Briefumschlag zu. Noch immer strahlte die Sonne wie aus einer Taschenlampe gebündelt darauf. Ich nahm den Brief in meine Hand. Der Umschlag war rau, fühlte sich irgendwie alt an. Auf der Vorderseite stand: Für Anna. Ein Brief an mich? Ich konnte es nicht fassen. Als ich ihn umdrehte, zitterten meine Finger leicht und wurden feucht. Er war nicht zugeklebt, sondern nur ineinander gesteckt. Normalerweise hätte ich nicht eine Sekunde lang gezaudert, ihn aufzureißen, doch bei diesem Brief war es anders. Mir war, als hielte ich etwas ganz Besonderes in der Hand, etwas ganz Wichtiges, nichts Alltägliches. Dann fasste ich Mut. Ich war entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich drückte schon meinen Fingernagel zwischen eine kleine Ritze des Umschlags, da lugte der Kopf meines Vaters über die oberste Stufe der Trittleiter. Mit einem breiten Grinsen sah er mich an, ohne Vorwurf und ohne Fragen. Er verstand mich auch, ohne zu fragen, und streckte mir seine Hand entgegen.
„Sind die endlich weg?“
Mein Vater nickte. „Schau dir mal dein Zimmer an. Du musst dir doch ansehen, wie wir deine Möbel gestellt haben. Komm mal mit, Schatz.“
Den Brief in meiner Linken hatte mein Vater nicht bemerkt. Ich knickte ihn, steckte ihn schnell in die Hosentasche und folgte meinem Vater nach unten. Mit einem lauten Ruck schob er die Treppe nach oben und die Klappe verschloss sich wieder.
Neue Gedanken überkamen mich. Wohin mit dem Bett, der Kommode? Wohin mit all den Kartons, den Taschen und dem ganzen Krempel? Der restliche Tag und Abend war vollständig vom Auspacken und Umräumen bestimmt, vom Suchen und teilweise Finden. Es war wie das Abstecken eines Reviers. Jeder suchte seinen Platz in dieser fremden Umgebung. Jeder Mensch hat seinen Platz in dieser Welt, doch meistens ist er nicht gleich offensichtlich. Er will erst mühsam gesucht werden.
„Ich weiß nicht, wo meine Zahnbürste ist, Mama. Habe ich meinen Schlafanzug in deinem Koffer?" So ging es hin und her, und nachdem wir uns müde und frustriert vom Nicht-Finden am Küchentisch getroffen hatten und an dem einzigen Ort ausruhten, der bewohnte, wenn auch nicht eigene Behaglichkeit ausstrahlte, kehrte ein wenig Frieden ein. Was hatte es für einen Sinn zu hadern und zu zetern? Der Umzug war vollzogen, Altes zurückgelassen und Neues noch nicht vertraut. Ich fühlte mich wie in einem Schiffshebewerk: Die Schleuse hinter mir war bereits verschlossen und die vor mir noch nicht geöffnet. Der Wasserpegel stieg zwar langsam, doch an eine Weiterfahrt war noch nicht zu denken. Ich war eingesperrt in diesem Vakuum, ohne sehen zu können, wie es hinter der Schleuse weitergehen würde. Auch meinen Eltern war anzumerken, wie hilflos sie sich fühlten, wie wenig Kraft noch übrig blieb, um mich zu trösten, meinen Schmerz zu lindern. Meine Bedürfnisse mussten hintanstehen, bis mir der Brief wieder einfiel. Eine willkommene Ablenkung. „Ich geh schlafen“, sagte ich schnell. „Ich bin müde und möchte noch etwas lesen.“ Vater und Mutter nickten kurz. Sie waren vollkommen erschöpft. Ich ließ mich von ihnen in den Arm nehmen und mir einen flüchtigen Kuss geben. Dann lief ich ins obere Stockwerk in mein Zimmer. Meine Jeans hatte ich bereits durch mein Nachthemd eingetauscht und so fand ich schnell den zerknüllten Brief in der Hosentasche. Neugierig öffnete ich ihn und nahm ein kleines Blatt heraus.
Kapitel 3 - Briefe eines Unbekannten
Liebe Anna,
Herzlich willkommen in deinem neuen Zuhause.
Ich hoffe, es gelingt dir, dich schnell einzuleben.
G.
Ungläubig schüttelte ich den Kopf. Was soll das nun bedeuten? Alles hatte ich erwartet, nicht aber solch eine ominöse Botschaft. Wer, bitte, ist G.? Wer weiß, dass ich hier bin? Wer wusste, dass ich diese Dachkammer finden würde?Was geht hier vor?
Ich las diese wenigen Zeilen drei, vier Mal, schüttelte wieder den Kopf und beschloss, den Brief in den Umschlag zurückzustecken. Verwirrt schlüpfte ich unter meine Bettdecke, Schutz und Geborgenheit suchend, legte mich steif wie ein Brett auf den Rücken, starrte an die frisch gestrichene weiße Zimmerdecke und sah mich noch einmal im Raum um, ob ich auch wirklich allein sei. Schließlich versuchte ich, diesen Brief einfach zu vergessen. Was es nicht geben konnte, das gab es auch nicht. So einfach war das, wenn man jung war. Wie hätte ich zu diesem Zeitpunkt auch ahnen können, dass es nicht bei diesem einen Brief bleiben würde? Dass Briefe dieser Art mich wie ein treuer Freund auf Schritt und Tritt begleiten würden und dass ich den Absender G. eines Tages persönlich kennenlernen würde? Doch wer sich hinter diesem Kürzel verbarg, blieb zunächst ein Geheimnis.
Am nächsten Morgen wachte ich erholt und bei guter Laune zwischen zerwühlten Kissen auf. Ich war voller Tatendrang, spürte neue Energie in mir aufkeimen und nahm mir vor, an diesem Tag diesem Raum meinen ureigenen Stempel aufzudrücken. Dies bedeutete, alle Poster von Pferden und Popstars in ungleicher Verteilung zugunsten der Popstars an die Wände zu heften, ein wenig Unordnung und Chaos zu verbreiten und mich so schnell wie möglich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Überzogene Betriebsamkeit hatte bei meinen Eltern schon oft funktioniert, wenn es darum ging, Unangenehmes schnell zu vergessen oder zumindest erfolgreich zu verdrängen. Warum also sollte es mir nicht auch auf diese Weise gelingen? Ich schlüpfte in meinen Morgenmantel, zog meine Hausschuhe an und hüpfte die Treppenstufen hinunter. Als ich in die Küche stürmte, war dort niemand. Ich rief nach meinen Eltern, doch ich bekam keine Antwort. Ich flitzte ins Wohnzimmer hinüber, stiefelte über Kisten und Kartons, rief wieder und wieder. Schließlich fand ich in der Küche einen Zettel mit einer Botschaft von meiner Mutter.
Guten Morgen lieber Schatz,