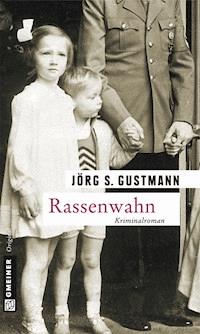
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Martin Pohlmann
- Sprache: Deutsch
Eine ungewöhnliche Mordserie erschüttert Hamburg. Fünf Menschen, die 70 Jahre zuvor in einem Lebensbornheim der SS zur Welt kamen, sterben. Kommissar Martin Pohlmann nimmt die Ermittlungen in einer Anstalt für psychisch kranke Menschen auf. Die Spur führt zu zwei hochbetagten Nazis, die bereits seit 60 Jahren hätten tot sein müssen: verurteilt und hingerichtet als Kriegsverbrecher und Massenmörder. Kann Pohlmann den Serienmörder stoppen und wird die Justiz endlich für Gerechtigkeit sorgen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 762
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jörg S. Gustmann
Rassenwahn
Kriminalroman
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2012 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
Für meine Mutter (1931–1986)
Ich erinnere mich daran, dass du immer einen
guten Krimi auf dem Nachttisch liegen hattest.
God gave me travelling shoes, God gave me the wanderer’s eye,
God gave me a few gold coins to help me to the other side.Looked around and said: be careful how small things grow,
God gave me travelling shoes and I knew that it was time to go.
Sent in the ship at night to take me to the hidden port.
Found me the key at last to open up the prison door.
Brought down the blackbird’s wings, gifted me with beggar’s eyes.
Sent in the jackals to tell me I should say bye, bye, bye.
I’m home, home,
Home, home, home
And I’m home, home,
Home, home, home
But I’m miles and miles and miles and miles and miles away
Where can I hide?
God gave me one last chance, gave me one last reprieve.
Jah gave me hunger, gave me the air to breathe.
Gave me one suitcase, gave me one last goodbye
Gave me travelling shoes, without them I would surely die, die, die.
Home, home
Home, home, home
Miles and miles and miles and miles and miles away
Where can I go?
Where can I hide?
Prolog
Die Zeit des Wartens kam ihr so lang vor wie die Ewigkeit, in deren Schlund sie sich stürzen wollte. Sie hatte keine konkreten Vorstellungen von dem, was sie hinter dem Vorhang erwarten würde, und doch sehnte sie sich mit jeder Faser ihres Seins danach, dieses Leben zu verlassen.
Ganz still lag sie da, atmete tief und ruhig. Die Turmuhr der nahegelegenen Kirche hatte wenige Minuten zuvor drei kräftige Schläge getan. Man konnte davon ausgehen, dass alle anderen im Haus mit Sicherheit schliefen. In dieser Nacht wollte Emilie Braun ihre seit einiger Zeit gehegten Gedanken erneut in die blutige Tat umsetzen.
Noch einmal sterben, diesmal aber richtig.
Behutsam, beinahe zärtlich, glitt die linke Hand zu dem Messer, das sie in der Ritze zwischen Bettkante und Matratze verbarg. Das Mondlicht schien friedlich durch die Gitterstäbe hindurch. Die Klinge, die sie hervorzog, blitzte kurz auf. Ein Käuzchen unweit ihres Fensters hielt Wache so wie sie, doch dieses würde den nächsten Morgen lebendig erleben.
Vorsichtig führte sie ihren Zeigefinger an der Schneide entlang und schien zufrieden. Am Abend, als die Geräuschkulisse des Hauses es zuließ, hatte sie das Küchenmesser an einer Fliesenkante scharf geschliffen. Ehe sie nun die Decke von ihrem ausgemergelten Körper schob, dachte sie an das bevorstehende Ereignis, an das Gefühl, wenn das warme Blut die Adern verließ und am Unterarm entlangkroch. Sie kannte diese Empfindung: Es kitzelte bisweilen leicht, bevor eine wohltuende bleierne Schwere das Bewusstsein einhüllte. Mit diesen Gedanken erhob sie sich von ihrem Bett. Sie schob die knochigen Füße in blaue Hausschuhe aus Frottee, die eine grotesk verzerrte rosa Blüte auf der Oberseite trugen. Dann schlurfte sie in ihrem Zimmer zu einem Tisch, der ihr als Schreibtisch gedient hatte. Mit einem leisen Klicken erwachten 60 Watt aus der Stehlampe zum Leben. Sie zog bedächtig die oberste Schublade des hellgrauen Tisches auf und betrachtete mit Stolz eine dicke, braune Kladde. Die Finger ihrer linken Hand umkrallten das Messer, als hätte sie Angst, man könne es ihr vor der Zeit wieder entreißen. Mit der rechten Hand schrieb sie einige Sätze auf einen glatt gestrichenen Papierbogen, den sie ebenfalls aus der Schublade hervorgezogen hatte. Ob die Zeilen wie ein Brief aussehen sollten oder eher wie ein Tagebucheintrag, war ihr vollkommen gleichgültig. Wichtig war nur, dass man sie fand, um denen, die sie lesen würden, eine Menge Probleme zu bescheren:
Hans ist tot.
Gestorben.
Hat sich in den Kopf geschossen.
Verflucht.
Hing schlaff, weit nach hinten über die Lehne gelehnt und sah an die Decke. An der Wand neben ihm klebte Blut aus seinem Kopf, mit dem er gedacht, studiert und mit uns geredet hat. An der Seite des Gesichtes, dort, wo früher ein herzförmiger Leberfleck saß, war nun ein Loch, groß wie eine Walnuss. Warum hat er das bloß gemacht, mein Hans?
Vielleicht haben sie ihn ja auch umgebracht, die Schatten aus der Vergangenheit. Haben ihn dazu getrieben, ihn nicht in Ruhe gelassen all die Jahre. Werd ihn gleich fragen, wenn ich ihn treffe, wo immer das sein wird.
Vor einer Woche schon haben sie ihn abgeholt. Vorgestern war Beerdigung, doch keiner von uns war eingeladen, nicht mal ich. Würde ja auch niemand machen, Menschen wie uns einzuladen.
Selbst wenn ich nicht viel rede – hab ich nie getan, deswegen bin ich ja hier –, hab ich jeden Tag in meinem Buch geschrieben. Hab immer viel gelesen und viel geschrieben. Hab alles ganz von Beginn an festgehalten. Hab auch aufgeschrieben, wen der Hans umgebracht hat. Sogar in Schönschrift, damit man, wenn ich nicht mehr da bin, es gut lesen kann. Hab mir Mühe gegeben beim Schreiben, damit man mir glaubt, dass ich nicht verrückt bin. Jedenfalls nicht bekloppter als die meisten Leute da draußen. Die meisten von denen da draußen gehören hier rein, die wissen’s nur noch nicht.
Emilie
Teil 1 Kapitel 1
Steinhöring, 18. August 1944
Gegen vier Uhr nachmittags näherte sich auf der Auffahrt ein eleganter schwarzer Wagen dem imposanten Heimgebäude. Man hörte den Motor von Ferne, niemand drehte sich nach ihm um.
Es war ein brandneuer Opel Kapitän mit unfassbaren 55 PS. Bisher fehlte dem Eigentümer die Gelegenheit, die Höchstgeschwindigkeit von 126 Kilometern pro Stunde zu testen. In Zeiten wie diesen waren die Straßen in einem bedauerlichen Zustand, wo es dem Fahrer nicht annähernd vergönnt war, die Kräfte des Motors auf dem Tachometer bewundern zu können.
Die Reifen kamen direkt neben dem Haus zum Stehen, ohne auf dem feinen Kies eine unschöne Bremsspur zu hinterlassen.
Das herrschaftliche Anwesen, vor dem dieser Wagen bei schönstem Sommerwetter parkte, hatte einst einer wohlhabenden jüdischen Familie gehört, die ihres Besitzes, nach Ansicht der SS, für höhere Zwecke enteignet wurde. Die ehemaligen Bewohner mussten ihr Haus, das sich über Generationen im Besitz ihrer Familie befand, gegen eine andere Unterkunft eintauschen. Eine Behausung, die sie nun mit Dutzenden Insassen, nach Männern und Frauen getrennt, teilten. Sie lebten fortan in Baracken voller Ungeziefer, Hunderte Kilometer von ihrer Heimat entfernt, während sie auf den Tag ihrer Befreiung oder den ihres Todes warteten.
Nun beherbergte diese exklusive Wohnstatt 29 Kinder und 15 Mütter sowie acht Pflegerinnen, drei Krankenschwestern, vier Hebammen, zwei Köche und einen im angrenzenden Gästehaus wohnenden Allgemeinmediziner, der um das Wohl aller dort Lebenden besorgt sein sollte.
Ein Mann um die 27, von schlanker Statur, stieg auf der Beifahrerseite des Wagens aus, während der Fahrer ungerührt sitzen blieb. Der Aussteigende gab kurze Anweisungen, der Chauffeur nickte daraufhin. Der Besucher ließ die schwere Tür des Opels ins Schloss fallen. Die dritte Fahrt mit dem neuen Automobil war zu seiner vollen Zufriedenheit verlaufen. Ein letzter entspannender Blick auf das Vehikel, bevor er hineinging, um sich einem unangenehmen Gespräch zu stellen.
Auf einer der untersten Treppenstufen hielt er kurz inne. Er wollte Sekunden der Unbeschwertheit heraufbeschwören und blickte sich um. Er holte tief Luft. Ein Singvogel in der Nähe pfiff auf die Befehle des Führers und trällerte dem Krieg zum Trotz. Dem Klang nach muss es ein Buchfinkenmännchen sein, überlegte er. Der Besucher suchte den Vogel mit den Augen, wollte ihn zwischen den Blättern ausmachen, doch erst als dieser aufflog, bemerkte er das blau-graue Köpfchen und die auffällig weiß gebänderten Federn. Er nickte zufrieden. Welch beneidenswerte Umgebung dieses Anwesen beherbergt, dachte er. Welch ein Segen, in dieser Abgeschiedenheit, fern allen Kriegstreibens, Kinder zu gebären und zu wertvollen deutschen Menschen heranwachsen zu sehen.
Nun wandte sich der Mann den Stufen zu, die vor ihm lagen. Er trug einen grauen, zweireihigen Anzug, den er zuknöpfte, sowie blankpolierte Schuhe mit feiner Ledersohle. Ein heller Hut mit einem schwarzen Band und weiter Krempe schützte seine undurchdringlichen Augen vor der Sonne.
Bei all dieser paradiesischen Anmutung täuschte die Idylle über die Wahrheit dessen, was im Inneren dieser Mauern geschah, hinweg. Nur wenige Menschen wussten in allen Einzelheiten von der wahren Bestimmung solcher Gebärstätten; sie waren zwar nicht geheim, aber äußerst exklusiv.
Eine adrette Krankenschwester kam dem Besucher entgegen, eilte die sieben Stufen des Haupthauses hinunter und grüßte ihn mit einem zackigen »Heil Hitler«. Sie trug eine weiße Schürze und eine weiße Haube auf dem Kopf. Die blonden Haare hatte sie zu einem Knoten zusammengesteckt, sodass die feinen Konturen ihres blassen Gesichtes zur Geltung kamen.
Der Besucher erwiderte den Gruß pflichtgemäß und ließ sich von ihr zu den Schlafräumen der Mädchen geleiten.
»Gut, dass Sie mich rechtzeitig benachrichtigt haben«, begann er steif, doch sein Ton nahm an Dringlichkeit zu. »Das Kind muss umgehend behandelt werden.« Der Besucher suchte den Blick der Schwester. »Was sagt Dr. Reuter zu diesem Problem?«
Die junge Frau rieb sich verlegen die Hände. Sie schwitzte, doch nicht allein wegen der Sommerwärme. »Nun«, antwortete sie, »er ist ratlos. Er erwähnte, einen Spezialisten hinzuzuziehen, möglicherweise einen … Nervenarzt.«
Der Besucher riss erneut den Kopf herum und sah die Schwester mit aufgerissenen Augen an. Seine Lippen presste er zu einem engen Schlitz zusammen, während er auf dem Absatz der Treppe stehen blieb. Solche Worte in seinen Ohren schienen ihm einen beinah körperlich spürbaren Schmerz zuzufügen.
Die Schwester lenkte ein. Sie hatte Angst. Angst vor diesem Mann, vor dessen Vorgesetzten, der rechten Hand des Führers und vor Bestrafungen jeder Art. »Bitte, glauben Sie mir, wir haben uns alle erdenkliche Mühe mit diesem Kind gegeben, aber es ist anders als die anderen. Es reagiert nicht auf das, was wir ihm sagen. Es helfen keine Schläge, kein Schlafentzug, keine dunkle Einzelkammer, nichts. Das Mädchen will einfach nicht gehorchen und nicht sprechen, obwohl es schon vier ist.«
Der Besucher rang nach Worten. Trotz seiner herausragenden Position, seiner erstklassigen Schulbildung und seines weltmännischen Auftretens erfasste ihn eine gewisse Hilflosigkeit – eine Sprachlosigkeit, die er als Kommandant nicht gewohnt war. In den Dingen, mit denen er nun konfrontiert wurde, fühlte er sich unsicher, und dieser Umstand ärgerte ihn. Noch mehr zu schaffen machte ihm der Inhalt jenes Disputes. Überlaut, ohne sich nach möglichen Zuhörern umzudrehen, fuhr er die Schwester an: »Dieser Zustand muss sich ändern. Es kann nicht sein, dass ausgerechnet hier solche Kinder zur Welt kommen. Sie wissen, was ich meine. Die Zukunft des deutschen Volkes hängt davon ab, dass wir einwandfreies Erbgut weitergeben. Wenn dieses Kind nicht kooperiert, werden wir andere Maßnahmen ergreifen müssen, obwohl es mir leidtäte.« Die Unterlippe des Besuchers zitterte kaum merklich.
Beide wandten sich nach rechts um und gingen in einen der Flure im ersten Stockwerk. Es roch nach frischer Farbe, und der Duft des einige Stunden zurückliegenden Mittagessens wehte in feinen, unsichtbaren Schwaden in Höhe seiner Nase. Nach weiteren 20 Schritten, die die Schwester eilig vor dem Hauptmann zurücklegte, blieben sie vor einer Tür stehen, die zu einem der Schlafräume führte. Sie trat beiseite. Der Offizier straffte seinen Rücken. Er kannte diesen Raum von einem Besuch, der eine Weile zurücklag. Er drückte die Klinke herunter, atmete bewusst ein und öffnete die schwere Tür. Ein Zimmer mit 30 Kinderbetten tat sich vor ihm auf. Dann, mit scheinbarem Widerwillen, sah er zu einem braunhaarigen Mädchen, das im dritten Bett an der linken Seite, direkt vor der Fensterfront, lag.
Er erkannte sie wieder.
Sie verharrte, steif wie ein Stock, auf ihrem Lager, hübsch anzusehen zwar, obgleich sie nicht blond war, wie es bei zwei blonden Elternteilen zu erwarten gewesen wäre. Sie trug ein weißes Kleidchen mit einer rosa Schleife am Hals. Ihre Füße steckten ebenfalls in weißen Söckchen, und die feinen Schuhe – alles zur Feier des Tages – standen nebeneinander vor dem Bett.
Ihre Reaktion bestand nicht darin, von ihrem Bett aufzuspringen, um den Besucher zu begrüßen, ihn zu umarmen, sich zu freuen oder ein Hallo zu winken, sondern lediglich darin, in regelmäßigen Abständen mit den Lidern zu zwinkern. In den Zeiten dazwischen starrte sie an die weißgetünchte, mit Stuck verzierte Zimmerdecke, an der sich ein Ventilator befand. Man hätte denken können, sie sei wie in einem Spiel damit beschäftigt, die Runden der sich drehenden Blätter mit den Augen zu verfolgen. Nicht mit einem winzigen Zucken sah sie zu dem elegant gekleideten Mann auf.
Nachdem der Besucher das Kind eine Weile beobachtet hatte, schüttelte er verwirrt, fast verzweifelt, den Kopf. »Mein Gott, das ist ja furchtbar. Wie oft ist sie so?«
Die Schwester tupfte sich mit einem Spitzentaschentuch die Stirn und bedachte das Mädchen mit einem mitfühlenden Blick. »Nur ab und zu, nicht oft. Meistens läuft sie draußen herum und spielt mit Stöcken, Tannenzapfen und Eicheln oder mit den Tieren, die sie auf dem Boden krabbeln sieht.« Die Schwester atmete schnell. »Sie fügt ihnen kein Leid zu, wie viele der anderen Kinder, im Gegenteil. Sie versucht sie zu bewahren und zu pflegen, und hätten wir sie nicht schon des Öfteren daran gehindert, würde sie die Tiere mit hereinbringen. Und wenn wir mit ihr schimpfen, legt sie sich hin und verharrt stundenlang in dieser Position. Wir reden auf sie ein, duschen sie eiskalt nach den Regeln von Pfarrer Kneipp, doch sie bleibt regungslos.«
Der Besucher rieb sich über den kurz getrimmten Schnurrbart. »Spielt sie denn wenigstens mit den anderen Kindern?«
»Nein. Niemals. Und berühren lässt sie sich schon mal gar nicht.« Die Schwester bedachte das Mädchen mit einem Lächeln, und mit weicher Stimme fügte sie hinzu: »Eigentlich ist sie friedliebend, doch ihr Verhalten ist sicher ungewöhnlich. Und sie spricht nicht.« Dann ergänzte sie hastig: »Jedenfalls nur mit wenigen und wenn sie es will. Manchmal hören wir sie murmeln, wenn sie im Gras sitzt und ein Käfer auf ihrer Handfläche sitzt. Dann ist sie fröhlich und redet scheinbar mit den Blüten des Löwenzahns oder mit dem Wind, der sich auf ihrer Schulter niederlässt, so als könnten diese sie verstehen oder als hätte sie unsichtbare Freunde.«
Der Besucher machte Anstalten, sich vor das Bett hinzuknien, vielleicht um dem Kind näher zu sein, ihm über den Kopf zu streicheln oder Ähnliches, doch auf halber Strecke nahm er die Hand wieder zurück. Ruckartig stand er auf. »Was haben Sie zu ihr gesagt, dass sie so reagiert hat?«
Die Schwester zuckte mit den Schultern. »Eigentlich nichts Besonderes. Wir haben ihr nur erzählt, dass heute ihr Vater kommt, um sie zu besuchen.«
Kapitel 2
Hamburg, 28. Oktober 2010
Kommissar Werner Hartleib betrat das Büro seines Kollegen Klaus Schöller und fand ihn zwischen weißgrauen Nebelschwaden mit einer grünen Plastikgießkanne in der Hand. Schöller machte einen unentschlossenen Eindruck, als er die Gießkanne betrachtete. Gelbe und rote Blümchen von ehemaligen Pril-Flaschen aus den Siebzigern klebten noch darauf und waren bis zur Unkenntlichkeit vergilbt.
Hartleib beobachtete den Unsinn seines Kollegen.
»Komm, lass gut sein. Das bringt nichts. Der Ficus ist hin. Hast eben kein Händchen für Pflanzen so wie Martin.« Sein Kollege missbilligte diese Aussage mit einem Grunzen und murmelte verächtlich den Namen Martin Pohlmann. Ein Name, den er ganz und gar nicht mochte.
Hartleib schob den Ärmel seines Sakkos hoch und sah auf die Uhr an seinem linken Handgelenk. Eine neue Junghans-Funkuhr von seiner Frau zum 40. Geburtstag, zwei Wochen zuvor.
»Hör jetzt damit auf und setz dich hin. Ich muss dir was sagen.«
»Pflanzen produzieren Sauerstoff«, beteuerte Schöller, seines Zeichens Kriminaloberkommissar im Polizeipräsidium Hamburg-Mitte, und ließ seinen Blick auf dem Ficus ruhen.
»Lebendige Pflanzen? Ja, die schon.« Hartleib schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung, weshalb ausgerechnet dir der Chef das Raucherzimmer als Büro gegeben hat.« Schöller grinste verschlagen.
»Du könntest ab und zu mal lüften.« Hartleib ging zum Fenster und stellte es auf gekippt. Es würde eine Weile dauern, bis die Atemluft den gesunden DIN-Normen eines deutschen Arbeitsplatzes entspräche.
Hartleib stand von seinem Kollegen abgewandt, und die Nachricht, die er mitzuteilen hatte, erfüllte ihn mit einer gewissen Schadenfreude: »Hast du schon das Neuste gehört?«
Schöller sah von dem Ficus zu Hartleib auf.
»Pohlmann kommt zurück.« Werner Hartleib sprach diese Worte mit Genuss.
Schöllers Blick glitt ins Leere. Er überlegte, ob er genau das gehört hatte, was Hartleib gesagt, vor allem, was er gemeint hatte. Hartleib nickte bestätigend und verschränkte die Arme vor der Brust. Ein süffisantes Grinsen dominierte zwischen den eingefallenen Wangen des Halbmarathonläufers.
Hartleib ging erneut zum Fenster und sah hinaus. Fast beiläufig erwähnte er: »Der Chef ist froh darüber.«
Schöller stellte die Gießkanne auf der Fensterbank ab und bedachte den vertrockneten Ficus mit einem sonderbaren Blick. Ihm schien erst in diesem Augenblick aufzufallen, dass das Gestrüpp in der Ecke des Raumes kein einziges Atom Sauerstoff mehr spenden könnte. Resigniert setzte er sich mit einer Pobacke auf die Schreibtischkante.
»Was soll das heißen – er freut sich? Ist es wegen dem aktuellen Fall?«
Hartleib hob die Schultern. »Glaub schon. Bin mir sogar ziemlich sicher.«
»Er geht davon aus, dass wir das nicht auf die Reihe kriegen, was?«
Hartleib schwieg.
Schöller fuhr sich mit den gelblichen Fingerspitzen seiner rechten Hand durch das volle Haar. »Na, er muss es ja wissen.« Dann fixierte er Hartleib. Der Rauch brannte in seinen Augen und er schloss sie für einen Augenblick. »Wann kommt er?« Schöller drehte sich um und drückte die 13. Zigarette des Tages gegen 11.15 Uhr im überfüllten Aschenbecher aus.
»Nächsten Montag.«
Schöller ließ die Antwort einige Sekunden sacken. Während er noch immer die längst erloschene Kippe zerdrückte, sagte er: »Sag mir, was Pohlmann hat, was wir nicht haben.« Schöller wartete nicht ab und nahm Hartleib die Antwort vorweg. »Gutes Aussehen scheidet schon mal aus.« Schöller zählte amüsiert seine Finger ab. »Pünktlichkeit, Ordnungsliebe, sorgfältige Aktenführung fallen mir auch nicht ein, wenn ich an ihn denke.« Schöller hob sein Hinterteil von der Schreibtischkante, ging um ihn herum und wühlte in der zweiten Schublade von oben nach einer vollen Schachtel Fortuna, jener billigen Marke aus dem letzten Mallorca-Urlaub, die er sich stangenweise illegal importiert hatte. Der Urlaub lag drei Wochen zurück, und er stellte mit Entsetzen fest, dass er die letzte Packung in seiner Hand zerknüllte. Die irritierende Nervosität eines Kettenrauchers ergriff von seinen Gedanken Besitz. Er riss weitere Schubladen auf und sah dann erst mit einem verzweifelten, gleich danach mit einem flehenden Blick seinen Kollegen Hartleib an.
Hartleib öffnete sein Sakko, als wolle er demonstrieren, dass er keine Zigaretten bei sich hätte. »Sorry, Klaus. Keine Chance. Ich rauch nicht mehr.«
Schöller schnaubte verächtlich.
»Seit wann?«
»Seit gestern.« Hartleib hielt Schöller seine linke Halshälfte entgegen. »Ich war beim Arzt. Hier! Siehste das Pflaster hinterm Ohr? Nikotin zum Abgewöhnen.«
Schöller lachte und hustete gleich darauf. »Toller Trick. Nikotinentzug mit Nikotin. Na klar.«
»Wenigstens das habt ihr gemeinsam, Pohlmann und du.«
Schöller sah auf. Seiner Meinung nach hatten sie überhaupt nichts gemeinsam.
»Na, ihr beide werdet euch eines Tages auf ganz natürliche Weise umbringen, mit ’ner letzten Kippe im Hals. Er ’ne selbstgedrehte, du ’ne spanische.«
»Du hältst das nicht durch.« Bohrender Neid lag in Schöllers Stimme.
»Garantiert. Sport und Disziplin. Und deine ewige Schnorrerei war ich auch leid.« Hartleib verschränkte die Arme und betrachtete seinen schmachtenden Kollegen. Er legte den Kopf ein wenig in den Nacken und wirkte in dieser Haltung herablassend auf Schöller. Genau das war auch seine Absicht.
»Okay, zurück zu Pohlmann. Du wolltest wissen, was er hat, was du nicht hast. Ich sag’s dir.« Hartleib grinste und diese Grimasse erreichte Schöller wie eine schallende Ohrfeige. »Er ist clever.« Hartleib hob die Hand und korrigierte sich. »Nein, warte … Er ist gerissen.«
»Du meinst, er war, bevor er …«
Werner protestierte entschieden. »Schätze, das kann jedem passieren. Viele Leute bekommen heutzutage einen Burn-out: Ärzte, Lehrer, Manager, Sekretärinnen, Musiker, warum nicht auch Polizisten. Und dann noch die Sache mit Sabine …«
Schöller hob die Hände, so, als wollte er sich ergeben. »Okay, aber trotzdem. Vielleicht wird er nie wieder so fit sein wie damals.«
»Das hoffst du vielleicht, aber ich kann dir versichern, dass er wieder der Alte sein wird. Er ist schlau. Bevor er abhaute, hatte er einen siebten Sinn für manche Sachen. Keine Ahnung, wie er das machte. Wenn keiner mehr weiterwusste, kam Pohlmann daher, zog irgendeinen Joker aus der Tasche und zack – Fall gelöst.«
Hartleib hustete. Schöller auch.
»Nee, wirklich«, fuhr Hartleib fort. »Du kennst ihn ja nicht so richtig. Bist ihm ja erst einen Monat vor seiner Abreise begegnet.«
Schöller ging in seinem verrauchten Büro auf und ab. Gedanken an eine neue Packung Zigaretten blieben wie eine sich festgebissene Zecke in seinem Gehirn haften. Schließlich wurde ihm wieder bewusst, dass man dabei war, an einem Bein des Sessels zu sägen, auf dem er saß.
»Hallo? Schon vergessen? Ich bin der offizielle Ersatz für Pohlmann.« Schöller hackte mit seinem rechten Daumen Falten in sein gebügeltes Hemd. Sein novemberbleiches Gesicht färbte sich rosa. »Wenn Pohlmann aus seinem bolivianischen Nest zurückkommt, bedeutet das, das ich demnächst gehen kann. Außendienst, Strafzettel schreiben – oder wie darf ich das verstehen?«
»Ecuador«, korrigierte ihn Hartleib und achtete darauf, seiner Stimme eine Prise Überheblichkeit zu verleihen. Endlich war der Moment gekommen, Klaus Schöller aus der Fassung zu bringen, und er genoss diesen Moment mehr als den faden Sex mit seiner zurzeit übellaunigen Frau.
»Puerto Lopez, um genau zu sein. Whale watching, Piña colada, dunkelgebräunte Mädels am Strand.« Hartleib ließ den Blick in den wolkenverhangenen Himmel Hamburgs schweifen. »Ich find das klasse. Warum denn nicht? Würdest du auch machen, wenn du könntest.«
Schöller sinnierte und musste ihm leider recht geben.
»Tja, wahrscheinlich würd ich das. Doch ich versteh’s trotzdem nicht. Pohlmann hatte fast zwei Jahre Auszeit. Warum sollte er aus seinem Paradies freiwillig zurückkommen wollen?« Hartleib schloss sein Sakko und sah Schöller eine Weile an, ohne gleich etwas zu erwidern. Dann wusste er die Antwort. »Weil er sich schon nach einem Jahr zu Tode gelangweilt hat, deshalb. Weil er es satt hat, Touristen in seinem kleinen Hotel zu bedienen. Weil er zu schlau ist, um mit 42 bei Daiquiris zu verblöden. Außerdem hat – und das behältst du bitte für dich, verstanden? – seine Freundin was mit einem anderen gehabt. Martin hat die beiden sogar erwischt.«
Bereits in diesem Augenblick bereute Werner Hartleib die Worte, die ihm unbedacht entwichen waren. Doch nun gab es kein Zurück mehr. Also versuchte er, das Beste aus der Situation zu machen und fügte erklärend hinzu: »Motor vom Boot kaputt, Tour musste ausfallen, ist früher nach Hause gekommen – ganz klassisch.« Hartleib nickte in Gedanken. »Ich schätze, er lässt alles liegen und stehen und ist froh, mal wieder ordentliches Hamburger Schietwetter zu schnuppern. Immer nur Sonne ist doch auch blöd, oder?«
Schöller konnte die Ironie kaum ertragen und verzog das Gesicht. »Ja, klar, total blöd. Und Seehunde gibt es hier auch, oder wie?«
»Genau.«
Hartleib verließ das Büro und schloss die Tür hinter sich. Er sah Schöller am Fenster stehen und sich auf einem Fingernagel herumbeißen. Der Geruch in dem Raum erschien ihm, der sich seit 22 Stunden zu den militanten Nichtrauchern zählte, unerträglich, und er wollte nicht die ganze Abteilung mit den wabernden Überresten der Fortuna, der Glücklichen, verseuchen. Warum sich die Spanier ausgerechnet die Glücks- und Schicksalsgöttin der römischen Mythologie für ihre Zigarettenmarke ausgeliehen hatten, war Hartleib schleierhaft. Es würde vermutlich keinen tieferen Sinn haben, außer dass Schöller in diesem Moment in Entbehrung seiner Zigaretten alles andere als glücklich war.
Hamburg, 1. November 2010
Der Flughafen Fuhlsbüttel lag, zum Leidwesen aller Anwohner, denen die landenden Flieger zum Greifen nahe waren, noch innerhalb von Hamburgs Toren, und alle, die in den Süden oder Norden flüchten wollten, kamen nicht umhin, von hier abheben zu müssen. Doch jetzt im November lag eine eigenartig gespenstische Stille über dem sonst hoffnungslos überfüllten Ort. Ausgerechnet in diesem Monat, in dem, gemäß einer Umfrage unter Hamburger Bürgern, die trübsinnigsten Tage des Jahres lagen, waren die Hallen für Abflug und Ankunft seltsam verlassen.
Eine Putzkolonne schob ihre Reinigungsgeräte in symmetrischen Bahnen über die Fliesen. Jene, die diese Geräte mit Unmut bedienten, dachten mit Wehmut an das eine oder andere auf den Monitoren aufleuchtende Reiseziel. Außerhalb der Ankunftshalle waberte eine trübe, dunkelgraue Masse über eingezogenen Köpfen, und im Unterbewusstsein befürchtete man, sie könne einfach hinunterfallen. Taxifahrer lasen ihre Bild-Zeitung zum dritten Mal und rechneten damit, am Monatsende rote Zahlen auf ihren Konten vorzufinden. Die startenden Flieger über ihnen brauchten geraume Zeit, bis die Sonne das Cockpit wieder erhellte. Der Monat mit der höchsten Selbstmordrate des Jahres.
Kriminalhauptkommissar Conrad Lorenz und Oberkommissar Werner Hartleib reckten die weißen Hälse und hielten innerhalb derer, die wie sie auf Bekannte oder Verwandte warteten, Ausschau nach einem Mann, den sie seit fast zwei Jahren nicht mehr gesehen hatten. Die Geschichte von Martin Pohlmann war im Kollegenkreis schnell erzählt, sofern man sich an die Fakten hielt und sich nicht um wuchernde Gerüchte scherte, die das Wesentliche umrankten: Verlobte bei einem Autounfall ums Leben gekommen, Burn-out, Nase voll vom Job, Ärger mit dem Vater, vorzeitig ausbezahltes Erbe und Abflug ins Nirwana. Nette Frau kennengelernt, kleines Hotel gepachtet, Müßiggang und täglicher Sex bis in alle Ewigkeit. Es gab da auch eine kleine, nette Homepage von einem Hotel an der Küste Ecuadors mit Bildern, die einen sofort die Koffer packen ließen, doch ein Foto vom Besitzer fehlte. Nur eine lächelnde Ecuadorianerin mit einem Tablett in den Händen, beladen mit exotischen Cocktails, posierte für die Kamera. Ob diese Frau jene war, welche mit ihm? Täglich? Man scrollte vergeblich nach weiteren diesbezüglichen Hinweisen und war nicht überrascht, dass man ernsthaft darüber nachdachte, ob man Martins Beispiel folgen sollte oder nicht. In der Regel klappte man resigniert den Laptop wieder zu und blieb in der Komfortzone stecken, in der man sich arrangiert hatte.
Lorenz und Hartleib rechneten mit einem glücklich aussehenden Mann Ende 42, braun gebrannt und so erholt, dass man es kaum aushalten konnte.
Dann sahen sie ihn aus der Menge der Ankommenden hervorstechen. Das Gegenteil von dem, was sie erwartet hatten, ließ sie schaudern und jeden Gedanken an einen Ausstieg schnell wieder vergessen oder wenigstens für eine Zeit verdrängen.
Kapitel 3
Steinhöring, 18. August 1944
Der Hauptmann in der schwarzen SS-Uniform hielt eine Weile dem Anblick des Mädchens, das bewegungslos auf dem Bett lag, stand. Schließlich wandte er sich abrupt ab.
»Ich will Dr. Reuter sprechen, sofort!«
Sogleich nickte die Schwester und lief los. Sie hielt ihre Haube fest, während sie zum Nebengebäude rannte, um nach dem diensthabenden Arzt zu suchen. Gottlob erreichte sie Dr. Reuter nach mehrfachem Rufen und aufdringlichem Schellen an seiner Wohnungstür. Immerhin war Sonntag.
Der Arzt öffnete die Tür zunächst nur einen Spaltbreit, und man sah ihm an, dass er soeben aus einem erholsamen Nachmittagsschlaf gerissen worden war. »Was ist denn, um Himmels willen?« Reuter rückte die Nickelbrille auf der Nase zurecht und glättete die zerzausten Haare. »Ist etwas passiert?«
»So ungefähr.« Die Schwester rieb sich die feuchten Hände. »Der Vater von Hedwig wünscht Sie umgehend zu sprechen.«
Sofort war der Arzt hellwach. »Na schön, geben Sie mir zwei Minuten. Ich komme sofort.«
Dr. Reuter schloss die Tür, eilte ins Bad, warf sich kaltes Wasser ins Gesicht, frisierte sich und zog seinen gestärkten weißen Kittel über. Ein silbereloxiertes Schild mit seinem vollen Namen und Titel prangte über der linken Brusttasche. Er eilte die Treppe zu Schwester Hildegard hinunter, die auf ihn gewartet hatte. Sie fürchtete sich, allein zurückzugehen, und war dankbar, dass der Arzt Wort gehalten und sich beeilt hatte. Als sie außer Atem im Gemeinschaftszimmer der Mädchen angekommen waren, hatte der Vater einen gewissen Abstand zu dem Kind eingenommen, das noch immer unbeweglich auf dem Bett verharrte. Er stand da und hatte die Arme derart fest um seinen Körper geschlungen, als wolle er die zerfallende Ordnung in seinem Inneren mit den Händen zusammenhalten. Obwohl er es gewohnt war, Soldaten zu befehligen, fühlte er sich aufs Äußerste unbehaglich. Kaum erblickte er Dr. Reuter, drehte er sich zu ihm um und schritt ihm entgegen. Er schien froh zu sein, keine Minute länger als nötig allein in der Anwesenheit des Kindes verbringen zu müssen, obgleich es als sein eigenes galt. »Ich wünsche eine Erklärung, Doktor. Was geht hier vor?« Der Kommandant fingerte fahrig an seinem Schnurrbart herum.
»Bitte beruhigen Sie sich. Hin und wieder kommt so etwas vor.«
Der Offizier berührte nun seine Stirn und sein Haar, das mit einem Scheitel versehen war, präzise gezogen wie mit einem Lineal. Er schnellte zu dem Doktor vor und trat dicht an sein Gesicht heran. Seine Tritte hallten kalt auf dem Boden. »Wollen Sie mich beleidigen? Ich bin Deutscher arischer Herkunft. Da kommt so etwas nicht vor!« Der Besucher musterte erneut das Kind. Es war ein zorniger Blick, der das Kind traf, als könnten Blicke gemeinhin etwas ausrichten.
Dr. Reuter wiegelte ab. »Aber nein, ganz sicher nicht. So war das nicht gemeint. Ich wollte sagen, das kommt schon mal vor, wenn die Mutter eines Kindes bei der Geburt verstirbt und das Kind somit ohne seine Mutter aufwächst.« Der Besucher blickte an Reuter vorbei und nickte. Diese Erklärung schien ihm zu gefallen. Es lag ganz sicher nicht daran, dass das Kind ohne seinen Vater aufwachsen musste und es sich daher so merkwürdig benahm.
»Kann ich Sie unter vier Augen sprechen, Doktor?«
Dr. Reuter knöpfte seinen Kittel bis zum Hals zu, als stünde eine ernste Patientenuntersuchung an.
»Schwester Hildegard, wären Sie so freundlich, in der Küche nach dem Rechten zu sehen?«
Sofort war die Schwester aus dem Zimmer verschwunden, doch sie verbarg sich hinter der Tür, wo sie den Worten der Männer lauschen konnte. Ein gefährliches, sogar lebensgefährliches Unterfangen, dessen sie sich nicht bewusst war. Was sie antrieb zu bleiben, war die Zuneigung zu dem Mädchen.
»Hören Sie, Doktor, es ist mir gleichgültig, wie Sie es anstellen, aber wenn der Zustand des Kindes dem Reichsführer SS zu Ohren kommt, haben Sie und ich die größten Schwierigkeiten. Das dürfte Ihnen klar sein. Es ist ja nicht so, als würde etwas mit meinem Erbgut nicht stimmen. Der andere Junge, für den ich als Zeugungshelfer dienen konnte, und mein Sohn Heinrich, den ich mit meiner Frau gezeugt habe, sind wohlauf und gedeihen prächtig. Sie sind blond, haben strahlend blaue Augen und werden gute deutsche, arische Herrenmenschen werden, aber dieses …, dieses Mädchen hier …«
Der Vater von Hedwig wies mit einer abfälligen Geste zu ihr hin. Beide vergaßen, dass sie gesunde Ohren hatte und jedes Wort verstehen konnte, was gesprochen wurde, selbst wenn sie sich tot stellte wie ein auf dem Rücken liegender Marienkäfer.
Der Arzt versuchte, seine Stellung als diensthabender Heimleiter professionell zu vertreten. Er legte die Fingerspitzen wie zu einem Indianerzelt aneinander und malte sich aus, er würde vor Studenten sprechen. Vor harmlosen, unbedeutenden Studenten.
»Nun, wir haben drei Möglichkeiten. Die erste ist, das Kind für lebensunwert zu erklären und entsprechend zu verfahren. Die andere Option ist, ihren vollständigen Namen zu ändern und sie zur Adoption freizugeben.« Reuter wandte sich dem Mädchen zu. »Es gibt viele Eltern, die sich sehnlichst Kinder wünschen oder nach dem ersten keine mehr bekommen können. Der Führer verlangt nach kinderreichen Familien, und es ist ein hübsches Mädchen, obgleich sie nicht blond ist. Vielleicht verliert sich die Haarfarbe noch und bleicht nach.«
»Und die dritte Möglichkeit?«, drängte der Besucher.
»Nun, wir könnten sie in eine Nervenheilanstalt einweisen und ein paar Tests mit ihr durchführen lassen, um das Phänomen, mit dem wir es hier zu tun haben, näher zu erforschen. Man könnte vielleicht herausfinden, wie sich derartige Mängel in der Entwicklung künftig vermeiden lassen.«
Der Offizier dachte nach und wägte alle Möglichkeiten ab. Es durfte auf keinen Fall an die Ohren der Obrigkeit gelangen, dass mit seiner Tochter etwas nicht stimmte. Man würde Nachforschungen anstellen, und das musste um jeden Preis verhindert werden, selbst wenn es dem Kind das Leben kosten würde.
Der Arzt wusste, dass der sicherste Weg in der Erklärung der Lebensunwertigkeit bestehen würde. Eine gängige Praxis, deren Strafverfolgung nicht stattfand, zumindest nicht zu jener Zeit. Das Kind würde auf ewig mit vielen anderen Behinderten oder Zurückgebliebenen zum Schweigen gebracht werden.
Eine, wenn auch winzige, Gewissensregung hinderte ihn daran, diese Option sofort zu wählen und die anderen Möglichkeiten zu verwerfen. Und so traf er eine Entscheidung. »Ich denke, wir sollten versuchen, Ihre Tochter zur Adoption freizugeben.«
Der Offizier verengte die Augen und dachte nach. Diese Lösung würde bedeuten, dass die Kleine am Leben bleiben würde. Wenigstens für eine gewisse Zeit. Er nickte, näherte sich Reuter bis auf zehn Zentimeter und ließ ihn seinen bitteren Atem spüren. »Vernichten Sie sämtliche Aufzeichnungen, Krankenakten, alles. Hauptsache, Sie verbergen das auffällige Verhalten dieses Kindes. Diese Anfälle hat es nie gegeben! Sind wir uns darin einig?«
Reuter befreite sich aus der Nähe dieses Menschen und trat einen Schritt zurück, doch der Kommandant folgte ihm, als wäre er mit Reuters Hals durch ein unsichtbares Seil verbunden.
Wieder drang der Besucher auf ihn ein. »Falls eine Adoption unmöglich ist, lassen Sie sie in eine entsprechende Fachklinik oder eine geschlossene Anstalt einliefern.«
Dr. Reuter begriff den Ernst der Lage. Sein Gegenüber war so mächtig, dass ihn ein falsches Wort bei übergeordneten Instanzen ins KZ hätte bringen können, andererseits winkten honorige Beförderungen, wenn er diese Sache im Sinne des Offiziers regeln würde.
»Sie können sich auf mich verlassen. Das Kind Hedwig Strocka hat es ab morgen nie gegeben.«
Der Offizier trat einen Schritt zurück. Er hatte erreicht, was er wollte. »Gut. Dann bin ich erleichtert. Morgen in der Frühe lasse ich Ihnen neue Papiere für dieses Kind vorbeibringen.« Strocka schlich ein letztes Mal an das Bett der Vierjährigen. Sie starrte nach wie vor an die Decke, doch ihre Ohren waren weit geöffnet. Er sah sie an und wandte sich sogleich wieder ab.
In diesem Augenblick löschte er die Existenz seiner Tochter in seinem Bewusstsein.
»Bringen Sie sie weit weg.« Der Offizier verzog angewidert sein Gesicht. »Ich will sie nie wieder sehen.«
Kapitel 4
Hamburg-Fuhlsbüttel, 1. November 2010
Martin Pohlmann winkte träge zurück. Es war kurz vor drei Uhr am Nachmittag, als er seinen Kollegen und seinen ehemaligen Chef hinter der Absperrung erblickte. 24 Stunden Transfer lagen hinter ihm, und er war sich nicht wirklich sicher, ob er sich auf ein Wiedersehen freuen sollte. Während der Landung hatte er aus dem Fenster geschaut und, während die bemüht freundliche Stimme des Piloten eine Ansage machte, hiesiges Wetter wahrgenommen. Mit Skepsis betrachtete er die wartenden Menschen. Dann war es so weit.
Hauptkommissar Lorenz schüttelte die blasse Hand seines Exmitarbeiters überfreundlich. Er fragte sich, wie man sich in einer derartigen Situation verhielt.
Werner Hartleib blieb zurückhaltender.
Beide sprachen nicht aus, worüber sie sich wunderten: Pohlmann war käsebleich, hatte eine Vielzahl von Pickeln und Pusteln in unterschiedlichen Stadien wie ein Pubertierender im Gesicht, und jenes war ums Doppelte aufgedunsen als noch vor 22 Monaten. Der Bauch ebenso. Sein schrilles Outfit gab den Rest.
»Mensch, Pohlmann, gut sehen Sie aus«, log Lorenz.
Pohlmann lachte auf. »Geben Sie sich keine Mühe, Chef. Ich seh furchtbar aus, das weiß ich genau. Sonnenallergie am ganzen Körper.« Pohlmann schüttelte den Kopf. »Ist nicht witzig in so einer Umgebung.«
Schnell hatte sich die Frage nach einem Fehlen eines Bildes des Pächters des Hotels auf der Homepage geklärt. Lorenz, der Pohlmann des Öfteren heimlich beneidet hatte, grinste verstohlen.
»Hi, Werner. Na, wie geht’s?« Werner Hartleib und Martin sahen sich in die Augen und schüttelten sich die Hände.
»Ganz okay. Alles beim Alten.«
Martin nickte. »Bist schlanker geworden. Gehste immer noch joggen?«
»Nächstes Jahr mach ich ’nen Marathon. Hab acht Kilo runter.« Martin Pohlmann sah neidisch an Werners flachem Bauch herab.
Während sie den Ausgang passierten, weinte der Himmel zur Begrüßung. Die drei Polizisten betraten den Gehweg und Pohlmann betrachtete gequält die große Pfütze, die sie bis zum Wagen überwinden mussten.
Nachdem Pohlmann selig eine Zigarette geraucht hatte, stiegen sie in den Polizeiwagen, der in erster Reihe parkte.
Die Fahrt verlief sonderbar: Zu Beginn noch oberflächliches Geplänkel, denn niemand wollte darüber reden, was wirklich in Ecuador passiert war. Untreue Partnerin statt ewiger Sex, Langeweile statt Müßiggang, Handtücher klauende Hotelgäste statt Paradies, Pickel statt Bräune. Lorenz sah in den Rückspiegel und fand Pohlmann schlafend vor.
Jetlag.
Lorenz und Hartleib bogen in die Straße ein, in der Pohlmann zwei Jahre zuvor gewohnt hatte. Sie gingen davon aus, dass sich an der alten Adresse nichts geändert hatte, und hielten im Prätoriusweg 17 in Eimsbüttel. Lorenz drehte sich auf dem Fahrersitz zu Pohlmann um und schüttelte den Kopf. Der Mund seines Fahrgastes stand offen, und kehlige Schnarchgeräusche übertönten den Motor.
Hartleib rüttelte am Knie des Kollegen und weckte ihn mit lauter Stimme. »Hey, Martin, wir sind da.«
Pohlmann schreckte aus seinem Traum und richtete sich auf. Er sah aus dem linken und rechten Fenster und begriff recht spät, wo er sich befand. Dann nickte er grunzend. Er kratzte sich an seinem Kopf und das Haar glänzte fettig. Der Flug musste wirklich sehr lang gewesen sein.
»Danke fürs Abholen. Okay, dann werd ich mal.« Pohlmann öffnete die Tür des Dienstwagens und schälte sich aus dem Fond heraus. Lorenz und Hartleib stiegen auch aus. Lorenz holte das Gepäck aus dem Kofferraum, während Hartleib Pohlmann verstohlen musterte.
Lorenz stellte die Koffer auf den Gehweg. »Ich weiß, Sie würden sich gern erst mal so richtig ausschlafen und ein paar Tage wieder eingewöhnen, aber ich muss Sie bitten, morgen früh ins Präsidium zu kommen.«
Pohlmann zog den Griff aus dem Trolli. »Der Fall, den Sie am Telefon angedeutet haben?«
Lorenz nickte.
»Ist neun okay?«
»Meinetwegen«, meinte Lorenz. Eigentlich wäre ihm acht Uhr lieber gewesen, doch in Anbetracht der Umstände …
»Dann bis morgen.« Pohlmann drehte sich um, nahm den zweiten Trolli an die andere Hand und ging zur Tür des Mehrfamilienhauses. Es begann heftig zu regnen. Pohlmanns Blick verfinsterte sich. Vor der Tür begann er nachzudenken, in welchem Gepäckstück er die Hausschlüssel verstaut hatte. Er konnte sich nicht einmal daran erinnern, ob er sie überhaupt eingesteckt hatte, als er Ecuador verlassen hatte.
Er stand unter dem kleinen Vordach des Hauses und öffnete nacheinander die Reißverschlüsse seines Rucksackes und beider Koffer. Kein Klimpern war zu hören und kein Schlüssel zu ertasten. Nun war er sich sicher, dass es keine Schlüssel für die Tür, vor der er stand, gab. Mist, schimpfte er. Er klopfte die Taschen seiner Lederjacke ab, aber auch da war nichts. Er versuchte, sich daran zu erinnern, wo er vor fast zwei Jahren den Schlüsselbund deponiert hatte, doch diese Sache schien wie ausgelöscht aus seinem Hirn. Er nahm sich vor, zu einem späteren Zeitpunkt darüber nachzudenken, wenn er nicht mehr so müde wäre. Er schellte bei Frau Lutter, einer alten Dame im Erdgeschoss, und freute sich, als sie ihm öffnete.
Mit vielen Worten musste er ihr erklären, wie es ihm ging, wie die Reise war und überhaupt müsse er ihr beim Tee alles über das wilde Land in Südamerika erzählen. Martin schwor ihr bei allen Heiligen, die er nicht kannte, dass er ihr ausführlich berichten würde, doch jetzt müsse er erst mal etwas Schlaf nachholen. Dafür hätte sie doch sicher Verständnis. Und ob sie noch den Schlüssel hätte, den er ihr mal vor Jahren gegeben hatte. Sie verschwand im Inneren ihrer Wohnung, und Martin hörte sie aufgeregt klimpern. Sie kam wieder heraus, schlug sich an die Stirn und erinnerte ihn daran, dass er ihr den Schlüssel vor der Reise abgenommen hatte. Martin zog ein altes Nokia-Handy aus der Tasche, was lediglich zum Telefonieren taugte, schaltete es ein und sah, wie der kleine Balken, der die Energie des Gerätes anzeigte, mit einem schrillen Piepen erlosch. Der Akku hatte schon vor dem Flug den Geist aufgegeben.
»Darf ich mal Ihr Telefon benutzen?«
»Inland?«, fragte sie nervös.
»Schlüsseldienst. Ich brauche ein neues Schloss.«
Nach 20 Minuten in Frau Lutters Wohnung wurde Martin von einem stämmigen Mann mit einer Klempnertasche erlöst.
»Dritter Stock«, lotste ihn Martin.
»Kein Aufzug?«
»Nee, kein Aufzug.«
Der Schlüsselexperte schleppte sich und seine Tasche Stufe für Stufe empor. Als er oben ankam, schwitzte er stark und ließ klirrend die Tasche fallen. »Die hier? Pohlmann?«
Martin nickte und zeigte ihm unaufgefordert den Personalausweis. Der Dicke sah ihn sich nicht an. Es war ihm egal, solange bezahlt wurde.
Mit wenigen Griffen, einer Bohrung und einem kurzen Krachen war die Tür offen. Der alte Zylinder wurde entfernt, der neue montiert und 300 Euro kassiert.
Willkommen zu Hause.
Martin drückte die Tür auf und schob Tonnen von Werbung, die durch den Briefschlitz geworfen worden waren, zurück. Er rollte seine Koffer hinein, stellte sie ab und schloss die Tür, nachdem er mit dem Fuß das Altpapier an die Wand gekickt hatte.
Eine seltsame Stimmung befiel ihn. Der Ort, den er auf immer verlassen wollte, hatte ihn wieder. Er fühlte sich allein. Es roch nach abgestandener Luft, und obwohl er die Heizungen vor der Abreise auf eins gestellt hatte, kroch die Kälte der Mauern unter seine Haut. Nichts Gemütliches oder Heimeliges empfing ihn.
Martin schüttelte die trüben Gedanken wie lästige Fliegen ab und beschloss, das einzig Vernünftige zu tun, was in seiner Situation zu tun ratsam war: ausgiebig zu schlafen.
2. November 2010
Am nächsten Morgen stand Pohlmann um zehn Uhr bei Lorenz auf der Matte. Er empfand sein nicht ganz pünktliches Erscheinen in Anbetracht der Zeitumstellung als gerechtfertigt. Ein letztes Mal sah er an sich herab: Er war unpassend gekleidet. Die Hemden, die sich in seinem Kleiderschrank stapelten, hatten die Größe M. Seit einem Jahr brauchte er L. Die Hosen, die er vor seiner Abreise getragen hatte, entsprachen der Konfektionsgröße 48. Nun brauchte er 52. Also musste er sich aus seinem Koffer bedienen, und dort fand er nur schlabberige Hawaii-Hemden und löchrige, abgewetzte Jeans. Es war schließlich nicht seine Idee gewesen, gleich am ersten Tag parat zu stehen, doch er beruhigte sich mit dem Gedanken, dass er heute nur ein Briefing und ein Gläschen Sekt bekommen würde. Doch er sollte sich gründlich getäuscht haben.
*
Unter normalen Umständen hätte sich der frisch eingetroffene Beamte ein paar Tage akklimatisieren müssen, doch leider herrschten zurzeit in Hamburg keine normalen Zustände. Lorenz öffnete die Tür, bat Martin herein und studierte dessen Outfit. Einen Kommentar hielt er zurück. Martin sah sich um. Es war unverändert unordentlich, und niemand erwartete ihn. Es gab keinen Sekt, kein Willkommens-Trärä, nichts. Martin wunderte sich nur.
Lorenz kramte in einer Schublade herum, als Hartleib das Büro betrat. Er begrüßte ihn nüchtern. Martin kam die Situation grotesk vor. Irgendetwas stimmte hier nicht, nichts war, wie es eigentlich hätte sein sollen oder wie man es normalerweise erwartet hätte. Dann fand Lorenz, wonach er gesucht hatte, und stammelte verlegen: »Hören Sie, Pohlmann. Tut mir echt leid, dass ich Sie dermaßen überfallen muss, aber ich habe hier einen kleinen, na, nennen wir es mal Wiedereinstiegsfall, der Ihre alten Instinkte zum Erwachen bringen soll.« Lorenz überreichte Pohlmann eine dünne Akte und legte den Kopf schief. Er kratzte sich im Nacken. Man merkte ihm mühelos an, dass es ihm unangenehm war. »Das Problem ist, es eilt leider.«
Pohlmann schlug die Akte auf, und der Stempel eines bestimmten Krankenhauses erregte seine Aufmerksamkeit. »Was ist das denn?« Er sah abwechselnd in die Gesichter seiner Gegenüber.
Pohlmann deutete auf den Stempel und das Dokument, das versiegelt war. »Es ist nicht das, was ich vermute, oder? Es geht nicht wirklich um einen Insassen im Landeskrankenhaus? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst?« Martins Stimme wirkte brüchig. »Ich komme gerade aus Ecuador. So schlimm war es da drüben nun auch wieder nicht.«
Lorenz wiegelte ab. »Nein, es geht nicht nur um einen Insassen, sondern leider auch um den Tod jenes Psychiaters, bei dem Sie damals Ihre Therapie begonnen hatten.«
Pohlmann wandte sich ab und kramte längst verdrängte Erinnerungen wieder hervor. »Professor Keller ist tot?«, fragte er leise.
Lorenz nickte und legte die Stirn in Falten. »Verdacht auf Selbstmord. Vor vier Tagen. Kurz bevor Sie mich aus Ecuador angerufen haben. Hat sich in den Kopf geschossen.« Lorenz rieb sich die Hände. Jetzt, nachdem er Pohlmann gegenüberstand, mit ihm sprach, sich an frühere Zeiten erinnerte, wusste er, dass es die richtige Entscheidung gewesen war, diesen Fall nur ihm übertragen zu können. Er schien als Einziger in Frage zu kommen, weil er den Professor so gut kannte wie kein anderer im Präsidium. Außerdem traute Lorenz Schöller es ganz und gar nicht zu, in kurzer Zeit Ermittlungsergebnisse zu präsentieren, mit denen die Presse etwas anfangen konnte. Doch selbst wenn Lorenz überzeugt war, Pohlmann war es noch lange nicht. Hinzu kam, dass Lorenz einen lausigen Diplomaten abgab und dafür bekannt war, nicht lange drum herum zu reden, sondern einfach die Dinge beim Namen zu nennen. Dass er sich damit nicht immer Freunde schuf, war klar.
»Na, was für ein Zufall!«, blaffte Pohlmann Lorenz an. Hätte ich bloß nicht angerufen,schoss es ihm durch den Kopf.
Lorenz bemühte sich, Pohlmann zu beschwichtigen. »Aber darum geht es heute noch gar nicht. In erster Linie sollen Sie nur ein Buch abholen. Mehr nicht. Ist ganz schnell erledigt. Dauert fünf Minuten.«
Pohlmann sah an sich herab. »So? Ich muss dringend Klamotten kaufen und mich um meine Wohnung kümmern.«
»Na ja, zugegeben. Bisschen eigenwillig, Ihre Garderobe, aber ich denke, für heute wird’s gehen. Ist ja nicht zu ändern.«
»Und warum kann Werner das Buch nicht holen?«
»Kollege Hartleib hat heute keine Zeit. Auf seinem Schreibtisch türmen sich andere Fälle.«
Pohlmann warf Lorenz und Hartleib einen verärgerten Blick zu.
»Bringen Sie einfach das Tagebuch einer Frau Braun mit. Sie bezichtigt darin Professor Keller eines Mordes.« Lorenz wurde ernst und wollte seine Position als Chef festigen. »Ist doch klar, dass wir uns als Mordkommission darum kümmern müssen. So, das genügt für heute. Den Rest erkläre ich Ihnen morgen.«
»Was ist bloß so wichtig an diesem verdammten Buch?«
Lorenz blieb ungerührt, froh, den Fall endlich los zu sein.
»Sie sind schon angemeldet, Martin.« Dann fügte er einige Erklärungen hinzu, so als solle es wie eine Entschuldigung klingen. Doch wenn er Pohlmann richtig einschätzte, würde dieser sich erst dann zufriedengeben und den Auftrag ausführen, wenn sein Gehirn mehr Informationen hätte. Lorenz strich sich den ergrauten Kinnbart glatt.
»Na gut, ich erklär es Ihnen. Also, es geht um Folgendes: Sie erinnern sich doch an die Geschichte von damals, diesen Prozess einiger Lebensborn-Zöglinge gegen den Staat Deutschland.« Lorenz lachte gekünstelt auf. »Einen Prozess gegen den Staat zu führen, wo doch jeder weiß, dass das gar nicht geht. Hat ja auch nicht geklappt. Aber dann die Sache mit dem Nazi, da haben die Leute hingehört. Bad news are good news. In diesem Fall waren das sowieso good news. Einem alten Nazischwein trauert ja keiner ’ne Träne nach, oder?« Pohlmann gähnte und sah Lorenz fragend an. Lorenz fuhr fort: »Na ja, und Emilie Braun behauptet in diesem Buch, dass Professor Keller diesen Nazi umgebracht hat.« Martin nickte und zog den Reißverschluss der Jacke über dem frierenden Bauch zu. Alle Argumente, die er jetzt noch hätte vorbringen können, hätten Lorenz nicht davon abgehalten, stur zu bleiben. So kannte er seinen Chef und so war er geblieben. Willkommen zurück in Hamburg. Also beschloss er, sich schnell auf den Weg zu machen, um dessen Redeschwall abzukürzen.
Lorenz kramte einen Schlüsselbund hervor. »Ihren alten Dienstwagen gibt es auch noch. Könnte sein, dass er nicht gleich anspringt. Außer Schöller hat den niemand benutzt.«
Pohlmann verließ wie in Trance das Büro. Lorenz rief ihm nach: »Na dann, bis morgen um acht.«
Als Pohlmann außer Hörweite war, wandte sich Werner Hartleib seinem Chef zu. »Meinen Sie nicht, man hätte ihm einen Tag zur Erholung geben müssen? Wenigstens sich umziehen hätte er müssen, oder?« Lorenz zog die Stirn in Falten. Nun kamen ihm doch erste Bedenken, Pohlmann so früh ins Schlachtfeld geschickt zu haben, noch dazu in eins, in dem Pohlmann nicht vollständig Herr seiner Souveränität sein würde.
*
Pohlmann fand den zwölf Jahre alten VW-Passat auf dem Parkplatz. Er ignorierte den Mief von Schöller darin. Erstaunlicherweise sprang der Wagen nach dreimaligem Orgeln an.
Das Präsidium befand sich nicht unweit der Außenalster, einige Straßen von der ewig verstopften Adenauerallee entfernt, in St. Georg. Die idyllisch klingende Adresse lautete: Beim Strohhause 31. Einer Legende zufolge stammte der Name aus dem 17. Jahrhundert und beruhte auf der Existenz eines Hauses, in dem ein Schlagbaumwärter seine Wohnung hatte und dort eine lebhaft besuchte Gaststätte betrieb. Es handelte sich um einen Fachwerkbau, dessen Felder zwischen den Balken mit Strohgeflecht ausgefüllt waren. Eine andere Überlieferung besagte indes, dass an dieser Stelle ein Dorf gelegen haben solle, das der Hamburger Kavallerie als Strohlager diente. Wie dem auch gewesen sein mochte, St. Georg war wahrlich kein beschaulicher Ort, den man unbeschadet des Nachts passieren konnte, selbst wenn das Viertel seinen Namen dem nach dem Heiligen Georg benannten Lepra-Hospital verdankte, das um 1200 außerhalb der Stadt gegründet worden war. Bis in die 80er-Jahre hinein war St. Georg eher ein Ort, der mit Drogen- und Menschenhandel zu kämpfen und nun den Sprung in die Moderne geschafft hatte. Es reichte sogar für eine Schlagzeile in der Bild-Zeitung, in der es hieß, dass sich St. Georg gemausert hätte und sich Künstler, Angestellte und Freaks – so wörtlich – sauwohl dort fühlten. Kontrovers hingegen wurde nach wie vor die multikulturelle Vielfalt dieses Stadtteils diskutiert, in dem nach Meinung der meisten Anwohner ein Polizeipräsidium wie ein Licht in der Dunkelheit wirken würde.
Martin legte den ersten Gang ein und erinnerte sich an eine Route, die ihn um den Stau herum lotsen würde. Der kleine Umweg, der ihn auf schnellerem Wege zum Steintorwall führen würde, war ihm trotz seiner zweijährigen Abwesenheit sofort wieder präsent. Die Fahrt nach Norderstedt dauerte bei günstigen Verkehrsverhältnissen eine halbe Stunde. Er rechnete in dem Moment mit dem Doppelten, als er den Glockengießerwall hinter sich ließ und auf die Kennedybrücke fuhr. Der Stau lichtete sich erst auf der Schäferkampsallee. Er bog, nachdem er die Kieler Straße hinter sich gelassen hatte, bei Hamburg-Stellingen auf die A7 ab, die ihn in Windeseile gen Norden bringen sollte. Bei Hamburg-Schnelsen-Nord bog er ab, ohne sich über nennenswerte Verkehrsbehinderungen geärgert haben zu müssen, und traf schließlich über die B 432 in Norderstedt ein. Wie er zum Landeskrankenhaus kommen würde, wusste er. Leider war ihm die Strecke zur Psychiatrie nur allzu vertraut.
*
Pohlmann erreichte das etwas außerhalb liegende Klinikgeländeund parkte den Wagen auf dem Besucherparkplatz. Er beschloss, eine letzte Zigarette zu rauchen, bevor er die Tore, an die sich hohe Mauern anschlossen, durchqueren würde. Wieder sah er an sich herab. Wie ein Polizist im gehobenen Dienst sah er im Augenblick nicht aus, und hätte er seinen Dienstausweis nicht dabeigehabt, hätte man ihn im Inneren der Klinik womöglich gleich dabehalten. Er trug immer noch das Hawaii-Hemd und hatte die rötlichen Haare zu einem Zopf im Nacken zusammengebunden. Der für deutsche Verhältnisse nicht mehr zeitgemäße Schnurrbart war ebenfalls rötlich, eher klebrig-braun von jahrzehntelangem Samson und Drum-Missbrauch. Er rauchte eigentlich alles, was man rauchen konnte, in Ecuador gelegentlich auch vermischt mit Gras, doch hier in Hamburg freute er sich über heimische Tabakmarken, weniger jedoch über heimisches Wetter. Er nahm die letzten Züge seiner Zigarette und bemerkte, wie die Finger seiner linken Hand, in der er die Kippe hielt, zitterten. Er wusste genau, dass dieses Zittern nicht auf ein Defizit an Zucker in seinem Gehirn oder den noch in seinem Inneren herumspukenden Jetlag zurückzuführen war. Auch die für seine Verhältnisse sibirisch anmutenden Temperaturen waren nicht dafür verantwortlich. Es waren diese Mauern, die er zu durchschreiten beabsichtigte und die sein vegetatives Nervensystem in Aufruhr versetzten.
Nachdem Martin dem Pförtner den Ausweis gezeigt und dieser in der Besucherliste nachgesehen hatte, durfte er passieren.
Der übergewichtige Mann erhob sich aus seinem Stuhl und lehnte sich aus dem Fenster seines Häuschens. Während er Pohlmann hinterher sah und ungläubig den Kopf schüttelte, wackelte sein fettleibiges Doppelkinn wie jenes von Scooby-Doo.
Eine zunehmende Unruhe verdrängte Martins Müdigkeit und er fror. Von außen betrachtet wirkte das Gebäude keineswegs unfreundlich. Roter Backstein mit weiß getünchten Giebeln und kleinen Balkonen an der Frontseite vermittelten eher den Eindruck eines Hotels oder eines friedlichen Sanatoriums. Kräftiger Efeu klammerte sich an den feinen Ritzen und Unebenheiten des Fugenputzes fest und erklomm das von der Außenwelt abgeriegelte Gebäude. Vor dem Haus lag ein kleiner Park, in dem ein Gärtner das letzte Herbstlaub zusammenrechte und die verblühten Rhododendrenblüten abknipste. Er trug einen grünen Overall mit dem Logo der Klinik auf dem Rücken, zog den Reißverschluss hoch bis zum Hals, sah von seiner Arbeit auf und bedachte den ungewöhnlichen Besucher mit einem sonderbaren Blick. Für Pohlmann sollte dies nicht der einzige ihm Unbehagen einflößende Blick gewesen sein, denn immerhin konnte die nette Parkanlage nicht darüber hinwegtäuschen, dass hinter diesen Pforten gequälte Seelen lebten, die ihre Hände durch vergitterte Stäbe reckten und zeitweise ihre Dämonen in die Nacht hinausschrien.
Kapitel 5
Steinhöring, 18. August 1944
Der Offizier schloss die Tür seiner neuen Limousine und kam zur Ruhe. Alle Stimmen, seien sie von innen oder außen, verstummten mit einem soliden Knall. Der Chauffeur startete stumm den Motor. Ungefragt hätte er sich nie getraut, auch nur einen Laut von sich zu geben. Er hielt es für das Beste, den Mund zu halten, nicht einmal darüber nachzudenken, worin der wahre Sinn dieser ominösen Kinderheime lag. Auf dem Beifahrersitz hingegen saß ein Mann, in dessen Kopf sich die Gedanken überschlugen. Die Bilder dieses Mädchens, die er nicht abwehren konnte, verstörten ihn. Dieses Kind könnte seine gesamte Karriere ruinieren, jetzt, wo er schon so weit in der Gunst des Führers aufgestiegen war. Er dachte an die Worte des Arztes. Ja, es musste wohl an der Mutter des Kindes gelegen haben, dessen war er sich sicher. Sie war doch nicht so gesund gewesen, wie sie gesagt hatte. Ihr Erbgut musste fehlerhaft gewesen sein – eine Schande des deutschen Volkes. Sie war schwach und starb, in seinen Augen ein natürlicher Ausleseprozess, denn nur der Starke sollte überleben.
Dass man während des Zeugungsaktes nicht unbedingt sturzbetrunken sein sollte, um eine gesunde Entwicklung des Kindes zu gewährleisten, hielt er nicht für bedeutsam.
Indes beeilte sich Dr. Reuter, die Akten von Hedwig zu suchen. Auch er war erleichtert, dass der Besucher fort war. Er ging in sein Sprechzimmer, wo er die Unterlagen in einem abschließbaren, metallenen Karteischrank aufzuheben pflegte. Im geeigneten Moment trat Schwester Hildegard hinzu und täuschte vor, Ordnung machen zu wollen. »Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie etwas Bestimmtes?« Sie erblickte die bereitgelegte Akte von jenem Kind, das sie seit der Geburt betreut hatte. Hedwig Strocka, uneheliche Tochter eines rein arischen Offiziers, über Generationen hinweg – so die offizielle Version. Ein Prachtexemplar für den Führer, leider jedoch ein Mädchen, das nicht an der Waffe ausgebildet werden könnte. Ein sicherlich für manche Menschen liebenswertes, nicht allzu hässliches Kind, verschlossen zwar und nicht willens, sich mit Worten mitzuteilen, doch dass sie gar nicht redete, entsprach nicht der Wahrheit. Sie redete nicht mit jedem, aber sie hatte mit Schwester Hildegard geredet. Wann immer die Schwester sich um sie bemühte, fand sie die Tür, die man öffnen musste, um zu Hedwigs Inneren zu gelangen, eine Tür, die sonst niemand fand. Nur dann, wenn sie allein waren und kein anderer sie sah oder hörte, öffnete Hedwig die zarten, manchmal bläulich verfrorenen Lippen und überredete ihre Stimmbänder, mit sanften und weichen Tönen Worte entstehen zu lassen, die so niedlich und unschuldig klangen, dass sie unmittelbar Zugang zu Hildegards Herzen fanden.
»Bitte, halten Sie mich nicht für unverschämt, aber sagen Sie mir doch bitte, was mit Hedi geschehen soll.« Obwohl sie es bereits wusste, weil sie gelauscht hatte, durfte sie auf keinen Fall das Vertrauen ihres Vorgesetzten verlieren. Dr. Reuter schätzte den unermüdlichen Einsatz der Schwester für die Kinder und behandelte sie mit Respekt. Einen Augenblick hielt er inne, während er seine Hände in dem Karteischrank vergrub. Er überlegte, wie weit er sie in seine Pläne einweihen durfte.
»Die Hedwig kann nicht hierbleiben«, sagte er. »Sie schadet dem Ruf unserer Einrichtung. Sie ist geistig nicht gesund.« Dann fuhr er fort, Akten zu sichten. »Ich habe es mir noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Ich denke, ich werde sie einweisen lassen müssen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand dieses verstörte Mädchen adoptieren möchte. Sie ist eine Belastung für jede Familie, zumal in diesen Zeiten.«
Schwester Hildegard wurde unruhiger und sie konnte nicht länger an sich halten. »Ich könnte sie doch mitnehmen. Sie wissen doch, dass ich nach Bremen versetzt werde. In zwei Tagen reise ich ab.« Dr. Reuter wägte alle Eventualitäten ab. Es musste sichergestellt werden, dass es ab morgen keine Hedwig Strocka mehr gab, so oder so. Ein Tag mehr oder weniger würde vermutlich nichts ausmachen. Andererseits wäre das Kind ein geeignetes Objekt für neurologische Forschungen. Diese Art der geistigen Störung war weitgehend unerforscht, und es wäre gewiss interessant herauszufinden, unter welchen pharmazeutischen, physikalischen und operativen Bedingungen man Hedwigs Zunge lösen könnte. Ob sie jedoch eine Lobotomie, die Durchtrennung des hirnansässigen Stirnlappens, überleben würde, war fraglich. In Zeiten wie diesen schafften es die meisten nicht oder waren pflegebedürftig bis an ihr Lebensende.
Reuter hielt in seinen Bewegungen inne und blickte zu Schwester Hildegard auf. Es schien, als suche er in ihren Augen die richtige Antwort auf die schwierige Frage, wie man mit Hedwig verfahren solle. »Strocka war sehr ungehalten über den Zustand seiner Tochter. Ihnen ist ja nicht bekannt, was er angeordnet hat, aber von einer Verlegung hat er jedenfalls nicht gesprochen.«
»Er muss es ja nicht erfahren«, flehte Hildegard und berührte Dr. Reuter vertraulich am Arm. »Ich weiß, dass sie schwierig ist, aber ich habe wirklich keinerlei Mühe mit ihr.« Dann überlegte sie kurz, ob sie ihr Geheimnis Dr. Reuter mitteilen sollte. Es galt, alles in eine Waagschale zu werfen, um das Kind zu retten. »Hören Sie, ich weiß, Sie glauben, sie sei verrückt, weil sie nicht spricht und weil sie sich manchmal so sonderbar benimmt, aber das stimmt nicht. Sie ist nicht verrückt. Sie ist vielleicht ein wenig …«, Hildegard rang mit Mühe nach der korrekten Bezeichnung, »… sie ist einfach nur anders als die anderen, aber auf ihre Art doch liebenswert. Sie spricht mit mir! Ja, es stimmt. In meiner Gegenwart ist sie ganz normal. Glauben Sie mir, sie mag mich. Ich bin für sie wie die Mutter, die sie nie hatte.« Dr. Reuter wandte sich zu Hildegard um. 30 Jahre Erfahrung als praktischer Arzt in fast allen Belangen der angewandten Medizin hatten ihm nicht geholfen, einen Zugang zu dem Mädchen Hedwig Strocka zu bekommen, selbst wenn man seine Versuche nur als halbherzig bezeichnen konnte und er sich auf viele Kinder konzentrieren musste. Nun sagte ihm diese nicht approbierte Schwester, dass sie den Schlüssel zum Herzen dieses Mädchens besaß.
Schnell setzte sie nach. »Ja, es stimmt. Was soll ich machen? Ich mag sie und sie vertraut mir. Bitte, Herr Doktor. Sie sind doch ein guter Mensch.«
Dr. Reuter war seinerzeit Arzt aus Leidenschaft geworden, selbst wenn zu Kriegszeiten gewaltige Abstriche in ethischen Fragen gemacht werden mussten. Doch dieses Bitten und Drängen um das Kind rührte ihn. Ein Teil seines Herzens war menschlich geblieben, und er dachte sich: Was kann schon passieren? Schwester Hildegard würde mit einem Kind, dessen neuen Namen sie am nächsten Tage erfahren würden, von Bayern nach Niedersachsen reisen. Niemand würde argwöhnen, dass etwas daran nicht in Ordnung war. Weder im Zug noch an anderen Kontrollposten. Reuter wandte sich von der Schwester ab und ging in seinem Büro auf und ab. Er hatte keine Zeit, lange über diese Sache nachzudenken. Es galt nun, schnell und zugleich richtig zu entscheiden, und diese Entscheidung musste aus dem Gefühl und nicht aus der Vernunft heraus getroffen werden.
Schließlich willigte er ein. Die Tragweite dieser Entscheidung war ihm in diesem Moment nicht bewusst. »Also schön. Sie genießen mein Vertrauen, Schwester Hildegard. Nehmen Sie sie mit, aber ich möchte in regelmäßigen Abständen von Ihnen erfahren, wie sich das Kind entwickelt.«
Hildegard nickte. Ihre Augen strahlten über diesen kleinen Sieg, in einem Krieg, in dem Millionen umkamen, wenigstens ein Kind retten zu können. Hedi würde bei ihr bleiben können, wenigstens für eine gewisse Zeit.
In diesen Zeiten wusste niemand, ob der Tag, an dem man noch die warme Sommersonne genoss, nicht der letzte sein könnte. Doch es galt nur, für den jeweiligen Tag Sorge zu tragen und nicht für den nächsten, für eine ganze Woche oder einen Monat. Niemand kannte seine eigene Zukunft, geschweige denn den Zeitpunkt und die Art seines Todes. Im Hinblick auf das, was Schwester Hildegard zu erwarten hatte, war dies auch gut so, denn niemals hätte sie geahnt, dass sie die Jahreszeit, in der das Laub die Bäume verließ, nicht mehr erleben würde.
Kapitel 6
Hamburg-Norderstedt, 2. November 2010
Pohlmann durchschritt verschiedene Türen, die eigens für ihn geöffnet wurden. Übertrieben oft blickte er sich in alle Richtungen um, während er langsamen Schrittes vorwärts ging. Er wusste nicht genau, wovon oder durch wen er sich bedroht fühlte, doch seine Sinne waren geschärft. Ihm war, als ruhten tausend unsichtbare Augen auf ihm, auf jeder seiner Bewegungen und würden spöttisch und verhöhnend auf ihn herabblicken.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























