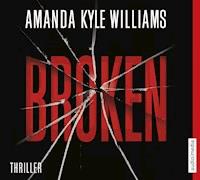
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Profilerin Keye Street
- Sprache: Deutsch
Es dauerte einige Sekunden, bis sie verstand, was sie da sah. Die schwarze Silhouette eines Mannes, der in ihrem Wohnzimmer stand und durch das Fenster zu ihr nach draußen blickte. Er war dunkel gekleidet und trug eine Skimaske. Er stand ganz still, dann blickte er sie plötzlich an. Er hob einen Arm, bildete mit Daumen und Zeigefinger eine Pistole, die er auf sie richtete, und machte eine Schießbewegung. Ein drückend heißer Sommer in Atlanta. Die Hitze ist so unerträglich, dass Dampf vom Asphalt der Peachtree Street hochsteigt. Privatdetektivin und Ex-FBI-Profilerin Keye Street hat sich fest vorgenommen, das Wochenende des 4. Juli zu genießen und ein paar ruhige Tage mit ihrem Freund zu verbringen: nur Aaron und sie und der ohrenbetäubende Lärm von Feuerwerken in der schwülen Nachtluft … Doch das Schicksal hat anderes für sie vorgesehen. Lieutenant Aaron Rauser wird vom Atlanta Police Department an einen verstörend grausamen Tatort gerufen: Ein dreizehnjähriger Junge wurde stranguliert. Gleichzeitig ist Keyes Hilfe gefragt: Ihre Cousine Miki behauptet, von einem Stalker verfolgt zu werden. Miki ist seit langem psychisch labil, darum bezweifelt Keye, dass wirklich nachts ein Mann in das Haus ihrer Cousine eingedrungen ist. Keye ist selbst trockene Alkoholikerin und hat wenig Lust, ins Fahrwasser ihrer instabilen Cousine zu geraten – aber da Miki nun mal zur Familie gehört, beschließt sie, ihr zu helfen. Ein weiterer Mord erschüttert Atlanta: Ein älterer Mann wurde erhängt, und obwohl beide Opfer nichts gemeinsam haben, tragen die Taten die Handschrift eines Serienkillers. Denn er hinterlässt eine ganz besondere Visitenkarte am Tatort …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amanda Kyle Williams
Broken
Thriller
Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Es dauerte einige Sekunden, bis sie verstand, was sie da sah. Die schwarze Silhouette eines Mannes, der in ihrem Wohnzimmer stand und durch das Fenster zu ihr nach draußen blickte. Er war dunkel gekleidet und trug eine Skimaske. Er stand ganz still, dann blickte er sie plötzlich an. Er hob einen Arm, bildete mit Daumen und Zeigefinger eine Pistole, die er auf sie richtete, und machte eine Schießbewegung.
Ein drückend heißer Sommer in Atlanta. Die Hitze ist so unerträglich, dass Dampf vom Asphalt der Peachtree Street hochsteigt. Privatdetektivin und Ex-FBI-Profilerin Keye Street hat sich fest vorgenommen, das Wochenende des 4. Juli zu genießen und ein paar ruhige Tage mit ihrem Freund zu verbringen: nur Aaron und sie und der ohrenbetäubende Lärm von Feuerwerken in der schwülen Nachtluft … Doch das Schicksal hat anderes für sie vorgesehen.
Lieutenant Aaron Rauser wird vom Atlanta Police Department an einen verstörend grausamen Tatort gerufen: Ein dreizehnjähriger Junge wurde stranguliert. Gleichzeitig ist Keyes Hilfe gefragt: Ihre Cousine Miki behauptet, von einem Stalker verfolgt zu werden. Miki ist seit langem psychisch labil, darum bezweifelt Keye, dass wirklich nachts ein Mann in das Haus ihrer Cousine eingedrungen ist. Keye ist selbst trockene Alkoholikerin und hat wenig Lust, ins Fahrwasser ihrer instabilen Cousine zu geraten – aber da Miki nun mal zur Familie gehört, beschließt sie, ihr zu helfen.
Ein weiterer Mord erschüttert Atlanta: Ein älterer Mann wurde erhängt, und obwohl beide Opfer nichts gemeinsam haben, tragen die Taten die Handschrift eines Serienkillers. Denn er hinterlässt eine ganz besondere Visitenkarte am Tatort …
Über Amanda Kyle Williams
Amanda Kyle Williams lebt in Atlanta im Süden der USA. Für die Keye-Street-Serie hat sie Kurse bei Brent Turvey, einem bekannten Kriminologen und Profiler, genommen, als Privatdetektivin fremde Menschen überwacht und als Gerichtsbotin gearbeitet. «CUT», ihr erster Roman mit Keye Street, erschien 2011 bei Wunderlich.
Inhaltsübersicht
Für meine Freundin Kari Bolin, deren
diabolische Phantasie mich selbst
an öden Tagen beflügelte.
PROLOG
Die Scheinwerferkegel strichen über einen prächtigen Magnolienbaum, als sie den Scheitelpunkt der Elizabeth Street erreichte. Die dicken weißen Blüten leuchteten in der Dunkelheit wie Zähne unter Schwarzlicht. Im Inman-Park-Viertel von Atlanta waren kurz vor elf an einem nieseligen Donnerstag die Bürgersteige hochgeklappt. Renovierte Einfamilienhäuser, gehobene Mittelschicht, ruhige Lage.
Zwei Wodka Martini zeigten Wirkung, und Miki Ashton gähnte zwischen den langsamen Schwenks der Scheibenwischer. Ja, sie konnte problemlos noch fahren, hatte sie ihren Freunden versichert. Nicht gesagt hatte sie, wie sehr ihr davor graute, in das leere viktorianische Haus zurückzukehren. Wie kommt es, dass man sich so einsam und verlassen fühlt, wenn man nach einem fröhlichen Beisammensein mit ein paar Drinks intus nach Hause fährt? Sie bedauerte, dass sie keine Haustiere hatte, keinen Hund, der sie begrüßen würde. Sie war mit Tieren aufgewachsen. Aber ihr Beruf, die vielen Reisen – es wäre nicht fair. Sie parkte den 76er Spitfire in der gepflasterten Einfahrt. Zwischen den Steinen wucherte Gras. Wieso hatten ihre Nachbarn anscheinend keinerlei Mühe, ihre Rasenflächen stets tadellos gepflegt zu halten?
Sie schob ein hüfthohes Holztor auf, das nicht mehr lackiert worden war, seit sie das Haus gekauft hatte, und dringend einen frischen weißen Anstrich brauchte. Dem Nachbarschaftsverein war ihre Nachlässigkeit ein Dorn im Auge. Etliche höflich formulierte Zettel in ihrem Briefkasten hatten sie an ihre Pflichten erinnert. Hatten die Leute keine anderen Sorgen?
Die Tasche über die Schulter gehängt, ging sie mit ausladenden Schritten in kniehohen Stiefeln über den nassen Weg zur Haustür. Ihre Absätze hallten hohl auf den gestrichenen Bohlen der umlaufenden Veranda wider. Ein unheimliches, gespenstisches Gefühl ließ sie stocken – das Gefühl, beobachtet zu werden. Nein. Nicht ganz. Beobachtet zu werden, daran war sie gewöhnt. Schließlich hörte Miki Ashton schon ihr Leben lang, dass sie hübsch war. Das hier war anders. Das hier hatte Zähne und Klauen. Es sträubte ihr die Nackenhaare. Plötzlich wollte sie weglaufen, als wäre sie sechs Jahre alt – als hätte sich ein Monster unter dem Bett versteckt, und sie müsste so schnell wie möglich so weit wie möglich weg. Im Laufe der Jahre hatte es reichlich Monster gegeben – Einweisungen, Verschreibungen, Suizidversuche, Rasierklingen, die eine oder andere Überdosis. Der bewaffnete Kampf gegen ihren eigenen Körper hatte begonnen, als sie vierzehn war und sich das erste Mal mit einer Rasierklinge die papierdünne Haut an den Handgelenken ritzte.
Unter einer einsamen Kugellampe fummelte sie mit den Schlüsseln herum. Sie musste sich endlich mal um bessere Beleuchtung kümmern. Wieder dieses Gefühl. Panik. Als würde gleich jemand mit einer Hockeymaske vor dem Gesicht und einer Kettensäge in der Hand aus den Büschen springen. Zu viele Filme. Zu viele Schmöker aus irgendwelchen Flughafenbuchläden.
Krieg endlich den verdammten Schlüssel ins Schloss.
Und dann hörte sie es. Miki hatte sich jedes Ächzen und jedes Seufzen eingeprägt, das das alte Haus von sich geben konnte. Vielleicht hätte sie ihre Medikamente nicht absetzen sollen. Vielleicht ging ihre Phantasie mit ihr durch …
Da war es wieder – die Holzdielen.
Drinnen.
Sie schlich über die Veranda zum Panoramafenster, die kleine Stiftlampe an ihrem Schlüsselbund fest in der Hand. Sie knipste sie an, und ein schwacher Lichtstrahl huschte über ihre fransenverzierte Ottomane, den Parkettboden, den antiken Schaukelstuhl, den sie auf einer Reise gekauft und sich nach Hause hatte schicken lassen, das Buch, das sie heute aufgeschlagen auf dem Couchtisch liegen gelassen hatte.
Dann war alles weg, das Licht wie abgeschnitten. Sie brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, was sie da vor sich sah – die dunkle Silhouette eines Mannes, der auf der anderen Seite des Fensters stand. Er blickte sie an – schwarze Kleidung, Skimaske –, reglos. Dann hob er seelenruhig den Arm, formte mit Daumen und Zeigefinger eine Pistole und drückte ab.
Der Schock katapultierte sie nach hinten. Schwindel kreiselte ihr durch den Kopf und erreichte dann ihre Kehle. Sie gab ihr Martini-Dinner von sich.
Irgendwo auf der Straße sprang ein Motor an.
Mikis Hand zitterte, als sie die Notrufnummer wählte.
1
Am Donnerstagabend klingelte mein Telefon.
«Ich muss dich sehen», sagte meine Cousine Miki.
Ach du Schande. Miki, die Tochter von Florence, der gestörten Schwester meiner Adoptivmutter. Als Jimmy und ich Kinder waren, wohnte sie auf einem Hausboot in ihrem eigenen Garten. Ich hatte Miki schon länger nicht gesehen. Wahrscheinlich war sie mal wieder in irgendein Drama verwickelt. Vielleicht steckte sie aber auch ernstlich in Schwierigkeiten. Miki zog Probleme magnetisch an.
Ich war so spät noch im Büro, um die Arbeit aufzuholen, die ich die ganze Woche über vor mir hergeschoben hatte, es war ein letzter verzweifelter Versuch, zum Unabhängigkeitstag ein langes Wochenende rauszuschlagen. Auch die Klimaanlage machte Überstunden. Atlantas drückend heißer Sommer war auf uns niedergegangen wie ein brennendes Gebäude.
Mein Name ist Keye Street. Ich betreibe eine kleine Detektei für INFORMATIONEN & ERMITTLUNGEN, wie ein Schild an meiner Bürotür verkündet. Und mit «klein» meine ich, dass sie nur aus mir und dem rotäugigen Computer-Nerd Neil Donovan besteht. Und mit «rotäugig» meine ich, dass er vermutlich heute Morgen schon einen Joint zu seinem Rührei geraucht hat. Von Haus aus bin ich Polizistin, Kriminologin, Psychologin und, na ja, Alkoholikerin. Ich war mal psychologische Gutachterin beim FBI, in der Abteilung für Verhaltensanalyse. Aber das hab ich in den Sand gesetzt, wie so ziemlich alles andere in meinem Leben damals. Deshalb bin ich jetzt Privatdetektivin. Die Arbeit liegt mir.
«Was ist los, Miki?», fragte ich. «Alles in Ordnung?»
«Nein», sagte meine liebreizende, rotblonde Cousine. Nebeneinander sahen wir beide aus wie Foto und Negativ. Ich bin eine chinesisch-amerikanische trockene Alkoholikerin mit Südstaatenakzent, weißen Eltern und einem schwulen afroamerikanischen Bruder. Neil ist überzeugt, man könnte diesen multiplen Minderheitenstatus irgendwie zu Geld machen. Vielleicht ein staatliches Förderprogramm. Generation-Y-Anspruchsdenken plus ein subversives Kifferhirn – da kann ja nichts Vernünftiges rauskommen.
Neil ist hauptsächlich für die Computerrecherchen zuständig, und ich hole Informationen ein, will heißen, ich hefte mich bestimmten Leuten an die Fersen, durchsuche ihren Müll, mache heimlich Fotos von ihnen, belausche ihre Unterhaltungen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, und stecke die Nase in ihre Privatangelegenheiten. Alles sehr glamourös. Wie mein mit Schokoriegel-Verpackungen und Starbucks-Bechern zugemüllter Wagen beweist. Unsere Kundenkartei besteht hauptsächlich aus Anwaltskanzleien und Headhunteragenturen, aber wir arbeiten für jeden, der Geheimnisse unter dem Teppich hervorgekehrt haben möchte. Vermisste Personen, Observierungen, Kautionseintreibungen und Gerichtszustellungen spülen auch dann Geld in die Kasse, wenn das Geschäft während der Winterferien eher mau läuft. Aber wenn es heiß wird in Atlanta und die grelle Südstaatensonne das Blut in unseren Adern zum Brodeln bringt, wenn die Kleidung knapper wird und in brechend vollen Straßencafés überarbeitete Kellner Tabletts mit eiskalten Getränken zu den Tischen schleppen, steht mein Telefon kaum noch still. Die Unartigen sichern mir den Lebensunterhalt. Damit habe ich kein Problem. Hauptsache, ich kann mir weiter meine Krispy-Kreme-Donuts leisten. Die ohne Schnickschnack, nur mit Zuckerguss und noch warm, sind meine derzeitige Sucht.
«Keye, ich muss dich jetzt sofort sehen», sagte Miki mit Nachdruck. «Es ist ernst.»
Ich ließ ein paarmal den Kopf kreisen. Bei Miki war immer alles total ernst. Ich war müde. Ich hatte tagsüber zwei Vorladungen zugestellt; bei einer musste ich einer Frau bis zu ihrem Arbeitsplatz folgen, mir ohne Rücksicht auf Verluste Zutritt zu ihrem Büro verschaffen und ihr den Schrieb hinwerfen, ehe sie ihren Kaffee abstellen konnte. Anschließend kämpfte ich mit dem Chaos rund um das Gerichtsgebäude von Fulton County, das sich Parkleitsystem nennt, erledigte den Papierkram für den Staatsanwalt, fuhr wieder los, spürte für Tyrones Kautionsbüro Quickbail einen Kautionsflüchtling in East Atlanta auf und lieferte ihn im Polizeipräsidium ab. Außerdem wartete meine zickige Katze schon seit Stunden auf ihre Portion Kondensmilch.
«Jemand ist in mein Haus eingebrochen, Keye. Ich kann da jetzt einfach nicht rein.»
Ich schnappte mir meine Schlüssel. «Ich hole dich ab.» Mikis Haus in Inman Park lag nur ein paar Blocks von meinem Büro an der Highland Road entfernt.
«Nein. Treffen wir uns im Gabe’s. Ich muss Leute um mich haben. Und ich brauche einen Drink.»
Ich nahm meinen Füller und biss darauf. Ich brauchte auch einen Drink, verdammt.
«Keye, bitte», sagte Miki, und da hörte ich etwas zum ersten Mal: echte Angst in der Stimme meiner Cousine.
Neun Minuten später fuhr ich auf den kleinen Parkplatz gegenüber vom Gabe’s an der Juniper Street. Der Laden war eine Mischung aus Kaminbar und Restaurant, mit Plüschsesseln, viel Platz zum Entspannen und einer Zigarrenlounge – so ein Lokal, wo Single Malt in genau der richtigen Temperatur serviert wird. Im Frühling und Sommer gab es Gourmet-Tapas auf der großen Veranda, die bis an die Straße reichte und einen Blick auf die verbaute Skyline bot, die Gäste drängten sich dort bis zum späten Abend. Das 14th Street Playhouse, das Alliance Theatre, die Symphony Hall und das Fox Theatre, alle diese Spielstätten versorgten das Gabe’s mit hipper Kundschaft, Multitasker, die sich mit dir unterhalten können und dabei gleichzeitig simsen, ihren Facebook-Status aktualisieren und die Weinkarte twittern.
Ich sah einen Menschenauflauf auf dem Parkplatz, als ich nach einer Lücke für den Impala suchte. Mein Instinkt sagte mir, dass Miki der Auslöser war. Ständig musste sie eine Show abziehen. Wann immer ich mit ihr aus gewesen war, stets hatte sie eine Entourage um sich, treue Anhänger, die sich in ihrem Glanz sonnen wollten. Auf diese Weise hielt sie alle auf Distanz und konnte gleichzeitig die Bewunderung genießen, die sie brauchte.
Ich parkte, bezahlte beim Parkwächter und ging in Richtung der Leute. Die Menge gut angezogener Menschen öffnete sich gerade so weit, dass ich die zarte Gestalt meiner Cousine in der Mitte sehen konnte. Als ich näher kam, roch ich Verbranntes und bemerkte ein kleines Feuer aus Zweigen und Laub und irgendetwas aus Stoff. Ich blieb am Rand stehen.
«Ihre schwarzen Handschuhe», flüsterte die Frau neben mir ehrfürchtig. Aha, die schwarzen Handschuhe. Erklärung überflüssig. Jeder in Mikis Leben kannte diese Handschuhe. Sie waren ein fester Bestandteil ihrer Depressionsrituale geworden. Ich glaube, wir hatten alle irgendwann mal gehofft, die Dinger zu tragen, würde Miki als Ausdruck ihres Unglücks genügen und sie davon abhalten, sich wieder selbst zu verletzen. Aber die Handschuhe hatten bloß als Warnung gedient. Irgendwer fand Miki dann in der Wanne, auf dem Fußboden, im Bett – mit aufgeschnittenen Pulsadern und so viel Barbituraten im Blut, dass selbst Keith Richards beeindruckt gewesen wäre.
Ich schob mich durch die Gruppe und sah Miki vor dem schwelenden Häufchen stehen. Jemand reichte ihr ein Sektglas. Sie hob das Glas dramatisch, als das letzte bisschen Stoff im Feuer zusammenschrumpfte. Jubel brach aus, während sie das Glas in einem Zug leerte.
Sie sah mich, lächelte und rief: «Ich hab die Kurve gekriegt, Keye. Der Vorhang hat sich geöffnet.» Und dann trat sie aus dem Kreis und ließ ihre Fans ohne ein Wort stehen. Sie umarmte mich und flüsterte: «Sei heute Abend mein Date. Beschütz mich vor den Wölfen.»
Ich hakte mich bei ihr ein, und wir überquerten die Juniper Street, schlängelten uns zwischen den Tischen auf der voll besetzten Veranda hindurch und gingen ins Gabe’s. Der erste Hauch von Tequila und Limette umarmte mich wie ein alter Freund. Inzwischen hab ich die meiste Zeit eigentlich nicht mal mehr Lust auf einen Drink. Nicht, wenn ich nachdenke. Aber es gibt Auslöser – ein Geruch, ein bestimmtes Glas, Geselligkeit –, da fängt mein Suchthirn fleißig an, die Erinnerungen zu romantisieren, zum Beispiel wie der erste Schluck des Tages den Stress lindert, wie ein guter Tawny Port nach dem Essen sich im Mund anfühlt und der Geschmack auf den Lippen bleibt. Dann spüre ich, dass meine Abstinenz auf der Kippe steht. Ich fühlte eine prickelnde Wärme im Nacken. Ich musste dringend wieder zu den Anonymen Alkoholikern. Natürlich hatte ich auch das sträflich vernachlässigt, wie so vieles.
Miki trug ein schwarzes Kleid, das ab den Knien ausgestellt war, eher Judy Jetson als Audrey Hepburn, und Overknee-Stiefel. Sie stellte sich neben mich an die Bar und sah mir forschend ins Gesicht. Wir mussten aussehen wie ein Liebespaar, was Miki garantiert einkalkuliert hatte. Auch so eine Methode, sich ihre Anhänger vom Leib zu halten.
«Alles in Ordnung?», fragte sie und fuhr dann fort, ohne mir Zeit zum Antworten zu geben. «Ach so, klar. Das mit dem Alkohol. Aber was soll’s? Ich passe schon auf, dass du dir nicht die Kante gibst. Na los, bestell dir einen Scheißdrink.»
«Das ist die schlechteste Idee des ganzen verdammten Tages.»
Sie griff in ihre Handtasche und ließ kurz ein Glasröhrchen mit einem schwarzen Deckel sehen. «Ich hab ein bisschen Koks dabei. Würde eine Line helfen?»
So ist meine Miki, denkt immer an andere. «Wohl kaum», antwortete ich mit mehr Abscheu, als ich ihr zeigen wollte. Wir alle schauten Miki seit Jahren bei ihrer unaufhaltsamen Selbstzerstörung zu. Ich war es echt leid. Ich hatte das alles selbst durchgemacht. Den Leuten, die uns spiegeln, gegenüber ist es mit unserer Toleranz nie weit her, oder?
Ich bestellte einen Traubensaft und erntete das gleiche Grinsen, das ich mir meistens gefallen lassen muss, wenn ich in einer Bar einen Traubensaft bestelle. Sie hatten natürlich keinen. «Okay, wie sieht’s mit Pepsi light aus?» Ein paar Leute starrten mich an. Pepsi in einer Coca-Cola-Stadt zu bestellen war Hochverrat.
«Wir haben Cola light», erwiderte der Barkeeper.
Ich entschied mich für ein Mineralwasser mit Zitrone, und Miki bestellte einen Wodka Martini, extra dirty. Wir gingen nach hinten durch zu einem freien Sofa mit Couchtisch. Im Raum verteilt standen lackierte Kirschholztischchen mit Schachbrettern. Und obwohl unser langer heißer Sommer in vollem Gange war, hatte man die Klimaanlage so eiskalt eingestellt, dass die Gaskamine die Luft wieder aufwärmen konnten. Von meinem Platz aus hatte ich einen guten Blick auf die im sanften Licht schimmernde Bar mit ihren Spiegeln. Ich schaute Miki an und versuchte, die Male an ihren Armen zu übersehen. Die dicken horizontalen Streifen aus weißem Narbengewebe erinnerten daran, wie verzweifelt sie gewesen war und wie zutiefst unfähig, sich selbst zu lieben. Es waren bestimmt acht oder zehn Schnitte an jedem Arm. An meiner Porzellanpuppen-Cousine wirkten sie besonders martialisch. Sie hatte vorhin die langen, schwarzen Handschuhe verbrannt, mit denen sie die Narben verdeckt hatte. Vielleicht war sie ja jetzt so weit, sie anzuschauen. Nicht zum ersten Mal war ich froh darüber, dass die DNA, die Mikis psychische Gesundheit ebenso vergiftet hatte wie die ihrer Mutter – vielleicht hatte sie sogar gelegentlich mit dem Glück meiner Adoptivmutter geflirtet –, nicht auch durch meine Adern rauschte. In Mutters Familie gab es etliche Fälle von Schwermut, über die der Mantel des Schweigens gebreitet wurde. Bei uns in den Südstaaten gibt keiner offen zu, wenn er an Depressionen leidet. Doch Florence und Miki hatten mit ihrem unverhohlenen und mitunter öffentlichen Kranksein die Familiengeheimnisse ans Licht gezerrt. Zum Glück war Miki jedes Mal rechtzeitig gefunden worden, wenn sie sich die Pulsadern aufgeschlitzt oder einen Haufen Pillen geschluckt hatte – von einem selbsternannten Aufpasser, einem Groupie, von jemandem aus dem Heer von Männern und Frauen, die sie wie hungrige Möwen umschwirrten. Sie konnten nicht anders. Eine strahlende, brillante, düstere und emotional unerreichbare Frau ist unwiderstehlich für die Dämonen und Obsessionen co-abhängiger Helfer und Masochisten. Mikis Krankheit inspirierte sie.
«Was sollte das mit den Handschuhen?», wollte ich wissen. Wir hatten uns zurückgelehnt, Drinks in der Hand, Beine übereinandergeschlagen, und blickten uns an.
«Dieser Teil meines Lebens ist vorüber.»
«Nimmst du deine Medikamente?»
Miki schüttelte den Kopf. «Ich kann so nicht leben. Ich kann nicht betäubt durchs Leben gehen. Ich kann einfach nicht.»
Ja klar. Koks und Alkohol betäuben natürlich überhaupt nicht. Sie war vermutlich auf einem manischen Höhenflug mit Aufputschmitteln und Alkohol. Ich fragte mich, ob der Einbruch in ihr Haus Tatsache, Einbildung oder reine Erfindung war. Offenbar sah sie mir meine Bedenken an.
Sie beugte sich vor und flüsterte: «Ich glaube, ich verfolge jemanden. Ich weiß nur nicht genau, wen.»
Ich starrte sie verständnislos an.
«Ach, komm schon, Keye. Entspann dich. Das war ein Witz.»
Stresshormone fingen an, mir durch die Blutbahnen zu jagen. Mein Blick fiel auf den Martini. Er war trübe und kalt. Meine Speicheldrüsen arbeiteten auf Hochtouren. Ich wollte nicht hier sein. Was soll’s? … Na los, bestell dir einen Scheißdrink.
Eine vollbusige Brünette mit einem altmodischen Zigarettenbauchladen kam vorbei und strebte in Richtung Zigarrenlounge, wo sie Spitzen abknipsen und Cognacs nachschenken würde. Irgendjemand an der Theke leckte Salz und Limette und kippte Tequila. Ich quetschte Zitronensaft in mein Mineralwasser und blinzelte zu Miki hoch. Geduld. Irgendetwas hatte ihr Angst gemacht. Sie wollte in diesem Moment hier sein, und ich musste in der realen Welt funktionieren, wo Leute nun einmal in Bars trinken und mit mir reden wollen. Ich bin Privatdetektivin, Herrgott noch mal. Die Hälfte meiner Kunden sind Säufer. Die alte Leier lief ab, dass es zu schwer war, dass ich einen Drink wollte. Ich rief mir in Erinnerung, dass es nicht real war. Das war bloß der Verstand, der durch schattenhafte alte Korridore geisterte. Ich riss mich zusammen, in dem Bewusstsein, dass jedes Mal, wenn ich das tat, jedes Mal, wenn ich nein sagte, neue Denkbahnen in mich hineingebrannt wurden, die helfen könnten, die nächste Krise abzuwenden.
«Ich hab einen Trainer engagiert, der alternative Methoden zur Stimmungsstabilisierung anwendet, um die Leute von Medikamenten wegzukriegen», erzählte Miki mir. «Sport und Ergänzungsmittel, Akupunktur und Diät. Es funktioniert. Ich mache Sport wie eine Wilde. Dabei wird irgend so eine Chemikalie freigesetzt, die mich gesund hält. Du weißt doch, dass ich schon eine ganze Weile brav bin, oder?»
Mit «brav» meinte sie, dass sie seit zwei Jahren nicht mehr eingewiesen worden war, weil sie sich geritzt oder eine Überdosis genommen hatte. Sie holte das Glasröhrchen aus ihrer Handtasche, füllte den Deckel mit weißem Pulver und schaute sich kurz um, ehe sie das Zeug unter ein Nasenloch hielt und einsog.
«Gehören Kokain und Wodka auch zur Diät?»
«So zynisch, Keye.» Sie ließ das Martiniglas sacht kreisen, nahm dann einen Schluck. Ich roch die Olivenlake. Ihre Lider hoben sich, und sie sah mich aus blauen Augen an. «Das macht mich wirklich traurig.»
«Du bist nicht die erste manisch-depressive Patientin, die gegen Medikamente argumentiert.»
«Ich bin keine Scheißpatientin!», explodierte Miki. Blicke richteten sich auf uns. Sie stellte ihren Martini zu fest ab. Flüssigkeit schwappte über den Rand. «Ich bin deine Cousine, Keye. Was soll der Scheiß?»
«Das war eine berechtigte Frage, Miki», konterte ich.
«Ich war letztes Jahr für den Pulitzer-Preis nominiert, Keye, für Fotoberichterstattung. Menschenskind, für den Pulitzer. Ist dir schon mal aufgefallen, wie viele World Photography Awards ich bei mir im Regal stehen hab? Manche von uns haben ihre Gelüste ganz gut im Griff. Wie sieht’s damit bei dir aus?», drehte sie das Messer in meinem Bauch herum.
«Ich hab auch um meine Sucht gekämpft, Miki», erwiderte ich sanft. «Lange. Es hat sich nicht gelohnt.»
«Bei mir im Wohnzimmer war jemand, als ich heute Abend nach Hause kam. Können wir uns einfach darauf konzentrieren?»
«Erzähl mir, was passiert ist», sagte ich betont sachlich.
Sie berichtete mir, wie sie an der Tür mit den Schlüsseln hantiert, dann irgendwas gehört und gewusst hatte, dass jemand im Haus war. Ihr streitlustiges Verhalten legte sich. Tränen liefen ihr über die blassen Wangen. Sie wischte sie weg und nahm mit zittriger Hand ihr Martiniglas. «Ich bin zu dem Fenster an der Veranda, und ich hab ihn gesehen. Im Wohnzimmer, Keye. Er war von der Haustür zum Fenster gegangen. Und er stand einfach da und starrte mich an. Er hat mit der Hand eine Pistole gemacht, so.» Miki hob den Daumen und streckte den Zeigefinger. «Und er hat abgedrückt.» Eine weitere Träne kullerte.
Ich legte meine Hand auf ihre. «Ist irgendwas gestohlen worden?»
Sie schüttelte den Kopf. «Mir ist nichts aufgefallen, als ich mit der Polizei durchs Haus ging. Ich bin aber nicht lange drin geblieben. Es ist total unheimlich, wenn du weißt, dass da jemand in deinen vier Wänden war und deine Sachen angefasst hat. Ich bin ins Auto und ein Stück die Straße runter und hab dich angerufen.»
«Wenn er dir was hätte tun wollen, hätte er sich nicht bemerkbar gemacht.»
Miki winkte einer Kellnerin, hob ihr Glas und sagte: «Wodka Martini, dirty.»
«Irgendeine Idee, warum jemand dir Angst einjagen will?», fragte ich.
«Keine Ahnung. Meine Nachbarn können mich nicht leiden, weil ich nicht ständig den Garten aufhübsche oder Kaffeekränzchen veranstalte oder so.»
«Ist ein bisschen drastisch für genervte Nachbarn.»
«Du glaubst mir nicht, stimmt’s? Das höre ich an deinem Tonfall. Du bist genau wie diese Scheißbullen.»
Der Alkohol hatte ihre Zunge schwer gemacht. Ich fragte mich, wie viele Drinks sie schon intus hatte, bevor sie zum Gabe’s gefahren war. «Ist irgendwer sauer auf dich? Irgendwelche Trennungen in letzter Zeit?»
«Zu Trennungen lasse ich es gar nicht mehr kommen. Gibt bloß Ärger. Ich bleib lieber unverbindlich.»
«Erzähl mir von denen, bei denen es Ärger gegeben hat», sagte ich. Die Kellnerin kam mit Mikis Drink, und ich borgte mir ihren Stift.
«Bei einem hat es richtig Ärger gegeben», sagte Miki und schob den Drink mitsamt Cocktailserviette vor sich. «Ich dachte, ich wäre verliebt. Aber er wollte über mich bestimmen. Auf so was hab ich keinen Bock mehr.» Ihr Ton war so eiskalt wie der Martini auf dem Tisch. «Wenn sie anfangen zu klammern, bin ich weg. Das ist mir das Theater nicht wert.»
«Würdest du mir einen Namen nennen?»
Miki zögerte. «Cash Tilison.»
«Was ist passiert?» Der Name sagte mir was. Ich notierte ihn mir auf einer Serviette. Tilison war Countrysänger und nicht Mikis erster Promi. Ich hatte nie einen von Mikis Freunden kennengelernt. Aber wir hatten seit der Highschool auch keinen besonders engen Kontakt mehr.
«Der ließ sich nicht abwimmeln. Jede Menge Anrufe, Beschimpfungen, SMS, E-Mails. Kam einfach nicht mit Zurückweisung klar. Eine Zeitlang ist er richtig ausgeflippt. Hat gesagt, er hätte noch nie so viel für eine Frau empfunden. Ich schätze, er hat sich eingeredet, das würde ihm das Recht geben, so mit mir zu reden.»
«Wie hat er denn mit dir geredet?»
«Hat mich andauernd Schlampe genannt. Miese Schlampe. Eiskalte Schlampe. Herzlose Schlampe. Das Wort Schlampe hatte es ihm echt angetan.» Sie nahm einen Schluck von ihrem Drink und lächelte. «So hat er mich auch genannt, wenn wir gevögelt haben. Hat mich dabei an den Haaren gepackt. Aber da hat es mir gefallen. Was soll ich sagen? Ich lasse mich gern hart rannehmen. Verstehst du, was ich meine?»
Ich war nicht gewillt, Miki zu verraten, ob ich wusste, was für Dominanz- und Unterwerfungsspielchen Leute im Bett spielten und wie radikal sie sich im wirklichen Leben davon distanzierten. Ich dachte an meinen kräftigen Lieutenant von der Mordkommission und wie sehr er sich im Bett von dem zähen Cop unterschied, der er im echten Leben war – seiner Männlichkeit so unglaublich sicher, dass er keine Angst hatte, die Kontrolle aufzugeben.
«Wie lange ging das?», fragte ich Miki.
«Zehn, fünfzehn Minuten, wenn ich Glück hatte.» Sie lächelte mich an.
Ich lachte, hob mein Mineralwasser. Wir stießen an, und die Anspannung zwischen uns legte sich.
«Er fing an, unangekündigt aufzutauchen. Selbst wenn ich auf Reisen war. Heutzutage gibt’s keine netten Affären mehr. Jeder muss immer gleich anhänglich werden.»
Klar, klar, alle wollen Miki. «Könnte Cash von der Statur her der Typ sein, den du heute Abend durchs Fenster gesehen hast?»
Miki überlegte, setzte an, etwas zu sagen, bremste sich aber. Ich versuchte, das Zögern zu deuten. Log sie? Oder empfand sie noch etwas für ihn? «Schätze ja», sagte sie schließlich. «Er war groß und breitschultrig.»
«Hat die Polizei gesagt, wie er reingekommen ist?»
«Die meinten, es gäbe keine Hinweise auf einen Einbruch. Und ich hab gesagt, was ist mit dem Typen, der bei mir im Wohnzimmer gestanden hat? Ist das nicht Hinweis genug?»
«Hat Cash einen Schlüssel?»
«Ich glaube nicht. Ich glaube, den hab ich mir zurückgeben lassen. Kann sogar sein, dass ich damals die Schlösser hab austauschen lassen.» Sie aß eine Olive von dem Plastikspieß in ihrem Drink. «Ich hatte so ein Gefühl, als würde mich jemand beobachten, als ich heute vor dem Fitnessstudio auf der Ponce aus dem Auto gestiegen bin. Und auf dem Laufband hatte ich wieder so ein Gefühl.»
«Selbst jetzt sind mindestens zehn Augenpaare auf dich gerichtet. Du siehst umwerfend aus.» Ich schielte zu dem glitzernden Schlaraffenland im anderen Raum hinüber. Eine Flasche Grey Goose machte mir schöne Augen. Gibt es was Betörenderes als Wodka made in France?
Miki sah mich an. «Komisch, dass du das sagst. Ich hab dasselbe immer von dir gedacht. Ich wollte du sein, als wir auf der Highschool waren.»
«Wieso denn das? Ich war doch bloß die chinesische Tussi», sagte ich, dabei bin ich so sehr ein Produkt des amerikanischen Südens, dass ich den dunkelgrünen Blättern der wilden Kudzu-Ranken entsprungen sein könnte, die unsere hohen Kiefernwälder überwuchern. Georgias sengende Sonne färbte meine Schultern so goldbraun, wie mein Bruder war, und ich spielte im dichten St.-Augustine-Gras im elterlichen Garten mit dem weißen Holzzaun drum herum. All das ist mir in den Leib gebrannt. Hier im Süden existierst du nicht einfach. Du schließt einen Blutpakt mit ihm, sobald seine weiche, feuchte Luft deine Nase mit dem sinnlichen Duft von Sternjasmin füllt und deine DNA wie fruchtbarer Samen flutet. Das ist mein Süden, der mir ein Zuhause geschenkt hat und eine Gemeinschaft von freundlichen und wohlmeinenden Menschen, die stolz ihre liberale Gesinnung zeigten, als mein Bruder und ich die ersten Kinder in der Nachbarschaft waren, die nicht aussahen wie alle anderen. Später war Jimmys Süden nicht so freundlich. Mein dunkelhäutiger, helläugiger, homosexueller Bruder wurde praktisch von jedem in unserer Umgebung misstrauisch beäugt.
Die Highschool bescherte mir einen rotblonden Jungen namens Bobby Nash, und er war der beste Küsser, den ich je erlebt hatte. Bobby saß lässig auf der Ladefläche seines Pick-ups, klimperte auf seiner Gitarre und sang mir leise etwas vor, an mondgestreichelten Abenden in Winnona Park, dem Viertel, wo ich unter dem filigranen Laub mächtiger Pekannussbäume und dicker Weiß-Eichen in Georgias einzigem County aufwuchs, das traditionell demokratisch wählt. Jahre später, nur wenige Meter entfernt von der Stelle, wo Bobbys schüchterne Hände mir halfen, mich selbst zu entdecken, zwang mich die gnadenlose Wechselhaftigkeit des Lebens so messerscharf wie eine Machete auf die Knie. Aber das ist eine andere Geschichte.
«Du warst die scharfe chinesische Tussi.» Miki lachte. «Gutaussehend, Läufer-Ass, Topschülerin. Ich dagegen hab mich schon in der Highschool geritzt. Das hatte aber noch nichts damit zu tun, dass ich mich umbringen wollte, weißt du. Es fühlte sich einfach gut an. Schmerz zu spüren. Zu bluten.» Miki strich mit einem Finger über eine Narbe innen am linken Arm. «Ich glaube, diese unverschämten Bullen kannten meine Krankenhausakte. Einer von ihnen hat zu seinem Kollegen irgendwas über Anrufe von meiner Adresse gesagt. Dabei ist das schon zwei Jahre her, seit ich so krank war, aber ich schätze, für die gilt: einmal verkorkst, immer verkorkst. Kannst du deinem Freund nicht mal verklickern, wie die Polizei mit den Leuten umspringt?»
«Ist sonst noch jemand zu dir rausgekommen? Hast du mit irgendeinem Detective gesprochen?»
«Nein», sagte Miki. «Aber ich werde nie vergessen, wie dieser Freak mich angesehen hat. Augen durch Schlitze in der Maske. Echt schaurig.»
«Konntest du die Augenfarbe erkennen?» Ich schielte wieder zur Bar und auf die kokette Flasche Grey Goose. Ich trank einen Schluck von meinem Mineralwasser und dachte daran, wie die Kohlensäure einem in die Nase steigt, wenn es mit gutem Wodka versetzt ist – sauber und scharf und ein ganz kleines bisschen bitter. Ich musste raus aus diesem Lokal.
«Nein. Es war dunkel.»
«Mach mir mal eine Liste von den Leuten, mit denen du in den letzten zwei Jahren zusammen warst. Wir werden auch deine Nachbarn überprüfen und uns ein wenig umhören. Und ich werde bei der Polizei beantragen, dass sie in deiner Straße verstärkt Streife fahren. Kann nicht schaden. Wie wär’s, wenn du heute Nacht mit zu mir kommst?»
Großer Gott, war ich denn von allen guten Geistern verlassen?
2
Ich wurde durch Dude (Looks Like a Lady) von Aerosmith geweckt, das aus meinem Handy plärrte – der Klingelton, den ich Lieutenant Aaron Rauser von der Mordkommission zugeordnet hatte. Ich tastete nach dem Wecker. Zwei Uhr, bloß einer der Nachteile einer Beziehung mit einem Cop. Ich hatte exakt eine Stunde geschlafen. «Langer Tag, hä? Alle Bösewichte erwischt?»
«Klar doch», sagte Rauser auf seine typisch langsame, gedehnte Art, die signalisierte, dass das sarkastisch gemeint war. «Wahrscheinlicher ist, dass Lucy Liu sich an mich ranschmeißt.»
«Du stehst auf Asiatinnen, was?»
«Ich steh auf dich.» Er hatte es ohne Enthusiasmus gesagt. Ich kannte ihn. Irgendwas stimmte nicht. Dann hörte ich Geräusche im Hintergrund, jede Menge Geräusche, Stimmen, das gelegentliche Quäken von Polizeifunkgeräten. Eine Sirene heulte auf. Er brüllte: «Sag denen, die sollen das Scheißding ausschalten. Hör mal, Schatz, ich habe fünf Fälle am Hals, und wir müssen am Ball bleiben, bevor die Spuren kalt werden. Das lange Wochenende, das wir geplant haben, das können wir vergessen.»
Ich dachte an lange Tage auf der Couch mit Lesen und Baseballgucken, Liebe am Nachmittag, Restaurantbesuche am Abend. Das war so selten. Wir hatten ein Picknick im Chastain Park geplant, einen Grillabend bei meinen Eltern am Montag, das große Feuerwerk in Decatur. Meine Eltern. Ach du Schande. Da Rauser arbeiten musste und mein Bruder in Seattle war, gab es niemanden, der Mutters Aufmerksamkeit von mir ablenken würde. Sie benahm sich einfach besser, wenn ein Mann dabei war. Vielleicht konnte ich Miki überreden, mit mir hinzugehen.
«Wir haben hier ein totes Kind», sagte Rauser. «Das ist für mich der Horror.»
«O nein. Das tut mir leid.»
«Der Junge wurde in die Büsche geworfen wie Abfall.»
Ich setzte mich auf. Knipste die Nachttischlampe an. «Wie alt war er?»
«Zwölf, höchstens dreizehn.»
«Habt ihr eine Todesursache?»
«Sieht aus, als wurde er erdrosselt. Würgemale am Hals.»
Ich dachte nach. «Fundort im Wohnviertel des Jungen? Könnt ihr sagen, ob es auch der Tatort ist?»
«Wir sichern noch die Spuren, aber es sieht ganz danach aus. Das Opfer war nur zwei Blocks von zu Hause entfernt. Wir befragen die Leute, aber wir haben noch kein Motiv.» Er schwieg einen Moment, und ich konnte die Sirenen und Funkgeräte hören. «Die Gegend hier war mal sicher, Keye. Wir versagen. Wir kommen nicht mehr nach. Ach, verdammt. Da rollen die Medien an. Ich liebe dich, Street.»
Kurz nach vier öffnete sich leise meine Schlafzimmertür. Rausers breite Schultern im Dunkeln. Er beugte sich übers Bett und küsste mich. «Wo ist White Trash?» Zwischen Rauser und meiner Katze lief was. In letzter Zeit schien sie ihn mir vorzuziehen. Aber er ist ja auch haarig und warm. Als würde man mit einem flauschigen Ofen schmusen. Katzen sind verrückt nach Körperwärme. Ich versuche, es nicht persönlich zu nehmen.
«Miki hat sie mit ins Bett genommen», sagte ich.
Rauser öffnete den Reißverschluss seiner Jeans und ließ sie zu Boden fallen. Darunter Boxershorts, ein Weihnachtsgeschenk von mir, schwarz-weiß kariert. «Miki ist hier? Das kann nichts Gutes bedeuten.»
«Bei ihr zu Hause wurde eingebrochen. Sie ist ziemlich fertig. Ich erzähle dir morgen alles.»
«Es ist morgen.» Er zog sich das T-Shirt über den Kopf und warf es auf seine Jeans. «Ich sehe mir später mal den Bericht an.» Er ging nackt in die Dusche. Ich lag da und schaute ihm nach, dachte daran, wie es gewesen war, wenn ich spätnachts von Tatorten und Leichenhallen und trauernden Familien nach Hause kam und so lange unter dem prasselnden Wasserstrahl blieb, bis er kalt wurde. Aber ich konnte es nie abspülen, und natürlich konnte auch Rauser das nicht.
Ich dämmerte weg, während er duschte, und wachte mit seinen Armen um mich auf, Lippen an meinem Hals, heißer Atem. Er sagte kein Wort, als er in mich eindrang und wir uns liebten. Mein starker Lieutenant ist nicht anders als wir alle. Er versucht, die Risse wieder zu schließen, egal wie, die sein Job in ihn reinhämmert. Manchmal denke ich, in ihm steckt mehr Schmerz als Verlangen. Ich fragte mich, ob mein Leben anders verlaufen wäre, wenn mich zu Hause offene Arme erwartet hätten, nachdem ich den Tag damit verbracht hatte, Morde zu rekonstruieren. Wenn mein Exmann mich gewollt hätte und mit seinen schlanken Fingern nur ein einziges Mal durch mein Haar gefahren wäre, wenn er ein bisschen geflüstert und wenigstens so getan hätte, als ob. Hätte ich trotzdem nach dem Cognac gegriffen, um mir die nötige Bettschwere zu verschaffen? Ich glaubte nicht. Ich wollte die Schuld für meine Sauferei nicht Dan zuschieben, aber es wäre verdammt noch mal nicht zu viel verlangt gewesen, mir ab und an mal eine weiche Landung zu ermöglichen.
Als um sieben das Bett wackelte, öffnete ich unwillig ein Auge. Rauser saß, White Trash auf dem Arm, auf der Bettkante. Er trug nur eine dunkelblaue Hose, die saubere Ersatzhose, die er bei mir deponiert hatte. Ich roch Kaffee, und als ich den Kopf drehte, sah ich meine Lieblingstasse, die ich mal von Jekyll Island mitgebracht hatte, gefüllt und dampfend auf dem Nachttisch stehen.
«Wie ich sehe, hast du White Trash gefunden.» Es war das Netteste, was ich über die Lippen brachte. Ich hätte am liebsten noch sechs Stunden geschlafen.
Rauser gab White Trash einen Kuss auf den Kopf und setzte sie auf den Boden, zog sich dann dunkelblaue Socken an. «Klar doch. Und ich hab außerdem deine Cousine in Unterwäsche gesehen. Super Morgen.»
Ich setzte mich auf. «Das muss ja entsetzlich für dich gewesen sein.»
«Ganz furchtbar. Und außerdem hat sie White Trash aus dem Gästezimmer geschmissen und gesagt, die Katze würde sie vorwurfsvoll anstarren.»
Ich griff nach meinem Kaffee. «Ja, White Trash kann ganz schön missbilligend gucken, wenn sie aufs Katzenklo muss.»
Rauser lachte leise. «Was liegt heute bei dir an?»
«Ein Kautionsflüchtling für Tyrone, ein paar Berichte abliefern. Das Übliche.» Ich trank einen Schluck Kaffee. Er war stark. Rauser hatte nicht die Geduld für Messlöffel. «Und bei dir?»
«Das Übliche», sagte er und küsste mich auf die Wange. «Danke, dass du mich letzte Nacht noch reingelassen hast.» Er stand auf, grinste mich an und wackelte mit den Augenbrauen.
«Du bist so unreif.»
«Das fandest du letzte Nacht aber nicht», sagte er und wich schnell dem Kissen aus, das ich nach ihm warf. «Willst du Frühstück? Ich mache mir Müsli.»
«Igitt. Lieber würde ich einen Sack Mulch verdrücken. Aber in deinem Alter musst du wohl an Ballaststoffe denken.»
Er grinste und zeigte mit dem Finger auf mich. «Sei lieber nett zu mir, Street. Ich bin wahrscheinlich der Mann, der deine Wechseljahre mit dir durchsteht. Und wir wissen alle, dass das kein Vergnügen wird.»
«Raus!» Ich warf noch ein Kissen nach ihm.
Eine Minute später traute er sich wieder ins Zimmer. «Hey, kann ich kurz mit dir sprechen?»
Ich lächelte ihn über meine Kaffeetasse hinweg an. Er hatte einen Aktenordner in der Hand. «Was ist denn?»
«Der tote Junge gestern Abend, etwas daran lässt mir keine Ruhe.»
Ich stellte den Kaffee ab und streckte eine Hand nach ihm aus. «Er war noch ein Kind. Ist doch klar, dass dir das an die Nieren geht.»
«Nein, nicht nur deshalb.»
«Ihr habt kein Motiv gefunden?»
Er fuhr sich mit einer Hand übers Gesicht. Helles Morgenlicht fiel durch die hohen Fenster, und die Falten um seine grauen Augen sahen aus wie tiefe Gräben. Über den Ohren war sein dunkles Haar weiß meliert. «Es gibt keinerlei Spuren von Missbrauch, obwohl wir die Obduktion heute Vormittag noch abwarten müssen. Wir ermitteln erst mal in die üblichen Richtungen.» Er sah auf die Uhr. «In einer Stunde fangen wir mit der Elternbefragung an.»
«Da liegt meistens der Hund begraben», erinnerte ich ihn, aber das wusste er natürlich selbst. Das Motiv bei einem Kindsmord findet sich erfahrungsgemäß in der Familie oder im engeren persönlichen Umfeld. Ich blickte auf meine Kaffeetasse. Unglaublich, dass wir so ein Gespräch führten, wo ich die Augen gerade mal fünf Minuten auf und erst eine halbe Tasse Kaffee intus hatte. Ich dachte an Miki und die Bar letzte Nacht. Das Verlangen nach einem Kaffee mit Schuss machte mich schlagartig hellwach. Vier Jahre wachte ich nun schon nüchtern auf, und noch immer musste ich jeden Tag gegen den Drang ankämpfen. Heute Morgen fiel es mir besonders schwer.
Er setzte sich neben mich, öffnete den Ordner, breitete den Inhalt zwischen uns auf dem Bett aus. «Wow. Macht doch immer wieder Spaß, was?», sagte ich und blickte auf die Fotos von dem Tatort, wo Rauser fast die ganze Nacht zugebracht hatte – der leblose Körper eines Jungen, Gesicht nach unten, Shorts, Sportschuhe, einen Arm auf Schulterhöhe, den anderen über dem Kopf, ein Knie etwas höher als das andere. Es sah aus, als wollte er wegkriechen. Neben seinen ausgestreckten Fingern lag eine Baseballkappe auf der Erde. Ich betrachtete die Aufnahmen von der unmittelbaren Umgebung des Leichnams – Zigarettenstummel, ein Stück rotes Plastik, Fastfood-Verpackungen, Becher und Strohhalme. «Wo kommt der ganze Müll her?»
«Ein paar Meter entfernt ist eine Baustelle. Die Besitzer des Grundstücks, wo der Junge gefunden wurde, haben gesagt, der Müll weht andauernd in ihren Garten. Wir haben alles eingesammelt, was um das Opfer herumlag.»
«Wer hat den Jungen gefunden?»
«Ein Jogger», sagte Rauser. «Wir haben ihn noch nicht ausgeschlossen. Auch sonst keinen. Aus den Eltern war gestern Nacht kaum was rauszukriegen. Der Junge war eine Sportskanone. So viel wissen wir jedenfalls. Es haben gleich ein paar Trainer sehnsüchtig darauf gewartet, dass er vierzehn wird.»
Ich sah mir ein weiteres Foto von dem Leichnam an. «Ein anderer Sportler könnte ein Motiv haben. Und die Kraft. Sieht groß aus für sein Alter, muskulös. Keine anderen Wunden am Körper, außer den Würgemalen?»
«Nein. Wir denken, der Täter hat den Jungen von hinten gepackt, zu Boden geworfen und ihm den Strick um den Hals geschlungen.»
«Es ist schnell gegangen», sagte ich zu Rauser. «Die Erde rings um den Leichnam ist kaum aufgewühlt. Und siehst du das?» Ich deutete auf die zur Faust geballte rechte Hand. «Das passiert manchmal bei Hinrichtungen durch Erhängen und bei brutaler Strangulation.»
3
Neil trug Shorts oder eine Badehose, da war ich mir nicht sicher. Sie war kobaltblau, bedruckt mit großen, schwarzen Blumen, und ging ihm bis zu den mit hellem Flaum bedeckten Knien. Das Hemd war beige-braun, kubanisch, mit breiten Längsstreifen, halb zugeknöpft – Neils Uniform. Sie änderte sich nur unwesentlich von Jahreszeit zu Jahreszeit – Shorts oder lange Hose, an den Füßen Vans mit Schachbrett- oder Schottenmuster. Er hatte eine Schwäche für knallige Schuhe. Im Fernsehen liefen die Morgennachrichten. Dank Neil ließ sich so gut wie alles in unserem Büro über ein sprachaktiviertes Smart Panel steuern, mit einer Fernbedienung in Reserve. Den großen Flachbildschirm – genialer Einfall der leidenschaftlichen und vermutlich gestörten Innenarchitektin, die ich engagiert hatte – konnte man geschmeidig an einem Flaschenzugsystem von den Dachbalken in unserem umgebauten Lagerhaus nach unten gleiten lassen. Eindeutig eine meiner Lieblingsspielereien in unserem Industrieloft.
«Morgen», sagte ich, als ich früher als sonst zur Arbeit kam. Ich hatte geduscht, sobald Rauser losgezogen war, um die Stadt zu retten, White Trash gefüttert und war gegangen, ohne meine Cousine im Gästezimmer zu wecken. «Ich brauche eine Liste der Hausbesitzer in Inman Park. Satellitenfotos mit den Eigentümernamen auf den entsprechenden Grundstücken wären super.» Ich ging in mein Büro, das eigentlich nur aus einem Schreibtisch, Stühlen und zwei Aktenschränken hinter einem hohen Zaun besteht – teils Maschen-, teils Stacheldraht –, noch so eine Idee der Innenarchitektin, deren Vision von unserem Arbeitsplatz sich nicht genau mit meiner gedeckt hatte.
«Ich freue mich auch, dich zu sehen», brummte Neil. Er wirkte noch bockiger als sonst. Diese Haltung legt er jedes Mal an den Tag, wenn er sich schlecht behandelt fühlt. Ich kenne Neil Donovan, seit ich beim FBI an einer Cybercrime-Serie gearbeitet hatte. Neil, Wiederholungstäter im Bereich Datendiebstahl und Cyber-Kriminalität, einigte sich schließlich auf einen Deal mit dem FBI. Später beauftragten ihn einige der Firmen, deren Datensicherungssysteme er geknackt hatte, ebendiese Systeme zu optimieren. Als ich beschloss, meine Privatdetektei aufzumachen, nahm ich Kontakt zu ihm auf. Ein Typ wie Neil ist Gold wert. Er ist ein unermüdlicher Spürhund, und in Sachen Privatsphäre kennt er keinerlei moralische Grenzen.
Ich schmiss meine Sachen auf den Schreibtisch und blickte durch die Maschen im Zaun auf Neils Rücken. Er saß in dem neuen schwarzen Aeron-Schreibtischsessel, für den er kürzlich tausend Dollar hingeblättert hatte. Mit den polierten Alu-Beinen wirkte das Ding wie aus einem futuristischen Survival-Film.
«Entschuldigung», sagte ich. «Hab ich nicht höflich genug gefragt? Guten Morgen, Neil, du wunderbarer Mann. Bitte besorg mir die gottverdammten Hausbesitzer in Inman Park.»
«O ja. Schon viel besser.» Er tippte auf seiner Tastatur herum, während ich ihm erzählte, dass bei Miki eingebrochen worden war. Einige Minuten später wurde der Ton der Morgennachrichten leiser.
«Ist auf dem Bildschirm», sagte Neil. «Möchtest du Kaffee? Ich ja.»
«Oh, du bist wirklich ein wunderbarer Mann. Ich hätte gern welchen.» Ich verließ mein Büro, um mir die Satellitenbilder von Mikis Wohngegend anzusehen. Die Namen der Hauseigentümer erschienen auf jedem Grundstück mit der entsprechenden Hausnummer. Neil reichte mir eine Tasse, aus der es herrlich duftete. Ich blickte auf etwas Rötliches und Schaumiges.
Kaffee in all seiner Vielfalt ist sozusagen ein weiteres Fachgebiet von Neil. Wenn er Bohnen einkauft, benimmt er sich wie ein mit allen Wassern gewaschener internationaler Kaffeehändler. Ich hab schon gesehen, wie er eine Handvoll Bohnen nimmt und mit geschlossenen Augen daran schnuppert. Er studiert Farbe und Textur und schiebt sie sich in den Mund wie Erdnüsse. Sie erzählen ihm eine Geschichte – nass aufbereitet, in schattiger oder sonniger Lage angebaut, sortenrein oder gemischt. Unterschiedliche Bohnen und unterschiedliche Mahlstärken für unterschiedliche Tage und unterschiedliche Stimmungen.
«Fangen wir mit den ersten drei Häusern rechts und links von Miki an, mit denen auf der anderen Straßenseite und direkt hinter ihr.»
«Das sind an die dreißig Leute.»
«Hast du irgendwas Dringenderes zu tun?» Ich gab ihm die Cocktailserviette, auf der ich Cash Tilisons Namen notiert hatte. «Einer von Mikis Freunden. Sie behauptet, er hat sie gestalkt.»
«‹Behauptet›?»
«Es geht um Miki.» Ich zuckte die Achseln. «Sie macht eine Liste von den anderen.»
Neil ging zurück zu seinem Schreibtisch und ließ sich in den Sessel fallen. Dann seufzte er laut. Ich betrachtete einen Moment lang seinen Hinterkopf. Irgendwas beschäftigte ihn. Und er wollte offenbar, dass ich es wusste.
«Und, schon irgendwelche Pläne fürs lange Feiertagswochenende?» Es war unbeholfen, aber was Besseres fiel mir nicht ein.
«Ich glaube, ich hab mich verliebt.» Er sagte es monoton, mit der ernüchterten Stimme eines Mannes, der soeben begriffen hat, dass er eine Glatze bekommt. «In zwei Frauen.»
Ich trank einen Schluck Kaffee. «Na, dann ist ja wohl doppelt wahrscheinlich, dass du Pläne hast. Dieser Kaffee ist übrigens köstlich.»
Er sah mich an, als hätte ich ihm gerade eröffnet, dass der Weihnachtsmann tot ist.
«Was ist?»
«Ich glaube, ich hab mir so was Ähnliches wie einen Rat von dir erhofft, Keye. Ich meine, das ist immerhin eine Riesensache.»
«Ach so. Okay. Da muss ich mal eben meine Erfahrungen als heterosexueller Mann abrufen. Hmm. Sorry. Mir fällt gar nichts ein.»
«Du bist blöd», sagte er, musste sich aber ein Grinsen verkneifen.
«Ich hatte schon Angst, du würdest mir sagen, dass du plötzlich auf Leder stehst oder so. Alle anderen in meinem Leben haben anscheinend irgendeine sexuelle Identitätskrise. Ich schwöre bei Gott, wenn Rauser mir je beichtet, dass er schwul ist, trinke ich Frostschutzmittel.»
«Wow. Es sollte hier eigentlich nicht um dich gehen.» Neil warf theatralisch die Hände hoch.
«Du Armer. Möchtest du über deine Gefühle reden? Komm mal her, du.»
Ich machte Kussgeräusche, trat zu ihm und versuchte, ihn zu umarmen. Lachend wehrte er mich ab. Wir waren kurz vor einem regelrechten Ringkampf, als das Telefon klingelte. Neil sagte dem Smart Panel, es solle den Anruf auf Lautsprecher stellen. Er hatte aus unserem Büro seinen Spielplatz für Elektronikschnickschnack gemacht. Eine Stimme dröhnte aus jeder Ecke unseres rundum verkabelten Lofts. Er regulierte die Lautstärke.
«Keye, Larry Quinn hier. Wie geht’s meiner Lieblingsdetektivin? Hör mal, ich hab einen Job für dich im Norden. Hübscher kleiner Erholungsort. Hast du Zeit?»
«Kommt drauf an», sagte ich und zwinkerte Neil zu. «Ich vertraue dir nicht, Larry.»
Quinn lachte. «Kein Vergleich zu der Sache mit der Kuh. Die Chance, dass du festgenommen wirst, ist gleich null.»
Letztes Jahr hatte Larry Quinn mich beauftragt, im ländlichen Norden von Georgia ein verschwundenes Haustier zu suchen. Okay, es handelte sich um eine Kuh namens Sadie. Ich hatte zehn Pfund zugenommen, dank des Apfelkuchens, von dem sich die Leute da oben anscheinend ausschließlich ernähren, wurde von der Polizei festgenommen und zusammen mit dem Kuhdieb, der nach Mist stank, auf der Rückbank des Sheriffwagens von Gilmer County zum Revier gekarrt.
«Du müsstest nach Creeklaw County», sagte Quinn. «Südliche Appalachen. Kleiner Ort namens Big Knob unweit der Grenze zu North Carolina. Schon mal gehört?»
«Äh … nein.»
Neil signalisierte seine Haltung zu allem Ländlichen, indem er das Gesicht verzog, als hätte er Jauche gerochen. Ich verdrehte die Augen.
«Da wohnt ein Ehepaar, das eine interessante Geschichte erlebt hat. Ein Typ namens Billy Wade lässt die Urne mit der Asche seiner verstorbenen Mutter fallen. Tja, und was da zum Vorschein kam, sah einfach nicht wie Asche aus. Die Wades haben den Inhalt von einem unabhängigen Labor untersuchen lassen. Zementmischung und Hühnerfutter.»
«Hoppla.»
«Natürlich wollen sie wissen, wo die Asche abgeblieben ist.»
«Natürlich.» Vermutlich wollten sie auch irgendjemanden verklagen, damit er ordentlich zahlte. Doch das sagte ich nicht. «Wieso fragen sie nicht einfach im Krematorium nach?»
«Das ist es ja gerade», erwiderte Quinn. «Haben sie. Der Betreiber, ein gewisser Joe Ray Kirkpatrick, geht ein paar Tage lang nicht ans Telefon, entschuldigt sich dann schließlich überschwänglich und sagt, ein Mitarbeiter hätte die Asche verschüttet und kontaminiert und die Urne mit Zementmischung gefüllt, um seinen Job nicht zu verlieren und den Angehörigen den Schmerz über verlorene sterbliche Überreste zu ersparen. Kirkpatrick sagt, er hat den Mann auf der Stelle gefeuert. Außerdem hat er den Wades die gesamten Bestattungskosten zurückgezahlt, nicht bloß die Kosten für die Einäscherung.»
«Wo liegt dann das Problem?» Ich nahm einen Stift und machte mir eine Notiz – Joe Ray Kirkpatrick. Wir hatten Zugriff auf Datenbanken, die uns im Handumdrehen umfassende Informationen über den Betreiber des Krematoriums liefern würden, und was uns dieser kostenpflichtige Zugriff nicht bot, konnte Neil spielend auf anderen Wegen in Erfahrung bringen.
«Die wittern, dass da was faul ist, Keye», sagte Larry Quinn. «Und ich auch.»
Und sie wittern eine dicke Entschädigung.
«Wieso gehen sie dann nicht zur Polizei?», fragte ich.
«Sind sie. Kirkpatrick hat den Wades alle Kosten erstattet. Die Cops sehen keine Grundlage für eine Anzeige. Könnte sein, dass dieser Krematoriumsfuzzi die Cops geschmiert hat.»
«Also haben die Wades dich angerufen.»
«Und ich jetzt dich», sagte Larry. «Keye, diese armen Leute sind verzweifelt. Billys Mama wollte, dass ihre Asche ins Meer gestreut wird. Die Wades sind arme Schlucker. Das ganze County steht in Sachen Einkommen und Bildung ganz schlecht da im Vergleich zum übrigen Georgia.» Quinns Stimme wurde heiser, je mehr er sich aufregte. So hatte ich ihn schon öfter erlebt, wenn er Lug und Trug witterte. «Arbeit gibt’s nur noch in der Dienstleistungsbranche. Golfplätze. Bisschen Tourismus. Riesenkluft zwischen Reich und Arm. Aber die Wades waren gewillt, sich extra freizunehmen, was sie sich nicht leisten können, und sieben Stunden von Big Knob an die Küste zu fahren, ein Boot zu chartern, bloß um ein Häufchen Zementmischung in den Atlantik zu kippen.»
«Und Hühnerfutter», fügte ich hinzu.
«Und Hühnerfutter, aber echt.» Larry lachte. «Wie würdest du dich dabei fühlen?»
«Keine Ahnung.»
«Verstehst du, was ich meine?»
«Und du willst einfach nur helfen», sagte ich. «Was bist du doch für ein netter Kerl.»
«Ganz genau», pflichtete Quinn mir bei, und ich wusste, dass er gerade sein breites Grinsen grinste, das im Lokalfernsehen von Atlanta berühmt war. Ein Anruf, und ich bin für Sie da, pflegte er in der gedehnten Sprechweise der alten Südstaaten zu sagen und in die Kamera zu zeigen.
«Und? Wie ist das Hühnerfutter da reingekommen?»
«Der Typ behauptet», sagte Larry, «dass sein Mitarbeiter die Tüte Zementmischung, mit der er die Urne füllen wollte, neben dem Hühnerfutter gelagert hat. Irgendwie sind ihm die Tüten umgekippt, und er hat beides vermischt.»
«Hühner? In einem Krematorium?»
«Brathähnchen», murmelte Neil.
«Hör mal, Keye, entscheidend ist, die Asche war keine Asche.»
«Ja, das hab ich kapiert. Aber ich würde trotzdem gern wissen, was Hühner in einem Krematorium zu suchen haben.»
Quinn seufzte, offenbar sollte seine Detektivin ihn nicht mit Fragen nerven. «Wenn ich das richtig verstanden hab, ist das eine kleine Farm. Sechseinhalb Hektar. Eigentlich ist es gut, dass das Hühnerfutter mit in die Urne geraten ist, sonst hätte kein Schwein was gemerkt. Zementmischung hat große Ähnlichkeit mit eingeäscherten menschlichen Überresten. Hat man mir zumindest gesagt.»
Ich dachte an das geplatzte Wochenende mit Rauser. Ich dachte an die Desserts, die meine Mutter auf dem langen Picknicktisch im Garten meiner Eltern in Winnona Park aufreihen würde – Brombeer-Cobbler, Süßkartoffel-Käsekuchen, Bananencremetorte. Dann stellte ich mir vor, was sie sagen würde, wenn ich allein ankam. Keye, Liebchen. Du hattest schon immer eine Schwäche für Männer, die dich an einem Feiertag allein lassen.
«Dieses Wochenende stehen die Chancen hervorragend, Leute zu Hause anzutreffen», sagte ich zu Larry. «Ich mach’s. Mail mir Kontaktinfos zu den Wades und diesem raffinierten Mitarbeiter vom Krematorium.»
«An der Sache ist noch was anderes nicht koscher. Die Wades behaupten, keiner da oben in der Gegend erinnert sich an irgendwelche Mitarbeiter, seit der Vater vor zwei Jahren gestorben ist und der Sohn den Laden übernommen hat. Kirkpatrick behauptet, den Mann nicht erreichen zu können. Latino. Keine Greencard. Er sagt, er hätte ihn schwarz bezahlt.»
«Auch Illegale haben Namen, Larry.»
«Dieser nicht.»
Ich beendete die Verbindung und lehnte mich mit meiner Kaffeetasse in der Hand gegen die Küchentheke. «Das war echt schräg», sagte Neil und schaltete wieder auf die Morgennachrichten um.
«Das kannst du laut sagen.»
«Glaubst du, du musst dir Tote angucken?»
Ich trank einen letzten Schluck roten, schaumigen Kaffee und ließ die Tasse auf der Arbeitsplatte stehen. «Ich hoffe nicht.»
«Ja, das wäre gruselig.» Neil warf sich mit einer schnellen Kopfbewegung die langen Haarfransen aus den Augen. «Kann ich dahin fahren?»
«Im Ernst?»
«Ich muss hier weg.»
Ich grinste ihn an. «Du hast mit beiden Pläne fürs Wochenende gemacht, nicht wahr?»
«Aus Versehen.»
«Und jetzt willst du beide Frauen versetzen und weglaufen?»
«So ungefähr.»
Ich nahm mir eine Aktentasche aus weichem Leder mit Schulterriemen und stopfte mein Material rein. «Ich muss los, ein paar Hintergrundberichte abliefern und bei Tyrone einen Auftrag abholen. Ich hab mein Handy dabei.» Als ich einen Blick darauf warf, sah ich, dass eine neue E-Mail gekommen war. Mikis Liste von sechs Männern, mit denen sie innerhalb von zwei Jahren zusammen gewesen war. Vier in den USA, zwei in Europa – die Komplikationen oder Vorteile, die ständiges berufliches Reisen mit sich bringt. Ich leitete die Liste an Neil weiter.
«Bring was zu essen mit, ja?», sagte Neil. Er hatte sämtliche Vorräte verputzt und nahm in seiner Not eine von den Werbepackungen Cornflakes, die mit der Post gekommen waren. Wir hatten auch keine Milch mehr, aber er schüttete die Cornflakes trotzdem in eine Schüssel und löffelte sie.
«Weißt du», sagte ich, «das Problem wäre durch einen Besuch im Supermarkt sofort behoben. Du bist längst an der Reihe.»
«Du siehst scharf aus heute Morgen.»
Ich trug einen hellen melierten Blazer mit Rock, ein schokobraunes Top und schlichte braune Pumps. Okay, schlichte Pumps von Louboutin bedeuteten ein Wochenhonorar. Aber sie waren traumhaft. Ich hätte sie am liebsten abgeleckt. Ich gab Neil einen Kuss auf den Kopf. «Mit Schmeicheleien kriegst du mich nicht zum Supermarkt.»
«Sei verflucht», sagte er und hob in einer so eleganten wie dramatischen Geste den Arm. «Und deine trashige kleine Katze auch.»
Er schaute auf den Fernseher. Irgendwas an der Art, wie sein Ausdruck sich veränderte, ließ mich seinem Blick folgen. Ich sah Rauser auf dem Bildschirm in den Jeans, die er sich heute Nacht vor meinen Augen bei mir im Schlafzimmer ausgezogen hatte. Polizeiabsperrband flatterte im Vordergrund. Blaulicht spiegelte sich auf Autos und dunklen Straßen. Es war eine Wiederholung des Liveberichts von Rausers Tatort letzte Nacht. Da rollen die Medien an. Ich liebe dich, Street. Mitarbeiter der Gerichtsmedizin schoben unbeholfen eine Trage aus den Büschen. Frank Loutz, der Gerichtsmediziner von Fulton County, folgte ihnen. Loutz beugte sich zu Rauser und sprach mit ihm, wobei er sich sein Klemmbrett vor den Mund hielt, wie ein Football-Coach am Sonntag, der seine Anweisungen vor Lippenlesern schützt. Der Nachrichtensprecher teilte uns düster mit, dass ein totes Kind von einem Jogger gefunden worden sei. Die Todesursache sei noch unklar. Es wurde gezeigt, wie die Mutter am Tatort auftauchte, schreiend das Flatterband durchbrach, auf die Männer von der Gerichtsmedizin zurannte, mit der Gewissheit einer Mutter, dass es ihr Sohn war, der da auf der Trage lag. Ich sank auf eines der ledernen Sitzelemente, die im Raum verteilt waren, und starrte zum Fernseher hoch, in dem sich der Horror abspielte.
Detective Linda Bevins sprang der kreischenden Frau in den Weg wie eine Profitorhüterin. Ich kannte Bevins. Sie war eine gute Polizistin. Die Frau weinte, argumentierte, fuchtelte mit den Armen. Bevins hielt sie an den Schultern fest, sagte irgendwas. Die Frau konnte vor Verzweiflung nicht mehr stehen. Sie sank zu Boden.
Ich dachte daran, wie die nächsten Tage für sie sein würden. Diese trauernde Frau, die Familie, Freunde, Schulkameraden, die Detectives und Spurensicherer, der ungenannte Jogger – sie alle würden sich unwiderruflich verändern.
Bei mir waren laute Stimmen und Krach der Auslöser gewesen. Wo ist das Geld, Alter? Gib uns das Scheißgeld. Dann Schüsse. Ich zitternd unter dem Tresen. Die Narben nahm ich mit zu neuen Eltern, die mit einem in sich gekehrten, unnahbaren Kind fertigwerden mussten. Wenn du in das große Fangnetz eines Mordes gerätst, hat das einen komplizierten Dominoeffekt auf dein Leben. Er hält Jahre an.
Die Rolltrage wurde in den Wagen der Gerichtsmedizin geschoben. Bald würde ein Therapeut vor Ort eintreffen, um bei der Bewältigung der Kollateralschäden zu helfen – posttraumatischer Stress, Depression und Fassungslosigkeit –, die jeden zerreißen würden, der den Jungen geliebt hatte. Auf die Eltern kam eine Flut von Fragen zu, Fragen, die sie wütend machen und verwirren würden. Die Detectives würden alles tun, um sie möglichst schnell als Verdächtige ausschließen zu können. Die Trauerbegleiter würden auftauchen und tun, was in ihrer Macht stand. Aber für die Familie dieses Jungen würde nichts je wieder so sein, wie es einmal war.
Die Kamera schwenkte auf Rauser. Ich spürte Neils Hand auf meiner Schulter. Wir sahen, wie Rauser Detective Bevins dabei half, die Mutter vom Boden hochzuziehen und in ein Fahrzeug zu verfrachten, weg von den gnadenlosen TV-Scheinwerfern. Er versuchte, an den Kameras vorbeizukommen, doch der Reporter versperrte ihm den Weg. «Lieutenant Rauser, können Sie uns irgendetwas über das ermordete Kind sagen?»
Mikrophone wurden ihm vors Gesicht gehalten. Seine kantige Wangenpartie spannte sich unter einem stoppeligen Bartschatten, graue Augen glitten über die Kamera. Wer irgendwas Verdächtiges in der Umgebung von Kings Court und Amsterdam Avenue gesehen oder gehört hatte, möge sich bitte melden. Er nannte die Nummer des Atlanta Police Department und duckte sich dann wieder unter dem Absperrband hindurch.
4
Ich lieferte die wöchentlichen Berichte bei der Kindermädchenvermittlung Super Nannies On Call ab, schaute dann kurz bei Rapid Placement rein, einer Headhunteragentur im One Atlantic Center in Midtown, um meine routinemäßigen Hintergrundüberprüfungen abzuliefern. Es war keine besonders aufregende Arbeit, aber diese beiden Unternehmen, zusammen mit ein paar Anwaltskanzleien und zwei Versicherungsagenturen, die mich von Observierungen bis hin zu Gerichtszustellungen mit allem Möglichen betrauten, bezahlten jeden Monat meine grotesk hohen Kreditraten. Und dann war da noch Tyrones Kautionsbüro Quickbail.
Seit ich beim FBI aufgehört habe, arbeite ich als amtlich registrierte Kopfgeldjägerin, das heißt, ich jage Kautionsflüchtlinge, und wie sich herausgestellt hat, hab ich ein Händchen dafür. Es ist ein lukratives Zubrot, und es ist weitaus interessanter als die meisten meiner Jobs, die in der Regel darin bestehen, auf irgendeiner Straße im Auto zu hocken und mir die Zeit damit zu vertreiben, die Farbe des nächsten Wagens zu erraten, Hörbücher zu hören und mit den Fingern aufs Lenkrad zu trommeln, um wach zu bleiben, bis irgendwer ohne seine Krücken aus dem Haus gelaufen kommt oder mit einer Prostituierten auftaucht. Die Jagd nach Kautionsflüchtlingen ist auch der Teil meiner Arbeit, den Rauser am meisten hasst. Aber er darf nichts dagegen sagen. Wir haben nämlich eine Abmachung. Ich jammere nicht darüber, dass er bei der Mordkommission ist, und er mischt sich nicht in meine beruflichen Dinge ein. Inzwischen hat jeder von uns schon das eine oder andere Mal die Abmachung gebrochen. Meistens aus Angst. Nachdem wir beide letztes Jahr so schwer verletzt wurden, fiel es mir nicht leicht, mich damit abzufinden, dass er wieder zum Atlanta Police Department zurückging. Und während er sich nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus noch eine Weile zu Hause erholte, machte er sich Sorgen, wann immer ich zur Arbeit ging. Er bestand darauf, dass ich meine Pistole überall dabeihatte. Ich war, nehme ich mal an, die einzige Frau im Supermarkt mit einer Mango, zwei Pfund Spargel und einer 10-mm-Glock. Wir haben uns arrangiert, weil wir mussten. Doch im Grunde ist, was den Beruf angeht, keiner von uns beiden gewillt, auch nur einen Deut nachzugeben.





























