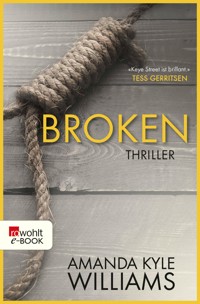4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Profilerin Keye Street
- Sprache: Deutsch
«Mein Name ist Keye Street. Der Vorname stammt von meinem asiatischen Großvater, den Nachnamen haben mir meine Adoptiveltern verpasst. Von Beruf bin ich Detektivin, genauer gesagt Privatdetektivin. Ansonsten bin ich trockene Alkoholikerin und Fan von Cheeseburgern und Donuts. Früher wurde ich mit Special Agent Street angesprochen. Klingt nicht übel, oder? Ich hatte einige praktische Erfahrung, bevor ich als Profilerin in das NCAVC, das Nationale Zentrum für die Analyse von Gewaltverbrechen in Quantico, versetzt wurde. Ein paar Jahre später nahm mir das FBI meinen Dienstausweis und meine Waffe ab und überreichte mir die Entlassungspapiere. ‹Sie haben die Fähigkeiten und das Talent, Dr. Street. Es fehlt Ihnen lediglich an Konzentration.› Ich weiß noch, wie ich in dem Moment dachte, dass mir nur eines fehlte. Und zwar ein Drink, was natürlich Teil des Problems war.» Inzwischen ist Keye Street trocken. Als ein Serientäter in Atlanta vollkommen wahllos Menschen umbringt, wird sie von ihrem alten Freund Lieutenant Rauser in die Ermittlungen hineingezogen. Bald steckt sie tief in einem der gruseligsten Fälle, die sie je erlebt hat. Denn die Leute öffnen immer die Tür, wenn der Mörder klingelt. Dann sticht er zu – immer und immer wieder ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Amanda Kyle Williams
Cut
Thriller
Über dieses Buch
«Mein Name ist Keye Street. Der Vorname stammt von meinem asiatischen Großvater, den Nachnamen haben mir meine Adoptiveltern verpasst. Von Beruf bin ich Detektivin, genauer gesagt Privatdetektivin. Ansonsten bin ich trockene Alkoholikerin und Fan von Cheeseburgern und Donuts. Früher wurde ich mit Special Agent Street angesprochen. Klingt nicht übel, oder? Ich hatte einige praktische Erfahrung, bevor ich als Profilerin in das NCAVC, das Nationale Zentrum für die Analyse von Gewaltverbrechen in Quantico, versetzt wurde. Ein paar Jahre später nahm mir das FBI meinen Dienstausweis und meine Waffe ab und überreichte mir die Entlassungspapiere.
‹Sie haben die Fähigkeiten und das Talent, Dr. Street. Es fehlt Ihnen lediglich an Konzentration.›
Ich weiß noch, wie ich in dem Moment dachte, dass mir nur eines fehlte. Und zwar ein Drink, was natürlich Teil des Problems war.»
Inzwischen ist Keye Street trocken. Als ein Serientäter in Atlanta vollkommen wahllos Menschen umbringt, wird sie von ihrem alten Freund Lieutenant Rauser in die Ermittlungen hineingezogen. Bald steckt sie tief in einem der gruseligsten Fälle, die sie je erlebt hat. Denn die Leute öffnen immer die Tür, wenn der Mörder klingelt. Dann sticht er zu – immer und immer wieder …
Vita
Amanda Kyle Williams hat für die Keye-Street-Serie Kurse bei Brent Turvey, einem bekannten Kriminologen und Profiler genommen, als Privatdetektivin fremde Menschen überwacht und als Gerichtsbotin gearbeitet. Sie lebt in Atlanta und arbeitet an dem nächsten Fall für Keye Street.
Für Anna Scott Williams, meine Muse.
Und für Donny Kyle Quinn,
der geholfen hat, die Saat zu säen.
Prolog
Die Sonne hatte den Tau im Gras unter den Eichen noch nicht erreicht, doch es war bereits so stickig und schwül, dass jede Bewegung anstrengte.
Im Wagen, der unbemerkt vor Lei Kotos Haus parkte, tupfte sich ein geduldiger Jäger die Schweißperlen von der Stirn und beobachtete mit Adleraugen, wie im Francine Drive der Alltagstrott begann.
Gegen sieben Uhr wurden die weißen Fenster des kleinen Hauses aufgerissen, und Lei Koto war zunächst verschwommen in der Küche zu sehen, ein beinahe abstraktes Bild hinter der Scheibe und dem Fliegengitter, aber dennoch ein Objekt der Begierde. Als sie dann Frühstück zubereitete, roch es bald bis auf die Straße nach gebratenem Speck und Toast und Kaffee, und da empfand ihr Mörder zum ersten Mal an diesem friedlichen Morgen ganz gewöhnlichen Hunger.
Kurz vor zehn war es wieder ruhig im Francine Drive. Der letzte Nachbar war zur Arbeit verschwunden, um Punkt zehn vor zehn, wie jeden Morgen. Die Frühstücksdüfte aus der Küche waren anderen Gerüchen gewichen, es roch jetzt irgendwie säuerlich nach Kohl.
Die Wagentür ging auf, Schritte auf dem Gehweg, ein Aktenkoffer, gute Schuhe, ein strahlendes Lächeln, eine Visitenkarte.
Die Leute öffnen immer die Tür.
1
Mein Name ist Keye Street. Der Vorname stammt von meinem asiatischen Großvater, den Nachnamen haben mir meine Adoptiveltern verpasst. Von Beruf bin ich Detektivin, genauer gesagt Privatdetektivin, ich arbeite fürs Gericht und als Kautionseintreiberin. Ansonsten bin ich trockene Alkoholikerin und leidenschaftlicher Fan von Krystal Cheeseburgern und Krispy Kreme Donuts. Früher war ich mal psychologische Gutachterin für das FBI. Wie ich hier im Süden im tiefsten Georgia gelandet bin, wo jemand mit meinem Äußeren von den Einheimischen immer noch als gottverdammte Fremde tituliert wird, und wodurch ich mich für die übrige Welt wie eine Hinterwäldlerin anhöre, ist ein Rätsel, das mir Emily und Howard Street nie ganz enthüllt haben. Ich weiß nur, dass der Kinderwunsch der beiden so groß gewesen sein muss, dass sie eine chinesisch-amerikanische Göre mit zweifelhaften Genen aus einem Waisenhaus adoptierten. Meine Großeltern und Vormunde waren ermordet worden, meine biologischen Eltern waren drogenabhängig, das Geld dafür verdiente meine Mutter mit Strip-Tanz. Ich habe keine Erinnerung an sie. Kurz nach meiner Geburt haben sie sich auf und davon gemacht. Mein Chinesisch ist quasi nonexistent, aber meine Adoptivmutter, Emily Street, die sich wie keine Zweite auf Andeutungen und Anspielungen versteht, hat mir eine Menge über die subtile und passiv aggressive Sprache der Frauen des Südens beigebracht. Eigentlich hatten sie ein niedliches weißes Kind haben wollen, doch irgendetwas in der Vergangenheit meines Vaters, etwas, womit sie partout nicht herausrücken wollen, hat ihnen das unmöglich gemacht. Ich habe schnell begriffen, dass die Menschen im Süden ungeheuer verschlossen sind.
Als Kind fand ich den Süden toll, ich liebte ihn und liebe ihn noch heute. Man lernt, ihm die Engstirnigkeit und alle Übel zu verzeihen, denn der Süden hat ein großes Herz. Man verzeiht ihm die schwülen Sommer, weil im Frühling alles blüht und gedeiht, weil der November mit einem üppigen Farbenspiel aufwartet, weil die Winter mild und kurz sind, weil Maisbrot und süßer Tee und Brathuhn genauso zu einem Sonntag gehören wie das Sichherausputzen für die Kirche und weil jeder waschechte Südstaatler bitte und danke sagt. Der Süden bedeutet Sonnenschein und Sommerwein, Kiefernwälder und dicke, selbstgezogene Tomaten. Hier kann man die Aprikosen direkt vom Baum pflücken und sich den Saft übers Kinn tropfen lassen. Hier schätzt und respektiert man die Nachbarn aus Alabama, die sonst überall die Zielscheibe einschlägiger Witze über den Süden sind. Der Süden geht einem ins Blut und sitzt einem in den Knochen. Nicht ich bin ein Teil des Südens, der Süden ist ein Teil von mir. Von einem Landstrich geprägt zu sein ist eine romantische Vorstellung. Aber hier unten sind wir alle ziemlich romantisch. Hier ist jeder Rhett Butler und Scarlett O’Hara und Rosa Parks in einem.
Mein afroamerikanischer Bruder Jimmy, den meine Eltern zwei Jahre nach mir adoptierten, hat völlig andere Erfahrungen gemacht. Da wir keine Weißen sind, hatten wir beide gegen Ignoranz und Klischees zu kämpfen, aber ich kam dabei noch besser weg als Jimmy. Die Leute waren oft überrascht, dass ich Englisch konnte, und fanden es entzückend, dass ich es wie eine echte Südstaatlerin sprach. Außerdem nahmen sie an, dass ich wegen meiner asiatischen Herkunft besonders gescheit war. Man erwartete von mir nicht nur, dass ich mich hervortat, man ermunterte mich regelrecht dazu. Die gleichen Leute hätten nachts die Straßenseite gewechselt, um meinem Bruder aus dem Weg zu gehen. Ein schwarzer Junge konnte nur gefährlich sein. Von unserer Mutter hatte er den Dialekt der Küste Carolinas übernommen, der eigentlich den weißen Südstaatlern in vorwiegend weißen Vierteln vorbehalten war. In einer Zeit, in der Vielfalt nicht gerade geschätzt wurde, konnte mein Bruder in keiner Gemeinschaft einen Platz finden und begann schon während der Highschool, sich an Universitäten der Westküste zu bewerben und sorgfältig seine Flucht vorzubereiten. Jimmy plant alles durch. Und er ist immer vorsichtig. Nie überzieht er sein Konto, er ist noch nie entlassen worden, hatte nie Drogenprobleme und ist noch nie nach ein paar Gläsern zu viel die Fifth Avenue in New York runtergejagt, hat seinen Kopf durchs Sonnendach gesteckt und seine Freude herausgebrüllt, so wie ich. Jimmy ist ein anständiger Junge. Er lebt jetzt mit Paul, seinem Liebhaber, in Seattle, und nicht einmal die Aussicht auf Mutters Brombeercobbler könnte ihn zurück nach Georgia locken.
Was ich in dieser Nacht auf der Veranda eines alten Hauses zu suchen hatte, meine Zehn-Millimeter-Glock in beiden Händen, den Rücken an die Wand gepresst, von der die Farbe blätterte und auf mein schwarzes T-Shirt abfärbte, und warum ich über den knarrenden Holzboden schlich, ist eine ganz andere Geschichte.
Früher wurde ich mit Special Agent Street angesprochen. Klingt nicht übel, oder? Ich war hervorragend ausgebildet für diese Arbeit und hatte einige praktische Erfahrung, bevor ich als Kriminalpsychologin oder Profilerin in das NCAVC, das Nationale Zentrum für die Analyse von Gewaltverbrechen, in Quantico versetzt wurde. Ein paar Jahre später nahm mir das FBI meinen Dienstausweis und meine Waffe ab und überreichte mir die Entlassungspapiere.
«Sie haben Verstand und Talent, Dr. Street. Es fehlt Ihnen lediglich die Konzentration.»
Ich weiß noch, wie ich in dem Moment dachte, dass mir nur eines fehlte, und zwar ein Drink, was natürlich ein Teil des Problems war.
An jenem Tag wurde ich ins Parkhaus des FBI geleitet, zu meinem alten Cabrio, einem weißen und ellenlangen 69er Impala, der schräg über die Linie auf zwei Parkplätzen stand. Schmeißt man einen Special Agent raus, kriegt man zwei freie Parkplätze. Kein schlechtes Geschäft.
Vier Jahre später manövrierte ich mich an einem zugezogenen Fenster vorbei und gratulierte mir dazu, es geräuschlos geschafft zu haben. Doch dann knarrte die vergammelte Veranda plötzlich. Durchs Fenster sah ich den Lichtschein eines Fernsehers, der so leise lief, dass ich fast nichts verstand. Ich wartete reglos, lauschte, ob sich drinnen etwas rührte, guckte dann um die Ecke und versuchte, durch die Vorhänge zu spähen. Ich konnte die Umrisse eines Mannes erkennen. Wow! Gewaltige Umrisse.
Solche Jobs können knifflig sein. Wer trotz hinterlegter Kaution nicht vor Gericht erscheinen will, bewegt sich schnell. Man muss zugreifen, sobald sich eine Chance ergibt. Man hat nicht die Zeit, etwas über die Nachbarschaft, die Tagesabläufe oder etwaige Besucher herauszukriegen. Ich war ohne Überwachung oder Unterstützung hier und völlig auf mich allein gestellt. Mein Herz hämmerte, und das Adrenalin strömte wie Wasser in einem Feuerwehrschlauch durch meine Adern. Ich schmeckte es geradezu. Mandeln und Süßstoff. Ich machte mir vor Angst fast in die Hose, und ich genoss es.
2
Die Straßenbeleuchtung war aus, der nächtliche Himmel mit dichten weißen Wolken überzogen, die ein schummriges Licht auf den überwucherten Vorgarten warfen und die Hitze wie eine Decke einschlossen. Atlanta im Sommer: schwül und stickig. Die Anspannung und die Feuchtigkeit ließen mir den Schweiß von der Stirn und über meine geschwärzten Wangen laufen. In meinen Tarnklamotten hockte ich mich neben die Eingangstür und kramte in meinem schwarzen Rucksack nach Tom. So nannte ich das Gerät, Tom, wie Peeping Tom, der Spanner. Es ist ein Miniaturbildschirm, der durch ein gut ein Meter langes Kabel mit einer Knopfkamera verbunden ist. Mit Toms Hilfe braucht man sich bei solchen Aufträgen nicht nur auf Vermutungen zu verlassen. Nachdem ich das Kabel mit der Kamera unter der Tür hindurchgeschoben und herumgedreht hatte, bekam ich einen ziemlich guten Blick ins Zimmer.
Der Gesuchte, Antonio Johnson, war ein Wiederholungstäter. Kaum zwei Monate aus dem Gefängnis entlassen, hatte er einen Laden überfallen. Vor drei Wochen hatte ich seine Fährte in Kanada aufgenommen und wieder verloren. Doch seine Exfrau lebte in Atlanta, und Johnson war dafür bekannt, ihr nachzustellen, und tatsächlich hatte er sie wieder belästigt. Über einen Freund bei der Polizei hatte ich herausgefunden, dass er sie von einem Münztelefon in einem schäbigen Motel in Atlantas drogenverseuchtem West End angerufen hatte. Dort spürte ich Leute auf, die Johnson kannten, und einer verpfiff ihn für vierzig Dollar. Er war in einer Wohnung an der Jonesboro Road in der Nähe des Bundesgefängnisses untergekommen, eine Gegend, in der selbst die Einheimischen ihre Autotüren verriegeln, wenn sie an einer Ampel stehen, und die jeder Pendler nach Einbruch der Dunkelheit lieber weiträumig umfährt.
Auf dem kleinen Monitor konnte ich ihn auf einem abgewetzten Sofa sitzen sehen, die Füße auf einem Couchtisch. Er schien allein zu sein, in der rechten Hand ein Bier, die linke lag in seinem Schoß und war teilweise verborgen. Was versteckst du da, Fettsack?
Während ich auf der Veranda in der Schwüle kauerte, genau über dem süßlichen Gestank des Mülls und leerer Bierdosen, roch ich etwas Synthetisches wie Sekundenkleber und Styropor.
Ich entsicherte die Glock und klopfte an die Tür. Ich wollte möglichst überzeugend wie eine Frau in Not klingen, wollte sagen, dass ich mal telefonieren müsste, dass ich eine Reifenpanne hätte, kurzum, ich wollte irgendwas sagen, damit er die verdammte Tür aufmachte. Ich war noch unschlüssig, aber ich hatte gelernt zu improvisieren, seit ich auf mich selbst gestellt war.
Johnson zögerte nicht. Auf meinem winzigen Monitor sah ich noch, wie etwas aus seinem Schoß hervorkam, und schon blies er ein faustgroßes Loch in die Tür, direkt neben meinem Ohr. Der Knall war laut wie ein Kanonenschlag und zersplitterte das Holz. Die Wucht schleuderte mich von der Veranda auf den Boden.
Ein weiterer Schuss. Das Vorderfenster ging zu Bruch, Scherben flogen umher. Ich kauerte mich an die Veranda, spürte Schnitte im Nacken und in den Armen, richtete mich dann so weit auf, dass ich ungefähr in Richtung des Fensters feuern konnte. Ich wollte ihn nicht erschießen. Ich wollte nur, dass er sich ein bisschen zurückzog.
Dann war alles still.
Geduckt lief ich die Stufen hoch. Noch immer kein Laut. Ich wollte gerade durch das Loch in der Tür greifen, um sie zu entriegeln, als ich es hörte. Er hatte eine verfluchte Pumpgun. Wenn man das Geräusch einmal gehört hat, vergisst man es nicht mehr. Der Vorderschaft wird zurückgezogen, der Verschluss öffnet sich, eine Hülse fliegt raus, der Vorderschaft wird zurückbewegt, eine neue Patrone wird geladen, der Verschluss schließt sich. Bei einem guten Schützen dauert das Ganze nur den Bruchteil einer Sekunde, und Johnson hatte eine Menge Übung.
Ich presste mich mit dem Rücken an die Wand, holte Luft und hielt einen Moment inne. In solchen Situationen ist es immer ratsam, eine kurze Kosten-Nutzen-Rechnung anzustellen. Wollte ich mich wirklich umbringen lassen, um diesen Kerl einzulochen? Verdammt, nein, das wollte ich nicht, doch der Adrenalinfluss, den solche Ereignisse hervorrufen, trieb mich vorwärts und nicht zurück, das illustriert vielleicht am besten den Unterschied zwischen Leuten meiner Branche und der normalen Bevölkerung.
Bum! Johnson hatte seine Pumpgun erneut abgefeuert. Wie bei einem Kanonenschlag spürte ich den Boden unter mir beben. Wahrscheinlich füllte er seine Patronen selbst. Wer weiß, womit er da auf mich schoss. Noch ein Teil der Tür flog heraus. Dann ertönte das rasche Knallen einer automatischen Waffe.
Auf drei, sagte ich mir.
Eins … zwei … zweieinhalb … zweidreiviertel. Scheiße! Drei!
Ich hob ein Bein und trat mit einem der Kampfstiefel, die ich bei solchen Jobs trage, so kräftig ich konnte gegen die Stelle direkt über der Klinke. Die Tür gab sofort splitternd nach und flog auf. Ich drückte mich wieder an die Wand und wartete.
Stille.
Ich umklammerte die Glock mit beiden Händen. Mein Herz schlug so heftig, dass ich spürte, wie eine Halsader gegen den Stoff pochte. Ich machte einen Schritt um die Ecke und inspizierte den Raum. Ein Wohnzimmer mit Essnische. Dahinter konnte ich die Küche erkennen sowie einen Flur. Wahrscheinlich gab es noch zwei weitere Zimmer und ein Bad. Kurz schaute ich nach draußen, ehe ich eintrat und die Türen und Fenster abzählte. Wo war er? Im Schlafzimmer, im Flur?
Dann Schüsse. Ich warf mich auf den Boden, rollte mich in die Essnische und feuerte ein paar Salven ab, damit er mir nicht zu nahe kam.
«Kautionseintreibung, Mr. Johnson! Lassen Sie Ihre Waffe fallen und kommen Sie mit den Händen hinter dem Kopf heraus! Sofort!»
«Eine Tussi?», rief Johnson zurück und lachte. «Nie im Leben!»
Ich hörte die Hintertür aufgehen und das Fliegengitter klappern. Ich lief in die Küche. Die Tür schwang noch, und ich sah die weißen Buchstaben auf Johnsons T-Shirt durch den dunklen Hinterhof zum Zaun wackeln.
Ich ging die Stufen zum Hof runter und schaute gelassen zu, wie sich Johnson dem Zaun und dem Tor näherte. Dort hatte ich etwas für genau diesen Fall installiert.
Es dauerte nicht lange. Der kleine Hof war mit einem Metallzaun umgeben, die Pforte mit einem hufeisenförmigen Riegel verschlossen. Johnson packte den Zaun, und als er sich gerade hinüberhieven wollte, warf die Explosion ihn zurück. Ich hatte nur ein bisschen Schwarzpulver, etwas Petrolatum, eine Batterie und ein paar Drähte benutzt. Noch in zwei Metern Entfernung klingelten mir die Ohren von dem Feuerwerk, und für ein paar Sekunden musste ich mir den Weg durch Millionen winziger Blitze bahnen.
Johnson lag reglos auf dem Bauch. Die Glock schussbereit in beiden Händen, ging ich vorsichtig zu ihm. Er war zwar ausgeknockt, atmete aber regelmäßig. Ich zog seine dicken Arme nach hinten. Die Handflächen waren versengt.
«So dramatisch sollte es eigentlich nicht werden», sagte ich zu seinem schlaffen Körper, während ich ihm die Handschellen anlegte, einen Gürtel durchzog und dann um seine Taille wickelte. «Aber ich habe eben überhaupt keine Ahnung von Sprengstoffen.»
Ich drehte Johnson auf den Rücken, hob seine riesigen Füße an und versuchte ihn wegzuziehen. Verdammt. Der Kerl wog mindestens hundertzwanzig Kilo und rührte sich nicht. Ich bin auf Zehenspitzen eins fünfundsechzig groß und wiege fünfzig Kilo. Nachdem ich ihn ungefähr zehn Zentimeter weit geschleift hatte, gab ich auf. Ich hätte über Handy die Polizei anrufen können, aber dort hätte man sich wochenlang über mich lustig gemacht.
Ich ließ seine Beine fallen und stieß ihm den Lauf der Glock in die Rippen. «Na los, du Riesenbaby, aufwachen.»
Es dauerte eine Ewigkeit, bis seine Lider aufgingen und er geradeaus gucken konnte.
«Hi», sagte ich fröhlich und leuchtete ihm mit der Taschenlampe in die blutunterlaufenen braunen Augen. «Erinnerst du dich an mich?»
Er krümmte sich wütend und grunzte wie ein Tier, als er merkte, dass seine Hände auf dem Rücken gefesselt waren.
«So, willst du jetzt deinen fetten Arsch zum Wagen bewegen, oder soll ich die Bullen rufen?»
«Und wer bist du, wenn du kein Bulle bist?»
Gute Frage, dachte ich. «Sobald ich das herausgefunden habe, lasse ich’s dich wissen», sagte ich und stieß ihn erneut, damit er aufstand. Doch da er sich mit den Händen nicht abstützen konnte, hatte er Probleme. Ich stellte mich hinter ihn und zerrte ihn hoch.
«Schon mal über eine Diät nachgedacht?»
«Das gefällt dir doch, du Schlampe», lallte Johnson. Er schien ziemlich benebelt zu sein. «Du bist doch scharf auf Antonio. Gib’s doch zu.»
Aber sicher. Ich steh auf vorbestrafte, fette Arschlöcher.
«Okay, Fettsack. Dann machen wir beiden mal eine kleine Spritztour.»
3
Das alte Sears-Roebuck-Gebäude ist ein Wahrzeichen Atlantas. Es wurde 1926 in sieben Monaten erbaut und wirkte mit dem martialischen Turm in der Mitte schon damals eher wie ein Gefängnis als wie ein Einkaufszentrum. Das Ungetüm aus verblichenen Ziegeln erstreckt sich über Tausende von Quadratmetern und erhebt sich neun Stockwerke über die Ponce De Leon Avenue am Rande der Innenstadt, wo man früher nicht zum Tanken anhalten konnte, ohne von Stadtstreichern angeschnorrt oder gar überfallen zu werden. Dann ist die Polizei eingezogen. Seit einigen Jahren steht auf dem Schild am Eingang CITY HALL EAST, es wird als Außenstelle des Rathauses benutzt und beherbergt zurzeit einen Teil unserer ständig wachsenden Bürokratie sowie mehrere Abteilungen von Atlantas riesigem Polizeiapparat. Aber das wird sich bald ändern. Der Bürgermeister hat einen Deal über vierzig Millionen Dollar mit einem Investor abgeschlossen, der behauptet, das Gebäude in ein paar Jahren zur neuen Topadresse der Stadt zu machen. Eigentumswohnungen, Ateliers und Restaurants sollen entstehen. So läuft es in Atlantas Innenstadt, die sich ständig wandelt und wo das Baugewerbe blüht. Die Umzugspläne der Stadt für die jetzigen Nutzer sind recht weit gediehen, aber niemand scheint Lust darauf zu haben, sein Büro zu räumen. Auf jeden Fall die Polizei nicht, wie ich aus erster Hand weiß.
Etwas weiter östlich bildete sich vor der Suppenküche bereits eine Schlange. Den ganzen Monat über hatte das Thermometer bei Sonnenaufgang nicht unter 25 °Celsius angezeigt. Die Stadt litt unter einer für den Süden typischen Hitzewelle, doch die Obdachlosen stellten sich in warmen Jacken für das Frühstück an. Offenbar spürt man die Wärme nicht, wenn der Magen leer ist. Ich fragte mich, wie die neue Topadresse der Stadt mit den Stammgästen der Suppenküche zurechtkommen würde.
Als ich mit Antonio Johnson ins Revier kam, sah ich, dass Lieutenant Aaron Rauser mich von seinem Büro im Morddezernat am anderen Ende des Ganges beobachtete. Johnson war mittlerweile wieder ganz munter und machte ein Mordstheater. Im Auto hatte er noch still auf der Rückbank gesessen, benommen von den Drogen und dem Feuerwerk, doch als ich von einem Telefon des Reviers Tyrone anrief, für dessen Kautionsbüro ich arbeitete, und ihm sagte, dass ich Johnson geschnappt hatte, fing der Kerl an, verrückt zu spielen.
Ein paar Polizisten, die am Ende ihrer Schicht hereintrudelten, lachten bei dem Aufruhr. «Hey, Keye», meinte einer der Uniformierten. «Was ist los? Hast du dich von dem Fettsack in den Arsch treten lassen?»
Ich verdrehte die Augen, übergab Johnson dem Erkennungsdienst und wartete dann auf die Papiere, die ich brauchte, um mein Geld von Tyrone zu kriegen. Als ich hinüberging in Rausers gläsernes Büro, machten die Beamten im angrenzenden Großraumbüro Kussgeräusche. Rausers Beziehung zu mir schien sie immer wieder zu dämlichen Witzen zu provozieren. Ich schätze, wir gaben ein seltsames Paar ab. Rauser ist weiß und zwölf Jahre älter als ich. Wir kommen aus völlig verschiedenen Welten, und im Revier ging das Gerücht um, wir wären ein Liebespaar. Stimmte nicht. Er ist mein bester Freund.
«Guten Morgen.» Ich versuchte fröhlich zu klingen, obwohl mir der Kopf dröhnte. Ich hatte keine Zeit gehabt, mich frischzumachen, meine Unterarme waren noch mit Glassplittern gespickt.
Rauser sah auch nicht besser aus. Er deutete hinüber zu dem Tisch, wo Antonio Johnsons Fingerabdrücke genommen wurden. «Warum musst du solche Scheißjobs annehmen?»
«Geld», sagte ich, aber das kaufte er mir nicht ab. Mein Lächeln verging. Es lag an seinem Ton. Manchmal musste Rauser nicht mehr tun, und das mochte ich ganz und gar nicht. Er hatte diesen Blick aufgesetzt. Immer hackte er auf mir herum, wenn er etwas nicht richtig fand.
«Keye, um Gottes willen. Du bist überqualifiziert für so was, und du hast genug Aufträge von großen Firmen. Du brauchst solchen Mist nicht zu machen. Manchmal verstehe ich dich nicht.»
Ich spielte mit einer Stiftkappe auf seinem Schreibtisch und vermied den Blickkontakt. Mir war klar, dass er das abweisend fand, aber ich war nicht in der Stimmung für seine väterlichen Ratschläge.
Im Geiste ging ich kurz die Liste der Firmenaufträge durch. Die Honorare waren in der Tat nicht schlecht. Ich hatte einen Teil der Hypothek für meine Wohnung damit getilgt. Aber es war stumpfsinnige Arbeit: Überprüfen der Lebensläufe von Arbeitnehmern, der Herkunft von Kindermädchen, der Ansprüche von verletzten Arbeitern, der Klagen gegen Bauunternehmer und von untreuen Ehegatten. Ab und zu bot die Zustellung von Vorladungen etwas Abwechslung, aber zum größten Teil waren die Aufträge unerträglich langweilig.
Seit ich das FBI verlassen hatte, besaß ich eine Lizenz für das Eintreiben von Kautionen. Damit war ich über die Runden gekommen, während ich meine eigene Privatdetektei aufbaute, und diese Aufträge bessern mein Einkommen noch immer schön auf. Meine Psychotante, Dr. Shetty, meint, es wäre ein Machtding, knallharter Fall von Penisneid. Tja. Ich schnall mir halt hin und wieder gern eine große Glock um.
Und meine Qualifikationen: ein Abschluss in Kriminologie an der Georgia Southern University, eine Promotion in Verhaltenspsychologie an der Georgia State. Doch selbst nach acht Jahren beim FBI würde ich damit in diesem Land bei keiner Polizeibehörde eine Stelle finden. Jedenfalls nicht mehr. Der Alkohol hat alles kaputtgemacht. Das Saufen hat nicht nur mein Leben durcheinandergewürfelt, sondern auch Eingang in meine Akten gefunden und meine Karriere für immer ruiniert. Ich könnte nicht einmal als Gutachterin arbeiten, denn Gutachter sind Fachleute, deren Vergangenheit im Zeugenstand nicht auseinandergepflückt werden kann. Ich habe zu viele Leichen im Keller.
Ich war fünfzehn Jahre alt, als ich zum ersten Mal von der Abteilung für Verhaltensforschung am NCAVC hörte, und danach konnte ich an nichts anderes mehr denken. Ich richtete meine gesamten Studien und mein ganzes Leben auf dieses Ziel aus, und ein paar Jahre später hatte ich es geschafft. Und dann habe ich alles vermasselt.
Manchmal erhält man nur eine Chance. Und manchmal ist das auch gut so. Denn im Grunde beginnt das wahre Leben erst dann, wenn man nicht das kriegt, worauf man fixiert war, und wenn man glaubt, nicht mehr weiterzuwissen. Plötzlich muss man umdenken und irgendwie versuchen, damit zurechtzukommen und seinen Seelenfrieden zu finden. Tief in sein Inneres zu schauen ist schließlich nie schlecht, selbst wenn einem dafür erst mal anständig in den Arsch getreten werden muss.
«Wenn du dich weiter mit diesem Kautionsscheiß herumschlägst, gerätst du irgendwann unter die Räder», brummte Rauser und murmelte dann etwas, das wie «kranke Arschlöcher» klang.
Ich ließ mich langsam auf einen der dünnen schwarzen Plastikstühle vor seinem Schreibtisch nieder. Mir taten alle Knochen weh vom Sturz von der Veranda, ich spürte den Schmerz erst jetzt richtig.
«Was ist los?», fragte ich.
Rauser zog eine Zigarette aus seiner Brusttasche und steckte sie sich in den Mundwinkel. Sein Zippo gab erst beim dritten Versuch Feuer. Eigentlich durfte er im Gebäude nicht rauchen, aber ich würde ihn nicht zurechtweisen. Heute nicht. «Erinnerst du dich noch daran, als es, wie soll ich sagen, normale Fälle gab? Leute, die den Kerl im Bett ihrer Frau erschießen oder so? Nichts Krankes. Ganz normale, alltägliche Morde.»
Ich schüttelte den Kopf. «Muss vor meiner Zeit gewesen sein.»
Rauser öffnete die Schublade seines Schreibtisches, ließ die Zigarette in einen versteckten Aschenbecher fallen und massierte sich mit gesenktem Kopf die Schläfen. Plötzlich fiel mir auf, dass sein Haar mehr graue als schwarze Stellen hatte. Er war fast fünfzig, gutaussehend und durchtrainiert, doch ein Leben mit zu viel Koffein und Zigaretten, ständig auf der Jagd nach Monstern, hatte ihn ergrauen lassen.
«Ein übler Fall?», fragte ich.
Rauser sah mich nicht an. «Das wäre untertrieben.»
«Du wirst ihn lösen», sagte ich. «Die Guten gewinnen immer, oder?»
«Genau», brummte Rauser ungefähr so überzeugend wie Bill Clinton bei einer eidesstattlichen Erklärung. «Und vielleicht kommt gleich Jugde Judy rein und wackelt mit dem Arsch für uns.»
«Hört sich gut an», sagte ich, und Rauser schenkte mir zum ersten Mal an diesem Tag ein Lächeln.
4
MESSERSPIELE.COM
Deine scharfe Community im Netz: Fetisch- & Messerspiele blogs > schärfer als SCHARF, eine Phantasie von BladeDriver Titel > Blutroter Kohl
Es war das erste Mal, dass ich ihr so nahe war, obwohl ich sie schon häufig gesehen hatte. Und sie hatte mich auch gesehen. Ob bewusst, kann ich nicht sagen, doch in der Öffentlichkeit hatten ihre Blicke mich gestreift. Ich stand auf ihrer Veranda und wartete, dass sie die Tür öffnete. Lange musste ich nicht warten. Sie hatte nicht einmal die Fliegentür zugemacht. Sie fühlen sich so sicher in ihren kleinen Häusern, dachte ich, und dabei fiel mir ein altes Lied ein. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky tacky … and they all look just the same …
Sie kam in einem hellblauen Baumwollkleid an die Tür, ein Geschirrtuch in der Hand, Schweißperlen auf der Stirn. Sie bat mich herein. Eine heiße Brise von der Straße wehte durch die geöffneten Fenster. Sie führte mich in die Küche und bot mir einen Stuhl am Tisch an. Sie kochte bereits, später würde es zu heiß sein. Das Haus hat keine Klimaanlage. Es ist schon stickig. Der Geruch vom kochenden Kohl nahm mir fast den Atem. Die Kücheneinrichtung war hellgelb und veraltet. Sie erzählte, dass ihr Sohn an diesem Nachmittag aus dem Ferienlager heimkehren würde, und ich musste die ganze Zeit daran denken, wie sie später riechen würde, dann, wenn die Angst eingesetzt hatte.
«Mein Sohn hat immer Hunger», sagte sie und lächelte mich an, als wäre es ein besonderes Talent, Hunger zu haben. Eine echte Glucke eben. «Ich bin froh, dass Sie da sind. Mir war nicht klar, dass Sie heute kommen wollten.»
Ich sagte ihr nicht, warum ich da war. Ich wollte die Überraschung nicht verderben. Die dumme Kuh lächelte mich an und strich sich mit dem Handrücken eine verschwitzte Strähne aus der Stirn. Ich dachte an ihre Haut, die Wärme, die Beschaffenheit, den salzigen Geschmack, den festen Widerstand, wenn ich meine Zähne hineinschlagen würde.
Sie bot mir Eistee an und stellte ihn vor mich. Wasserperlen tropften vom Glas auf die Tischplatte. Ich ließ meine Hände im Schoß liegen und rührte das Glas nicht an. Ich berühre nichts. Ich bin unsichtbar.
Ich hatte meinen Aktenkoffer auf den Tisch gelegt und so geöffnet, dass sie nicht hineinschauen konnte. «Was glauben Sie, wie wird der kleine Tim wohl damit zurechtkommen, bei Ihrer Schwester zu leben?», fragte ich. Ich konnte dem Impuls zu spielen nicht widerstehen.
Sie stand am Herd und drehte sich zu mir um. «Ich verstehe Sie nicht. Mein Sohn lebt bei mir.»
Du wirst schon noch verstehen.
In dem Moment sah ich ihr zum ersten Mal an, dass sie etwas unsicher wurde. Ich sah Unruhe in ihren dunklen Augen, als sie erst den Aktenkoffer und dann mich ansah, ihr Blick zu meinen Händen schweifte und schließlich zur Küchentür. Irgendetwas in ihr alarmierte sie und bat um Aufmerksamkeit, eine leise Stimme, die ihr sagte, schnell die Flucht zu ergreifen. Aber sie hörte nicht darauf. Die Menschen hören nie darauf. Im Grunde ist es vollkommen absurd. Sie wollen mich nicht vor den Kopf stoßen. Was, wenn sie sich irrten? Das wäre ihnen unglaublich peinlich.
Ich schloss die Augen und atmete ein. Unter dem Essensgeruch und der Hitze nahm ich ihn schließlich wahr, den zwiebeligen Duft der Angst, ihrer und meiner, der schwer in der Luft hing. Er traf mich wie ein Stromschlag. Die Hormone spielten verrückt, mein Herz pochte wild bei dem Gedanken an das, was gleich geschehen würde. Ich spürte ein tiefes und drängendes Brennen zwischen den Beinen. Ich konnte nur noch diese kleine Frau sehen. Nichts anderes konnte ich riechen, nicht anderes wollte ich. Sie war alles.
Ich streifte mir enge Latexhandschuhe über, so dünn, dass ich mit den Fingerspitzen beinahe die Luft spüren konnte, und nahm dann mein Lieblingsspielzeug aus dem Aktenkoffer: einen Krummdolch mit mattiertem Weißgoldschaft und einer zwölf Zentimeter langen Stahlklinge. Ich betrachtete ihren schmalen Rücken, während sie dastand und in ihrem Kohl rührte, und fragte mich, ob sie die Verbindung zwischen uns bereits spürte. Ich wollte, dass sie sie spürte, dass sie es wusste, einen kurzen Moment, bevor meine Hand sie berührte.
Ich glaube, sie wusste es. Ich glaube, sie wollte es.
Das Viertel zwischen Virginia-Highlands und Little Five Points in Atlanta ist sehr angesagt. Meine kleine Detektei befindet sich an der Highland Road in einer Reihe ehemals vergessener Lagerhäuser. Vor ein paar Jahren entschloss sich der Eigentümer, die Außenfassaden zu renovieren und im hellen Miami-Art-déco-Stil, mit viel Glas und Metall, zu gestalten. Jetzt nennen sich die Gebäude Studios, die Wohnungen heißen jetzt Lofts. Die Miete für die bisherigen Bewohner stieg in die Höhe – also für mich, die schwule Theatergruppe nebenan, den Tätowierer und Piercer mit den S/M-Aufklebern auf seinem Jeep daneben und die indische Friseuse am Ende. Die Renovierung würde unsere Geschäfte ankurbeln, sagte man uns. Wir würden mehr Laufkundschaft haben, jetzt, wo die Gebäude auch Leute aus den nahen Cafés anzögen, die dort Espresso trinken und Biscotti essen. Ich hasse Biscotti. Also wirklich, wer steht denn auf diese harten Kekse? Und Laufkundschaft hasse ich auch. Meistens handelt es sich um völlig Verrückte. Menschen mit ein bisschen Grips im Kopf machen keinen Schaufensterbummel, um einen Detektiv zu finden.
Aber das Viertel mag ich. Wenn die Theatergruppe probt, ertappe ich mich dabei, wie ich den ganzen Tag Revuelieder summe, und wenn ich bis spät am Abend gearbeitet habe, treffe ich manchmal auf kostümierte Schauspieler, die vor dem Haus rauchen und plaudern. Neulich beobachtete mich eine Frau in einem Nixenkostüm. Sie hatte eine Zigarette zwischen den Lippen und betrachtete mich durch den Qualm, sagte aber nichts. Ich auch nicht. Was soll man zu einer schwulen Nixe sagen? Eine Kreidetafel kündigte Proben für Swishbucklers an.
Der Haarsalon zwei Türen weiter läuft ruhig und während der normalen Geschäftszeiten. Die Besitzerin verabscheut zutiefst Begriffe wie Friseuse, Haarschneiderin oder, Gott bewahre, Kosmetikerin und lässt jeden wissen, dass sie Haarkünstlerin genannt werden möchte. Außerdem hat sie kürzlich von ihrem Guru einen neuen spirituellen Namen verliehen bekommen und würde es sehr gerne sehen, wenn ihre Nachbarn dies respektierten, was wir tatsächlich versuchen. Doch der Wechsel vom schlichten Mary zu Lakshmi fällt uns manchmal etwas schwer. Der Name bedeutet in etwa Göttin des Wohlstands, und jeder Nachbar hofft inständig, dass an dem Namen etwas dran sein möge und das Glück uns endlich hold ist.
Mein Büro befindet sich in Studio A, auf einem kleinen Schild an der Tür steht: AUSKÜNFTE & ERMITTLUNGEN. Drinnen erzeugen die Computer, Drucker, ein paar alte Faxgeräte, die Leuchtstoffröhren und eine riesige Klimaanlage ein konstantes Brummen, das ich manchmal noch höre, wenn ich nachts die Augen schließe.
Ich habe die Detektei vor ein paar Jahren gegründet, nachdem ich blinzelnd aus der Entzugsanstalt kam, so als hätte ich drei Monate lang in einer Höhle gelebt. Ich war auf der Suche nach irgendetwas, nach irgendeiner Arbeit, nach irgendeiner Ablenkung. Ich wollte auf keinen Fall dorthin zurück. In der Klinik hatte mich jemand gefragt, ob dies mein erster Entzug sei, und ich weiß noch, wie ich ihn mit offenem Mund anstarrte und dachte, mein Gott, einmal genügt nicht? Aber jetzt verstehe ich. Draußen klarzukommen ist eine ganz andere Sache. Es gibt keine Hilfe und keine Sicherheit. Kein Netz und keinen doppelten Boden. Der Tag hat zu viele Stunden, und Stunde um Stunde wird man mit seiner eigenen eklatanten Schwäche konfrontiert.
In den ersten Tagen besuchte ich in der ganzen Stadt Treffen der Anonymen Alkoholiker, manchmal ging ich von einem Treffen direkt zum nächsten. Und ich hasste sie. Das ständige Gerede von Gott ging mir echt auf die Nerven. Ich weiß, ich weiß. Sie sagen dort, man kann sich irgendwas als seinen persönlichen Gott wählen. Leichter gesagt als getan. Wenn man bei einem Meeting ist und jeder Händchen halten und beten will, dann hat man nicht wirklich eine Wahl. Und dass jeder Teilnehmer ständig vom Alkohol redete, führte bei mir nur dazu, dass ich ständig Lust auf einen Scheißdrink hatte. Aber bei den Treffen kriegt man nichts zu trinken, und das ist eben der Punkt, jedenfalls war es für mich der Hauptgrund hinzugehen. Die Leute bei den Meetings, denen ich mich so überlegen fühlte und die ich manchmal für ihre Schwächen und ihre Freundlichkeit verachtete, nahmen meine Feindseligkeit extrem geduldig und verständnisvoll hin und retteten mir trotz meiner beschissenen Einstellung das Leben. Statt in den nächsten Schnapsladen zu rennen, ging ich hinaus in die Welt, um zu arbeiten.
Die Detektei lief sofort gut an, und ich war die ganze Zeit beschäftigt mit traditionellen Ermittlungsaufträgen, der Suche nach Vermissten, dem Aufspüren von Wanzen, dem Verhaften von Flüchtigen und gelegentlich mit Ausflügen in Gebiete, über die man lieber nicht öffentlich spricht.
«Denver», gluckste Neil. «Wir haben ihn. Er hat dort ein Haus gekauft.»
Neil ist blond, ein bisschen schmuddelig und meistens unrasiert. Er saß vor einem Computer, sein Hawaiihemd bis zum Bauchnabel aufgeknöpft. In einer Stadt ohne Strand wirkt Neil ein wenig fehl am Platz. Als ich mich zu ihm hinunterbeugte, um auf den Bildschirm zu sehen, roch ich Kaffee und Marihuana, seine persönlichen Aufputschmittel.
Wir versuchten seit einiger Zeit, einen Buchhalter aufzuspüren, der aus der Stadt verschwunden war, mitsamt dem Inhalt eines Firmensafes, in dem sich unter anderem eine ziemlich große Menge Bargeld befunden hatte. Die Firma wollte keine Anklage erheben, sondern die Sache, so hatte ich es verstanden, auf leise Weise klären. Wir sollten einfach den Buchhalter ausfindig machen und ihnen die nötigen Informationen übergeben. Ich fragte nicht nach den Gründen. Irgendetwas in dem Safe war offenbar einige Mühen wert, aber das ging mich nichts an. Meine Tage als Gesetzeshüterin waren vorbei.
«Der Typ klaut fünfhunderttausend», meinte Neil und strich sich sein langes Haar hinters Ohr. «Und dann geht er nach Denver? Kannst du dir das vorstellen?»
Neil war der erste Mensch gewesen, den ich angerufen hatte, als mir die Idee für die Detektei kam, denn ohne sein Wissen hätte ich nicht anfangen können. Er kennt sich wie kein anderer mit Computern aus, er ist einer von diesen Typen, die sich während ihrer Highschool-Zeit am liebsten ins Zimmer einschlossen, den Computer auf dem Schoß, ein paar Drogen in Reichweite und den Kopf voller revolutionärer Spinnereien. Früher war Neil ein Hacker, und zwar ein äußerst erfolgreicher, der es erst auf die Fahndungsliste für Internetkriminelle geschafft und dann als Berater fürs FBI gearbeitet hatte. Er steht auf der Gehaltsliste von unzähligen Großkonzernen, die ihn als Sicherheitsexperten anheuerten, nachdem man seine illegalen Aktivitäten nicht hatte stoppen können. Neil wird heute bezahlt, um nicht zu hacken. Er ist also nichts anderes als ein Erpresser. Aber es kann nicht schaden, so jemanden zu kennen, oder? Außerdem arbeitet er zu günstigen Konditionen, denn eigentlich braucht er das Geld nicht. Er arbeitet für mich, weil es ihm Spaß macht, allerdings macht es ihm nur Spaß, wenn er die volle Kontrolle hat. Das heißt, er arbeitet nur, wenn er Lust hat und nur zu seinen Bedingungen. Ich habe kein Problem damit. Er ist ein äußerst wertvoller Mitarbeiter, und meistens kommen wir gut miteinander aus.
Er wandte sich von seinem Monitor ab und schaute mich zum ersten Mal an diesem Morgen an. Ich trug Cargoshorts und hatte die Ärmel meines Hemdes bis zu den Ellbogen hochgekrempelt. Meine Unterarme waren nach der etwas schiefgelaufenen Verhaftung noch ziemlich zerkratzt. Neil nippte an seinem Kaffee und musterte mich.
«Willst du nach Denver und dir den Kerl schnappen?»
Ich schüttelte den Kopf. «Ich will nur bezahlt werden.»
«Die wollen mit Sicherheit, dass du hinfährst und holst, was er aus dem Safe geklaut hat, und ich wette, dass es ihnen nicht um das Geld geht. Vielleicht haben sie ihre Bücher frisiert oder Ausschreibungen manipuliert. Wer weiß, vielleicht waren auch Sexvideos im Safe.»
Ich dachte darüber nach. «Ich fahre trotzdem nicht hin.»
Er lächelte und schaute mich durch seine blonden Strähnen hindurch müde an. «Hast du Angst, dir einen Nagel abzubrechen?»
«Ich heiße ja nicht Neil, oder?», konterte ich.
Einen Augenblick schien es ihm die Sprache zu verschlagen. «Feigling», gab er zurück, und so begann der Tag ganz nach unserem Geschmack mit kindischem Geplänkel.
Von draußen hörten wir ein lautes Tuten, einen Moment später ging die Tür auf, und Charlie Ramsey kam grinsend in unser Büro. Neil schaute mich lächelnd an. Wir arbeiten nach Vereinbarung, und wenn jemand unangekündigt reinkommt, dann handelt es sich meistens um Charlie, Rauser oder meine Freundin Diane, die ich seit der Schulzeit kenne. Charlie kündigt sein Kommen immer mit der Hupe an seinem Fahrradlenker an. Er ist schätzungsweise Mitte vierzig, arbeitet als Fahrradkurier und hat ungefähr den Verstand eines Zwölfjährigen, weshalb er sehr gut zu uns passt. Charlies Besuche sind immer eine willkommene Ablenkung.
Im Viertel kursieren eine Menge Geschichten darüber, wie Charlie mit über vierzig auf einem Fahrrad mit Hupe geendet war. Im Grunde klingen alle Geschichten ähnlich: Er hatte einen erstklassigen Job, eine großartige Familie, sein Leben war ein einziger Sonnenschein, bis er an der Ecke 10th Street und Peachtree von einem gepanzerten Geldtransporter überfahren und für immer beeinträchtigt wurde. Frau und Kinder liefen ihm davon, Charlie verlor seinen Job und sein Zuhause. Er hat heftige Schmerzen im Nacken, erzählte er mir einmal, außerdem Migräneattacken, die ihn schachmatt setzen. Manchmal kann man ihn kaum verstehen. Wenn er aufgeregt ist, spricht er undeutlich und wird ziemlich laut, und da Charlie mit seinem immer etwas schief sitzenden Fahrradhelm eigentlich recht maulfaul ist, kann ein Gespräch mit ihm ein bisschen, nun ja, surreal werden. Gelegentlich scheint er klare Momente zu haben, aber die sind eher selten. Die meiste Zeit ist er einfach ein großes, einfältiges Kind. Einmal habe ich ihn nach seiner Vergangenheit gefragt, und er hat von dem Unfall erzählt. Allerdings spricht er nie über die Zeit vor dem Unfall, sondern immer nur über die Zeit nach dem Unfall, so als hätte sein Leben erst dann begonnen. In einem seiner seltenen klaren Momente hat er mir erzählt, dass sich das Leben von einer Sekunde auf die andere total verändern kann. Er hat Monate in einem Rehabilitationszentrum verbracht und mitgekriegt, dass die Patienten dort uns Außenstehende die «vorübergehend körperlich Gesunden» nannten, ein weiterer Hinweis darauf, wie veränderlich das Leben ist. Diese Lektion hatte ich schon gelernt, bevor Charlie in unser Leben trat, aber seine Ernsthaftigkeit an diesem Tag werde ich nie vergessen. Wir hatten ihn einige Wochen nicht gesehen und machten uns Sorgen um ihn. Charlie fährt jeden Tag mit seinem Rad durch den tückischen Verkehr in Atlanta und ist, da er nur noch ein halbes Gehirn zu haben scheint, eine Art tickende Zeitbombe. Rauser und Neil haben ständig Wetten am Laufen – einen Zehner, dass er dieses Jahr unter die Räder gerät usw. Ich beteilige mich nicht daran.
Man weiß nie, wann Charlie auftaucht, es kann am frühen Morgen oder am späten Nachmittag sein, aber normalerweise kommt er mehrmals die Woche vorbei, immer lächelnd und selten ohne ein Geschenk. Im Sommer kann es zum Beispiel sein, dass seine abgewetzte Baseballkappe voller Brombeeren ist. Im Winter pflanzt er Stiefmütterchen in den Blumentopf vor unserer Tür. Zwei Straßen weiter ist eine Gärtnerei, und wir vermuten, dass Charlie die bunten Stiefmütterchen nachts klaut, wenn ihn nur ein anderthalb Meter hoher Drahtzaun von den Beeten trennt. Am meisten scheint er die gelben mit den violetten Augen zu mögen, die gleichen, die zufälligerweise im Angebot der Gärtnerei immer wieder fehlen.
Er kam lächelnd herein, den Helm schief auf dem Kopf und die dickrandige Brille fast bis auf die Stirn geschoben. Er trug seine Kurieruniform, Shorts und ein besticktes Poloshirt, dazu weiße, kurze Socken. Sein Körper ist schlank und kräftig, seine Beinmuskulatur zeigt, dass Charlie einmal ziemlich sportlich war. Aber so wie er seinen Kopf hält, das gelegentliche Zucken und das Starren mit offenem Mund, das ihn manchmal überkommt, all das lässt keinen Zweifel daran, dass mit dem armen Charlie irgendetwas nicht stimmt.
Er streckte uns seine umgedrehte Baseballkappe hin. «Feigen», sagte er, zu laut und so vernuschelt, dass es wie Fleigen klang. «Magst du Fleigen, Keye? Neil, du?»
«Frische Fleigen?», meinte Neil und grinste. «Super. Wo hast du die geklaut?»
Charlie zeigte Richtung Tür. «Von einem Scheißbaum», sagte er und sah zufrieden aus. Neil lachte schallend und applaudierte. Er hatte Charlie beigebracht, wie man fluchte. Ich warf Neil einen bösen Blick zu.
«Meine Eltern haben einen Feigenbaum im Garten, Charlie», sagte ich. «Willst du wissen, wie sie die Feigen zubereiten?» Ich öffnete den Kühlschrank und holte eine Packung Mascarpone heraus. Neil und ich verfeinern alles damit, ob Selleriestangen oder Sandwiches. «Kommst du mit einem Messer klar, Charlie? Kannst du die Feigen halbieren?»
Charlie nickte. «Ich weiß, wie man Fische ausnimmt.»
«Wow», sagte ich, rieb etwas Orangenschale in den Mascarpone und gab ein wenig Honig dazu. Charlie nahm einen Teelöffel, tauchte ihn in die Masse und bedeckte nach meinen Anweisungen die Feigenhälften. Danach verzierte ich das Ganze noch mit Schoko-Haselnuss-Creme. Eine Weile bewunderten wir unser Werk.
«Verdammt schön», sagte Charlie.
«Sie werden dir schmecken, versprochen», sagte ich.
«Hältst du deine Versprechen, Keye?», fragte Charlie und steckte sich eine Feige in den Mund.
Ich dachte darüber nach. «Ich habe es nicht immer getan, Charlie, aber ich versuche es.»
Neil schenkte sich frischen Kaffee ein und setzte sich an den Tisch.
Charlie nahm noch eine Feige. «Die sind wirklich gut! Warum heißt du Keye?»
«Mein Großvater hieß Keye.»
«Aber du hast doch gar keine Familie.»
Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich Charlie etwas über meine Kindheit erzählt hatte, aber dann fiel mir wieder der Tag ein, an dem ich so mutig gewesen war, ihn nach seiner Vergangenheit zu fragen. Er war so unglaublich klar und ernsthaft gewesen. Vielleicht hatte ich ihm damals etwas erzählt.
«Doch, ich habe eine Familie. Aber die hatte ich nicht gleich von Anfang an. Die Familie, die ich jetzt habe, wollte meinen Namen nicht ändern.»
«Das ist gut. Es ist ein schöner Name», sagte Charlie und wischte sich mit dem Unterarm etwas Käse und Schokolade vom Mund. «Und was du von Anfang an hattest, gehörte ja alles dir, oder?»
Ich legte meine Hand auf seine. «Du bist ein sehr kluger Kerl. Weißt du das?»
«Ja», antwortete Charlie. «Ich kann Fische echt schnell ausnehmen.»
5
Die Tür ging auf, die Sonne schien hinein, und Lieutenant Aaron Rauser schlenderte herein und stieß beinahe mit Charlie zusammen.
«Charlie, wie geht’s?», fragte Rauser und hob eine Hand.
Charlie lachte laut auf und schlug Rausers Hand ein. «Muss arbeiten gehen, Mr. Mann. Hey, Keye kann kochen», meinte er und verschwand ohne weitere Erklärung.
«Oookay», sagte Rauser und fügte dann halb flüsternd hinzu: «Kaum zu glauben, dass er mal Biochemiker war oder so. Armer Kerl.»
«Ich habe gehört, er war Ingenieur, aber ich glaub’s nicht», sagte Neil und spähte hinaus, um sich zu vergewissern, dass Charlie weg war. «Meiner Meinung nach ist er einfach zurückgeblieben.»
Rauser kicherte, und ich sagte: «Das ist unglaublich unsensibel, selbst für eure Verhältnisse.»
«Was soll’s», meinte Neil und kehrte mit seinem Kaffeebecher an den Schreibtisch zurück.
Rauser ging in die Küche, wo es fast immer frischen Kaffee gab. Neil scheint von nichts anderem zu leben. Und manchmal, wenn er besonders großzügig ist, macht er Rauser und mir Cappuccino. Morgens bevorzugt er seinen Kaffee schwarz und stark, nachmittags im Winter trinkt er gerne einen Jamaican Blue und im Sommer kubanischen Eiskaffee mit Sahne und Zucker. Wenn meine Beine zu zittern anfangen, schenkt er mir keinen mehr ein.
Aber heute war Rauser nicht wegen des Kaffees gekommen. Er hatte etwas auf dem Herzen. Ich sah, wie er an seiner Unterlippe nagte, als er sich einen Becher einschenkte. Ohne Jackett, mit dem Schulterholster über einem schwarzen T-Shirt, unter dem sich sein Bizeps abzeichnete, und den grauen Hosen sah er nicht übel aus. Ich betrachtete ihn mit Wohlgefallen, solange er mich nicht anschaute. Rauser war kein glatter, aber ein ziemlich gutaussehender und männlicher Typ, der sich jeden Morgen bis zum Schlüsselbein hinunter rasieren musste. Eher Tommy Lee Jones als Richard Gere.
Als Rauser die übriggebliebenen Feigen entdeckte, sah er mich fragend an und aß sie dann alle auf. Die Lust auf Süßes war nur eine Eigenschaft, die wir teilten.
Er holte sich noch einen Kaffee aus der Küche, die im Grunde nur eine Ecke des umgebauten Lagerhauses war, eine Nische mit den nötigen Geräten, einer Spüle und roten Marmorplatten. In dem weiten, offenen Raum direkt dahinter waren große, bauschige Sitzelemente aus Leder strategisch angeordnet, dazu Lederwürfel in Rot, Lila und Minzgrün. Die Wände waren in einem hellen Salbeiton gestrichen, die längste und freistehende Wand war jedoch dunkelgrün und in der Mitte mit einer grellhellgrünen Linie verziert, einer Mischung aus Blitz und EKG-Kurve. Ich hatte die Gestaltung einer Innenarchitektin mit gutem Ruf anvertraut, eine fragwürdige Entscheidung, wie ich später dachte.
«Fehlt nur noch ein rosaroter Dinosaurier!», lautete meine erste Reaktion, als ich unser fertiges Loft zum ersten Mal sah. Die Innenarchitektin stand, eine Hand in die Hüfte gestemmt, vor ihren ehrfurchtsvoll aufgereihten Untergebenen und erklärte mir alles sehr ausführlich und mit zusammengebissenen Zähnen, so als wäre ich unfähig zu erkennen, wie modern und aufregend ihre Gestaltung war. Gut. Meinetwegen. Ich mag es modern und aufregend. Hey, ich hatte eine Menge Geld ausgegeben, um von ihr ins 21. Jahrhundert katapultiert zu werden, und, bei Gott, ich würde es zu schätzen wissen. Ein breiter Flachbildfernseher, der sich bei Bedarf aus seiner Halterung heruntersenkte, war mein Highlight. Er begeistert mich immer wieder. Neil, Rauser, ich, Diane und manchmal auch Charlie haben hier schon einige Abende verbracht und Spiele oder Filme geschaut. Oder Kicker gespielt an einem Tisch, den Neil extra bestellt hatte. Allerdings musste er dann jemanden zum Zusammenbauen engagieren. Wir waren uns bei dem Versuch zweimal in die Haare geraten, ehe uns klarwurde, dass uns schlicht das Werkzeug dazu fehlte. Das verfluchte Ding war in bestimmt fünfhundert Einzelteilen geliefert worden.
Rauser kam zu uns zurück, blies den Dampf von seinem Kaffee und beobachtete uns mit hochgezogenen Augenbrauen. Neil und ich alberten gerade herum, und das schien ihn zu ärgern.
«Ja», sagte er, laut genug, um uns zu unterbrechen. «Die intellektuelle Stimulation hier, genau deswegen komme ich so gerne her.»
«Warum bist du sonst hier?», fragte Neil grinsend.
«Um zu sehen, ob du genauso gut Schwanz lutschen kannst wie Kaffee kochen», entgegnete Rauser.
«Das hättest du wohl gern», meinte Neil, ohne Rauser anzuschauen. Er war auf seinen Bildschirm konzentriert, auf dem ein Durcheinander aus Buchstaben, Zahlen und Zeichen zu sehen war. Vielleicht hackte er sich gerade bei der CIA ein, jedenfalls hatte er das schon einmal getan und dabei das Wort Intelligence in ihrem Logo durch ein anderes ersetzt, das ihm besser gefiel.
Er drehte seinen Stuhl herum, verschränkte die Arme und musterte Rauser einen Moment. «Ich habe heute Morgen übrigens ein leichtes Halluzinogen in den Kaffee getan.»
Neil und Rauser schienen sich ständig in einer Art Wettstreit zu befinden. Da meine Anwesenheit das nur zu verschlimmern schien, drehte ich mich zu meinem Büro um, bevor die beiden aufeinander losgingen. Ich hatte Arbeit zu erledigen, aber Rauser war mir sofort auf den Fersen.
Er folgte mir in die linke hintere Ecke des Lagerhauses, die mein Büro ist. Es hat weder Wände noch sonst irgendwelche Abgrenzungen, hinter denen man seine Ruhe hätte. O nein, das wäre zu einfach gewesen. Stattdessen hatte die Innenarchitektin einen riesigen Drahtzaun aufstellen lassen. Er ist ungefähr drei Meter hoch und wird von dunkelblauem Licht angestrahlt, sodass man sich an Ostberlin zu Zeiten des Kalten Krieges erinnert fühlt. Wirklich etwas Besonderes und, das muss ich zugeben, auf eine abstruse Art schön.
Rauser knallte seinen alten Aktenkoffer auf meinen Schreibtisch, mühte sich kurz mit einem der Schnappschlösser ab und klappte ihn auf. Ich musste grinsen. Die unteren Ecken waren völlig abgewetzt und das Leder so ausgeblichen, dass man nicht mehr erkennen konnte, welche Farbe der Koffer ursprünglich gehabt hatte. Der Anblick amüsierte mich, er war typisch für Rauser. Die Polizei hatte ihm einen neuen Wagen angeboten, aber ihm gefiel sein alter Crown Vic. Rauser, hatte ich gesagt, der Wagen ist ein Oldtimer. Was denkst du dir dabei? Er hatte mit den Achseln gezuckt und etwas gebrummt wie dass er keine Lust hätte, das Handschuhfach und die Türfächer und überhaupt alle irgendwo hingestopften Notizen und Landkarten und Zeitungen und Zigaretten und Abfälle aufzuräumen.
Er zog einen Stapel Fotos aus dem Koffer und ließ ihn vor mir auf den Schreibtisch fallen. Ohne Vorwarnung wurden mir Tatortfotografien vorgeknallt. Der Tod auf meinem Schreibtisch. Mein Lächeln und meine gute Laune verblassten schnell.
«Eine Hausfrau», sagte Rauser, als ich ein Foto in die Hand nahm und die Luft durch die Zähne einsog. «Eine ganz normale Frau. Weißt du, was ich meine?» Er setzte sich mir gegenüber auf einen Stuhl. Mir wurde plötzlich flau im Magen.
Ich drehte das erste Foto um und las die Daten. Lei Koto, Asiatin, dreiunddreißig Jahre alt. Auf dem Bauch in einer Blutlache in einer Küche liegend. In der oberen rechten Ecke konnte man den Rand eines Herds erkennen. Ihre Beine waren gespreizt, Hintern und Oberschenkel nackt und blutig, es gab eine Menge Stich- und Bisswunden. So wie sie dalag, sah sie furchtbar klein und allein aus, dachte ich. Und mir kam einmal mehr in den Sinn, was für eine einsame Sache der Tod ist und wie krass, unwirklich, entstellend und gleichzeitig verräterisch Fotografien vom Ort einer Gewalttat sind. Schon auf den ersten Blick, noch bevor man Einzelheiten erfährt, erkennt man an den Farben, den durch die grellen Scheinwerfer der Spurensicherung hervorgehobenen Furchen und Schwellungen, am Blut und dem verfilzten Haar und der unnatürlichen Körperhaltung, dass es sich um eine Mordszene handelt. Solche Bilder vergisst man nie.
«Wer hat sie gefunden?», fragte ich.
«Ihr zehnjähriger Sohn», antwortete Rauser. Ich schaute von den Fotos auf. «Tim», fügte er hinzu.
Das wird ihn prägen, dachte ich, seine Sichtweise auf die Welt ändern. Seinen Blick auf einen Fremden, einen Blutfleck, ein leeres Haus. Es wird diesen kleinen Jungen genauso verändern, wie es mich verändert hat. In gewisser Weise sind wir alle verunstaltet durch den scheußlichen Schmerz, den ein Mord auslöst. Ich wollte nicht über dieses Kind nachdenken oder darüber, was es empfand oder empfinden würde. Wenn man sich damit auseinandersetzt, lässt man die Finsternis in sein Leben sickern. Und obwohl mir das bewusst war, litt ich mit dem Jungen, ein Teil von mir wollte ihm helfen, ihn vor den Albträumen bewahren, vor dem Herumgeschobenwerden, das kommen würde. Denn im Grunde weiß niemand, was man mit einem Kind anfangen soll, das durch ein Gewaltverbrechen heimatlos geworden ist. Nehmen Verwandte ihn auf? Die Polizei wird die Frage laut stellen, gedankenlos und in bester Absicht. Die Erwachsenen werden hinter seinem Rücken tuscheln und sich Sorgen machen und ihm bekümmerte Blicke zuwerfen und damit seine Furcht nur vergrößern. Ein Fremder vom Jugendamt wird bei ihm sitzen, während nach den nächsten Angehörigen gesucht wird. Doch keine Beruhigung, keine Freundlichkeit kann den Riss in seinem Leben heilen. Das wird Jahre brauchen.
Die Fotos zitterten in meinen Händen.
«Warum zeigst du mir die?»
Er reichte mir einen Brief, der an Lieutenant Rauser/Morddezernat adressiert und ordentlich getippt war, aber keine Unterschrift aufwies. Ich blickte einen Moment lang darauf, ehe ich zu lesen begann. Rauser beobachtete mich dabei.
Liebster Lieutenant,
wollen Sie wissen, wie ich es getan habe? Nein, das werden Ihre forensischen Experten mittlerweile herausgefunden haben. Finden Sie die Einzelheiten beunruhigend? Ich habe so lebendige Erinnerungen daran, wie ich vor ihrem Haus stand und den Dunst aus der Küche roch. Als sie die Tür öffnete, lächelte sie. Ich weiß, was Sie jetzt denken, aber Sie werden keine Spur von mir in ihrem Leben finden. Ich gehörte nicht zum engeren Kreis. Sie starb, ohne zu wissen, wer ich war. Sie starb mit der Frage, warum. Alle wollen sie ein bisschen Frieden inmitten des Chaos. Aber es ist ihr Chaos, nicht meines. Ich antworte ihnen nicht. Ich bin nicht da, um sie zu trösten.
Die Zeitungen haben mich Monster genannt. Ich glaube, Sie wissen es besser. Was haben die Profiler Ihnen erzählt? Dass ich intelligent bin, im normalen Leben nicht auffalle und sexuell funktioniere? Schade, dass die Methoden dieser Experten nicht ausreichen, um meine zu ermessen. Sie haben den Zeitungen bestimmte Informationen über die Tatorte vorenthalten. War Ihnen bewusst, dass mich die dauernden falschen Spekulationen zu einer Reaktion zwingen würden? Und was sagt Ihnen Ihre Erfahrung über diesen Brief, dieses neue Hilfsmittel für Ihre Ermittlung? Entweder sind Sie zu dem Schluss gekommen, dass ich sowohl angeberisch als auch sadistisch bin oder dass ich ein tiefes und dringendes Bedürfnis habe, gefasst und bestraft zu werden. Und bestimmt fragen Sie sich, ob ich tatsächlich die Person bin, die Sie suchen. Soll ich Sie überzeugen?
Schon um zehn Uhr war es an diesem Morgen drückend heiß, und die Luft in der Küche war stickig und feucht von dem Topf mit kochendem Kohl. Ich spürte eine Brise durch das offene Fenster, als ich neben dem Tisch stand und auf sie hinabschaute. Da rührte sie sich schon nicht mehr, und als ich sie umdrehte, um mein Zeichen zu setzen, wirkte sie so klein.
Das Letzte, was sie hörte, abgesehen von ihrem eigenen Wimmern, war das Klicken meiner Kamera und das leise Knacken ihres Genicks, als würde ein Wunschknochen entzweibrechen.
6
«Er hat ihr das Genick gebrochen», sagte ich leise und lehnte mich zurück. In der Hand hielt ich das Foto von Lei Koto, verrenkt und blutüberströmt auf dem Boden ihrer Küche, den Kopf unnatürlich weit nach links gebogen.
«Das ist die Todesursache», meinte Rauser. «Was hältst du von dem Hinweis auf den Wunschknochen?»
Ich drängte meine Gefühle beiseite. Ich drängte sie beiseite, so wie ich es immer getan hatte, und wechselte zu meinem ausgebildeten Ich, zu meinem distanzierten Ich. Als Wunschknochen wird das gegabelte Brustbein von Geflügel bezeichnet. Wenn zwei Personen jeweils an einem Ende ziehen und den Knochen auseinanderbrechen, so sagt der Brauch, hat diejenige, die den längeren Teil erwischt, das Recht auf die magische Erfüllung jedes Wunsches. «Macht, Dominanz, Manipulation des Opfers, des Körpers des Opfers», antwortete ich.
«Was in diesem Brief steht, entspricht den Tatsachen, bis hin zum Kohl auf dem Herd. Wir geben die Todesursache oder Einzelheiten vom Tatort nie an die Presse weiter. Das Original des Briefs ist im Labor. Wenn wir Glück haben, finden wir auf dem Umschlag einen Fingerabdruck oder Speichelspuren. Viel mehr haben wir bisher nicht.»
«Du hast einen Brief des Mörders. So ein psychologisches Beweismaterial bekommt man nicht alle Tage.»
Rauser nickte. «Dieser Fall ist anders gelagert, Keye. Es gibt kein Motiv, die Tatorte geben nichts her. Es gibt praktisch kein handfestes Beweismaterial. Ich schätze, wir finden diesen Kerl nur, wenn wir seine Inszenierungen verstehen.»
Irgendwo tief in mir schrillte eine winzige Alarmglocke. Ich spürte die vertraute Verlockung, ein Psychogramm zu erstellen und mich mit den Gewalttaten von Straftätern auseinanderzusetzen. Ja, dieser Fall war anders, dachte ich. Meine Hände begannen zu schwitzen. Alle wollen sie ein bisschen Frieden inmitten des Chaos. Sie war nicht sein erstes Opfer, hörte ich mich zu Rauser sagen. Ja, dieser Fall liegt anders. Der Täter ist nicht nur irgendein Opportunist, irgendein Gewaltverbrecher, sondern etwas anderes, ein grausames und gieriges Wesen, das Angst und Schmerz auslöst und sich daran weidet.
«Wir wissen von vier Opfern.» Rausers graue Augen waren kalt wie Winterregen. «In Florida ist ein Detective auf ungelöste Fälle angesetzt worden, er hat die Details in die Datenbank eingegeben. Zwei Fälle dort wiesen Ähnlichkeiten mit einem Fall von hier, aus den nördlichen Vororten, auf. Bei dem Koto-Fall entdeckten wir sofort das gleiche Muster. Kein Zweifel, es ist die gleiche Handschrift. Die Position der Leiche, die vielfachen Stichwunden, die Inszenierung, das Fehlen von Spuren. Außerdem lagen die Opfer in allen Fällen mit dem Gesicht nach unten, die Beine gespreizt, und sie wiesen sowohl Stichwunden an verschiedenen Körperstellen auf, die ihnen vor dem Tod zugefügt wurden, als auch Stichwunden an bestimmten Stellen wie den Oberschenkeln, dem Gesäß und der unteren Rückenpartie, die ihnen nach Eintritt des Todes zugefügt wurden. Dann die Bisswunden an der Innenseite der Oberschenkel, den Schultern, am Hals und am Gesäß. Und immer wurde die gleiche Waffe benutzt, eine gezackte Klinge, vielleicht ein Fischmesser, zwölf bis fünfzehn Zentimeter lang. Die Bissmarken weisen auf ein und denselben Täter hin.»
«Keine DNA?»
Rauser schüttelte den Kopf. «Er benutzt Gummi- oder Latexspangen, vielleicht einen Gebissschutz. Wir überprüfen Sanitätshäuser, Zahnärzte, Sanitäter, Krankenhäuser.» Er kaute an seiner Lippe. «Vier Opfer, von denen wir wissen. Aber wie viele Mordfälle sind nicht in der Datenbank erfasst? Oder haben andere Merkmale? Wenn der Täter schon in jungen Jahren zu morden begonnen hat, stimmen dann die frühen Morde mit den aktuellen überein? Ich nehme an, dass er dazugelernt und sich entwickelt hat.»
«Wann fand der erste Mord statt?»
Rauser musste nicht in seine Notizen schauen. «Keye, dieser Kerl ist bestimmt seit mindestens fünfzehn Jahren auf der Jagd.»
Wie viele Morde waren unentdeckt? Wie viele ungelöste Fälle hatten noch nicht Eingang in die Datenbank gefunden? Ich versuchte, das zu verarbeiten. «Der letzte Mord hat sein Verlangen nicht befriedigt», stellte ich fest. «Deswegen schreibt er dir. Er ist ruhelos, unerfüllt. Er teilt dir mit, dass er jetzt erst richtig aktiv wird, Rauser.»
Rauser kratzte sich sein stoppeliges Kinn. «Weißt du, was mir wirklich zu schaffen macht? Die Art, wie er die Opfer zurücklässt. Der Scheißkerl wusste genau, dass Koto ein Kind hat. Er weiß genug von jedem Opfer, er kommt und geht genau rechtzeitig, um nicht gesehen zu werden. Der Junge sollte sie finden.»
Ich wollte nicht an den Jungen oder an sonst jemanden denken, der einen geliebten, mit solcher Verachtung gequälten und getöteten Menschen auffindet. Es dauerte einen Moment, ehe ich den größer werdenden Kloß in meinem Hals herunterschlucken konnte. «Das rituelle Zurschaustellen der Leiche, sie in eine Position zu legen, die der Mörder als erniedrigend betrachtet, damit ein Angehöriger sie so findet, die Leiche unbekleidet zurückzulassen, die noch nach dem Tode zugefügten Verstümmelungen, all das gehört zum Aspekt der Dominanz. Mit diesen Maßnahmen verschafft sich der Mörder absolute Kontrolle über das Opfer.»
Rauser nahm weitere Fotografien aus seinem Koffer, mehrere mit Gummibändern zusammengehaltene und etikettierte Stapel, die er mir über den Schreibtisch zuschob. «Warum dreht er die Opfer deiner Meinung nach um? Das hat er in allen Fällen getan.»
«Vielleicht kann er den Anblick ihrer Gesichter nicht ertragen», antwortete ich und dachte einen Augenblick darüber nach. «Vielleicht hat er das Gefühl, sie beobachten ihn.»
«Mein Gott», meinte Rauser.
«Die Leichen zu positionieren verschafft ihm weitere Macht. Es hilft ihm, sich von ihnen zu distanzieren und sie noch mehr zum bloßen Objekt zu machen.»
Ich ging die Fotos der Reihe nach durch. Anne Chambers, Weiße, 22, Tallahassee, Florida. Bob Shelby, Weißer, 64, Jacksonville, Florida. Elicia Richardson, Schwarze, 35, Alpharetta, Georgia. Und Lei Koto, Asiatin, 33. Drei Frauen und ein Mann unterschiedlichen Alters und ethnischer Zugehörigkeit, alle mit dem Gesicht auf dem Boden liegend, erstochen und gebissen.
Sie starb mit der Frage, warum. Alle wollen sie ein bisschen Frieden inmitten des Chaos. Aber es ist ihr Chaos, nicht meines. Ich antworte ihnen nicht. Ich bin nicht da, um sie zu trösten.
Ich schaute Rauser an. «Bei diesen Verbrechen ist die Tötung nicht das Entscheidende. Sie ist lediglich des Resultat seines Verhaltens am Tatort. Manipulation, Kontrolle, Dominanz, das sind die Motive.»
Rauser stöhnte. «Wunderbar, dann wird es ja ganz leicht, ihn zu finden.»