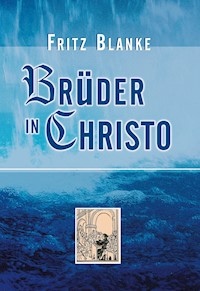
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schleife Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Autor beschreibt den Werdegang dieser faszinierenden Erweckungsbewegung von hingegebenen Christen, die dafür brannten, die Nachfolge Jesu noch konkreter in ihrem persönlichen Leben und in der Gestaltung der Kirche umzusetzen. Dafür wurden sie verfolgt, verbannt oder mussten sogar mit ihrem Leben bezahlen. Herausragend an Fritz Blankes Arbeit ist die erstaunliche Balance zwischen der profunden Kenntnis und Würdigung von Zwinglis Werk und Geist und der einfühlsamen und wohlwollenden Schilderung der Erweckung unter den Rebbauern am Zürichsee. Heute geht es um Schritte der Versöhnung und darum, das Erbe der Täufer wieder neu zu entdecken: ihre ungeteilte und mutige Hingabe an Jesus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch erschien erstmals 1955 im Zwingli Verlag, Zürich.
2. Auflage Mai 2024
© Schleife Verlag, Pflanzschulstrasse 17, CH-8400 Winterthur, SchweizTel. +41 (0)52 2322424, E-Mail: [email protected], www.schleifeverlag.ch
ISBN: 978-3-907827-24-6Bestellnummer 120.024
E-Book ISBN: 978-3-905991-74-1E-Book Bestellnummer 120.024E
Umschlaggestaltung: Atelier Pia Petri MaurerSatz und E-Book: Nils GroßbachDruck: Booksfactory, Berlin
Alle Rechte vorbehalten, auch für auszugsweise Wiedergabe und Fotokopie.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur Nachauflage von «Brüder in Christo»
Vorwort
Die Vorstufen des Täufertums in Zürich (1523–1525)
Die Entstehung der Täufergemeinde in Zollikon
Der Zusammenstoss mit der Obrigkeit
Neuer Aufschwung
Erneute Gefangenschaft
Die Propheten von Zollikon
Das Ende
Anmerkungen
Vorwort zur Nachauflage von «Brüder in Christo»
Der Aufbruch in Zollikon im Jahr 1525 war eine wichtige Initialzündung der ganzen Täuferbewegung. 2025 feiern wir das 500-jährige Jubiläum dieser «Erweckung», wie Fritz Blanke sie nennt. Der Nachdruck von «Brüder in Christo» erfolgt aus diesem Grund. Das Büchlein nimmt uns mitten hinein in die damalige bewegte Geschichte und inspiriert uns zum Aufbruch und zur radikalen Nachfolge Jesu Christi in unserer Zeit.
Als Schleife Verlag haben wir das erstmals 1955 im Zwingli Verlag erschienene Buch im Hinblick auf die Täuferkonferenz der Stiftung Schleife 2003 neu herausbringen dürfen. Der damalige Kirchenratspräsident Ruedi Reich verfasste das Vorwort. Im Bussgottesdienst am 3. Mai 2003 im voll besetzten Zürcher Grossmünster erklärte er die Verfolgung des Täufertums durch die reformierte Kirche als «Verrat am Evangelium» und die Täufer als «Zweige desselben evangelischen Astes am grossen christlichen Baum», folglich zu legitimen Kindern der Reformation.
Pfr. Geri Keller, Gründer der Stiftung Schleife und Initiant der Täuferkonferenz, entschuldigte sich für das Verhalten der Reformierten: «Wir haben uns geirrt!» Der amische Bischof Ben Girod, der aus den USA als ein Repräsentant des Täufertums angereist war, rief uns am Wirkungsort Zwinglis in Zürich zu: «We forgive you». Wir Anwesenden spürten, dass wir Zeuge davon werden, wie Gott seine Kirchengeschichte weiterschreibt: Der Riss quer durch die ursprüngliche Reformationsfamilie wird gekittet, es geschieht Versöhnung.
Pfr. Geri Keller und Pfr. Ruedi Reich beim Bussgottesdienst im Grossmünster im Mai 2003
«We forgive you», erklärt der amische Bischof Ben Girod (USA)
Für mich als damaligen Vikar im Praktikumsjahr war diese Konferenz existenziell wichtig. Nachdem ich mich im Studium intensiv mit der Täufergeschichte auseinandergesetzt hatte, spürte ich als angehender Pfarrer der reformierten Kirche, dass von der Reformation her eine Schuld gegenüber den Täufern auf uns lastete, die auch in der Art und Weise, wie wir oft Freikirchen behandeln, weitergeht. Im Grossmünster zu sitzen, zu erleben, wie Vertreter der Landeskirche sich entschuldigen, und dem Chor der Amischen zu lauschen, war für mich eine prägende Erfahrung. Es gab auch andere Versöhnungsinitiativen und Anlässe, aber dieser hat bei mir persönlich einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen.
Wir benötigen das ganze Erbe der Reformation: die Rückkehr zur Schrift, den Mut der Reformatoren, aber auch die tätige Nachfolge und das erweckliche Feuer, welches die Täufer damals in besonderer Weise verkörperten. Davon ist in diesem Büchlein die Rede und wir hoffen, dass auch unsere Herzen noch einmal entzündet werden, damit Gott in dieser Zeit seine Geschichte mit uns weiterschreiben kann.
Thomas Bänziger
Pfr. Dr. theol., theologisch-pastorale Leitung Stiftung Schleife
Vorwort
«Brüder in Christo» – ein Büchlein mit historischem Sachverstand geschrieben, mit akribischem Ernstnehmen der Quellen und zugleich – wie es Fritz Blanke entspricht – mit Liebe und Respekt denen gegenüber, welche es mit ihren Erfahrungen und Erkenntnissen, Irrungen und Wirrungen darstellt, eben die «Brüder in Christo».
Wer das Privileg hatte, Fritz Blanke als akademischem Lehrer an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich zu begegnen, sieht ihn noch vor sich: Die gebeugte Gestalt, seine wache Menschlichkeit, seine vornehme Zurückhaltung. Und dann ist hier die Art, wie er Kirchengeschichte lehrte. Hier wurde nicht nur doziert, sondern erzählt – von «narrativer Theologie» spricht man heute –, man spürte die Liebe zum Detail, manchmal auch die verhaltene Ironie, alles aber blieb auf die evangelische Mitte bezogen. Kirchengeschichte wurde nie zum «theologischen Weltgericht». Schuldige wurden nicht nochmals verurteilt. Dennoch wurden auch Irrtum und Schuld benannt und im Licht des Evangeliums überdacht.
Die Liebe von Fritz Blanke galt den «Stillen im Lande». Das ist im vorliegenden Büchlein deutlich zu spüren. Das besondere Engagement des Zürcher Kirchengeschichtlers galt der Zürcher Reformation. Aber nicht die «Geschichte der Sieger» oder umgekehrt die «Geschichte der Besiegten» wollte er darstellen. Sein wissenschaftliches und sein menschliches Interesse galt dem tragischen Riss, der hindurch geht durch die Zürcher Reformationsbewegung. Die «offizielle Reformation» von Huldrych Zwingli und Heinrich Bullinger wird von Blanke gewürdigt. Aber die Wertschätzung gilt auch der Täufergemeinde in Zollikon mit dem drängenden Konrad Grebel, dem draufgängerischen Jörg Blaurock und dem glaubensstarken Felix Manz.
Fritz Blanke zeigt die Widersprüchlichkeit der werdenden Täuferbewegung: Die enge Verbundenheit mit Zwingli und die spätere, auch gehässige Abwendung von ihm, die Erwartung einer radikalen Reformation, getragen durch den Zürcher Rat, und dann die Abwendung von der Obrigkeit, weil diese nicht tut, was die Stürmer und Dränger verlangen.
Parteilich für die «Schwestern und Brüder in Christo» geht Blanke vor, aber nie parteiisch abwertend dem Zürcher Rat und dem Reformator gegenüber. Zwingli und die Täufer – Fritz Blanke zeigt das Gemeinsame: Die tiefe Verwurzelung im Evangelium, die reformatorische Erkenntnis der Rechtfertigung aus Glauben allein, die Bereitschaft zur Busse und das Vertrauen auf die Gnade Jesu Christi. Nicht die Ausläufer mittelalterlicher religiöser und sozialer Erneuerungsbewegungen sah Blanke in den Täufern. Er erkannte sie als Menschen, die von Huldrych Zwingli zu reformatorischer Wahrheit geführt wurden, diese aber konsequenter als er umsetzen wollten. Er sah sie als Menschen, welche die Spannung nicht mehr aushielten zwischen reformatorischer Predigt und mittelalterlich-katholischer Praxis im Gebiet des Zürcher Stadtstaates.
Fritz Blanke tadelt Zwingli nicht, auch wenn seine Liebe zu den Frauen und Männern in Zollikon deutlich und anrührend ist. Das Volkskirchliche und das Freikirchliche stehen vor uns als zwei Möglichkeiten evangelischer Existenz. Beide – das Volkskirchliche und das Freikirchliche – haben je ihre Chancen und Gefahren. Das Volkskirchliche will in die Breite wirken, das Evangelium in die Gesellschaft hineintragen, soziale und ökonomische Konsequenzen aufzeigen und durchsetzen im Vertrauen darauf – um nun mit Zwingli zu reden –, dass die «göttliche Gerechtigkeit» die «menschliche Gerechtigkeit» erneuern und vervollkommnen wird. Wer in die Breite wirkt, ist in der Gefahr, zu wenig in die Tiefe zu gehen. Das aber taten die Täufer. Der persönliche Glaube, die Busse und Heiligung, das schlichte Übersetzen des Evangeliums in den Alltag, das wurde hier gelebt. Freilich geschah dies auch mit einer Tendenz zum Biblizismus und einem Hang zur Abkehr von der Verantwortung für die Welt.
Aber Jahrhunderte vor der Proklamation der Menschenrechte wurde von den Zürcher Täufern die freie Entscheidung zum Glauben, die Glaubens- und Gewissensfreiheit gefordert. Blanke begreift die Täuferbewegung als Erweckungsbewegung. Dies ist das Entscheidende für den volkskirchlichen und den freikirchlichen Ast der Zürcher Reformation auch heute: Die Hoffnung, dass Christus uns zum Glauben erweckt, Tag für Tag. Ohne «Erweckung» keine evangelische Kirche. Bis heute verdankt die Landeskirche den «erweckten Christen» viel. Aber sie hat sich in der Ausgrenzung oder gar Verfolgung der «Brüder und Schwestern in Christo» oft auch als undankbar erwiesen.
Darum sei auch das Schmerzliche offen angesprochen: Die reformierten Schweizer Kirchen und die internationale Täuferbewegung sind aus gemeinsamen Wurzeln entstanden, aber aus Freunden sind Feinde geworden. Hier gilt es, die historische Schuld der Zürcher Kirche und weiterer reformierter Schweizer Kirchen anzusprechen. Das Unrecht, das taufgesinnten Menschen über Jahrhunderte angetan wurde, war ein Verrat am Evangelium, welches wir nur mit tiefem Bedauern und Erschrecken zur Kenntnis nehmen können. In einer Zeit, in welcher religiöse Überzeugungen erneut zum Ausgrenzen von missliebigen Menschen benutzt werden, kann es nicht deutlich genug gesagt werden: Wer anders Denkende und anders Handelnde ausgrenzt und bekämpft, der verrät das Evangelium. Da, wo aber diese Schuld anerkannt wird, da kann auch das, was Fritz Blanke in seinem Büchlein zeigt, festgestellt werden: Reformierte Kirchen und Täuferbewegung sind Zweige desselben evangelischen Astes am grossen christlichen Baum.
Das vorliegende Büchlein, für dessen erneute Herausgabe dem Schleife-Verlag herzlich zu danken ist, zeigt diese Nähe von Zürcher Reformation und taufgesinnten Gemeinden von ihren Ursprüngen her. An uns ist es, dies neu zu erkennen und aus dem Gemeinsamen zu leben. Nicht etwa um stolze freikirchliche oder landeskirchliche Konzepte geht es hier, sondern um das Vertrauen, dass Christus uns hier und heute, gerade auch in unserer Verschiedenheit, für sein Zeugnis brauchen will. Wie denn, wenn nicht durch eine «Erweckung» zum Glauben, zur Hoffnung und zur Liebe, könnte es uns heute gelingen, Kirche Jesu Christi, Gemeinde Jesu Christi zu sein. Und diese Kirche Jesu Christi lebt damals wie heute – und hier sind sich freikirchliche und der landeskirchliche Zweig der Zürcher Reformation einig – aus dem Hören des Gotteswortes, welches zum Leben und Tun führt.
«Welch ist Christi Kilch?», fragt darum Huldrych Zwingli und antwortet: «Die sin Wort hört. Wo ist die Kilch? Durch das gantz Erdrych hin. Wer ist si? Alle Gleubigen. Wer kennt si? Gott.»
Ruedi Reich, Kirchenratspräsident der evangelisch-reformierten Landeskirchedes Kantons Zürich – Februar 2003
1
Die Vorstufen des Täufertums in Zürich (1523–1525)
Die Vorgeschichte des Zürcher Täufertums ist gefügt aus fünf Akten, deren ersten ich überschreiben möchte: Beginn der Entfremdung.
Im Januar 1523 wurde Zürich durch Ratsbeschluss evangelisch. Jedoch nicht alle Zürcher haben diesen Schritt von innen heraus bejaht. Es gab, wie Zwingli selbst berichtet, in jener ersten Zeit (1523/24) in Zürich drei Klassen von Evangelischgewordenen. Die einen waren die blossen Antikatholiken, also negative Protestanten, deren einziger «Glaube» darin bestand, dass sie nicht mehr katholisch waren und nicht mehr katholisch sein wollten (III, 381, 21–383, 28)1. Die anderen waren die libertinistischen Protestanten, die im Evangelium lediglich einen Freibrief sahen, um den Begierden zu frönen (III, 383, 29–387, 14). Von diesen zwei Gruppen unterscheidet Zwingli diejenigen Personen, «so im Wort Gottes arbeiten» (III, 405, 33), d. h. die Zürcher evangelischen Pfarrer. Sie stehen nicht allein, sondern um sie schart sich ein Kreis von Menschen, die die frohe Botschaft wirklich verstanden haben. Der Zürcher Reformator steht also seiner eigenen Kirche mit Kritik gegenüber. Er sieht ihre Schwächen, aber er ist dankbar, einen Stab treuer Mitarbeiter zu haben, die ihm helfen, die Schäden des evangelischen Zürich mit der Zeit zu beseitigen.
Zu dieser Gruppe der engsten Mitkämpfer Zwinglis gehörten ursprünglich auch Konrad Grebel, Sohn eines Ratsherrn, und Felix Manz, Sohn eines Chorherrn am Grossmünster. Beiden hatte Zwingli den Weg zum Evangelium gewiesen.
Wie nahe sich Zwingli und Grebel einmal standen, mag man daraus ersehen, dass eine der wichtigsten Frühschriften des Reformators, der Archeteles, durch ein lateinisches Gedicht Grebels abgeschlossen wird (I, 327). Der Archeteles erschien im August 1522.
Im Herbst 1523 tauchen zwischen Zwingli und seinem Jünger Grebel die ersten Meinungsverschiedenheiten auf. Sie sind zwar auf den ersten Blick nicht belangreich, bergen aber doch die Keime der späteren Trennung in sich. Der Rat von Zürich hatte auf den Oktober 1523 ein Religionsgespräch einberufen, um zu erfahren, was vom biblischen Standort aus von der katholischen Messe und den Kirchenbildern zu halten sei. Aufgrund der empfangenen Belehrung wollte dann der Rat zu gegebener Zeit inbezug auf die Beibehaltung oder Abschaffung von Messe und Bildern einen Entscheid treffen. Am Abend des 27. Oktober war die Aussprache über die Messe beendigt. Man war zum Ergebnis gekommen, dass die römische Lehre, die Messe sei eine Wiederholung des Opfers Christi, falsch sei.
Schon will man ein neues Thema in Angriff nehmen, da meldet sich Konrad Grebel zu Wort und verlangt, dass der Rat jetzt sogleich den Pfarrern, solange sie noch beieinander seien, Bescheid gebe, wie sie es in Zukunft mit der praktischen Durchführung des Abendmahls halten sollen (II, 783, 36–784, 5). Zwingli entgegnet, das Wie und Wann einer solchen Beschlussfassung sei den Ratsherrn zu überlassen (1II 784, 6–9). Er ist also gegen eine Sofortmassnahme. Erstens hatte der Rat eine solche, als er zur Disputation einlud, gar nicht versprochen (II, 666). Sodann hat Zwingli selbst grundsätzliche Bedenken gegen ein zu schnelles Vorgehen. Nach Zwinglis Auffassung ist das Volk für liturgische Änderungen noch gar nicht reif, es muss zuerst noch gründlicher im Worte Gottes unterrichtet werden (II, 789, 13–14).
Zwingli und Grebel haben dasselbe Ziel: die völlige Abstellung der unter dem Katholizismus eingerissenen Missbräuche. Aber Grebel wünscht Abschaffung auf einen Schlag, Zwingli ist der Überzeugung, man müsse zuerst «unentwegt und standhaft» (II, 788, 18–19) gegen die verkehrten Bräuche predigen und sie innerlich überwinden. Zwingli glaubt also an das langsame Absterben des katholischen Herkommens unter dem Einfluss der neuen Verkündigung; Grebel aber ist für rasches Durchgreifen.
Welche Haltung ist die richtige? Jede von beiden hat ihren Nachteil und Vorzug. Aufschub ermöglicht Rücksicht auf die Gewissen, trägt aber die Gefahr der Verschleppung in sich. Die plötzliche Beseitigung der katholischen Traditionen andererseits bringt eine klare Lage, kann aber die Gewissen vergewaltigen. Hinter diesen beiden Verhaltensweisen steht eine verschiedene Charakteranlage. Grebel ist der Angriffige und Unbekümmerte, Zwingli denkt organischer und ist darum bedachtsamer.





























