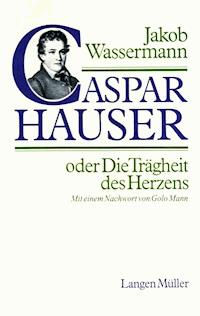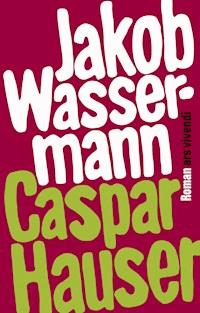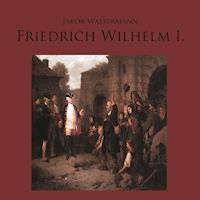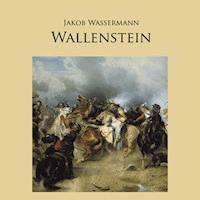Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Vor längerer Zeit wurde ich in einem Kreis von Freunden gefragt, woran ich arbeite, und als ich gestand, daß ich das Leben Henry Morton Stanleys beschreiben wolle und die hiezu nötigen Studien seit Jahren gesammelt dalägen, schienen sie merklich verwundert und wollten wissen, was mich an einem Mann interessiere, dessen Taten weder in der Geschichte noch in der Gegenwart lebendige Spuren hinterlassen hätten und dessen Name bereits der Vergessenheit anheimgefallen sei. Ich bestritt es; ich sagte, um den Namen schwebe jene geheimnisvolle Melodie des Klima, die ins Unbewußte der Menschheit dringe, er habe den unverkennbaren Rhythmus, den ihm die Geläufigkeit auf Millionen Zungen verliehen, und was sie als Vergessenheit bezeichneten, sei nur ihre Vergeßlichkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bula Matari
Das Leben Stanleys
Jakob Wassermann
WARUM ICH DIESES BUCH GESCHRIEBEN HABE
KINDHEIT UND JUGEND
VORBEREITUNGSJAHRE
DER GROSSE GLÜCKSFALL
NIEDERLAGE NACH DEM SIEG
DAS GROSSE HERZ VON AFRIKA
1. Die Suche
2. Der Strom
DIE ILLUSION
NEUER RUF, NEUE ANSTALTEN
DER URWALD
WO BLEIBT DIE NACHHUT?
VERSUCH EINER DEUTUNG
DAS RÄTSEL EMIN
UND DANN ...?
Karte: Stanleys Fahrten durch Zentralafrika
BENUTZTE QUELLEN
Sir Henry Morton Stanley
WARUM ICH DIESES BUCH GESCHRIEBEN HABE
Vor längerer Zeit wurde ich in einem Kreis von Freunden gefragt, woran ich arbeite, und als ich gestand, daß ich das Leben Henry Morton Stanleys beschreiben wolle und die hiezu nötigen Studien seit Jahren gesammelt dalägen, schienen sie merklich verwundert und wollten wissen, was mich an einem Mann interessiere, dessen Taten weder in der Geschichte noch in der Gegenwart lebendige Spuren hinterlassen hätten und dessen Name bereits der Vergessenheit anheimgefallen sei. Ich bestritt es; ich sagte, um den Namen schwebe jene geheimnisvolle Melodie des Klima, die ins Unbewußte der Menschheit dringe, er habe den unverkennbaren Rhythmus, den ihm die Geläufigkeit auf Millionen Zungen verliehen, und was sie als Vergessenheit bezeichneten, sei nur ihre Vergeßlichkeit.
Sie gaben mir zu, ein Irrtum über die Person und das Werk sei nicht gut möglich, und wollten ihren Einspruch nur dahin verstanden wissen, daß sie an beiden, Person und Werk, das Einmalige, das Mustergültige und Vorbildliche vermißten. Was unterscheidet ihn denn, bemerkte einer, von der großen Zahl verdienstvoller Pioniere, die genau wie er in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts den afrikanischen Kontinent durchforschten, ebenso mutig, todverachtend und opferwillig wie er, in jedem Fall aber wissenschaftlich begabter und menschlich bescheidener; wodurch gebührt ihm der Vorzug vor einen Nachtigal oder Schweinfurth, einem Rohlfs oder Livingstone, einem Baker oder Casati, von hundert andern zu schweigen? Gesteh es nur, fügte er spöttisch hinzu, er ist ein hobby von dir, dieser Stanley, was dich an seiner Gestalt reizt, muß uns nicht notwendig von seiner Bedeutung überzeugen.
Ich erwiderte, einer Rechtfertigung meinen Unternehmens bedürfe es wohl kaum; der Reiz sei zugegeben, habe aber seine tiefe Ursache; vielleicht liege es im rein Psychologischen, vielleicht im Charakter, vielleicht im Typus, vielleicht in der Epoche. Ihr dürft nicht außer acht lassen, daß hier Jugendeindrücke mitspielen, sagte ich; als Fünfzehn-‚ als Zwanzigjähriger habe ich die Erfolge, die Triumphe des Mannes noch erlebt; ich war Zeitgenosse; die Welt war voll von ihm; er war der Heros einer ganzen Generation von Knaben und Jünglingen; wenn man Stanley sagte, war es wie eine Fanfare; die Existenz eines solchen Mannes hatte damals unbedingt etwas Märchenhaftes. Ganz schön, wurde eingewendet, damals; heute ist das Märchen verklungen; heute steht das Bild unter andern verstaubten Bildern in einer Galerie, die wir nicht mehr besichtigen. Was ist uns Stanley? Bleibt nur die Frage: W1; ist er dir? Geograph? Entdecker? Abenteurer? Was hat er schließlich mit dir zu tun?
Ein heikles Verhör. Wie soll man Rechenschaft ablegen von der Lockung, die ein Schicksal übt? Von der Enthüllung, ja Offenbarung eines historischen Vorgangs innerhalb seiner Zeitgefangenheit, und daß das mittlerweile verflossene halbe Jahrhundert ihn in jene Beleuchtung rückt, wo die Nähe nicht mehr trägt und die Ferne noch nichts verzerrt hat? Dies war schwer zu erklären, aber da ich mich nichtsdestoweniger zu erklären wünschte, sprach ich von dem sehr Besonderen des Lebenslaufs, seinem unerhörten Reichtum an Begebenheiten, dem beispiellosen Kräfteeinsatz, der unbegreiflichen, schier übermenschlichen Beharrlichkeit, einer seltenen Herrschergabe, erstaunlich bei einem aus niedrigsten Verhältnissen emporgetragenen Mann, und, vor allem, von der höchst ungewöhnlichen Intuition, die er bei jedem Seiner tollkühnen Projekte bewiesen und die ihm erlaubt habe, mit fast nachtwandlerischer Sicherheit durch alle Gefahren hindurchzugehen.
Seine Figur habe stets etwas Anachronistisches für mich gehabt; die Züge des Forschers und Reisenden wirkten beinahe wie Täuschung, die Rolle des Koloniengründers entspräche schon eher einer Wirklichkeit; genau genommen sei er ein verspäteter Kondottiere; drei Jahrhunderte zuvor hätte er in ganz anderer Weise Geschichte gemacht als in der lauen und nüchternen Periode, in die er hineingeboren war, die Familienähnlichkeit mit den großen Land- und Seefahrern zwischen 1500 und 1700 dränge sich von selbst auf, der moderne Gelehrte im Dienst der sogenannten Zivilisation (ein Wort, das er gern und häufig im Mund führte) sei in ihm auf Schritt und Tritt verdrängt worden von dem Gewaltmenschen und Eroberer.
Gewiß, entgegnete der jüngste der Freunde, das alles wollen wir dir nicht abstreiten, doch scheint mir damit der zureichende Grund für eine so weitläufige Arbeit noch nicht gegeben zu sein; du hast von einer tieferen Ursache gesprochen, diese ist keineswegs tief, oder doch nicht tief genug, um dich für ein solches Vorhaben in Spannung zu erhalten und alle seine Mühen in Kauf zu nehmen; es muß eine bestimmte Idee sein, die dich antreibt, ein gedankliches Leitmotiv, da doch die ganze Art deines Hervorbringens immer eines solchen Brennpunktes bedarf.
Das ist durchaus wahr, gab ich zu; in dem Augenblick, da du es aussprichst, wird es mir auch deutlicher bewußt, und ich will versuchen, es zu formulieren. Ein Mensch wie dieser Stanley ist ganz und gar auf Handeln gestellt. Sein Leben ist eine ununterbrochene Kette von Aktionen. Kaum ist die eine beendet, geht er zur nächsten über, und seine Leidenschaftlichkeit, seine Geistesgegenwart, seine Entschlossenheit vermindern sich dabei nicht um einen Grad. Wenn er zur Besinnung kommt, geschieht es niemals mit Bezug auf sein Inneres, sondern stets auf das äußere Tun, und als einziger Ersatz für seelenhafte Sammlung und geistige Anschauung bietet sich ihm die traditionelle Frömmigkeit des anglikanischen Puritaners, der primitive Glaube eines völlig unkomplizierten Herzens, der allerdings im Verlauf schwerer Schicksalsprüfungen ziemlich interessante Wandlungen erfährt, die darzustellen wären.
Nun will ich erstens zeigen, wie dieses scheinbar so praktische, so erfolgreiche, so weltliche und nützliche Handeln durch seine fortwährende Steigerung zur förmlichen Raserei führt, zur Entselbstung geradezu, und daß ihm bei ernstlicher Prüfung nicht bloß der vielgerühmte Boden der Realität fehlt, sondern daß es unweigerlich und automatisch in die Phantastik mündet. Und ich will, in logischer Folgerung, die heimliche Tragik dieses wie alles „Tuns“ nachweisen; wie das, was man die Tat und das Leben der Tat nennt, den Menschen von der Seele aus zerstört, wenn er kein inneres Gegengewicht dafür findet, und daß eine noch so breite Wirksamkeit die seelische Gleichgewichtslage nicht zu schaffen vermag, durch die er allein sein Dasein erträglich machen kann. Ja, mit wachsender Verstrickung in die Aktivität büßt er sie wachsend ein. Gewahren wir denn nicht dasselbe Phänomen des inneren Absterbens, des rätselhaften Selbstverlustes bei allen großen Handelnden der Weltgeschichte, bei Alexander, bei Attila, bei Cäsar, bei Napoleon, bei Cromwell?
Zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens kommt plötzlich, man weiß nicht wie und weshalb, Wahnsinn und Verstörung über sie. Und wissen wir nicht, daß etwa ein Kaufmann, ein Fabrikant, ein Beamter, wenn sie jahrzehntelang in der gleichen Richtung tätig gewesen sind, unerklärlicherweise zusammenbrechen, sobald diese Tätigkeit eines Tages plötzlich aufhört? Ihr werdet mich gewiß nicht verdächtigen, daß meine Absicht die Verteidigung einer quietistischen Lebenshaltung sei. Worum es mir geht, ist der Ausgleich zwischen Tun und Sein, vielmehr die Unmöglichkeit dieses Ausgleichs in der modernen Welt, und in diesem Sinn ist mir die Gestalt Stanleys zum Symbol geworden. Das Abenteuerliche kommt nur von außen hinzu, Geschickswechsel und außerordentliche Fügungen, die farbigen Bilder exotischen Lebens, die Fülle seltsamer und grandioser Landschaften, die wirkliche Wildnis, die nie zuvor eines Europäers Fuß betreten, der wirkliche Wilde und sein seit dem Schöpfungstag verschlossener Bezirk, seine fremdartige Gesellschaftsordnung und seine religiösen Mysterien. All dies, von Stanley aus gesehen, ist kolumbisches Erlebnis.
Aber darüber steht, anders als an der Wende des Mittelalters, der Geist einer europäischen, oder wenn ihr wollt, europäisch-amerikanischen Gemeinschaft, die das ihr zugehörige Glied nicht für die Dauer einer Stunde nach eigener Machtvollkommenheit schalten läßt, es auf Weg und Steg in unsichtbaren Banden hält, ihm die Entschlüsse diktiert, Gesetze und Moralregeln einimpft, ein bestimmtes soziales Verhalten vorschreibt, ihm nur so viel Zeit und Geld zur Verfügung stellt, nicht um einen Tag und einen Pfennig mehr, als sie für notwendig findet, und es sofort ächten und vernichten würde, ließe es sich einfallen, ihrem Gebot und ihrer Erwartung zuwiderzuhandeln.
Der Mann ist also nicht frei, er ist kein echter Kondottiere, er kann seinem Auftraggeber so wenig wie seinem Stammland kündigen, er muß genaue Rechenschaft ablegen, er wird für seine Leistungen bezahlt als säße er in irgendeinem Redaktionszimmer. Europa-Amerka ist sein Chef, die Kompagniefirma, bei der er fest angestellt ist. Man spürt, wie er an dieser Kette zerrt, fünftausend Meilen von London und zehntausend von New York schleift er sie im afrikanischen Urwald hinter sich her, ein Subalternbeamter in der grenzenlosen Wildnis.
Seiner eigentlichen Anlage nach wäre er der Mann gewesen, um Reiche zu gründen, und er war ja nicht weit weg von der Aufrichtung eines Kongostaates mit Henry Stanley als unumschränktem Autokraten, sein Traum war es ohne Zweifel, statt dessen mußte er Bücher schreiben und populäre Reiseberichte verfassen. Das ist das Neue an ihm, daß er Reporter und Journalist war, das gibt seiner Erscheinung das Schillernde und Problematische und in gewissem Sinn auch das Großartige. Es verleiht ihm etwas vom Improvisator und Glücksritter, den sein Metier in die äußersten Möglichkeiten treibt und der für seine Unternehmungen kein Vorbild braucht. Dadurch wird auch seine menschliche Tragik so augenscheinlich, die Tragik des maßlosen Tuns.
Das ergriff mich nachhaltig. Ich verspürte das Verlangen, seine Gestalt aus der Vergangenheit, wo sie zu vergehen drohte, herauszutragen und sie von dem Staub und Moder, in dem sie bereits steckte, zu säubern. Vermutlich hätte ich mich aber noch lange nicht dazu entschlossen, wäre nicht ein eigentümlichen Phantasieerlebnis gewesen, das mich von den Hemmungen frei machte. Ich weiß nicht, ob ihr den Zusammenhang fühlen könnt, ich kann nur sagen, daß eben dies die Wirkung war.
Ich hatte mich in den letzten Wochen viel mit Heiligenlegenden beschäftigt und kam dabei auf das Leben der heiligen Elisabeth. Ich las, wie ihr nach dem Tod ihres Gatten, des Landgrafen von Thüringen, endlich der Weg offen steht, das franzikanische Ideal der vollkommenen Armut zu verwirklichen, wie sie mit der Familie bricht, ihre Kinder verläßt und in einer eiskalten Winternacht mit notdürftig bedeckter Blöße von der Burg herabsteigt, um sich zwischen schmutzigen Fässern und Geräten hinter einer elenden Schenke zu bergen. Sie hatte Wohltätigkeit in ausschweifendstem Maße geübt; sie hatte, zum Verdruß der Ihren, alles verschenkt‚ was sie besessen, Geld, Kleider, Schmuck, Nahrungsmittel, sie ging darin weiter als irgendein Menseh ihrer Kaste je zuvor gegangen war. Das maßlose Tun hatte ihre Seele erschöpft, es hatte sich selbständig gemacht, das Tun, es war autonom geworden, sie war nur noch eine Getriebene. Das Bild der zarten jungen Fürstin, die sich durch maßloses Tun in maßloses Leiden gestürzt hatte, verfolgte mich unablässig. Immer sah ich sie zwischen schmutzigen Fässern hinter der elenden Spelunke, und so unermeßlich weit der äußere Weg auch erscheint von dieser Vision bis zu Stanley, der innere war im Zeitraum eines Schauders zurückgelegt …
KINDHEIT UND JUGEND
Die Kindheitserinnerungen Stanleys, die er in seiner, in den späteren Teilen ziemlich fragmentarischen Selbstbiographie mit bitterer Ausführlichkeit erzählt, lesen sich wie ein Dickens'scher Roman. Was nicht wunderbar ist, fällt doch Stanleys Jugend in die nämliche Epoche des viktorianischen England, die den „David Copperfield“, den „Oliver Twist“ hervorbrachte; das Schicksal des einzelnen innerhalb eines bestimmten geschichtlichen Ablaufs ist typisch. Wären solche Bücher nicht historische Monumente, so wären sie auch niemals zeitgenössische Beweisstücke gewesen. Außerdem darf nicht übersehen werden, daß ein so großer Autor die Schreibart und die Anschauungen ganzer Generationen von Schriftstellern beeinflußt.
John Rowlands, dies der ursprüngliche Name Stanleys, ist Waliser von Herkunft, geboren am 28. Januar 1841. Der walischen Heimat verdankt er die unverwüstliche Natur, die Zähigkeit und Knorrigkeit, die bäurische Derbheit. Vom Vater weiß er nichts, die Mutter hat er nur zwei- oder dreimal gesehen. Da er gelegentlich von seiner „unehrlichen“ Geburt spricht, kann man annehmen, daß er ein illegitimes Kind war. Lieblosen Verwandten auf Gnade und Ungnade überlassen, wächst er auf wie ein Tier. Kein Heim, kein freundliches Wort, keine Hilfe von irgendwem. Im Alter von sechs Jahren steckt man ihn in eins jener berüchtigten englischen Erziehungshäuser, deren Aussehen, Einrichtung und grausame Prügelpädagogen dargestellt und der öffentlichen Empörung preisgegeben zu haben das unsterbliche Verdienst von Charles Dickens ist.
Es war das St.-Asaph-Unionshaus. „Ein schauriges Schicksal, das eines britischen Outcast,“ so äußert er sich später, „die Strafen zehren an seinem Gemüt und brechen ihm das Herz. Es ist härter als das Schicksal des gemeinsten Verbrechers, weil es gänzlich unverdient und sehr verschieden ist von dem, was der Angehörige einer christlichen und zivilisierten Nation von ihr zu beanspruchen ein Recht hat. Es kostete mich einige Zeit, bis ich die Bedeutungslosigkeit von Tränen in einem Asyl einsehen lernte.“
Der Lehrer, James Francis, war Kohlenarbeiter gewesen‚ bis er durch einen Unglücksfall die linke Hand verlor. Da er etwas Bildung besaß, wurde er zum Schulmeister von St. Asaph gemacht, wo er viele Jahre sein Unwesen trieb. Er wurde immer tollwütiger, zuletzt entdeckte man, daß er den Verstand verloren hatte; er starb im Irrenhaus. Man kann sich leicht vorstellen, was ein elternloses Kind unter der Fuchtel eines Wahnsinnigen zu erdulden hatte. Statt allem Verweilen auf quälenden und trotzdem ungenügenden Einzelheiten gebe ich eine Episode wieder, die tief in der Phantasie des Knaben haften blieb:
„Als ich mein elfte: Jahr erreicht hatte, war ein mit mir gleichaltriger Knabe wegen seiner Schönheit und Liebenswürdigkeit der König der Schule. Sicherlich gehörte er einer weit über uns stehenden Gesellschaftsklasse an. Sein kohlschwarzes Haar wallte in schöner Lockenfülle um ein feingeschnittenes Gesicht von milchiger Weiße, seine Augen waren sanft und klar, sein Gang von einem Anstand‚ der zur Nachahmung herausforderte. Eines Tages wurden wir durch das Gerücht erschreckt, er sei plötzlich gestorben. Es hieß, er läge in der Leichenhalle, und ich und einige Kameraden kamen auf die Idee, ihn sehen zu wollen.
Von furchtsamer Neugier getrieben, zu erfahren, was der Tod sei, benutzten wir einen günstigen Augenblick und drangen klopfenden Herzens in das Haus ein. Der Körper lag auf einer schwarzen Bahre und sah, mit einem Laken bedeckt, ungewöhnlich lang für den eines Knaben aus. Einer der Keckeren zog das Tuch zur Seite, und beim Anblick des wächsernen Gesichts mit seiner unheimlichen Regungslosigkeit fuhren wir alle zurück und starrten es gebannt an. Es war etwas Erhabenes in seiner wunderbaren Nichtachtung der Kälte und Dunkelheit ringsum und in der vollkommenem Ruhe seiner Züge. Wir wollten schreien, um ihn aufzuwecken, wagten es aber nicht, weil uns die Feierlichkeit seines Antlitzes beklommen machte. Doch zogen wir das Tuch noch weiter zurück und gewahrten, was keiner von uns zu sehen erwartet hatte: der Körper war bleifarben und zeigte die Furchen von schwarzen Striemen. Wir eilten stumm hinweg, fest überzeugt, daß diese Zeichen der Züchtigung noch im Tode als Zeugen wider den Schuldigen auftreten würden. Daran zweifelte keiner, daß Francis für den Tod unseres Freundes verantwortlich war.“
Es spricht von sittlicher Kraft, daß er in dieser Leidenszeit um religiöse Erkenntnis ringt; dies wird späterhin ein weltlicher Zug seines Charakters. In den hoffnungslosesten Situationen, und deren gab es im Lauf seines Lebens nicht wenige, ist es eine fromme Betrachtung, der Aufblick zu einem geahnten Göttlichen, die ihn vor der Verzweiflung schützen. Man muß das festhalten, es gehört zu den einfachen Wahrheiten einer Natur, deren Elastizität und grenzenlose Tatbereitschaft sonst kaum zu fassen wären.
„Ich begreife Gott als eine sehr wirkliche Persönlichkeit, die in der Überwachung der Weh heute noch ebenso gegenwärtig ist wie zu den Zeiten der Bibel. Um jedoch die göttliche Einwirkung zu erlangen, mußte man sie inbrünstig erflehen und durch Sündenlosigkeit ihrer würdig werden. Ich machte große Anstrengungen, um mich der Eitelkeit und des Stolzes zu entledigen, und zwang mich, die Opfer zu bringen, die man mir auferlegte. Des Nachts erhob ich mich und kämpfte im geheimen mit meinem bösen Selbst, warf mich auf die Knie und legte mein Herz entblößt vor die Füße dessen, der alle Dinge sieht. Ich glaubte an das Dasein von Engeln, die auf die Erde geschickt waren, mir zum Schutz, glaubte, daß die Teufel in der Dunkelheit spukten, um mich ihren Grimm fühlen zu lassen, und glaubte, daß ich ihren Umtrieben die schrecklichen Träume verdankte, unter denen ich im Schlafe stöhnte.“
Nicht anzunehmen, daß der Fünfzigjährige diese Empfindungen nachträglich in seine Jugend hineingedichtet hat, sie sind zu echt als kindliche Rettungsversuche vor Elend und gänzlicher Verlassenheit, zudem bezeichnen sie die Seelenlage eines Volks und das Verhältnis eines besonderen Individuums zu den oberen Mächten, doch nicht als Einzelfall, sondern durch die Lebensatmosphäre bedingt, wodurch sich eine allgemeine, in den Grundzügen unveränderliche Haltung ergibt, verbindlich für ihn selbst wie für das Gesamte der Nation. „Es wäre mir unmöglich, Klarheit über mich zu geben, wenn ich meine religiösen Gefühle verschwiege,“ sagt er, „täte ich es, so fehlte der wahre Schlüssel zu meinen Handlungen.“ Ein solches Wort läßt keine Mißdeutung zu, ob man von seiner erschöpfenden Wahrheit überzeugt ist oder nicht, ob eine Schutzfärbung der Persönlichkeit bezweckt ist oder eine innere Durchdrungenheit vorliegt.
Ergreifend ist folgendes Bekenntnis: „Ich muß schon zwölf Jahre alt gewesen sein, als ich begriff, daß für ein Kind eine Mutter etwas unumgänglich Nötiges sei. Den meisten Knaben von zwölf Jahren wird eine so einfache Tatsache kein Kopfzerbrechen machen, da aber meinen Bedürfnissen der Großvater und die Amme genügt hatten, leuchten mir die Dringlichkeit der Existenz einer Mutter nicht ein. Als man mir mitteilte, meine Mutter sei nach St. Asaph gekommen, war meine erste Regung das Entzücken darüber, daß ich auch eine Mutter hatte, und die zweite war Neugier, wie sie wohl aussähe und ob ihre Ankunft eine Besserung meiner Lage mit sich brächte. Francis trat zu mir, wies auf eine hochgewachsene Frau mit einem großen Knäuel schwarzer Haare am Hinterkopf und fragte mich, ob ich sie erkenne. Nein, Herr Lehrer. Was, du erkennst deine eigene Mutter nicht? Ich fuhr mit flammendem Gesicht zusammen, guckte scheu nach ihr hin und bemerkte, wie sie mich kalt und kritisch musterte. Mir war zumut als sollte ich vor Zärtlichkeit gegen sie überströmen, aber ihr Ausdruck war so abschätzig, daß sich meine Herzklappen wie mit einem Knall schlossen.“ Aus diesem meisterhaften kleinen Bildnis schaut einen ein Mensch an.
Endlich erträgt er das Leben in St. Asaph nicht länger, nach einem greulichen Auftritt mit Francis flieht er aus der Kinderhölle und läuft spornstreichs nach Ffynnon Beuno, einem musischen Dorf, wo Verwandte von ihm wohnen. Einer der Vettern ist Schullehrer und stellt ihn als Aufsichtsperson an. Er unterrichtet auch gleichaltrige Knaben in Geschichte und Geographie, worauf er sich jedesmal in nächtelangem Lesen und Surdieren vorbereitet. Der Vetter ist ein unverträglicher Bursche. Zwietracht und Nörgelei nehmen kein Ende, abermals ergreift Stanley die Flucht und begibt sich zu einer Tante nach Tremcirchion in Nordwales.
Die Tante, eine harte, mürrische Bäuerin, die nur am Sonntag ein wenig auftaut, behandelt ihn nicht minder verächtlich als die andern Milglieder der Familie. Sie ist ungemein stolz; jedermann in Tremcirchion ist „stolz“. Man macht ihn zum Schafhirten. Auf dem Gipfel der Craig Fawr träumt er von ereignisreicher Zukunft; dort ist er am glücklichsten, einzig der Gesellschaft seiner Schafe und seiner Gedanken überlassen. Nach einiger Zeit tritt eine andere Tante auf den Plan und erbietet sich, dem Knaben eine Stelle in Liverpool zu verschaffen.
Schweren Herzens nimmt er Abschied vom Dorf, als ahne er, daß damit die lebenslange ruhelose Wanderung beginne, die atemraubende Jagd nach Glück und Erfolg; der Mann, bei dem er Beschäftigung erhalten soll, entpuppt sich als Schwindler, die Verwandten, selbst in Not, können ihn nicht unterstützen, er streicht tagelang durch die Straßen, um einen Posten zu suchen, nach hundert Abweisungen verdingt er sich für fünf Schilling Wochenlohn bei einem Kurzwarenhändler; der Dienst dauert von sieben Uhr morgens bis neun Uhr abends und besteht in Ladenausfegen. Lampenreinigen und Fensterputzen.
Die Liverpooler Jungen, mit denen er sich am Hafen herumtreibt, lehren ihn den Unterschied zwischen einem Schoner erster Klasse und einem gewöhnlichen Auswandererschiff und zwischen einem in Bosten und einem in England gebauten Schiff.
Bei dem Händler ist seines Bleiben; nicht, er wird Lehrling in einem Fleischergeschäft, wodurch er aber seine Lage keineswegs verbessert, ein boshafter Gehilfe oder Werkführer, einer jener sadistischen Peiniger, wie sie sich in kleinbürgerlichen Berufen so häufig finden, verbittern ihm das Leben. Als Arbeit ist ihm aufgetragen, täglich frischen Fleischvorrat in großen Körben auf die im Dock liegenden Schiffe zu bringen.
Als er eines Tages auf dem Frachtschiff ‚Windermere‘ dem Kapitän die Rechnung übergibt und dabei die reiche Ausstattung der Kabine anstaunt, die vergoldeten Spiegel und glänzenden Randleisten, fragt ihn der Schiffsherr, ob er nicht als Kabinenjunge auf die ‚Windermere‘ kommen wolle. Fünf Dollar Monatslohn und die Ausrüstung; da gibt es kein Zaudern, das Schiff verspricht ihm die Erfüllung von Knabenträumen.
„Hätte ich mich nicht so vollkommen verzweifelt gefühlt, ich hätte mich an die Heimat geklammert, wie die Seemuschel an den Felsen.“ schreibt er in seiner Bildersprache. Angesichts der trostlosen Situation, der erniedrigenden Tätigkeit, der ewigen Familienzänkereien, seiner Bettlergarderobe, der elenden Beköstigung sieht er keinen andern Weg in die Zukunft.
Er hat bald Ursache, seinen Entschluß zu bereuen. Eine schlimmere Behandlung als die auf dem Schiff hat er nie zuvor erduldet. Prügel und Hunger, Hunger und Prügel. Schrubbe bis du triefst, bis dir der Schweiß in den Karpfenschlund läuft, leg dich auf deinen Besen und fahre nicht so zimperlich herum wie eine alte Jungfer beim Staubwischen, du Lümmel, so lauten noch die sanftesten Ermahnungen des Maats, und die Mannschaft ist nicht wohlwollender gesinnt. Alle Greuel, die man aus alten und neuen Seemannsgeschichten kennt, von Marryat bis Jack London und Travens Totenschiff, werden hier nach- und vorgerlebt. Die Taktik ist, dem Angeworbenen den Schiffsdienst derart zu verleiden, daß er im ersten Güberseeischen Hafen Reißaus nimmt und damit dem Eigentümer den Sold erspart.
Das tut auch unser John Rowlands. Kaum hat die ,Windermere‘ in New Orleans Anker geworfen, so verschwindet er im Gewühl der Stadt. Die Überfahrt auf diesem Schilf gehört zu den finstersten Erinnerungen seines Lebens. In den Aufzeichnungen darüber steht ein bedeutsames Wort über sein proletarisch gedrücktes Verhältnis zur gesamten Umwelt: „Wenn ich für einen Menschen bete, ist er gerade dabei, mich zu verwünschen; lobe ich ihn, so schmäht er mich; befehle ich, so trotzt man mir, und fühle ich zu irgend jemand Zuneigung, so ist es mein Los, von ihm verachtet und verlacht zu werden. An Bord der ‚Windemereʻ fiel mit dies sonderbare Zusammentreffen zum erstenmal auf. Ich grollte keinem, ich fand an jedem etwas zu bewundern; sie aber verfluchten mich, meine Augen, mein Gesicht, mein Herz, meine Seele, meine Person, meine Nationalität. Mein Vorstellungskreis wurde um einen neuen Begriff bereichert. Jeden weiteren Fall merkte mein Gedächtnis verwundert an, bis ich mich der Überzeugung nicht mehr verschließen konnte, daß dies ein zu meinem Leben gehörigen festes Gesetz sein müsse. Über alledem wurde mein Gemüt allmählich so undurchdringlich wie ein Schwanenrücken gegen die Regengüsse.“
Obwohl hier der vorausgesetzte Unschuldsstand etwas übertrieben betont sein mag, läßt sich doch die Haltung eines Mannes zu seinen Mitmenschen schwerlich markanter ausdrücken. Es ist die Haltung des Tätigen, der ohne Mißtrauen verloren ist. Denn das ungemessene Vertrauen des Anfangs ist ja nur der Weg zur Abwehr und Selbstabschließung. Im Grunde ist ein solches Geständnis nur bei wahrhafter Naivetät möglich, und Naivetät besitzt dieser Mann in hohem Grad, eine kindliche und eine bäurische Naivetät.
Nicht ohne unfreiwillige Komik ist die Erzählung, wie er mit einem gleichaltrigen Kameraden, der mit ihm auf der ‚Windermere‘ gewesen war, in ein Bordell gerät. „Als ich damals, arglos wie ein Lamm, den Kai verlassen hatte,“ mit dieser moralischen Betrachtung beginnt er den entrüsteten Bericht (den ein alternder, ruhmbeladener Mann niedergeschrieben hat), „war ich so unverdorben wie einen die gottesfürchtige Befolgung der zehn Gebote nur machen kann. Das waren für mich die Grenzsteine, die die Bezirke des Rechttuns von denen des Unrechttuns trennten. Zwischen diesen großen Marksteinen gab es viele wohlbekannte kleinere Wegweiser, aber einige waren darunter, die für ein so argloses Gemüt wie das meine fast unbemerkbar waren. Nur ein engelhaft reines Wesen vermochte ohne Fehltritt den schmalen Scheideweg zwischen Gut und Böse entlang zu tappen. Nach dem Essen durchschlenderten wir in süßem Wohlbehagen einige Nebenstraßen und traten in ein Haus, dessen Wirtin uns außerordentlich zuvorkommend empfing. Harry flüsterte mit ihr und wir wurden in einen luxuriösen Raum geführt. Auf einmal huschten aus den Türen lustig kichernde junge Damen herein, die so sparsam bekleidet waren, daß ich vor Bestürzung sprachlos war. Ich befand mich in völliger Unkenntnis ihres Gewerbes und war willig genug, mich aufmuntern zu lassen, als sie sich aber allerhand Freiheiten mit meiner körperlichen Person herausnahmen, kamen sie mit so verabscheuenswürdig schlecht vor, daß ich sie von mir stieß und zum Hause hinausstürzte.
Harry lief hinter mir her und wandte all seine Überredungskunst an, mich zur Rückkehr zu bewegen, aber eher wäre ich in den schmutzigen Mississippi gesprungen als diesen Schäkerinnen nochmals in die Augen zu sehen. Mein Widerwille war so groß, daß ich auch in späteren Jahren niemals den Abscheu gegen weibliche Wesen dieser Gattung habe überwinden können.“
Wir dürfen es ihm glauben, wenn er auch häufig dazu neigt, sich und seinen Wandel als exemplarisch hinzustellen. Ist er gleich von einer gewissen Hybris nicht freizusprechen, die teils nationalen Ursprungs, teils Ergebnis seiner harten Jugend ist, so hat er doch stets getrachtet, so zu leben wie er überzeugt war, daß man leben müsse. Aus der Zeit in New Orleans berichtet er ein reizendes Erlebnis mit einem als Junge verkleideten Mädchen, mit dem er einige Nächte lang das Bett teilt und das sich nie entkleidet, bis er endlich durch eine Reihe befremdlicher Wahrnehmungen das Geschlecht der Zimmergenossin entdeckt, die er aus Mitleid bei sich aufgenommen hat, denn wie er hat sie als Schiffsjunge England verlassen, wie er ist sie nach der Landung von dem Schiff geflüchtet: das alles ist mit bemerkenswerter Zartheit wiedergegeben, die nicht den Zweifel läßt, daß sich die Dinge so und nicht anders abgespielt haben. Ein winziges Detail nur in einem so großartigen Leben, aber es flößt unbedingtes Zutrauen ein. Stanley war damals etwa fünfzehn Jahre alt.
In keiner andern Epoche könnte sich diese Jugend ereignet haben als in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Jede Schicksalswendung, die Art der in ihr auftretenden Zufälle, die sozialen Verknüpfungen, die Umgangsformen, die berufliche Zielsetzung, die sentimentalische, von einem bestandenen Moralkodex diktierte Beziehung von Mensch zu Mensch, die bürgerliche Färbung und Richtung der Gesellschaft wie des Einzelnen, alles trägt die spezifischen Züge dieses Zeitalters. Die Begegnungen haben, von uns aus gesehen, nicht selten etwas Romanhaftes; sicherlich ist es nicht allein die zeitliche Distanz, die dies bewirkt, viel mehr noch die historisch gewordene Beschaffenheit aller Lebensverhältnisse, so daß dasselbe Geschehen, das um uns grenzenlos fließt, dort anekdotisch beschlossen ist. So erinnert der Vorgang, wie der junge John Rowlands, heimatloser Flüchtling, Lagerist bei der Firma Speake & McCreary, Engros- und Kommissionsgeschäft, von dem reichen edlen Kaufmann Henry Stanley an Sohnes Statt angenommen wird, an irgendeine rührselige Geschichte von Rider Haggard oder Mrs. Ouida; darum ist er jedoch nicht minder wahr, er hat nur den unverkennbaren Stil einer Zeit‚ von der mittelmäßige Autoren oft getreuere Schilderer sind als große.
Schon das erste Gespräch zwischen Master John und Herrn Stanley ist bezeichnend. „Du möchtest gern Arbeit haben, um recht reich zu werden, wie? was für eine Arbeit kannst du denn? kannst du lesen? Was für ein Buch steckt da in deiner Tasche?“ – „Das ist meine Bibel, ein Geschenk von unserm Herrn Bischof.“ – „Zeig sie her, deine Bibel. Kannst du schreiben? Dann markiere mir dort den Kaffeesack mit derselben Adresse‚ die du auf dem Sack daneben siehst.“
In wenigen Minuten hat John zwanzig Kaffeesäcke mit Adressen bemalt, und Mr. Stanley, den solche Fertigkeit im Verein mit der Bibel aus eines englischen Bischofs Händen entzücken muß, verfehlt nicht‚ das junge Genie seinem Geschäftsfreund Speake ans Herz zu legen. Bibel und Kaffeesack, das ist Amerika, wie es leibt und lebt, wenigstens das Amerika um 1860.
Mr. Stanley war Makler, der zwischen den Pflanzern am oberen Strom und den Kaufleuten von New Orleans Aufträge vermittelte und mit einem Bruder in Havanna Handel trieb. Er besaß eine junge Frau, deren Zuneigung der junge John zu erwerben wußte, so daß er schon vor der Adoption wie ein leibliches Kind im Hause gehalten ward. Die Freundlichkeit, der er allenthalben begegnet, kräftigt sein Selbstgefühl. Fähigkeiten erwachen in im, zu deren Entfaltung er sich verpflichtet findet. Die Angst der Unterdrückten, die ihn bis dahin beherrscht hat, löst sich von ihm. Die Aussicht auf den Himmel, so drückt er es aus, steht ihm jetzt ebenso frei wie jedem andern, da die amerikanischen Freiheitsrechte nicht auf der Tiefe der Taschen noch auf der physischen Überlegenheit beruhen, sondern dem Landstreicher ebenso zugute kommen wie dem stolzesten Kaufmann. (Damals war Amerika noch wirklich, was europäische Idealisten in ihm sahen, war es doch auch das Gelobte Land der deutschen Revolutionsflüchtlinge.)
Es in, nicht unwahrscheinlich, daß Stanley, wäre er in England geblieben, in der dumpfen Atmosphäre, in der er aufgewachsen, erstickt wäre. Als er sich erinnert, daß nur wenig gefehlt hätte, und er hätte die moralische Kraft nicht aufgebracht, den Verwandten, die ihn von dem Dienst auf der ‚Windermere‘ abhalten gewollt, Widerstand zu leisten, kommt er zu wunderlichen Meditationen über die Bedeutung des Neinsagens im Leben.
„Nach meiner Überzeugung müßte der Mut zum Nein so früh geweckt werden, wie es die Intelligenz eines Kindes nur irgend erlaubt. Die wenigen Male, wo ich dazu fähig war, sind für mich von unermeßlichem Wert gewesen.“
Ein überraschendes Bekenntnis deshalb, weil gerade Stanleys Leben ohne Kompromiß zwischen Ja und Nein verlief. Wie viele Männer, die aus der Tiefe kommen, besaß er eine ungewöhnliche Kraft der Selbsterziehung, und seine äußerlich betonte Gottgläubigkeit ging über bloßen Lippendienst und traditionelle Form ziemlich weit, wenn auch nicht entscheidend, hinaus.
Die junge Frau seines Gönners bezeichnet er als die erste „Lady“, die er kennengelernt. Vermutlich hat sie seinen Bildungsehrgeiz wachgerufen, denn mit der ihm eigenen Leidenschaftlichkeit erschließt er sich nun die Welt der Bücher und verschlingt Gibbon, Spenser, Pope, Dryden und ein Dutzend anderer Autoren. Sein geistiger Enthusiasmus hebt ihn auch gesellschaftlich. Das Leben in den Südstaaten vor dem Bürgerkrieg war in dieser Hinsicht von lateinischer Leichtigkeit und Heiterkeit, die Millionen von Negersklaven bewirkten, daß jeder Weiße ein Herr war, mochte er auch sonst der ärmste Teufel sein, zudem bildeten alle Weißen in vorbereitender Abwehr eine einzige große Familie wie die Schwarzen ihrerseits.
Diese Solidarität zeigt sich in dem Verhältnis des jungen Stanley zu seinen Pflegeeltern, privates Beispiel für einen öffentlichen Grundsatz; als Mr. Stanley eine längere Reise antritt, vertraut er seine junge Gattin dem kaum den Kinderschuhen entwachsenen Knaben an; die junge Frau erkrankt tödlich, und um dem übermüdeten Hausmädchen in der Pflege behilflich zu sein, gibt John ohne Besinnen eine Stellung auf, was ihm später von seinem Ziehvater hoch angerechnet, ja der eigentliche Beweggrund wird, daß dieser den hochherzigen Jüngling adoptiert.
Immer wieder stößt man in der Erzählung dieser Geschehnisse auf originelle Betrachtungen wie die, als er die Gewißheit erlangt, daß die von ihm so bewunderte Frau sterben muß: „bis dahin hatte ich des festen Glaubens gelebt, daß, wer stürbe, nur durch seinen Mangel an gutem Willen überwältigt werden kann und man dem Ungeheuer Tod nur ordentlich Trotz zu bieten brauche, um ihm die Beute zu entreißen.“ Und er zitiert das tiefe Wort von Young: „Alle Menschen halten alle Menschen für sterblich, nur nicht sich selbst.“ In der Tat mag es vielleicht daran liegen, daß jeder für sich allein die Kraft zum Leben behält.
Da Mr. Stanley nicht erreichbar ist und bis zu seiner Rückkehr noch Monate vergehen können, ist John Rowlands gezwungen, nach dem erstbesten Broterwerb zu greifen, der sich ihm bietet; er wird Holzsäger, Laufbursche, Krankenwärter und läßt sich schließlich, weil er den Pflegevater in St. Louis weiß, auf einem Stromdampfer anheuern. Jeder muß durch das Joch der Not hindurch, ehe er in Glück und Freiheit eingeht, tröstet er sich stoisch.
Im November 1859 kommt er in St. Louis an; zu seiner Bestürzung erfährt er, Mr. Stanley sei die Woche vorher nach New Orleans zurückgefahren; es in eine altmodische Zeit, der Mensch noch nicht mit all seinen Handlungen und Absichten von elektrischem Draht umgittert. Er hat keinen Cent in der Tasche, aber er überlegt nicht lang; daß er nach New Orleans zurückfahren muß, seht fest, so verdingt er sich auf einem der Prahme, die die im Urwald gefällten Stämme stromabwärts befördern. Er muß Wasser tragen, Schüsseln und Pfannen scheuern, Kartoffeln schälen, Maisbrei rühren, nach dem Feuer sehen und bisweilen beim Rudern helfen.
Was dann folgt, ist ein Idyll, vielleicht das einzige, das im Leben dieses Mannes zu finden ist, die einzige kurze Zeit, wo er froh und sorglos gewesen zu sein scheint. Man könnte füglich darüber hinweggehen, würden nicht gerade hier einige bedeutsame Schlaglichter auf die Entwicklung seines Charakters geworfen, denn ohne die echte Zärtlichkeit und Liebe, mit der ihn der wiedergefundene Vater aufnimmt, dessen Namen er auch von nun an führt, hätte er, dessen bin ich ziemlich sicher, den seelischen Halt, die innere Verfestigung nicht gehabt, die ein unerläßliches Erfordernis bei der Rolle sind, die ihm das Schicksal vorbehalten hat.
Vom Geschehenen aus betrachtet, hat das, was wir die „Bestimmung“ eines Menschen nennen, eine lückenlose Logik. In seinen frühesten Träumen hatte er sich oft vorgestellt, was für ein glücklicher Knabe er wäre, wenn er einen Vater oder eine Mutter hätte; und nun kam „als Antwort des Wunderbar-Erhabenen“ (dies sind seine Worte) die Verwirklichung. Es müssen gewaltige Gemütskräfte in ihm verborgen gewesen sein; er berichtet, daß er, als ihn der verehrte Mann in die Arme geschlossen, ohnmächtig zusammengebrochen sei, und versäumt bei dieser Gelegenheit allerdings nicht, hinzuzufügen, es sei dies die einzige Zärtlichkeit gewesen, die er erfahren, seit er denken konnte.
Zur Besiegelung des Bundes erhält er eine Fülle von Geschenken, die ihm so neuartig sind wie ihre Anwendung: Zahnbürste, Nagelbürste, lange weiße Nachthemden; es ist ihm vorher nie in den Sinn gekommen, daß man Zähne und Nägel putzen und das Hemd wechseln müsse, bevor man zu Bett geht. Überhaupt ist er von Kultur gänzlich unbeleckt, dafür verfügt er, wie alle, deren Aufstieg kaspar-hauserhaft ist, über ein erstaunliches Gedächtnis, in einem Grad, daß er eine Seite voller Zahlen, wenn er sie ein einziges Mal überlesen hat, in unveränderter Reihenfolge auswendig hersagen kann.
Mr. Stanley geht mit ihm auf Reisen, er will ihn durch Anschauung unterrichten; es ist nicht zu bezweifeln, daß er ein Mann von Bildung und Geschmack war, wenn die gehaltvollen und tiefgreifenden Gespräche, die sein Zögling zum Teil wörtlich wiedergibt, im selben Geist geführt worden sind; sie stehen manchmal in Stoff und Form den Unterhaltungen in den Goetheschen Wanderjahren nicht fern, und mag man auch abziehen, was spätere Redaktion, was verklärende Erinnerung hinzugetan, es bleibt immer noch so viel, um die bewundernde Anhänglichkeit des Schülers zu rechtfertigen, dem durch eine märchenhafte Schicksalswandlung die entscheidende Stufe zur Selbstfindung und geistigen Existenz gebaut wurde. Solche stille Führer, die in Vergessenheit sinken, wenn sie ihre, zeitlich gesehen, bescheidene Mission erfüllt haben, gibt und gab es viele in der Welt, jedes höhere Lebenswerk ruht auf ihnen und ihren unbekannten Namen.
Und doch ist in diesem Fall etwas schwer Verständliches geschehen. Nach allem, was Stanley von ihm berichtet, ist der Mann reich gewesen. Seine ausgedehnten geschäftlichen Reisen waren eine beständige Gefährdung in einem Land und Klima, wo dauernd Epidemien herrschten, Cholera, Sumpffieber, Typhus. Trotzdem und trotz seiner Zuneigung zu dem Adoptivsohn hat er nichts unternommen, um die Zukunft des jungen Menschen zu sichern.
Bevor er im Jahr 1860 nach Westindien fährt, bringt er den nun Zwanzigjährigen zu Freunden auf eine Farm nach Arkansas, sie sehen einander nie wieder, und der junge Stanley befindet sich mit dem Tag des Abschieds in derselben Bettelarmut und Hilflosigkeit wie vor der Bekanntschaft mit der romantischen Vatergestalt, nur daß er jetzt weiß, was es bedeutet, wenn man nicht bettelarm und hilflos ist. Hier klafft eine Lücke oder etwas Verschwiegenes. Daß Mr. Stanley unterwegs gestorben ist, wird freilich erzählt, dennoch hat man das Gefühl als sei eine Entfremdung vorhergegangen, die man uns verheimlicht hat.
VORBEREITUNGSJAHRE
Eine Zeitlang bringt er sich als Holzfäller durch, muß nach einem Streit mit einem Sklavenaufseher flüchten, wird Kommis im Lagerhaus von Mr. Altschul, einem jüdischen Kaufmann, und dort brandet die Kriegsstimmung an ihn heran, die, von hetzerischen Agenten und kleinen Lokalblättchen geschürt, bis in die Wildnis von Arkansas vordringt. Es ist immer dann das nämliche, damals wie heute, wahrscheinlich war es schon so, als die Griechen gegen die Perser zogen. In diesem Punkt ist die Menschheit unwandelbar. Ein befreundeter Junge erklärt dem Unpolitischen die Dinge, wie er sie sieht und gehört hat: sein Vater besitzt hundertzwanzig Sklaven, jeder Sklave repräsentiert einen Wert zwischen fünfhundert und zwölfhundert Dollar, dieses Vermögen zu enteignen, wie es die Abolitionisten beabsichtigen, ist glatter Raub, und den zu verhüten, muß man kämpfen bis auf den letzten Mann.
Daß die Union jeden Pflanzer für jede Seele zu entschädigen gewillt ist, behält er aus guten Gründen für sich, falls er es weiß, das erfährt Stanley erst, als er Kriegsgefangener ist, und man kann sich denken, daß es ihm bei seinem starken Gerechtigkeitsgefühl sofort eine andere Anschauung des Verhältnisses zwischen Norden und Süden beibringt.
Lassen schon die Männer an Kriegsbegeisterung nichts zu wünschen übrig, so gebärden sich die Frauen vollkommen rabiat; mit funkelnden Augen geloben sie, selber auszuziehen und über die Yankees herzufallen, falls auch nur ein einziger Mann zögere, die Waffen zu ergreifen. In einem Land, wo die Frauen wie höhere Wesen geachtet werden, muß eine solche Sprache die Männer toll machen.
Da Stanley zunächst keine allzu große Lust bezeigt, seine Haut zu Markt zu tragen, wird er scheel angesehen, ja, eine junge Dame schickt ihm durch die Post ein Hemd und einen Unterrock von einer Negerin, und als eines Tages ein Farmer zu ihm kommt und ihn freundlich fragt, ob er sich denn nicht endlich den heldenmütigen Kindern von Arkansas als Mitkämpfer anschließen wolle, kann er nicht umhin, sich bereit zu zeigen, wenn er nicht als Feigling gebrandmarkt werden will.