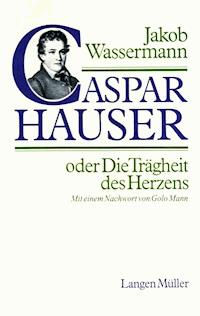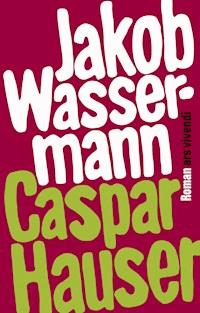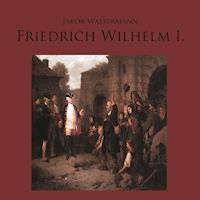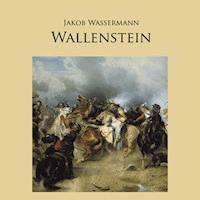Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
In seinem ersten Buch "Melusine" von 1896 erzählt der noch unbekannte Autor Jakob Wassermann von einer jungen, unreifen Liebe, die vom ersten Moment an zum Scheitern verurteilt scheint. Der junge Student Vidl Falk freundet sich mit der jungen Melusine an. Melusine, genannt Mely, hat sich mit ihrem Vormund Oberst Wolfgang Thewalt überworfen und droht nun mittellos zu werden. Will Vidl der jungen Frau anfangs noch beistehen, lassen Melys Verhalten und ihre Antworten viele Fragen über ihr wahres Verhältnis zum Oberst offen; ihre wirklichen Motive bleiben rätselhaft. Ist es Liebe oder Abhängigkeit, die sie zwischen dem jungen Studenten und ihrem Vormund hin- und hertaumeln lassen. Wie auch Vidl bleibt der Leser im Unklaren, der Autor lässt in den wichtigsten Momenten den literarischen Vorhang fallen und überlässt das Ungeschriebene der Fantasie. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jakob Wassermann
Melusine
Jakob Wassermann
Melusine
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954188-32-1
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
Schluß.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
I.
Wenige Menschen verstehen es, ihre Wünsche im Bereich des Möglichen zu lassen. –
Nach monatelangem Hungern war es Vidl Falk endlich gelungen, ein Stipendium von der Hochschule zu erhalten. Mehr hatte er nicht gewünscht. Er betrachtete sich als gemachten Mann und strebte, sich das Leben etwas gemächlicher einzurichten. Mit der ganzen Besitzesfreude eines Kapitalisten trug er sein Vermögen spazieren. Jedoch vermied er das Gedränge der Verkehrsstraßen, denn er fürchtete sich vor Taschendieben. Wenn er beim Mittagessen die Zeitung zur Hand nahm, so studierte er zuerst unter der Rubrik »Lokalnachrichten« die Aufzählung der Diebstähle und der verlorenen Geldbörsen.
Der plötzlich eingetretene Reichtum berauschte ihn. Die schmale, armselige Zelle, in der er bis jetzt gehaust, ekelte ihn auf einmal an. Er kündigte und ging aus, ein Zimmer zu suchen, das mit seinen Träumen möglichst übereinstimmen sollte. Der erfinderische Sinn Münchner Vermieterinnen, der schon den Aushängezettel mit jenen feinen Nuancen versieht, welche auf den Preis schließen lassen, erleichterte ihm das Suchen.
Eines Nachmittags erkletterte er die zwei steilen Treppen eines ziemlich vornehmen Hauses in der Heßstraße. »Pension Bender« stand an der Korridortüre.
Ein kleines, zierliches Fräulein führte ihn in das ausgeschriebene Zimmer. Leutselig und mit weltmännischem Behagen betrachtete Falk die vier Wände des Zimmerchens und beklagte, daß keine Ottomane oder »so was Ähnliches« vorhanden sei. Derselbe herablassende junge Mann hatte sich vor noch nicht vier Tagen mit einem Mittagessen begnügt, das aus einem für zehn Pfennige Äpfel bereiteten Mus und mit einem Abendessen, welches aus purem Schwarzbrot bestand.
Mit ironischem Lächeln beobachtete ihn das junge Mädchen. Es schien seine Spottlust mit Mühe zu zügeln.
»Warum lachen Sie denn?«, fragte Falk, indem er ein möglichst gutmütiges Gesicht machte, fügte aber sogleich hastig hinzu, daß er das Zimmer mieten würde. »Wer wohnt denn sonst noch bei Ihnen?«, fragte er, mit der Nase in der Luft schnuppernd, denn es roch nach Weihrauch.
Das Mädchen ließ ein helles, hölzernes Lachen hören und erwiderte: »Nebenan wohnt Doktor Brosam – er ist Arzt und er mag den Weihrauch sehr gern –«
»Pfui!«
»Dann ein Fräulein von Erdmann, eine Gelehrte, und Fräulein Mirbeth. Das ist alles.«
»Eine Gelehrte –? Jung?«
Jetzt lachten sie Beide. –
Gegen Abend des nächsten Tages – es war der 1. November – bezog Falk seine neue Wohnung. Als er mit Auspacken und Ordnen seiner Habseligkeiten fertig war, ging er in die Küche, um die Magd nach etwas zu fragen. Die Küchentüre stand halboffen und er wollte sie schon aufstoßen, als ihn der Anblick einer weiblichen Gestalt, welche drinnen ganz nahe an der Tür stand, daran hinderte. Diese Gestalt war groß und schlank, fast hager. Das ihm zugewandte Profil zeigte herbe und unschöne Linien, ja, es erschien ihm fast abstoßend. Soviel er im Dunkeln urteilen konnte, war sie noch sehr jung; er hörte eine schleppende und etwas gewöhnliche Stimme, die mit dem Tonfall einer Ermüdeten der Magd Erklärungen irgend welcher Art gab.
Vidl Falk wandte sich rasch ab, um nicht gesehen zu werden; aber in diesem Augenblick kam das Fräulein Bender aus dem Wohnzimmer und fragte nach seinem Begehr. Während er noch mit ihr sprach, verließ das schlanke, junge Mädchen die Küche und ging an ihnen vorbei. Falk sah ihr nicht ins Gesicht, obwohl er ihre Züge jetzt genau hätte sehen können, da die Magd mit der Korridorlampe folgte. Nur flüchtig musterte er ihren Schlafrock von düsterroter Färbung mit den Aufschlägen an der Brust und dem Brokataufputz. Doch obwohl er der Vorbeigehenden durchaus keine Beachtung schenkte, hörte er doch auch nicht darauf, was das kleine, spöttische Fräulein Bender sagte. Eine Unruhe, die freilich nur einige Sekunden dauerte, hatte ihn daran verhindert.
»Wer war denn das?«, fragte er nachher ganz gleichgültig die Kleine.
Das Mädchen streifte ihn mit einem kurzen Seitenblick und sagte mit komischer, fast komödiantischer Wichtigkeit: »Das war Fräulein Mirbeth.«
Falk glaubte etwas Gehässiges aus dem Ton dieser Antwort zu hören, nicht gegen ihn, sondern gegen jene Dame. Nach Monaten noch erinnerte er sich der ironischen Betonung des Namens und des überlegen gespitzten Mundes mit der hervortretenden Unterlippe.
Noch in derselben Nacht schrieb Vidl Falk die folgenden, etwas jugendlich klingenden Sätze in sein Tagebuch: »Ich bin ruhig und glücklich jetzt, – beglückt von der Einsamkeit und allerlei unnützen Gedanken. Und doch fühle ich etwas Leeres in mir, eine Lücke, ein Loch. Sollte dies das Weib sein? Ich glaube kaum. Man kann sich doch nicht nach dem Giftbecher sehnen.«
Auf der ersten Seite dieses Tagebuchs befanden sich in lapidaren Lettern die prunkvollen Worte: Die reine Wahrheit.
II.
Fräulein Emilie von Erdmann erwachte seufzend aus dem Morgenschlummer. Das Auf- und Zuklappen der Türen hatte ihren Schlaf verscheucht. Die dicke, ältliche Dame stöhnte sehr laut und hielt sich mit beiden Händen den Kopf. Als der Lärm kein Ende nahm, murmelte sie Flüche und Schimpfworte, ballte beide Fäuste gegen die unsichtbaren Feinde draußen und rief endlich verzweifelt aus: »Mein Leben ist verpfuscht!« Dann sank sie theatralisch in die Kissen zurück und holte ein Brustbonbon aus dem Schubfach eines kleinen Tisches neben dem Bett.
Sie empfand jenes heftige Unbehagen, das Jeden heimsucht, der aus dem Schlaf zu den Sorgen des Lebens zurückkehrt. Auch die Überlegung, wieder um einen Tag älter geworden zu sein, verstimmte sie. Der Verfall ihres Körpers war das Schauspiel, worüber sie täglich von neuem grollen mußte. Und sie wollte noch jung sein und zur Jugend gezählt werden. Aber mit fünfzig Jahren ist man alt, der kunstreichsten Modistin zum Trotz.
Das Dienstmädchen brachte den Morgenkaffee und Fräulein von Erdmann beschwerte sich lebhaft über die Unruhe. »Liebste Anna«, sagte sie mit vibrierender Stimme, »ich bin so elend, so krank. Sehen Sie her«, (sie streckte ihre Gichtfinger aus den Kissen) »wissen Sie was das ist? Das ist der Hohn des Lebens! Geben Sie mir die Hand, Anna! Ich weiß, daß Sie es gut mit mir meinen. Ich war nicht immer so. Ich habe Tage des Glanzes gesehn.«
Das Mädchen lächelte kalt. Mit kecker Vertraulichkeit betrachtete es nach Dienstbotenart die gelbe, schwammige Hand. Wieder allein, nahm die Kranke eilig den kleinen Spiegel von der Wand und blickte starr hinein. Sie zuckte mit keiner Wimper, ihr Gesicht nahm einen königlich strengen und dann einen finstern, zürnenden Ausdruck an, und ihre abnorm langen, fleischigen Ohrlappen röteten sich.
Von neuem wurden draußen die Türen zugeschlagen, polternde Schritte ertönten auf dem Korridor, und der neue Herr rief nach Wasser. Mit einem Wutschrei sprang das Fräulein aus dem Bette. Sie suchte nach ihren Strümpfen, und kramte zu diesem Zweck unter den am Boden liegenden Wäschestücken, Zigarrenschachteln, Büchern, Zeitungen, Briefen und Unterröcken; sogar auf dem Tisch suchte sie zwischen den Kaffeetassen, Flaschen und Speiseresten. Aber das Erfolglose ihrer Bemühungen erkennend, begnügte sie sich damit, einen langen, faltenlosen Mantel um die Schultern zu hängen, der das schmutzige Nachthemd nur schlecht verhüllte, und barfuß in ein paar zerrissene Pantoffeln von ehrwürdigem Alter zu schlüpfen. Sie wollte schon hinausgehen, aber zwei Gründe hielten sie von ihrem Beschwerdegang ab. Erstens, dachte sie, wird mein Kaffee kalt und zweitens wäre diese kleine Frau Bender fähig, mich wegen der lumpigen paar hundert Mark, die ich schuldig bin, zu ennuyieren. Dies »ennuyieren« gefiel ihr; es verhüllte das am Besten, was zu denken sie sich schämte.
Nach dem reichlichen Frühstück hatte sie ihre Morgenzigarre angezündet und sich in schöner Pose auf die Ottomane gelegt. Da knarrte die Tür in den Angeln und unwillig wandte die Liegende das Haupt. Sie sah Fräulein Mirbeth im Zimmer stehen, dicht neben der Tür, die das junge Mädchen langsam geschlossen hatte. Emilie von Erdmann sprang auf. »Was – Sie, Fräulein!«, rief sie erstaunt.
Fräulein Mirbeth antwortete nicht. Sie schaute gerade vor sich hin, aber nicht auf einen bestimmten Punkt, sondern sie blickte weit in die Ferne und sie schien etwas wahrzunehmen, das mehr und mehr ihre Angst erregte. Ihre Arme hingen schlaff an dem grauen, wollenen, schwarzgemusterten Morgenrock herab und ihre kleinen, feinen, schmalen und mageren Hände leuchteten förmlich durch das Zimmer.
»Aber liebes Kind, was haben Sie denn?«, rief Fräulein von Erdmann erschrocken und haschte zärtlich nach der Hand dieses »Kindes«, das einen Kopf größer war als sie.
Das junge Mädchen machte noch immer keine Bewegung. Wohl aber begannen die Nasenflügel zu beben und die schwarzen Augen, die aus dem blassen Gesicht hervorleuchteten wie zwei überaus glänzende Perlen, füllten sich mit Tränen. Beständig, ohne aufzuhören, nagte sie an der Unterlippe und dann ging ein Zucken durch ihren Körper. Sie zitterte. Plötzlich machte sie zwei oder drei Schritte vorwärts, – schnell als fürchte sie zu fallen, warf sich auf die Ottomane, legte den Kopf auf die verschränkten Arme und begann zu weinen, – leise und unaufhaltsam.
Fräulein von Erdmann war ratlos. Mechanisch strich sie über das wirre, dunkle, glanzlose Haar der Weinenden, das bei jeder Berührung knisterte wie Seide.
Die dicke Dame suchte zu trösten. »Wer hat Ihnen denn ein Leids getan, Sie Arme? Ist es Ihr – Ihr Vormund, ist es dieser schreckliche Oberst? Sagen Sie mir alles. Unbesorgt dürfen Sie sich mir anvertrauen. Ich bin verschwiegen wie das Grab. Vertrauen Sie mir, liebes Kind. Ist er denn in Sie verliebt, dieser Oberst? Und hat er Sie beleidigt? Vertrauen Sie mir!«
Und sie drängte in das junge Mädchen mit dem ganzen Ungestüm einer Frau, die um jeden Preis ein Geheimnis zu erpressen sucht.
Fräulein Mirbeth richtete sich auf. Sie drückte einen Augenblick die Lider zu, wie um dadurch widerwärtige Bilder hinwegzuscheuchen und sagte schroff. »Lassen Sie mich!« Ihr Gesicht war voll Scham, und sie wußte nicht, wohin sie den Blick wenden sollte. Mit aufgehobenen Händen stand Fräulein von Erdmann vor ihr und sagte mehr als zehnmal: »Vertrauen Sie mir!«
Das junge Mädchen schüttelte den Kopf und entgegnete langsam: »Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein. Ich war wohl recht dumm. Aber ich kann jetzt nicht reden. Verzeihen Sie mir.« Sie nickte zerstreut und ging hastig hinaus.
Wütend, mit verächtlich zusammengepreßten Lippen sah ihr die dicke Gnädige nach.
III.
Fräulein Mirbeth kehrte in ihr Zimmer zurück. Lange Zeit ging sie auf und nieder, mit großen Schritten und scheinbar völlig losgelöst von allem, was sie umgab. Sie war phlegmatisch in ihren Bewegungen und ihr Gesicht verriet keine innere Regung mehr. Aber etwas Freudloses und Hoffnungsloses lag auf ihr wie Novemberreif. Beim ersten Anblick erschien sie schlaff, müde und gleichgültig.
Sie setzte sich an den Schreibtisch, nahm Feder und Papier zur Hand und schickte sich an, zu schreiben. Doch blieb es nur beim Ansetzen der Feder, deren Spitze sie stets ängstlich betrachtete. Offenbar wußte sie genau, was sie schreiben wollte: Satz für Satz; aber diese Sätze aufs Papier zu bringen, war ihr unmöglich. Unmutig warf sie die Feder fort und stützte den Kopf in die Hand. Jetzt mußte sie aufquellende Tränen verschlucken und plötzlich errötete sie vor Scham oder vor Haß. Sie zog ein kleines, mit flotter Hand beschriebenes Stück Papier aus der Tasche, entknitterte es und sah länger als eine Viertelstunde darauf nieder.
Da klopfte es und das kleine Fräulein Bender trat herein. Mit ihren schwebenden, etwas gesucht graziösen Schritten ging sie auf die regungslos Dasitzende zu, faßte sie bei der Hand und sagte: »Was ist Ihnen denn, Mely? Sie sind so verstört, schon seit gestern. Sogar Mama hat es bemerkt und hat gesagt, ich solle doch mal herein.«
Mely Mirbeth schüttelte langsam den Kopf, wie jemand, der fest entschlossen ist, seinen Kummer allein zu tragen. Aber im Nu war dieser Entschluß bei ihr vergessen und die vorige Schwäche ergriff sie wieder. Hastig und suchend erfaßte sie die Hand des jüngeren Mädchens. In dieser unwillkürlichen Bewegung lag ein Schwächegeständnis und ein Anschmiegungsbedürfnis und dies wurde von dem jungen Mädchen wohl verstanden. Es näherte seine Lippen den Wangen Melys und fragte leise: »Sie waren bei Fräulein von Erdmann?«
Mely lächelte schuldbewußt.
»Das sollten Sie wirklich nicht tun«, fuhr die Kleine fort. »Warum das? Die haßt uns ja doch, weil wir jünger sind als sie. Sie stirbt vor Neid um unsere Jugend.«
Melys Lächeln wurde heller und fröhlicher. Mit naiver Verwunderung sah sie das zierliche Mädchen an, das ein so scharfes und selbständiges Urteil zu geben wagte. Man sah auch an der schnellen Bewegung ihrer Lider, daß sie darüber nachdachte. »Sie sind bös, Helene«, sagte sie endlich, erhob sich und begann wieder ihr Umherwandern. »Ach Helene«, rief sie nach einer langen Pause, »wenn Sie wüßten, was ich alles durchzumachen habe!«
Helene Bender saß mit verschränkten Armen auf der Lehne des Fauteuils und blickte mit ihren klugen, grauen Augen Mely an. Etwas Ungläubiges und Ironisches lag in ihrem aufmerksamen Blick. So klein sie war und so unbedeutend sie aussah, so skeptisch blieb sie gegenüber jedem Gefühlsausbruch und um den schmalen Mund mit der vorgeschobenen Unterlippe lag stets ein gleichgültiger Spott. Sie glaubte nicht an Melys Leiden, sie hielt jene für zimperlich und anspruchsvoll und vor allem für oberflächlich. Nur aus Neugierde war sie hereingekommen.
Mely ahnte nichts davon. Sie vertraute allen Menschen, außer denen, die sie haßte. Was man ihr sagte, das glaubte sie, selbst die plumpen Lügen. In ihrem Schmerz befangen, hielt sie es für unmöglich, daß jemand an der Tiefe dieses Gefühls zweifeln könne. Sie setzte sich und sagte mit ihrer jetzt weichen und einschmeichelnden Stimme, die etwas Bekümmertes stets in sich hatte: »Ich wollte ja auf alles gern verzichten, wenn ich nur meine Ruhe hätte. Mit nacktem Brot nahm ich vorlieb, – nur endlich einmal ein anderes Leben. Die Aufregungen, die Quälereien, die Beleidigungen, – ich bin ganz krank.«
Und sie seufzte tief auf, wie Kinder tun, wenn sie sich ausgeweint haben. »Sie wissen nicht, was das ist, Helene«, fuhr sie traurig fort. »Sie haben Ihre Mutter da und leben so bequem und Sorgen haben Sie keine. Aber ich bin ganz allein auf der Welt und dieser Mann darf mich mißhandeln wie er will, darf mich beschimpfen – o, ich bin ganz krank! Da hab ich wieder einen Brief, sehn Sie Helene, – da, was das ist! – Ich muß mich zu Tod schämen.«
»Was ist es denn?«
»Ach – das kann ich Ihnen ja gar nicht sagen. Es ist – er will – – nein, es ist unmöglich.« Verwirrt und voll Scham wandte sich Mely ab. »Schon einmal hat er es verlangt«, flüsterte sie. »Und weil ich nicht will, muß ich mich quälen lassen, um nichts, um jede Kleinigkeit.« Sie nahm den Brief und zerfetzte ihn nervös zwischen den Fingern. Dann ging sie zum Kleiderschrank, nahm ihre Straßenrobe heraus und öffnete mit einem einzigen Riß die Knöpfe ihres Morgenrocks.
»Ja – mögen Sie ihn denn nicht?«, fragte Helene schüchtern. »Oder wie ist das?«
»Mögen! Erschießen könnt ich ihn.«
Das kleine Mädchen lächelte verständig. Sie trat zu Mely und ergriff deren beide Hände. »Seien Sie doch ruhiger«, sagte sie. »Ist es denn gar so schlimm? Wer weiß, vielleicht stellen Sie sich’s nur so entsetzlich vor. Er ist doch oft recht nett mit Ihnen. Wie viel Schönes hat er Ihnen schon geschenkt.«
Die Trostgründe waren banal; doch auf Mely übte die stille, sichere und selbstbewußte Art dieser Frühreifen einen beruhigenden Einfluß. Sie strich mit der Hand über die Stirn und blickte unschlüssig vor sich hin.
»Was wollen Sie denn tun?«, fragte Helene ängstlich.
»Hinüber will ich. Alles will ich ihm sagen. Seinen Brief will ich ihm vor die Füße werfen!«, stieß das junge Weib hervor. Sie hatte vergessen, daß sie den Brief soeben zerrissen hatte.
»Nicht – nicht das«, beschwichtigte Helene. »Warten Sie noch bis heute Abend wenigstens. Sie machen es ja nur schlimmer, – warten Sie.« Das Mädchen sprach sanft und zugleich überlegen. Doch Mely schüttelte den Kopf. »Ich muß«, sagte sie. »Ich bin sonst ganz unglücklich den ganzen Tag.« Und während sie sich ankleidete, erzählte sie. »Sehn Sie, Helene, ich habe neulich zu meinem schwarzen Kleid einen bunten Hut gekauft. Da gab’s Skandal. Das sei gemein, sagte er. Die Dienstboten täten das. Ich wolle mich auffallend kleiden, nur aus Koketterie. Ich soll kokett sein, Helene, das ist doch lächerlich, wie? Aber er will nicht, daß mich ein anderer Mann nur anschaut, deswegen soll ich keine Farben tragen. Und dann das: ich habe dreitausend Mark Vermögen gehabt, von der Mutter noch. Und als ich volljährig war, – nein etwas später, vor drei Jahren war’s, bekam ich das Geld. Da hat er nicht aufgehört, zu drängen, ich solle doch das Geld verbrauchen, und ich – so dumm! – mache die unsinnigsten Ausgaben. Kurz, in sechs Monaten war alles verputzt. Und wie ich dann das erste Mal von ihm Geld verlangen mußte, da hätten Sie ihn sehen sollen. Ganz glücklich war er darüber, ganz weg vor Freude.«
Helene war erstaunt. »Nun – das ist doch schön!«
»Aber verstehen Sie denn nicht? Jetzt war ich doch von ihm abhängig und er konnte machen mit mir, was er wollte. Jetzt hieß es gehorchen, – oder… Versteht! Sie nicht? Aber es ist beim Oder geblieben. O, es war gemein.«
Sie war fertig mit der Toilette, nahm Handschuhe und Schirm und zur Tür gehend, sagte sie leichthin: »Gelt, ich bin dumm, Helene. Andere würden lachen. Ach Gott und grade zu dieser alten Erdmann muß ich hinein. Wie dumm, wie dumm! Was denkt sich jetzt die.« Als ob sie aus sich selbst nicht klug zu werden vermöchte, schüttelte sie ganz langsam den Kopf. Sie war unzufrieden mit sich, auch deswegen, weil sie so offen gegen Helene gewesen war.
Als sie schon im Hausflur angelangt war, kehrte sie wieder um und ging in ihr Zimmer zurück. Furcht und Mutlosigkeit hatten sie erfaßt. Sie lehnte sich in den Fauteuil und schloß die Augen. Trotz des Mantels, den sie nicht abgelegt hatte, fror sie aus dem Innern heraus. Wie Spreu im Winde wirbelt, so stürmten die Gedanken in ihr durcheinander. Heiraten kann ich dich nicht, das wirst du doch einsehen, zitierte sie nervös lächelnd. Seine Frau hat er zu Grund gerichtet, dachte sie und runzelte feindselig die Stirn. Es war seltsam, daß diese Frau jetzt vor ihr stand, wie sie an einem Maskenball des letzten Karnevals kostümiert gewesen: im roten Pierrotgewand mit weißer Zipfelmütze. Noch deutlich entsann sie sich dabei des glühenden Gesichts, das oft mit einem spähenden und unterwürfigen Ausdruck dem Oberst sich zuwandte. Zwei Jahre erst war sie tot. Sie war ein feines Geschöpf gewesen, klug und wenig kokett, groß und in ihren Zügen der Saskia von Uhlenburg ähnlich. Sie war stets die Sklavin ihres Gatten gewesen. Bis ins Unbedeutendste ging dieser sklavische Zug an ihr, dies gänzliche und für Andere oft so unbegreifliche Aufgelöstsein im Wesen des Mannes.
Mely rührte sich nicht. Ihre Lippen waren nicht geschlossen, und sie hielt den Atem an. Und dann lächelte sie so, als sei sie mit allem einverstanden, was man mit ihr treibe. Eine große Müdigkeit kam über sie, und sie hegte den Wunsch zu schlafen. Aber Bild auf Bild stieg herauf: sie lebte wieder in ihrer Vergangenheit. Sie sah sich als Kind zur Volksschule gehen; sie sah beide Eltern auf dem Totenbette liegen, und sie sah den alten, gütigen Herrn, den Vater des Obersts, der ihr gerichtlicher Vormund geworden war. Dann blickte sie in die hellen, kahlen Klostergänge hinein, in denen sie zum erstenmal mit entsetzten Augen gestanden. Wie fremd und feierlich war dort die Welt! Sie hatte geglaubt, die Mauern seien endlos und hinter ihnen begänne das Meer. Sie hatte sich gefangen, bestraft gefühlt inmitten der gleichgekleideten Mädchen, unter der strengen Obhut der Schwestern. Ihre Sehnsucht nach der Stadt war groß; die Sandhaufen am Bahndamm erschienen in ihren Träumen, und die elterlichen Püffe und Prügel kamen ihr vor wie süße Späße. Sie mußte merkwürdig schwierige Dinge auswendig lernen und vor jedem, der sie ansprach, ängstigte sie sich. Sie fürchtete alle Menschen mit Ausnahme des Katecheten Kilian, den sie mit der Fülle ihres zwölfjährigen Herzens liebte. Er war ein schöner, blühender Jüngling, der niemals seitwärts blickte, auch nicht zu Boden, sondern stets gegen Himmel. In dieser Zeit wurde sie sehr fromm und sehr folgsam und wurde den Andern als gutes Beispiel gepriesen. Doch unverständlich war ihr nur das eine, daß sie für alle Menschen, die sie kannte, mitbeten sollte. Das konnte sie nie fassen. Wie sorgsam und gewissenhaft hatte sie stets ihre Sünden notiert, um bei der Beichte ja nichts zu vergessen: ich habe der Schwester Cäcilia in Gedanken unrecht getan; ich war zu träg, um die salischen Kaiser zu lernen; ich habe mich beim Aufwecken schlafend gestellt, um noch länger im Bett bleiben zu können – –
Wie lange war das schon her! Wie schnell waren die Jahre hingegangen! Allmählich hatte sie die Welt draußen vergessen, und sie begriff nicht mehr, daß es außerhalb des Klosters noch etwas von Wichtigkeit und Bestand geben könne. Weltlich und sündhaft waren ihr jene Mädchen erschienen, die, lustig und guter Dinge, das Leben sonnig fanden und von ihren Eltern in der Stadt erzählten, von Kaffeekränzchen, Musik und Tanz.
Eines Umstands erinnerte sie sich mit Entsetzen und stets suchte sie ihre Gedanken daran zu verscheuchen, nur um sich das Nachfühlen jenes Schreckens zu ersparen. An einem Osterfest, kurz nach ihrem fünfzehnten Geburtstag, ging mit ihrem Körper etwas Neues, Unbegreifliches vor. Sie stand vor einem Rätsel, das sie tief erschütterte. Noch sah sie sich mit zitterndem Leib an den Fensterposten gelehnt und in den verregneten Frühlingsmorgen hinausschauen. Sie wünschte aufs innigste, zu sterben, sie glaubte gesündigt zu haben und wußte nicht, worin diese Sünde bestand. Sie sah das Leben als etwas Finsteres und Gewalttätiges vor sich stehen und fürchtete sich. Stundenlang in der Nacht lag sie weinend auf ihren Kissen, und die Qual der Verheimlichung erdrückte sie. Sie schämte sich vor allen, sie versteckte sorgfältig die benutzte Wäsche, und kein Mensch fand sich, der das Dunkel ihrer kindlichen Phantasien gelichtet hätte. Einst, als ihre Seele durch das erneute Auftreten des Ungewohnten in Schrecken versetzt war, ging sie, unwissend wie sie war, ins Bad. Darauf kam die furchtbare Krankheit, deren Folgen sie niemals verwunden hatte. Eine unsichere Empfindung des Grolls und des Hasses beherrschte sie jetzt, wenn sie daran dachte, wieviel Schmerz ihr hätte erspart werden können durch die verständige Offenheit einer Lehrerin oder einer Freundin.
Aber nie hatte sie eine Freundin besessen. Von Allen war sie abseits stehen gelassen worden. Etwas, das sie unaufhörlich bedrückte, etwas Hoffnungsloses stand über ihrem Leben.
Sie überlegte, was sie tun könnte, um sich frei und unabhängig zu machen. Und doch, welche Angst empfand sie vor dieser Freiheit. Sie sah dabei immer das Bild eines einzelnen Baumes auf einer endlosen Heide, und dieses Bild der Hilflosigkeit machte sie schwach. Wenn ich doch nur einen Bruder hätte, dachte sie, der mich vor Beleidigungen wie der heutigen schützen könnte. Dann dachte sie an ihre Schwester, die sich hatte verführen lassen und die sich nun mit einem Kind elend durch die Welt schleppte. Niemand durfte wissen, daß sie eine Schwester hatte und wer das sei. Das hatte sie dem Oberst geschworen, und er hatte ihr unter dieser Bedingung erlaubt, das Mädchen zu unterstützen. »Aber sei vorsichtig dabei; denn die Gesellschaft, in der du verkehrst, und zu der ich dich emporgehoben habe, ist schlau und argwöhnisch.«
Sie zerknüllte ihren Handschuh in der Faust. Entschlossen stand sie auf, und bald darauf ging sie mit hastigen Schritten dem Hause des Oberst Thewalt zu. Ihre Augen blitzten vor Kampflust.
IV.
Es war Nacht, als sie die Wohnung des Obersts verließ. Sie mußte gegen den Wind ankämpfen, der ihren Schleier aufblies. Fest schloß sie den Mund, und mit weit vorgebeugtem Kopf ging sie. Sie hatte die Begleitung des Obersts ausgeschlagen. »Nie mehr werde ich dies Haus betreten, nie mehr«, flüsterte sie verzweifelt, »ich Elende, ich Elende.«
Ganz belanglose Dinge fuhren ihr durch den Kopf. Es wäre schön, dachte sie, wenn ich jetzt mitten durch den Wind reiten könnte auf einem wilden Gaul, wie neulich draußen am See.
In der Pension saß man beim Tee. Fräulein von Erdmann, ein polnischer Adliger, Doktor Brosam, Frau Bender und Helene waren da. Die Herren erhoben sich, als Mely eintrat. Sie atmete noch heftig vom Treppensteigen und preßte eine Hand auf die Brust. Zerstreut nickte sie, wobei sie keinen der Anwesenden ansah, und die Zähne schauten unter den schwellenden Lippen hervor, ohne daß sie jedoch lächelte.
»Nehmen Sie vielleicht noch eine Tasse Tee, Fräulein Mirbeth?«, fragte Frau Bender, und ihre großen, blauen Augen leuchteten dabei. Sie lachte fröhlich, als Mely bejahte und zeigte ihre prachtvollen Zähne.
Es entstand eine peinliche Pause, so daß Mely den Argwohn faßte, man habe sich über sie unterhalten. Darüber erschrak sie; denn nichts fürchtete sie so sehr, als das, was man hinter ihrem Rücken über sie sprach.
»Nein, welcher Sturm heute!«, sagte sie endlich zögernd. Sie fing den spöttischen Blick auf, den die Erdmann mit dem Doktor wechselte, und ihr Argwohn wurde bestärkt. Wie sie in den Doktor verliebt ist, die alte Schachtel, dachte sie. Wie sie sich herausgeputzt hat über ihrem Schmutz. Sie lächelte Helene verständnisinnig zu, die, als begriffe sie nicht, mit einem kaum sichtbaren, verwunderten Kopfschütteln antwortete.
»Das ist noch gar nichts, – der Wind genügt nicht«, erwiderte der Doktor, behaglich schlürfend. »Um die ungesunde Sumpfluft unserer Zustände zu vernichten, müßte ein ganz anderer Sturm gehen.«
»Sie Sozialist!«, seufzte Fräulein von Erdmann heiß und näherte ihre Hand dem Arm des Doktors.
»Sie habben abber garr keine Kälte hier«, sagte der Pole wichtig. »In Rußland – ooh! Was für Kälte, was für Kälte! Werde ick Ihnen eine Geschichte erzählen. Vorikes Jahr fahrt ein Pfarrer russischer in ein village Umgegend von Kiew. War serr kalt. Schnee so hoch und Wind eisiker. Und wie Abbend kommt, laufen, – wie sakt man: loup, des loups? –«
»Wölfe –«