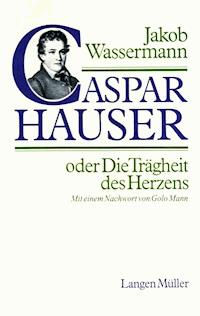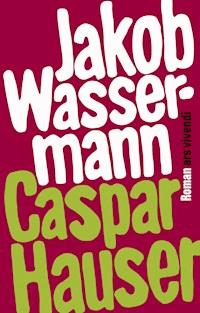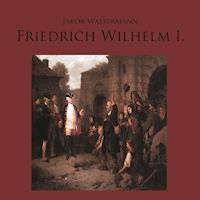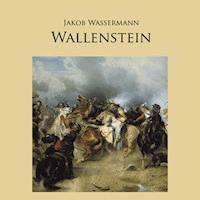Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman spielt 1849 bis 1909 in Nordbayern - vor allem in Nürnberg und in Franken. Die Werke des Komponisten Daniel Nothafft stoßen besonders bei den merkantilen Nürnbergern auf Unverständnis und Ablehnung. Als Daniel heiratet, merkt er, Lenore, die Schwester der Braut Gertrud, ist die Richtige. Einige Nürnberger Bürger, die dem Bettelmusikanten Daniel übel wollen, vermuten eine Dreiecksbeziehung und assoziieren diese höhnisch mit dem bronzenen Gänsemännchen. Das stellt einen Bauern dar, der auf dem Nürnberger Obstmarkt steht und zwei Gänse unter den Armen trägt. (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 803
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Gänsemännchen
Jakob Wassermann
Inhalt:
Jakob Wassermann – Biografie und Bibliografie
Das Gänsemännchen
Erster Teil
Die Mutter sucht ihren Sohn
Feinde, Brüder, Freund und Maske
Der Nero unserer Zeit
Inspektor Jordan und seine Kinder
Stimmen von außen und Stimmen von innen
Erinnerung an eine Traumgestalt
Zweiter Teil
Daniel und Gertrud
Die gläserne Kugel zerbricht
Tres faciunt collegium
Philippine zündet ein Feuer an
Lenore
Dritter Teil
Das Zimmer mit den verwelkten Blumen
Prometheische Symphonie
Dorothea
Der Teufel fährt in Flammen aus dem Haus
Aber abseits, wer ists?
Das Gänsemännchen, Jakob Wassermann
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849619374
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Jakob Wassermann – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 10. März 1873 in Fürth, gestorben am 01.01.1934 in Altaussee/Steiermark. Wassermann machte nach Absolvierung der Realschule notreiche Wanderjahre durch und lebte lange in Wien, dem Kreise Schnitzlers und Hofmannsthals nahe stehend. Er schrieb die Romane: »Melusine« (Münch. 1896), »Die Juden von Zirndorf« (das. 1897, neubearbeitete Ausg. 1906), »Die Geschichte der jungen Renate Fuchs« (Berl. 1900, 9. Aufl. 1906), »Der Moloch« (das. 1902), »Alexander in Babylon« (das. 1904) und »Caspar Hauser« (Stuttg. 1908); ferner die Novellen: »Schläfst du, Mutter?« (Münch. 1897), »Die Schaffnerin« u. a. (das. 1897). »Der niegeküßte Mund. Hilperich« (das. 1903), »Die Schwestern« (Berl. 1906) und die theoretische Schrift »Die Kunst der Erzählung« (das. 1904). Weitere Werke sind z.B. "Caspar Hauser oder die Trägheit des Herzens" (Roman, 1908), "Das Gänsemännchen" (Roman, 1915), "Christian Wahnschaffe" (Roman, 1919), "Laudin und die Seinen" (Roman, 1925) und "Der Fall Maurizius" (Roman, 1928). W. zeichnet sich durch moderne Auffassung und scharfe Beobachtung des Lebens aus.
Wichtigste Werke:
Melusine(Roman, 1896)Die Juden von Zirndorf(Roman, 1897)Schläfst du, Mutter?(Novelle, 1897)Die Geschichte der jungen Renate Fuchs(Roman, 1900)Der Moloch(Roman, 1902)Der niegeküßte Mund(Erzählungen, 1903)Die Kunst der Erzählung(Abhandlung, 1904)Alexander in Babylon(Roman, 1905)Donna Johanna von Castilien(Erzählung, 1906)Caspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens(Roman, 1908)Die Gefangenen auf der Plassenburg(Erzählung, Erstausgabe 1909)Der goldene Spiegel(Novellenband, 1911)Geronimo de Aguilar(Erzählung, 1911)Faustina(1912)Der Mann von vierzig Jahren(Roman, 1913)Das Gänsemännchen(Roman, 1915)Christian Wahnschaffe(Roman, 1919)Die Prinzessin Girnara, Weltspiel und Legende (Schauspiel, 1919)Mein Weg als Deutscher und Jude(Autobiographie, 1921,)Imaginäre Brücken(Studien und Aufsätze, 1921)Sturreganz(Erzählung, 1922)Ulrike Woytich(Roman, 1923)Faber, oder die verlorenen Jahre(Roman, 1924)Laudin und die Seinen(Roman, 1925)Der Aufruhr um den Junker Ernst(Novelle, 1926)Das Gold von Caxamalca(Erzählung, 1928)Christoph Columbus, eine Biographie (1929)Selbstbetrachtungen.1931Engelhart RatgeberDer Fall Maurizius(1928)Etzel Andergast(1931)Joseph Kerkhovens dritte Existenz(1934)Das Gänsemännchen
Erster Teil
Die Mutter sucht ihren Sohn
1
Die Landschaft hat vielfaches Grün; vom Rednitztal bis zum Taubertal hinüber ziehen sich tiefe Wälder, meist Nadelholz. Doch um die Dörfer ist in weitem Bogen alles bebaut, denn es ist uralter Kulturboden. An den zahlreichen Weihern steht das Gras höher, so hoch oft, daß man von den Gänseherden nur die Schnäbel gewahrt, und wäre das Geschnatter nicht, man könnte sie für wunderlich bewegte Blumen halten, diese Schnäbel.
Das Städtchen Eschenbach liegt ganz flach in der Ebene. Es ist ein übriggebliebenes Stück Mittelalter, aber die Fremden kennen es nicht, es ist stundenweit von jeder Bahnlinie entfernt. Ansbach ist die nächste Stadt im großen Ring des Verkehrs; um sie zu erreichen, bedient man sich der Postkutsche. So heute wie damals, als Gottfried Nothafft, der Weber, dort lebte.
Die Stadtmauern sind mit Moos und Efeu bewachsen; über den Graben führen noch die alten Zugbrücken durch baufällige runde Tore in die Straßen. Die Häuser haben Erker und weitvorspringende Firste, und ihr gekreuztes Balkenwerk sieht aus wie Muskelgeflecht.
Von dem Dichter, der einst hier geboren wurde und der das Lied vom Parzival sang, wissen die Leute nichts mehr. Vielleicht raunen in der Nacht die Brunnen von ihm, vielleicht wandelt sein Schatten manchmal im Mondschein um Kirche und Rathaus. Die Menschen wissen nichts mehr von ihm.
Das kleine Häuschen des Webers stand unweit vom Gasthaus zum Ochsen, ein wenig abgerückt von der Straße. Drei vertretene Stufen führten zum Tor, und sechs Fenster blickten auf den stillen Platz. Wer hätte denken sollen, daß der Geist der großen Industriewelt sich bis zu diesem verlorenen Winkel zerstörerisch eine Bahn schaffen würde!
Als Gottfried Nothafft im Jahre 1849 geheiratet hatte, seine Frau Marianne war eine von zwei Schwestern Höllriegel aus Nürnberg, hatte er sich noch auskömmlich zu ernähren vermocht. Sie wünschten sich beide ein Kind und jahrelang vergebens. Oft sagte Gottfried am Feierabend, wenn er auf der Bank vor dem Haus die Pfeife rauchte: »Wie schön, wenn wir einen Sohn hätten.« Da schwieg Marianne und senkte die Augen.
Später sagte er nichts mehr, weil er die Frau nicht beschämen wollte. Aber seine Miene verriet den Wunsch nur um so deutlicher.
2
Eines Tages machte sich ein Stocken des Gewerbes bemerkbar. Die Weber im ganzen Lande klagten; sie konnten nicht mehr mitkommen, es war eine lähmende Krankheit, von der sie betroffen wurden. Der Markt hatte plötzlich niedrigere Preise, die Beschaffenheit der Ware hatte sich verändert.
Dies geschah gegen das Ende der fünfziger Jahre, als von Amerika aus die neuen Maschinenwebstühle eingeführt wurden. Da fruchtete kein Fleiß mehr, das billige Produkt, das die Maschine zu liefern vermochte, raubte der Handarbeit den Absatz.
Gottfried Nothafft ließ sich's zuerst nicht verdrießen; so läuft ein Rad noch, wenn der Antrieb gehemmt wird. Aber nach und nach verging ihm die Lust. In einem einzigen Winter wurde sein Haar grau, und mit fünfundvierzig Jahren war er ein gebrochener Mann.
Und da, als die Armut drohend vor der Türe stand und Mariannes Gemüt durch Haß befleckt war, erfüllte sich die Sehnsucht des Ehepaares, und die Frau wurde, im zehnten Jahr der Ehe, schwanger.
Der Haß, den sie hegte, galt der Maschine. In ihren Träumen wurde die Maschine zu einem Ungeheuer mit stählernen Schenkeln, das tückisch kreischend Menschenherzen verschlang. Es erbitterte sie die Ungerechtigkeit eines Vorgangs, bei dem in frecher Mühelosigkeit gedieh, was ehedem unter den bedächtigen Fingern des Webers sinnvoll und natürlich erstanden war.
Die Gesellen mußten einer nach dem andern entlassen werden, und ein Webstuhl nach dem andern kam auf den Dachboden. Tag für Tag schlich Marianne hinauf und kauerte stundenlang vor den Geräten, die einst eine wohltätig bestimmbare Kraft in Bewegung gesetzt hatte und die jetzt Leichnamen glichen.
Gottfried ging mit seinen Lagervorräten hausierend über Land. Einmal kehrte er zurück und brachte ein Stück Maschinengewebe mit, das ihm ein Kaufmann in Nördlingen geschenkt hatte. »Sieh doch, Marianne, was das für ein Ding ist,« sagte er und reichte ihr den Stoff. Aber Marianne zog schaudernd die Hand davon weg, als hätte sie den Raub eines Mörders erblickt.
Nach der Geburt des Knaben verloren sich die krankhaften Empfindungen, dafür verfiel Gottfried von Monat zu Monat mehr. Und wenn er auch die Jahre überstand, er hatte aufgehört, ein heiterer Mensch zu sein, und freute sich nicht einmal des heranwachsenden Knaben. Als er seine eigenen Waren verkauft hatte, übernahm er fremde und schleppte sich mühsam von Dorf zu Dorf, Sommer und Winter hindurch.
Trotz der Knappheit, die im Hause herrschte, war Marianne überzeugt, daß Gottfried erspartes Geld zurückgelegt habe, und gewisse Andeutungen des Mannes hatten diese Hoffnung befestigt. Es gehörte zu seinen eigentümlichen Lebensansichten, die Frau über den wahren Stand seines Vermögens im unklaren zu lassen. Als die Läufte immer schlechter wurden, schwieg er über diesen Punkt völlig.
3
Auf dem Kornmarkt in Nürnberg betrieb Jason Philipp Schimmelweis, der Mann von Mariannes Schwester, eine Buchbinderei.
Schimmelweis war ein Westfale. Er war aus Haß gegen Junker und Pfaffen in die protestantische Stadt im Süden gekommen und hatte von Anfang an allen Leuten durch seine Mundfertigkeit große Achtung abgenötigt. In dem Haus, wo er sein Geschäft errichtet, hatte auch Therese Höllriegel gewohnt und sich durch Schneidern ihr Brot verdient. Er hatte geglaubt, sie besitze einiges Geld, aber es hatte sich erwiesen, daß es für seinen Ehrgeiz zu wenig war. Da benahm er sich gegen Therese so, als ob sie ihn betrogen hätte.
Er verachtete sein Handwerk und wollte höher hinaus. Er fühlte den Beruf zum Buchhändler in sich. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, mangelte es ihm an Kapital. So hockte er denn mißvergnügt in dem unterirdischen Gewölbe und leimte und salzte und zürnte seinem Geschick und las in seinen Mußestunden sozialistische und freigeistige Schriften.
Es war der Herbst, in dem der Krieg gegen Frankreich wütete. Am Vormittag war die Kunde von der Schlacht bei Sedan eingetroffen. Von allen Kirchen läuteten die Glocken.
Da trat zu Jason Philipps Verwunderung Gottfried Nothafft in die Werkstatt. Sein langer Patriarchenbart und die hohe Gestalt machten ihn zu einer ehrwürdigen Erscheinung, obwohl sein Gesicht müde aussah und die Augen erloschen waren.
»Grüß Gott, Schwager,« sagte er und bot die Hand, »dem Vaterland geht's besser als seinen Bürgern.«
Schimmelweis, der Verwandtenbesuche nicht liebte, erwiderte den Gruß mit vorsichtiger Kälte. Erst als er erfuhr, daß Gottfried im »roten Hahn« Logis genommen, hellten sich seine Züge auf. Er fragte, was den Schwager in die Stadt geführt.
»Ich habe mit dir zu sprechen,« antwortete Gottfried Nothafft.
Sie gingen in einen Raum hinter der Werkstatt und setzten sich nieder. In Jason Philipps Augen lag ein abschlägiger Bescheid schon jetzt für jedes Ansinnen, das ihn Mühe oder Geld kosten würde. Aber er fand sich angenehm enttäuscht.
»Du sollst wissen, Schwager,« begann Gottfried Nothafft, »daß ich mir in den neunzehn Jahren, die ich mit meinem Weib zusammengelebt, dreitausend Taler erspart habe. Und weil mir zumut ist, als könnte mir bald was Menschliches zustoßen, komm ich zu dir mit der Bitte, das Geld in Verwahrung zu nehmen für Marianne und den Buben. Hab Sorge genug gehabt, es beiseite zu halten in der letzten schlimmen Zeit. Marianne weiß nichts davon und soll nichts davon erfahren. Sie ist ein schwaches Weib, die Weiber verstehen nichts vom Gelde und was für eine Würde es hat, wenn es mit so saurem Schweiß erworben ist. In einer Stunde der Not greift sie danach, und eh sie sich besinnt, ist's weg. Ich will aber meinem Daniel den Eintritt ins Leben erleichtern, wenn er die Lern- und Lehrjahre hinter sich hat. Er ist jetzt zwölf, also noch einmal zwölf, so Gott will, und er ist ein Mann. Marianne kannst du mit den Zinsen aushelfen, und ich verlange nichts anderes von dir, als daß du schweigst und an dem Jungen väterlich handelst, wenn ich nicht mehr bin.«
Jason Philipp Schimmelweis erhob sich und drückte Gottfried Nothafft gerührt die Hand. »Du kannst dich auf mich verlassen wie auf die Bank von England,« sagte er.
»Das hab ich mir wohl gedacht, Schwager, und darum der Weg.«
Er zählte dreitausend Taler in Reichsscheinen auf den Tisch, und Jason Philipp stellte ihm eine Quittung aus. Dann drängte er in ihn, er möge doch die Nacht über im Hause bleiben, allein Gottfried Nothafft sagte, er müsse wieder heim zu Weib und Kind und habe von der verflossenen Nacht genug, die er in der lärmenden Stadt zugebracht.
Als sie in die Werkstatt zurückkehrten, saß Therese dort und hielt ihr Erstgebornes, die dreijährige Philippine, auf dem Schoß. Das Mädchen hatte einen großen Kopf und häßliche Züge. Gottfried vergönnte sich kaum Zeit, der Schwägerin Rede zu stehen. Später erkundigte sich Therese bei ihrem Mann, was Nothafft gewollt habe. Kurzangebunden versetzte Jason Philipp: »Mannsgeschäfte.«
Drei Tage darauf schickte Gottfried die Quittung wieder; auf ihre Rückseite hatte er geschrieben: »Was soll mir der Wisch, er könnt mich nur verraten. Ich habe Wort und Handschlag von dir, selbes genügt. Mit Dank für deinen Freundschaftsdienst dein treugeneigter Gottfried Nothafft.«
4
Eh noch der Friede geschlossen wurde, legte sich Gottfried zum Sterben hin. Er wurde in dem kleinen Kirchhof an der Mauer begraben, und ein Kreuz wurde aufgerichtet.
Jason Philipp und Therese waren zur Beerdigung gekommen und blieben drei Tage bei Marianne wohnen. Die Hinterlassenschaftsprüfung ergab zu Mariannes Schrecken, daß keine zwanzig Taler im Hause waren, und was sie vor sich sah, war ein Leben der Not und des Kummers. Da waren Jason Philipps Ratschläge und Anordnungen ein rechter Trost, und seine Erklärung, daß er ihr nach Kräften beistehen wolle, beruhigte ihr Herz.
Es wurde beschlossen, daß sie einen Kramladen einrichten solle, und Jason Philipp schoß hundert Taler vor. Es hatte den Anschein, als sei Jason Philipp ein gemachter Mann. Er trug den Kopf hoch, und seine runden Bäckchen zeugten von Wohlgenährtheit. Er trommelte gern an die Fensterscheiben und pfiff dabei. Es war die Marseillaise, die er pfiff, aber in Eschenbach wußte man das nicht.
Daniel blickte aufmerksam auf seine Lippen und pfiff die Weise nach. Da lachte Jason Philipp, daß sein Bäuchlein erbebte, dann sagte er, sich der Trauerstimmung erinnernd: »So ein Bengel.«
Der Knabe mißfiel ihm jedoch. »Der selige Gottfried scheint sich zu wenig um ihn gekümmert zu haben,« sagte er, als er einmal Zeuge einer Widerspenstigkeit Daniels war, »der Bursch braucht eine starke Hand.«
Daniel hörte diese Worte und sah dem Onkel höhnisch ins Gesicht.
Am Sonntag nach der Vesper nahm das Ehepaar Schimmelweis Abschied, und Daniel war nicht da. Die Frau des Ochsenwirts rief herüber, sie habe ihn mit dem Organisten in die Kirche gehen sehen. Marianne lief zur Kirche, um ihn zu holen. Nach einer Weile kam sie zurück und sagte zu dem wartenden Jason Philipp: »Er sitzt bei der Orgel und ist nicht wegzubringen.«
»Er ist nicht wegzubringen?« fuhr Jason Philipp auf, und seine runden Bäckchen glühten vor Zorn, »was heißt denn das? Das läßt du dir gefallen?« Und er ging selbst in die Kirche, um den Ungehorsamen zur Stelle zu schaffen.
Als er in den Chor hinaufstieg, begegnete ihm der Organist und lachte. »Sie suchen wohl den Daniel?« fragte er; »der stiert noch immer die Orgel an und ist wie verzaubert von dem bißchen Spiel.«
»Will ihm den Zauber schon austreiben,« knurrte Jason Philipp.
Daniel kauerte hinter der Orgel auf dem Boden und blieb beim Anruf seines Onkels unbeweglich. Er war so versunken, daß seine Augen einen Ausdruck hatten, der Jason Philipp auf den Gedanken brachte, der Knabe sei vielleicht nicht recht bei Verstand. Er packte Daniel bei der Schulter und herrschte ihn an: »Komm mal sofort mit mir nach Hause.«
Die Augen aufschlagend und erwachend und das entrüstete Fauchen der fremden Stimme vernehmend, riß sich Daniel los und erklärte frech, bleiben zu wollen, wo er war. Jason Philipp geriet in Wut und suchte sich des Knaben neuerdings zu bemächtigen, um ihn mit Gewalt hinunterzuschleppen. Da sprang Daniel zurück und rief mit zitternden Lippen: »Rühr mich nicht an!«
Ob es nun die Stille des Kirchenraums war, die mahnend und erschreckend auf Jason Philipp wirkte, oder ob die außerordentliche Bosheit und Leidenschaft in den Zügen des Knirpses ihn veranlaßten, von seinem Vorhaben abzustehen, genug, er drehte sich um und ging wortlos davon.
»Es ist höchste Zeit, die Post wartet schon,« rief ihm seine Frau entgegen.
»Ein hübsches Früchtchen ziehst du dir auf,« sagte er mit finsterem Gesicht zu Marianne; »an dem wirst du noch was erleben.«
Marianne blickte zu Boden. Die Worte trafen sie vorbereitet. Die Wildheit und Verstocktheit des Knaben, das selbstsüchtige Beharren auf seinen Einbildungen, seine Härte, seine Ungeduld und die Verachtung jeder Regel, dies alles ängstigte sie sehr. Es wollte ihr scheinen, als ob das Schicksal etwas von dem törichten und quälenden Haß, den sie während der Schwangerschaft genährt, in das Gemüt des Kindes habe fließen lassen.
5
Jason Philipp Schimmelweis verließ das düstere Kellerloch am Kornmarkt, mietete einen Laden an der Museumsbrücke und eröffnete eine Buchhandlung. Das Ziel jahrelanger Wünsche war erreicht.
Es wurde ein Gehilfe aufgenommen, und Therese saß den Tag über an der Ladenkasse und lernte Geschäftsbücher zu führen.
Als sie ihren Mann gefragt hatte, woher er das Betriebskapital genommen, hatte er erwidert, ein Freund, der zu seiner Tüchtigkeit Vertrauen geschöpft, habe es ihm gegen mäßige Verzinsung geliehen. Den Namen des Freundes zu verschweigen, sei ihm zur Pflicht gemacht worden.
Therese glaubte ihm nicht. Ihr Geist war voll dunkler Befürchtungen. Sie grübelte unablässig und wurde wachsam und mißtrauisch. Sie forschte insgeheim nach dem namenlosen Helfer und fand keine Spur von ihm. Wenn sie hin und wieder Jason Philipp zur Rede stellte, schnauzte er sie böse an. Von einer Zurückerstattung des Geldes und von Zinsenzahlung wurde nicht gesprochen, auch wiesen die Geschäftsbücher keine Eintragung der Art auf. Sie hätte an Wichtelmännchen glauben müssen, um sich ihrer die Jahre überdauernden Besorgnisse entschlagen zu können. Aber sie glaubte nicht an Wichtelmännchen.
Die Natur hatte sie weder mit Fröhlichkeit noch mit Sanftmut begabt; unter dem Druck des unlösbaren Rätsels wurde sie eine verdrossene Gattin und eine launenhafte Mutter.
Wenn Ruhe im Laden war, nahm sie bald dies, bald jenes Buch zur Hand und las. Einen Mörderroman etwa; oder einen schwatzhaften Traktat über geheime Laster. Womit sollte ein Publikum angelockt werden, dem das Bücherkaufen als eine sündhafte Verschwendung galt? Sie las ohne sonderliche Lust, nur mit einer mürrischen Art von Wißbegierde Enthüllungen über das Leben an Fürstenhöfen und gedruckte Verrätereien aller möglichen Spione, Abenteurer und Halunken. Unbewußt gewöhnte sie sich daran, die Welt, in die ihr Blick nicht gelangen konnte, nach Büchern zu beurteilen, in denen sich die Ausgeburten verpesteter Gehirne Wahrheit anmaßten.
Aber als sich mit den Jahren der Wohlstand im Bürgertum hob, verließ Jason Philipp Schimmelweis die lichtscheue Sphäre seines Gewerbes. Er war ein Mann, der die Zeit verstand, und er hißte die Segel, wenn er sicher war, daß günstiger Wind sie schwellen würde. Er vertraute sein Boot der immer mächtiger werdenden Strömung der proletarischen Parteien an und hoffte dort Profit zu machen, wo halb und halb sein Herz war. Er zeigte dem Bürger die Rebellenstirn und bot dem Arbeiter die biedere Rechte. Man mußte nur einen Weg nach oben finden. Mancher unbedeutende Krämer konnte jetzt seine muffigen Stuben mit einer Villa in der Vorstadt vertauschen, die er mit pomphaften Möbeln ausstattete, und seine Söhne ins Ausland schicken.
Da erwachte auch die alte Reichsstadt aus ihrem romantischen Schlummer. Hatten die erhabenen Kirchen, die schöngeschwungenen Brücken und verwinkelten Häuser ehedem ein sinnreich Lebendiges gebildet, so waren sie jetzt nur noch Überbleibsel, und Burg und Wälle und die gewaltigen Rundtürme wurden zu Ruinen einer glücklich überstandenen Zeit der Träume. Schienen wurden durch die Straßen gelegt und verrostete Ketten, an denen unförmliche Laternen aufgehängt waren, vom Eingang enger Gäßchen entfernt. Fabriken und Schlöte umgaben das ehrwürdige und pittoreske Weichbild wie ein eiserner Nahmen das Gemälde eines alten Meisters.
»Der moderne Mensch muß Luft und Licht haben,« sagte Jason Philipp Schimmelweis und klimperte mit dem Geld in seiner Hosentasche.
6
Daniel besuchte das Gymnasium in Ansbach. Er sollte nur die Berechtigung zum einjährigen Heeresdienst erwerben und dann in eine kaufmännische Stellung eintreten. So hatte es Jason Philipp mit Marianne ausgemacht.
Er zeigte nur geringen Eifer. Die Lehrer schüttelten die Köpfe über ihn. Ein so beschaffenes Wesen hatten sie trotz ansehnlicher Welterfahrung noch nicht kennen gelernt. Das Brüllen einer Kuhherde und der Lärm des Spatzenvolks fanden ihn williger lauschend als die bewährtesten Leitsätze der Grammatik. Viele hielten ihn für dumm, einige andere für tückisch. Seinen Weg durch die Klassen machte er, obgleich mit Not, durch eine wunderbare Fähigkeit des Erratens und in besonders kritischen Momenten durch die Hilfe und den Fürspruch des Kantors Spindler.
Die Familien, bei denen er die Wohltat des Freitisches genoß, beklagten sich über seine schlechten Manieren. Die Gerichtsrätin Hahn hatte ihm wegen einer flegelhaften Antwort das Haus verboten. »Habenichtse müssen demütig sein,« rief sie ihm zu.
Kantor Spindler war. ein Mann, der mit Fug von sich behauptete, daß er zu Größerem bestimmt gewesen, als in einer Kreisstadt zu versauern; seine weißen Locken umrahmten ein Gesicht, welches durch die Melancholie um den Untergang von Idealen und Illusionen geadelt wurde.
An einem Sommermorgen hatte er sich mit der frühen Sonne erhoben und war über Land gegangen. Wie er nun beim Dorf Dautenwinden an die erste Scheune kam, sah er eine Musikantengesellschaft, die am Abend vorher und bis in die Nacht zum Tanz aufgespielt hatte und nun, aus dem Heu sich erhebend, die Fasern von Kleidern und Haaren strich. Und droben, unter dem offenen Giebel der Scheune, lag Daniel Nothafft im Stroh und versuchte der Flöte, um die er einen der Musikanten gebeten hatte, mit vertiefter und hingegebener Miene eine Melodie abzulocken.
Der Kantor blieb stehen und schaute hinauf. Die Musikanten lachten, aber er nahm an ihrer Heiterkeit keinen Teil. Es dauerte lange, bis der ungeschickte Flötenbläser ihn gewahrte, dann kletterte er herunter und wollte sich mit einem scheuen Gruß davonstehlen. Der Kantor trat ihm in den Weg. Sie gingen zusammen, und Daniel erzählte, daß er sich seit dem gestrigen Nachmittag von den Musikanten nicht habe trennen können. Der Vierzehnjährige vermochte es nicht auszudrücken, aber es war, als habe ihn eine höhere Macht gezwungen, dieselbe Luft mit Menschen zu atmen, die Musik machten.
Von dem Tag an, drei Jahre lang, kam Daniel in jeder Woche zweimal zum Kantor, der ihn aufs gründlichste in der Lehre von Kontrapunkt und Harmonik unterrichtete. Diese Stunden hatten Beflügelung und Weihe. Der Kantor fand ein eigenes Glück darin, eine Neigung zu nähren, deren Entfaltung ihm wie Lohn für viele Jahre echoloser Einsamkeit erschien. Die verzweifelte Leidenschaft, das Aufbäumen und dumpfwilde Rasen, die ihm sowohl aus dem Wesen wie auch aus den ersten Kompositionsversuchen seines jungen Schülers entgegenschlugen, gaben sie ihm gleich Anlaß zur Sorge, wollte er immer wieder durch den Hinweis auf die hochruhenden Muster und Meister der Kunst beschwichtigen.
Und so kam die Zeit, wo Daniel sein Brot verdienen sollte.
7
Da fuhr der Kantor nach Eschenbach, um mit Marianne Nothafft zu reden.
Marianne begriff ihn nicht. Beinahe hätte sie gelacht.
Sie hatte bisher unter Musik nichts anderes verstanden als das Gedudel eines Leierkastens, den Gesang des Turnvereins oder den Marsch einer Militärkapelle. Wollte er herumziehen und vor den Haustüren fiedeln? Er war ein Verrückter in ihren Augen. Sie preßte die Hände gegeneinander und hörte dem Kantor zu wie einem Menschen, der nichtige Worte an ein großes Unglück verschwendet. Der Kantor sah, daß seine Macht so klein war wie seine Welt und mußte unverrichteter Dinge wieder gehen.
Marianne schrieb an Jason Philipp Schimmelweis.
Man sah es fast, wie Jason Philipp den rotbraunen Vollbart mit beweglichen Fingern durchpflügte und spöttisch mit den Augen zwinkerte; man hörte die ganze Schärfe seiner norddeutschen Zunge, als er an Daniel schrieb: »Hab nichts anderes von dir erwartet, als daß es dein innigster Wunsch ist, ein Tagdieb zu werden. Mein lieber Junge! Entweder du parierst und entschließest dich, ein anständiges Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu werden, oder ich ziehe meine Hand von euch ab. Was dann das Los deiner Mutter sein wird, male dir gefälligst selber aus, denn vom Hering- und Pfefferverkaufen kann sie nicht leben, wenn der Herr Sohn mitschmarotzt.«
Daniel zerriß den Brief in unzählige Teile und ließ sie vom Fenster aus mit dem Wind fortfliegen, indes seine Mutter weinte.
Hierauf ging er in den Wald, irrte bis zum Abend herum und nächtigte in der Höhlung eines Baumes.
8
Es wäre zu erzählen von fortgesetzter Auflehnung, von lieblosen Worten hüben und drüben, von Bitten und Klagen und fruchtlosen Vorstellungen und erbitterter Wechselrede und erbittertem Schweigen.
Und wie er flieht und zurückkehrt und wie träg er die Tage hingehen läßt und wie er durch die Landschaft stürmt und an den Wassertümpeln liegt, wo das Gras hochsteht, und wie er sich des nachts aus dem Schlaf erhebt und die Fenster öffnet und der Ruhe flucht und den Wolken ihre Bewegung neidet.
Und wie die Mutter ihm folgt, wenn er in die Kammer schleicht und das Ohr an die Tür preßt und hineintritt und die Kerze brennen sieht und zu ihm geht, an sein Bett geht und vor seinen glänzenden Augen erschrickt, die sich bei ihrem Nahen verfinstern. Und wie sie voll Erinnerung an ihre ersten Sorgen um ihn, erwartend, daß der Abend und der Anblick ihrer Schwäche ihn willfährig machen wird, noch einmal bittet und fleht. Und wie er sie dann anschaut und gleichsam innerlich zusammenstürzt und zu tun verspricht, was sie fordert.
Wie er dann in Ansbach beim Lederhändler Hamecher auf den Warenballen sitzt, im langen öden Tor, oder auf den Stufen einer Kellertreppe, oder auf dem Speicher und träumt, träumt, träumt. Und wie sich Herrn Hamechers nachsichtige Verwunderung in Befremdung und dann in Entrüstung verwandelt und er dem Unbrauchbaren nach einem halben Jahr den Laufpaß gibt.
Wie dann Jason Philipp noch einmal Gnade für Recht ergehen läßt und einen neuen Schauplatz mit neuen Menschen für pädagogisch ersprießlich hält, schon um Kantor Spindlers verhängnisvollen Einfluß zu mindern. Wie von Bayreuth gesprochen wird und wie niemand Daniels feuriges Erschauern bemerkt, weil ihnen der Name Richard Wagners fremd ist und der Name des dortigen Weinhändlers Maier vertraut. Wie er nach Bayreuth kommt, dem Jerusalem seiner Sehnsucht, und sich zum Scheinfleiß zwingt, um nur bleiben zu dürfen, wo Sonne, Luft und Erde, die Tiere, der Kehricht und die Steine jene Musik aushauchen, von der Kantor Spindler gesagt, daß er sie wohl ahne, aber zu alt sei, um sie zu fassen oder zu lieben.
Und wie er ungeachtet seiner Bemühung, den Nützlichen zu spielen, Notenköpfe unter die Fakturen malt und in verlassenen Gewölben sonderbare Gesänge vor sich hinbrüllt und ein ganzes Faß mit Wein auslaufen läßt, weil auf seinen Knien aufgeschlagen die englischen Suiten liegen.
Und wie er sich ins Festspielhaus zu einer Probe stiehlt, durch einen beflissenen Wächter hinausgewiesen wird und dabei die Bekanntschaft von Andreas Döderlein macht, der Professor an der Musikschule in Nürnberg ist und unermüdlicher Apostel des neuen Heilandes. Und wie Döderlein zu verstehen und zu helfen nicht ungewillt scheint und viel Vergnügen über den urwüchsigen Enthusiasmus und die flammende Hingabe seines Schützlings äußert. Und wie Daniel, berauscht von der allgemeinen und unverbindlichen Verheißung einer Freistelle an der Schule des Professors bei Nacht und Nebel der Stadt den Rücken kehrt und sich aufmacht, um zu Fuß nach Eschenbach zu wandern; vor die Mutter hinstürzt; sich förmlich hinwühlt vor ihr; bettelt; beschwört; fast irre redet; sie zu bewegen sucht, Jason Philipps Sinn zu ändern, ihr zu erklären sucht, daß sein Leben, seine Seligkeit, sein Blut und Herz an diesem einen Einzigen hängt, und wie sie nun hart wird, die ehedem Gütige, steinhart und eiskalt, und nichts versteht, nichts spürt, nichts glaubt, nur das Schreckliche seiner unheilbaren Verstörung, so nennt sie es, empfindet.
Von alledem wäre zu erzählen, aber es sind Ereignisse, so selbstverständlich in ihrer Folge wie daß Funken und Rauch Produkte des Feuers sind; bestimmbar jedenfalls, oft dagewesen und immer wieder in gleicher Weise wirkend.
Es sind althergebrachte Vorurteile von Zigeunerhaftigkeit und Vagabundentum, die in Mariannes Seele nisten, denn all ihre Vorfahren und ihres Mannes Vorfahren haben sich im Handwerk redlich ihr Brot verdient. Sie sieht nicht ein, was durch die Freistelle an Döderleins Anstalt gewonnen sein soll, da Daniel ja nichts besitzt, um sein Leben zu fristen. Er hat beim Kantor Klavierspielen gelernt, will sich auf dem Instrument vervollkommnen und mit dieser Fertigkeit seinen Unterhalt erwerben. Sie schüttelt den Kopf. Er spricht von der Größe der Kunst, von der Beglückung, die ein Künstler geben, der Unsterblichkeit, die er erringen könne, und daß es ihm vielleicht vergönnt sei, etwas zu machen, was nur Einer einmal zu machen imstande sei. Sie hält es für anmaßenden Wahn und lächelt verächtlich. Da wendet er sich in seinem Innern von ihr ab, und sie ist ihm keine Mutter mehr.
Als Jason Philipp Schimmelweis vernahm, was im Werke war, scheute er die umständliche Reise nicht und erschien in Mariannes Laden wie ein Racheengel. Daniel fürchtete ihn nicht mehr, weil er nichts mehr von ihm hoffte. Insgeheim mußte er lachen, als er den kurzen und kurzhalsigen Mann in seinem Grimm sah. Dabei flackerten immer noch listige und spöttische Lichter über Jason Philipps rotwangiges Gesicht, denn er hatte eine zu hohe Meinung von sich, um den nichtswürdigen Schwärmereien eines Neunzehnjährigen mit dem ganzen Gewicht seiner Persönlichkeit entgegenzutreten.
Während er mit funkelnden Äuglein sprach und das rote Zünglein einige widerspenstige Schnurrbarthaare von den beredten Lippen wischte, stand Daniel an den Türpfosten gelehnt, hatte die Arme über der Brust verschränkt und betrachtete bald seine Mutter, die stumm und altgeworden in der Sofaecke saß, bald das Ölporträt seines Vaters, das ihm gegenüber an der Wand hing. Ein Jugendfreund Gottfried Nothaffts, ein Maler, der verschollen war wie seine übrigen Bilder, hatte es verfertigt; es zeigte einen Mann von ernster Haltung und erinnerte an einen der fürstlich aussehenden Zunftmeister des Mittelalters. Da erkannte Daniel den Weg, der ihn durch die Geschlechterreihe dorthin geführt hatte, wo er war.
Und als er nun in Jason Philipps Gesicht schaute, glaubte er die Unruhe des schlechten Gewissens darin wahrzunehmen. Der Mann handelte nicht aus einer Überzeugung, so schien es ihm, der Mann war von vornherein entschlossen, nicht zu wollen. Und ferner schien es ihm, daß nicht bloß der eine Mann und sein zufällig begründeter Zorn, sondern daß eine ganze Welt gegen ihn in Waffen stand und zu seiner Verfolgung verschworen war. Er hatte keine Lust mehr, das Ende von Jason Philipps oratorischer Leistung abzuwarten und verließ die Stube.
Jason Philipp erblaßte. »Täuschen wir uns nicht, Marianne, du hast eine Schlange an deinem Busen genährt,« sagte er.
Daniel stand vor dem Wolframs-Brunnen auf dem Platz und ließ sich vom Purpur der untergehenden Sonne bestrahlen. Ringsum glühten die Steine sowie die gekreuzten Balken in den Häusermauern, und die Mägde, die mit Wassereimern kamen, blickten verwundert in die Lichtfülle des Himmels. In dieser Stunde wurde ihm die Heimat teuer. Als Jason Philipp den Platz betrat, an dessen Ecke die Postkutsche harrte, war er bestrebt, von Daniel nicht gesehen zu werden, und machte hinter ihm einen Bogen. Aber Daniel drehte sich um und heftete seine Augen fest auf den eilig schreitenden und verbissen zur Seite schauenden Mann.
So begibt es sich immer wieder. Und daran, daß der Flüchtling sich wendet und dem Verfolger Schrecken einjagt, ist auch nicht viel Wunderbares.
9
Daniel sah, daß seines Bleibens bei der Mutter nicht war. Er konnte der Mutter nicht auf der Tasche liegen. Sie war arm und vom Gutdünken eines tyrannischen Verwandten abhängig. Den ungestümen Drang niederhaltend, zwang er sich zu kühlem Bedacht und setzte sich einen Plan. Es war notwendig zu arbeiten und so viel zu verdienen, daß er über Jahr und Tag zu Andreas Döderlein gehen und ihn an sein großmütiges Anerbieten mahnen konnte. Er studierte Zeitungsinserate und schrieb Briefe. Eine Druckerei in Mannheim suchte eine Hilfskraft für Korrespondenzen. Da er sich mit dem niedrigen Lohn einverstanden erklärte, forderte man ihn auf, zu kommen. Marianne gab ihm das Reisegeld.
Drei Monate hielt er es dort aus, dann wurde ihm der Plage zu viel. Dann schuftete er sieben Monate lang bei einem Baumeister in Stuttgart, dann vier Monate bei der Kurverwaltung in Baden-Baden, dann sechs Wochen in einer Zigarettenfabrik bei Kaiserslautern.
Er lebte wie ein Hund. Aus Furcht vor Geldausgaben mied er jeglichen Verkehr. Er war grenzenlos einsam. Vor Darben und Hungern wurde er mager wie ein Strick. Die Wangen fielen ihm ein, und die Glieder schlotterten in den Gelenken. Er nähte und flickte seine Kleider selbst, und um die Stiefel zu schonen, nagelte er Hufeisen an die Absätze und breite Stifte in die Sohlen. Das Ziel hielt ihn aufrecht; Andreas Döderlein winkte in der Ferne.
Jeden Abend zählte er die Summe, die er erspart hatte. Und als er endlich, nach sechzehn Monaten der Entbehrungen, zweihundert Mark im Vermögen hatte, glaubte er den großen Schritt wagen zu dürfen. Nach seinen Berechnungen und dem Maßstab, den ihm sein bisheriges Leben geliefert hatte, meinte er von dem Gelde fünf Monate zehren zu können, und im Verlauf dieser Zeit konnten sich ja neue Quellen erschließen. Er hatte viele Menschen kennen gelernt und viele Verhältnisse erfahren, aber in Wirklichkeit hatte er nichts kennen gelernt und nichts erfahren, denn er hatte in der Welt gestanden wie eine Laterne mit verdecktem Licht. Da er, um zur Erwerbsarbeit tauglich zu bleiben, mit ungeheurer Energie seinem Geist die angeborene Betätigung mit dem Hinweis auf die Zukunft verwehrt hatte, befand sich nun sein Inneres in der Glut eines Hochofens.
Auf der Wanderschaft nährte er sich von trockenem Brot und Käse, wie er es gewohnt war. Aus den Büchern und Notenheften, die er besaß, hatte er ein Paket gemacht und es an das Nürnberger Bahnamt geschickt. Es waren Vorfrühlingstage, und wenn das Wetter schön war, schlief er im Freien, wenn es regnete, kroch er in einen Schuppen. Sein Bündel benutzte er als Kopfkissen, der verschlissene Mantel schützte ihn vor dem Nachtfrost. Nicht selten fand er freundliche Aufnahme und eine Mahlzeit bei Bauersleuten; bisweilen auch schloß sich ihm ein walzender Handwerksbursche an, aber seine Schweigsamkeit verscheuchte den Weggenossen bald.
Einmal kam er in der Nähe von Kitzingen zu einem vergitterten Park. Unter einem Ahornbaum saß ein junges Mädchen in weißem Gewand und las in einem Buch. Eine Stimme rief: »Sylvia!« worauf sich das Mädchen erhob und mit unvergeßlicher Anmut der Tiefe des Gartens zuschritt.
Sylvia, dachte Daniel, es klingt wie aus einer besseren Welt. Ihm graute vor dem Los, draußen stehen zu müssen vor dem Gitter, das den Augen alles gab und den Händen alles versagte.
10
Sein erster Gang war zu Andreas Döderlein. Es wurde ihm mitgeteilt, der Herr Professor sei verreist. Zwei Wochen später stand er wieder in dem alten Haus auf der Füll. Nun hieß es, der Herr Professor sei heute nicht zu sprechen. Sehr entmutigt, doch um seiner Sache nichts schuldig zu bleiben, kam er nach drei Tagen zum drittenmal und wurde empfangen.
Er trat in ein überheiztes Zimmer, in welchem der Professor in einem Lehnstuhl saß, sein Töchterchen, ein Kind von etwa acht Jahren auf den Knien und eine stattliche Puppe im rechten Arm hielt. Die weißen Ofenkacheln waren mit bildlichen Darstellungen aus der Nibelungensage geschmückt, auf Tisch und Stühlen lagen Notenhefte, die Fenster hatten Butzenscheiben, und in einer Ecke befand sich allerlei Gestrüpp, mit Pfauenfedern, farbigen Tüchern und chinesischen Fächern künstlich gruppiert, eine Zusammensetzung, die den Namen Makartbukett trug und in der Mode war.
Döderlein stellte das Mädchen auf die Erde, gab ihm die Puppe und richtete sich zu seiner Riesengröße auf, was ihm offensichtlichen Genuß verschaffte. Sein Hals war so dick, daß das Kinn wie auf einer weißen Gallertmasse ruhte.
Er schien sich Daniels nicht zu erinnern. Stichworte mußten die Fülle seiner Gesichte zerteilen, dann schlenkerte er mit einem Knallgeräusch zwei Finger, zum Zeichen, daß sein Geist die gewünschte Haltestation erreicht hatte. »Ja, ja! Ja freilich; gewiß, gewiß, mein lieber junger Mann; aber wie denken Sie sich das eigentlich? Gerade jetzt, wo alle Plätze so dicht besetzt sind wie eine krumenbestreute Straße von Spatzen. Möglich, daß man im Herbst darüber sprechen könnte. Ja, im Herbst, da ließe sich die Angelegenheit erwägen.«
Eine Pause, die durch ein halbes Dutzend Hms den Charakter tiefsinnigen Bedauerns erhielt. Und sei man denn echter Begabung so sicher? Habe man auch in Betracht gezogen, daß die Kunst mehr und mehr zum Tummelfeld für die Unreifen und Gescheiterten werde? Gar zu schwer seien die Schafe von den Böcken zu scheiden. Und schließlich, die Begabung vorausgesetzt, wie verhalte es sich denn mit der moralischen Kraft? Es sei doch unbestreitbar, daß darin der Kernpunkt der Frage zu suchen sei; oder nicht? Habe man eine andere Meinung darüber?
Wie im Nebel gewahrte Daniel, daß das kleine Mädchen an ihn herantrat und ihn mit einem seltsam prüfenden, seltsam ungerührten Blick betrachtete. Beinahe hätte er die Hand ausgestreckt, um die Augen des Kindes zuzudecken, dessen Art ihm in einer geisterhaften Vorahnung unheimlich war.
»Es tut mir herzlich leid, daß ich Ihnen keine tröstlicheren Aussichten eröffnen kann,« tönte wieder die ölige und von ihrem eigenen Klang freudig gehobene Stimme Andreas Döderleins an sein Ohr, »aber wie gesagt, vor dem Herbst ist nichts zu hoffen. Lassen Sie mir jedenfalls Ihre Adresse hier. Schreiben Sie Ihre Adresse auf diesen Zettel. Oder nicht? Wie Sie wollen. Adieu, junger Mann; adieu.«
Döderlein geleitete ihn bis zur Türe, kehrte hierauf zu seiner Tochter zurück, nahm sie wieder auf die Knie, die Puppe wieder auf den Arm und sagte: »Die Menschen, meine liebe Dorothea, sind ein armseliges Geschlecht. Vergleiche ich sie mit den Spatzen auf der Landstraße, so tue ich, scheint mir, den Spatzen wenig Ehre an. Hach, du lieber Gott! Schreibt nicht einmal seinen Namen auf den Zettel. Gekränkt! Ei, ei, ei,! Ihr komischen Menschen, ihr! Schreibt seinen Namen nicht; ei, ei, ei!«
Er summte das Walhalla-Motiv, und Dorothea beugte sich über die Puppe und küßte kokett lachend deren Wachsgesicht.
Daniel, vor dem Hause stehend, biß die Lippen zusammen wie ein Fiebernder, der seine Zähne am Klappern verhindern will. Warum, fragte ihn die tiefe Seele, warum bist du in ihren Schreibstuben gesessen und hast die Zeit vertan? Warum hast du für jene deinen Leib gemartert und mir die Flügel gebunden? Warum warst du taub gegen mich und wolltest Früchte sammeln, wo nur Steine sind? Warum bist du feig vor deinem Schicksal geflohen in ihre Schreibstuben, zu ihren Warenhäusern, zu ihren Geldschränken, zu ihrer traurigen Geschäftigkeit? Nur um dieser Stunde willen? Armer Narr!
Nie mehr, Seele, antwortete er, nie mehr.
11
Anfangs hatte Marianne hie und da eine kurze Nachricht von Daniel erhalten. Dies geschah immer spärlicher; im zweiten Jahr schickte er ihr bloß zu Weihnachten ein paar Zeilen.
Um die Zeit, als er seine letzte Arbeitsstelle verließ, schrieb er auf einer Postkarte, daß er seinen Aufenthaltsort wieder einmal verändere, aber daß er nach Nürnberg ging, unterließ er ihr mitzuteilen. Frühling und Sommer verflossen, da wurde ihr zwischen Furcht und Hoffnung schwankendes Gemüt durch einen Brief Jason Philipps grausam aus der Unentschiedenheit gescheucht.
Er schrieb, Daniel treibe sich in Nürnberg herum; er habe ihn vor einigen Tagen zufälligerweise unter den Meßbuden auf der Insel Schütt gesehen, in einem Aufzug, den zu schildern die Feder sich sträube. Als er ihn stellen gewollt, sei er verschwunden gewesen. Was ihn in die Stadt geführt, darüber könne er, Jason Philipp, keine Auskunft geben, aber es sei zehn gegen eins zu wetten, daß wieder ein ganz niederträchtiger Streich zugrunde liege, denn der Bursche habe nicht ausgesehen wie einer, der sich anständig durchbringt. Er schlage Marianne vor, zu kommen und bei der Razzia auf den Strolch zu helfen, man müsse, ehe es zu spät sei, verhindern, daß der unbescholtene Name, den er trage, dauernd verunglimpft werde. Als Reisebeitrag sende er hierzu fünf Mark in Briefmarken.
Mittags hatte Marianne den Brief erhalten, hatte Laden und Haus verschlossen, um zwei Uhr befand sie sich auf dem Ansbacher Bahnhof, und um vier Uhr kam sie in Nürnberg an. Ihr Köfferchen in der Hand tragend, fragte sie sich von Straßenecke zu Straßenecke nach der Plobenhofgasse durch.
Therese saß hinter der Ladenkasse. Das braune Haar auf ihrem viereckigen Bauernkopf war glatt frisiert. Zwanziger, der sommersprossige Gehilfe, war mit dem Auspacken von Büchern beschäftigt. Therese begrüßte die Schwester scheinbar freundlich, verließ aber ihren Platz nicht, sondern reichte bloß die Hand über das Tintenfaß hinüber und musterte Mariannes armselige Erscheinung, die verschossene Mantille und das altmodische Stoffhütchen, dessen schwarze Sammetbänder unter dem Kinn zur Masche geknüpft waren.
»Geh einstweilen hinauf,« sagte sie, »unterhalte dich mit den Kindern, Rieke soll deinen Koffer holen.«
»Wo ist dein Mann?« fragte Marianne.
»Bei einer Wählerversammlung,« antwortete Therese mürrisch; »sie können sich ja nicht versammeln, wenn er fehlt.«
Jetzt trat ein Mann im Arbeitskittel in den Laden und fing an, mit leiser, aber erregter Stimme auf Therese einzusprechen. »Ich habe das Werk gekauft, das Werk ist mein Eigentum,« sagte der Mann, »und wenn man mit der Rate mal aussetzt, so ist das kein Grund, daß man sein Eigentum verliert. Das sind Praktiken, Frau Schimmelweis, Praktiken sind das.«
»Was hat denn Herr Wachsmuth von uns bezogen?« wandte sich Therese an den Gehilfen Zwanziger.
»Schlossers Weltgeschichte,« war die prompte Erwiderung.
»Da müssen Sie halt Ihren Vertrag lesen,« sagte Therese zu dem Arbeiter, »im Vertrag ist alles festgesetzt.«
»Das sind Praktiken, Frau Schimmelweis, Praktiken sind das,« wiederholte der Mann, als ob in diesem Ausdruck alles enthalten sei, was ihm an vernichtendem Urteil zu Gebote stand; »unsereiner will sich fortbringen, unsereiner will was lernen; gut, denkt man, kaufst dir ein Buch, rückst um eine Charge hinauf in deinen Kenntnissen. Gut, man geht zu einem Parteifreund, man geht zum Buchhändler Schimmelweis, da ist man geborgen, denkt man. Für schwere sechzig Mark schafft man sich eine Weltgeschichte an, rackert sich die Raten vom Lohn ab, und auf einmal, mir nichts, dir nichts, wenn man schon die Hälfte gezahlt hat, soll man sein Eigentum wieder verlieren, weil man zweimal im Rückstand geblieben ist. Das sind Praktiken, Frau Schimmelweis, Praktiken sind das.«
»Lesen Sie Ihren Vertrag,« sagte Therese, »da ist jeder Punkt festgesetzt.«
»Kein Wunder, daß man dabei reich wird,« fuhr der Arbeiter mit immer lauter werdender Stimme fort und blickte zornig auf Jason Philipp, der mit eingedrücktem Hut und kotbespritzter Hose eben zur Ladentür hereinschoß, »kein Wunder, daß man sich Häuser kaufen und in Grundstücken spekulieren kann. Jawohl, Schimmelweis, das sind Praktiken, und ich pfeif auf Ihren Vertrag. Von allen Seiten hört man's ja, wie Sie's treiben, was für eine Fuchsfalle das ist mit den Ratenzahlungen und wie Sie den Arbeiter bewuchern. Erst wird ihm die Bildung angepriesen, und dann wird er geschröpft damit. Pfui Teufel!«
»Nehmen Sie sich zusammen, Wachsmuth!« rief Jason Philipp streng.
Wachsmuth ergriff seine Kappe und schlug die Ladentüre hinter sich zu.
Marianne Nothaffts Augen liefen mechanisch über die Titel einer Reihe feuerfarbenen Broschüren, die auf dem Tisch ausgebreitet waren. Sie las: »Auf zur Entscheidungsschlacht«; »Moderne Sklavenhalter«; »Dem Armen sein Recht«; »Christentum und Kapitalismus«; »Die Verbrechen der Bourgeoisie«. Obwohl ihr diese Schlagworte nichts bedeuteten und nichts sagten, spürte sie in ihrer Brust auf einmal wieder jenen alten, schon vergessenen Haß gegen die Maschine.
12
»Laß mir ein Butterbrot schneiden, Therese,« befahl Jason Philipp, »der Magen kracht mir.«
»Hast du denn im Wirtshaus nichts gegessen?« fragte Therese mißtrauisch.
»Ich war nicht im Wirtshaus.« Jason Philipps Augen blitzten, und er schüttelte den Kopf wie ein Löwe.
Da ging Therese, um das Butterbrot zu holen, und es war eigentümlich, wieviel Argwohn und Widerspruch sie in die Langsamkeit ihres Schrittes zu legen vermochte. Ihre Tochter Philippine kam aber schon mit dem Butterbrot über die Stiege herunter.
Jetzt erst gewahrte Jason Philipp seine Schwägerin. »Da bist du ja, wie klein du dich machst,« sagte er flüchtig überrascht und reichte ihr die rundliche Hand. »Therese soll dir die Kammer unterm Speicher geben, da hast du eine hübsche Aussicht auf die Pegnitz.«
Therese reichte ihm das Butterbrot. Er beroch es und runzelte die Stirn, weil es so dünn bestrichen war, hatte aber nicht den Mut, sich tadelnd darüber zu äußern. Er biß hinein, und mit vollen Backen wandte er sich neuerdings an die schweigende Marianne.
»Na, dein Filius ist also wieder abgängig. Schöne Geschichte das. Wird noch im Zuchthaus enden, der saubere Herr. Das beste wäre, ihn nach Amerika zu spedieren, aber wie wir seiner habhaft werden sollen, ist mir noch unklar. Polizeilich gemeldet ist er nicht, und ich weiß eigentlich gar nicht, wozu du da bist. War eine Übereilung von mir, dich kommen zu lassen.«
»Wenn ich nur wüßte, wovon er lebt,« flüsterte Marianne beklommen.
»Neulich hab ich irgendwo gelesen,« fuhr Jason Philipp erzählerbehaglich fort, »daß aus einem zoologischen Garten eine Giraffe durchgebrannt war. Von Giraffen hast du doch gehört? Es sind langhalsige Vierfüßler, die sehr albern und bockig sind. Das dumme Vieh war in einen Wald gelaufen und die Leute wußten nicht, wie sie es fangen sollten. Da hing ein Wärter die Stallaterne vor seine Brust und ein Bündel Heu auf den Rücken, und mit sinkender Nacht begab er sich in den Wald. Die Giraffe erblickt kaum den Laternenschein, als sie neugierig herzurennt. Der Mann dreht sich um, sie riecht das Heu, sie zupft und frißt, der Mann geht weiter, sie zupft und frißt weiter, und so bringt er die Bestie wieder in den Käfig. Was meinst du, könntest du nicht deinen Daniel, wenn ihn der Hunger piesakt, auch mit ein bißchen Heu wieder kirre machen? Denk mal drüber nach.«
Jason Philipp lachte vergnügt und Zwanziger grinste. Dieser besaß in seinem Prinzipal eine Quelle des Witzes, und wenn er am Abend im »Bärleinhuter« oder im »gläsernen Himmel« beim Bier saß, ergötzte er die Zechgenossen mit Schimmelweisschen Geistesblüten und fand vielen Beifall.
Ein magerer Greis, der Glacéhandschuhe und einen Zylinderhut trug, betrat den Laden. Es dämmerte, er hatte sich draußen vorsichtig umgesehen, nun ging er eilig auf Jason Philipp zu und sagte mit einer gebrochenen Fistelstimme: »Also, was ist's mit den Neuigkeiten? Was haben wir Schönes?« Er rieb sich die Hände und stierte unter dünnen, roten Lidern blöde vor sich hin. Es war der Graf Schlemm-Nottheim, ein Vetter des liberalen Parteihauptes, des Freiherrn von Auffenberg.
»Stehe ganz zu Diensten, Herr Graf,« sagte Jason Philipp, stramm wie ein Unteroffizier, wenn er vom Hauptmann angesprochen wird.
Er führte den Grafen in eine Ecke des Raums und sperrte einen schweren Eichenschrank auf. In diesem lagen die vom Staatsanwalt verbotenen erotischen Druckwerke, die nur unter der Hand und an verläßliche Personen verkauft werden konnten.
Jason Philipp tuschelte, und der alte Graf wühlte mit gierigen Fingern in einem Bücherhaufen.
13
Im finstern Treppenhaus erklomm Marianne die steile Stiege und läutete vor einem Gitter. Sie mußte der Magd sagen, wer sie war, auch den Kindern mußte sie ihren Namen nennen. Ihre stadtfremde Höflichkeit erweckte bei den Kindern ein Gelächter. Die zwölfjährige Philippine tat hochmütig und wackelte beim Gehen mit den Hüften. Alle drei hatten den viereckigen Kopf der Mutter und eine käsige Gesichtsfarbe.
Die Magd brachte das Köfferchen, dann kam auch Therese und half der Schwester beim Auspacken. Mit ihrer spitzen und lieblosen Stimme stellte sie viele Fragen, wartete aber nicht die Antwort ab, sondern berichtete von Heiraten, Entbindungen und Todesfällen, die sich in der Stadt ereignet hatten. Sie vermied es, dem Blick Mariannes zu begegnen, da sie sich Gedanken darüber machte, wie lange der Besuch der Schwester wohl dauern und welche Unkosten daraus entstehen würden.
Von Daniel sprach sie nicht. Ihr Schweigen verurteilte ihn mehr als ihres Mannes bissige Reden es taten. Sie hielt unerschütterlich an beinahe religiösen Vorstellungen der Gehorsamspflicht der Kinder gegen die Eltern fest und traute Marianne nicht die Kraft zu, das Verbrechen an diesem heiligen Gebot zu ahnden.
Als Marianne wieder allein war, setzte sie sich ans Fenster der Kammer und sah traurig auf den Fluß hinunter. Das gelbe Wasser glitt wellenlos dahin und umspülte die Mauern der gegenüberliegenden Häuser. Sie konnte die Museumsbrücke und die Fleischbrücke überschauen, und das Menschengewühl auf den Brücken beunruhigte sie.
Sie ging auf die Straße und blieb am Kopf der Museumsbrücke stehen. Sie war der Meinung, jeder in der Stadt wohnende Mensch müsse einmal hier vorüberkommen. Ihr aufmerksamer Blick durchforschte alle Gesichter, und wo ihm eins entschlüpfte, verfolgte er die in den Abend schwindende Gestalt. Es kamen immer weniger Menschen, je später es wurde.
Des Nachts lag sie wach und lauschte den dumpf klingenden Schritten der Spätlinge, und am andern Tag wanderte sie vom frühen Morgen bis in die Dämmerung straßauf, straßab. Was sie sah, machte ihr das Herz schwer, die Menschen erschienen ihr wie stumme Tiere, geplagt und böse, die engen Gassen raubten ihr den Atem und der Lärm benahm ihr die Sinne.
Aber sie wurde nicht müde, zu suchen.
Am fünften Tag kam sie erst gegen zehn Uhr abends nach Hause und Therese, die schon zu Bett gegangen war, schickte ihr einen Teller Linsensuppe. Während sie ihn hungrig auslöffelte, vernahm sie Schritte auf dem Flur, ein Klopfen an der Türe, und Jason Philipp trat ein. »Komm mal gleich mit mir,« war alles, was er sagte, aber sie begriff. Mit zitternden Händen warf sie ein Tuch um die Schultern, denn die Oktoberabende waren schon kalt, und folgte ihm schweigend.
Sie gingen zur Adlergasse bergan, bogen in diese hinein, dann nach wenigen Schritten in ein schmales und finsteres Gäßchen zur Rechten. Über einem Tor hing eine Laterne, auf deren grünen Scheiben die Worte standen: »Zum Jammertal«. Grün beleuchtet war auch die steinerne Treppe, die in den Keller führte, die Fässer unten und der mit Bänken und Tischen versehene öde Gastraum. Eine sauer schmeckende Weinluft drang empor.
Neben dem Eingang befand sich ein vergittertes Fenster. Dort machte Jason Philipp halt und winkte Marianne zu sich hin.
An den langen Tischen drunten saß eine wunderliche Gesellschaft, junge Leute, wie man sie nirgends sonst in Häusern und nur selten auf den Straßen sieht. Die Not schien sie zusammengeworfen, die Nacht aus ihren Schlupfwinkeln gelockt zu haben; Schiffbrüchige, die an verlassener Küste in eine Höhle geflohen sind. Sie hatten lächerlich bunte Krawatten und traurig fahle Mienen, und das grüne Licht ließ sie noch leichenhafter aussehen. Seit langem hatte kein Haarkünstler eines ihrer Häupter berührt, seit langem kein Schneider Hand an sie gelegt. So schienen sie in mehr als einem Betracht Verächter des Handwerks zu sein.
Zwei alle Kerle saßen abseits, zwei Säufer, nicht in guten Umständen, aber einigermaßen erstaunt über die acherontische Sippe. Denn sie empfingen schließlich doch am Samstag ihren Wochenlohn, und jene lebten sichtlich ohne Lohn dahin, seit Jahren.
In einer halbdunklen Ecke vor dem Klavier aber saß einer und hämmerte gewaltig auf die Tasten. Er hatte keine Notenblätter vor sich, er spielte aus dem Gedächtnis. Das Instrument röchelte; die Saiten schepperten kläglich; die Pedale ächzten; doch der Spieler war so behext von seiner Produktion, daß ihn die Mängel der Materie wenig kümmerten. Wie sinnlos auch das Getöse klang, die schrill tobenden Akkorde, die wüsten Aufschreie des Diskants, die gejagten Triolen und brodelnden Tremolos im Baß, so gab doch die Ergriffenheit des Spielers, die Ekstase und der erdferne Rausch, worin er sich befand, der Szene eine Melancholie und eine Feierlichkeit, die des grünen Kellers und der troglodytisch fahlen Zuhörerschaft nicht bedurft hätte, um so zu wirken, wie sie wirkte.
Marianne hatte in dem Spieler sogleich Daniel erkannt. Sie mußte sich am Fenstergitter festhalten und die Knie gegen das Gesimse stemmen. Jason Philipp galt nicht umsonst für einen Mann von humoristischer Anlage; das Bild von Daniel in der Löwengrube war zu verführerisch, und er raunte die Worte in Mariannes Ohr. Aber das Fenster war offen und da sich das Musikstück eben zu einer Fermate gesteigert hatte, drang seine Stimme bis hinunter und einige an der Tafelrunde schauten hinauf. Marianne war unbesonnen; sie glaubte, der Vortrag sei zu Ende und rief, matt und furchtsam: »Daniel!«
Daniel sprang empor, starrte nach der Ruferin, sah Jason Philipps höhnisches Gesicht, stürzte zur Tür, zur Treppe und in drei Sätzen die Treppe hinan.
Er stand in der Torwölbung und seine Lippen wollten Worte rufen. Der unselige Mensch, dachte Marianne, und ihr war, als könne sie das Wort, vor dem sie zitterte, zurückzwingen in die Brust, in der es geboren wurde.
Vergebens, das Wort wurde ausgesprochen. Er wolle die Mutter nicht mehr sehen; er wolle mit sich selber und für sich selber leben, er wolle frei sein, er brauche niemand, er wolle frei sein.
Jason Philipp schleuderte dem Frevler einen Blick der Verachtung zu und zog Marianne mit sich fort. Noch an der Ecke des Gäßchens vernahmen sie die aufgeregten Stimmen der Leute vom Jammertal.
Am andern Morgen kehrte Marianne nach Eschenbach zurück.
Feinde, Brüder, Freund und Maske
1
Daniel hatte sich bei dem Bürstenmachersehepaar Hadebusch eingemietet, auf dem Jakobsplatz hinter der Kirche.
Damals im März war es noch recht kalt geworden, und Frau Hadebusch hatte eine abergläubische Furcht vor Kohlen, die sie als Teufelsdreck bezeichnete. Hinten im Hof war das Holzlager, davon nahm sie die Scheite, mit denen die Öfen geheizt wurden. Aber diese Scheite waren teuer; hätte Daniel das eiserne Öfchen in seiner Mansardenstube mit so kostbarer Nahrung gespeist, so hätte die Monatsrechnung eine unerschwingliche Höhe erreicht. Er zahlte sieben Mark für die Stube und rechnete immer wieder, um seine Freiheit durch keinen vergeudeten Groschen zu verkürzen.
So saß er frierend bei seinen Büchern und Heften, bis endlich Frühlingswärme durch die offenen Fensterluken zog. Die Bücher holte er sich gegen Entrichtung von sechs Pfennigen für den Band von einer Leihbibliothek am Königstor. Achim von Arnim und Jean Paul waren in jener Zeit seine Dichter; bei dem einen fand er die Welt außen wunderbar geschmückt, bei dem andern innen.
Mit dem Meldezettel Daniels, auf welchem er sich Musiker nannte, kam Frau Hadebusch in die Wohnstube, die, wie alle Räume im Haus, wie für Zwerge gebaut war und, wie gleichfalls alle Räume, nach Leim und Laugenwasser duftete. Es hatten sich dort, da es Feierabend war, Herr Francke und Herr Benjamin Dorn niedergelassen, die Mieter des Mittelstocks, ferner der Sohn der Frau Hadebusch, der schwachsinnig war und grinsend auf der Ofenbank hockte.
Herr Francke war Stadtreisender für ein Zigarrengeschäft und galt bei den weiblichen Dienstboten der Umgebung als ein gefährlicher Herzensdieb; Benjamin Dorn war Schreiber bei der Versicherungsgesellschaft Prudentia, gehörte einer Methodistengemeinde an und stand wegen seiner gottgefälligen Lebensführung bei allen respektablen Leuten in Respekt.
Das Schriftstück wurde von den Herren eingehend und mit gerunzelten Stirnen geprüft, und Herr Francke äußerte sich dahin, daß ein Musiker, von dem man keine Musik vernehme, mit nichten als Musiker zu betrachten sei.
»Wird die Baßgeige oder das Flügelhorn, oder was er sonst gelernt hat, ins Pfandhaus getragen haben,« sagte er geringschätzig; »vielleicht kann er nur trommeln, und das kann ich auch, wenn man mir eine Trommel gibt.«
»Ja, eine Trommel muß man haben, um trommeln zu können,« bemerkte Benjamin Dorn; »es ist jedoch die Frage, ob sich so ein Gewerbe mit den Grundsätzen christlicher Bescheidenheit verträgt.« Er legte den Finger an die Nase und fügte hinzu: »Es ist eine Frage, die ich, in aller Demut versteht sich, in aller Demut verneinen möchte.«
»Er hat gar keine Verwandten, sagt er, und gar keine Bekannten,« jammerte Frau Hadebusch mit einer Stimme, die klang, wie wenn man Rüben auf einem Reibeisen schabt, »und gar keine Stellung und gar keine Aussichten und von Stiefeln und Kleidern nichts, als was er auf dem Leibe trägt. Mein Lebtag hab ich keinen solchen Zimmerherrn gehabt.«
Der Meldezettel flatterte auf den Boden, von wo ihn der schwachsinnige Hadebusch junior aufhob, eine Tüte daraus drehte und diese in den Mund steckte, um Trompete zu blasen, eine Prozedur, bei welcher das wichtige Dokument allmählich aufgeweicht und so seiner Bestimmung entzogen wurde. Frau Hadebusch hielt zu wenig von den polizeilichen Vorschriften, um sich in der Folge noch einmal um ihre Vermieterinnenpflicht zu kümmern.
Herr Francke nahm ein Paket schmieriger Karten aus der Tasche und begann zu mischen. Frau Hadebusch kicherte gleich einer Hexe, wenn es im Kamin raschelt, der Methodist bezwang seine frommen Skrupel und zählte Pfennige auf das Tischbrett, und der Stadtreisende stülpte die Rockärmel hoch, als sei er im Begriff, einem Huhn den Hals abzuschneiden.
Es dauerte nicht lange, so erhob sich ein mißtönendes Gezänke, da Herr Francke zur Göttin Fortuna in einem etwas gewalttätigen Verhältnis stand. Der alte Bürstenmacher steckte den Kopf in die Tür und fluchte, der Schwachsinnige blies träumerisch die papierene Trompete, und die vorhin so friedfertig gewesene Gesellschaft stob wutschnaubend auseinander.
2
Daniel wanderte zur Burg hinauf, an den Wällen entlang, über die Brücken und die Stege.
Es war seine Jugend, die ihn die Nacht so lieben ließ, daß er die Menschheit vergaß und sich wie allein auf der Erde erschien; die Jugend, die ihn den Dingen mit Inbrunst überlieferte und ihn fähig machte, Melodien wie Geisterblumen um alles zu flechten was sichtbar war; Melodien, die so zärtlich, so beredt, so schwebend keine Feder jemals zu Papier gebracht hat und die dahinstarben, wenn die Hand sich ihrer bemächtigen wollte.
Aber es war auch die Jugend, die beim Blick auf gemütlich erleuchtete Fenster sein Auge gehässig entzündete und mit Bitterkeit gegen die Zufriedenen, die Gleichgültigen, die Fremden, ewig Fremden, nichts von ihm Wissenden seine Brust erfüllte.
Er war klein und groß; klein vor der Welt, groß vor sich selbst. Er war ein Gott, wenn die Töne aus ihm sprühten wie Funken von einem Amboß, und ein Ausgestoßener, wenn er im finstern Hof hinterm Stadttheater wartete, bis der Schlußchor der Oper Fidelio durch die Mauern zu ihm drang.
Von überall her rauschten die Quellen, aus Kinderaugen und von den Sternen. Es gab keine Grenze mehr, sein Tag war eine Wildnis, sein Hirn ein durstiges Ackerfeld im Regen, seine Gedanken Sturmvögel, seine Träume Leben über dem Leben.
Er nährte sich von Brot und Obst, nur jeden dritten Tag erlaubte er sich ein warmes Nachtessen in der Wirtschaft zum weißen Turm. Da lauschte er manchmal verstohlen der ungewöhnlich klingenden Unterhaltung einiger junger Leute, und brennend erwachte in ihm das Verlangen nach Aussprache mit Gleichgestimmten. Aber als ihn die Brüder vom Jammertal in ihre Mitte nahmen, glich er doch einem Robinson oder Selkirk, den man von seiner Insel entführt.
3
Benjamin Dorn hatte ein mitleidiges Gemüt, und die Begierde, eine verlorene Seele zu retten, verlieh ihm den Mut, Daniel Nothafft einen Besuch abzustatten. Er humpelte mit seinem Klumpfuß die krachende Stiege hinauf und klopfte schüchtern an die Tür.
»Kann ich Ihnen, mein Herr, vielleicht in christlicher Weise mit etwas dienen?« fragte er, nachdem er sich geschneuzt hatte.
Daniel starrte ihn verwundert an.
»Ich könnte Ihnen, mein Herr, natürlich ganz uneigennützig, in christlicher Weise, zu einer Anstellung verhelfen. Bei der Prudentia gibt es mancherlei zu arbeiten. Ich würde sicher keine Fehlbitte bei Herrn Zittel tun. Herr Zittel ist Bureauchef, mein Herr. Auch beim Herrn Generalagenten Diruf stehe ich in Gunst. Und mit Herrn Inspektor Jordan verkehre ich fast täglich. Herr Inspektor Jordan ist ein äußerst gebildeter Mann. Seine Tochter Gertrud ist von mir in christlicher Weise erleuchtet worden. Sie hat Anteil an der Gnade erlangt, mein Herr. Wenn Sie sich mir anvertrauen wollen, betreten Sie einen heilsamen Weg. Ich bin immer bemüht. Ohne unbescheiden zu sein, darf ich sagen, daß ich mit der Bemühung geboren bin.«
Er sah aus wie ein Flickwerk aus Übelkeit, Trübsal und Gottgefälligkeit, und sein Rockkragen war zerfranst.
»Lassen Sie's nur gut sein,« entgegnete Daniel, »Sie sehen ja, es geht mir ganz erträglich.«
Der fromme Versicherungsschreiber seufzte und wischte mit dem Handrücken ein Tröpfchen von seiner Nase. »Beherzigen Sie, mein Herr, das Wort Salomonis: Hochmut erniedrigt den Menschen, wer aber demütig ist im Geiste, erlangt Ehre.«
»Ich will's beherzigen,« sagte Daniel trocken und beugte sich wieder über das Notenblatt, an dem er schrieb.
Benjamin Dorn seufzte abermals und humpelte wieder hinaus. Zu Frau Hadebusch sagte er, mit dem Daumen emporweisend: »Mutter Hadebusch, ich kann nicht anders, ich muß mir in christlicher Weise das Herz erleichtern, – denken Sie sich –«
»Jesus Maria, was tut er? Was treibt er?« keuchte die Alte, ihren Besen unter die Achsel schiebend.
»Der Tisch ist voller Papier, und das Papier ist mit lauter Geheimzeichen bedeckt, so wahr ich hier stehe.«
Da schickte Frau Hadebusch, in Angst vor der Schwarzkunst des Mansardenbewohners, ihren Gatten zum Revierkommissär. Dieser aufgeklärte Beamte hieß den Bürstenmacher einen alten Schwätzer. Aus Verdruß hierüber begab sich der Bürstenmacher ins Gasthaus zum Roß und betrank sich und mußte, es war eine schöne Mondnacht, von Benjamin Dorn heimgeführt werden.
4