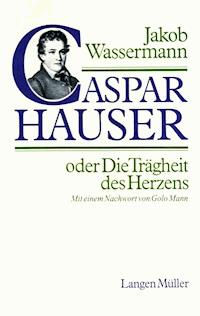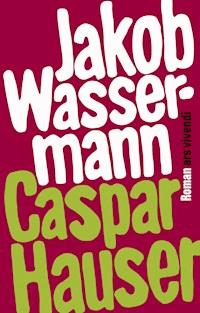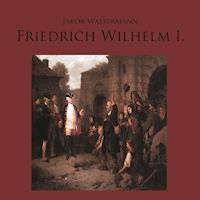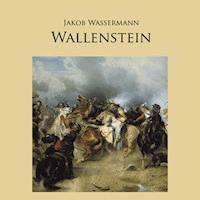Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wassermanns beklemmende Bekenntnis- und Weckschrift aus dem Jahr 1921, jetzt neu ediert und umfangreich kommentiert – eine erhellende Lektüre in unserer politisch wirren Zeit »Ich weiss nicht, ob ich Ihnen von diesem Versuch einer Selbstbiographie erzählt habe, ›Mein Weg als Deutscher und Jude‹ ist der Titel; es war eine wichtige Sache, die mir wie Eisenlast monatelang auf der Brust lag, bis ichs endlich herunterschrieb. Sie werden es ja bald lesen. Wenn es nur hundert Köpfe in Deutschland zur Besinnung bringt, hat es schon seine Schuldigkeit getan.« So schrieb Wassermann am 1. Dezember 1920 an den Schauspieler Hans Aufricht. Das Buch wurde eine Bekenntnis- und Anklageschrift, worin der damals berühmte Romanautor berichtet, wie ihm immer aufs Neue das Gefühl gegeben wurde, dass er als ›Jude‹ nicht ›deutsch‹, als ›Deutscher‹ nicht ›Jude‹ sein könne. Wassermann erzählt dabei von Erfahrungen auch gerade mit Wohlmeinenden, die ihm seine Selbsteinschätzung ›Deutscher und Jude‹ bestreiten wollten, verbunden mit Argumentationsmustern, die heute nicht nur von rechter oder rechtsradikaler, sondern auch von ›bürgerlicher‹ Seite her wieder zu hören sind. Wassermann schreibt ausführlich und detailliert, in neutraler Diktion, doch nicht ohne die Ursache anzuprangern, die für ihn »der deutsche Haß« war. Gedacht war die Schrift, die nun, reich kommentiert und mit vielen Dokumenten, neu vorgelegt wird, als Weckruf – der vergeblich blieb.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jakob Wassermann
Mein Weg als Deutscher und Jude
Herausgegeben und kommentiert von Dierk Rodewald
Inhalt
Mein Weg als Deutscher und Jude
Anhang
Kommentar
Nachwort
Dank
Mein Weg als Deutscher und Jude
… vis animae conturbatur et
divisa seorsum disiectatur, eodem
illo distracta veneno.
LUCREZ, III. 498.
Ferruccio Busoni
dem Freund dem Künstler gewidmet
Ohne Rücksicht auf die Gewöhnung meines Geistes, sich in Bildern und Figuren zu bewegen, will ich mir – gedrängt von innerer Not und Not der Zeit – Rechenschaft ablegen über den problematischesten Teil meines Lebens, den, der mein Judentum und meine Existenz als Jude betrifft, nicht als Jude schlechthin, sondern als deutscher Jude, zwei Begriffe, die auch dem Unbefangenen Ausblick auf Fülle von Mißverständnissen, Tragik, Widersprüchen, Hader und Leiden eröffnen.
Heikel war das Thema stets, ob es nun mit Scham, mit Freiheit oder Herausforderung behandelt wurde, schönfärbend von der einen, gehässig von der anderen Seite. Heute ist es ein Brandherd.
Es verlangt mich, Anschauung zu geben. Da darf denn nichts mehr gelten, was mir schon einmal als bewiesen gegolten hat. Auf Beweis und Verteidigung verzichte ich somit überhaupt, auf Anklage und jede Art konstruktiver Beredsamkeit. Ich stütze mich auf das Erlebnis.
Unabweisbar trieb es mich, Klarheit zu gewinnen über das Wesen jener Disharmonie, die durch mein ganzes Tun und Sein zieht und mir mit den Jahren immer schmerzlicher fühlbar und bewußt worden ist. Der unreife Mensch ist gewissen Verwirrungen viel weniger ausgesetzt als der reife. Dieser, sofern er an eine Sache hingegeben ist oder an eine Idee, was im Grunde dasselbe besagt, entringt sich nach und nach der Besessenheit, in der das Ich den Zauber des Unbedingten hat, und Welt und Menschheit kraft einer angenehmen und halbfreiwilligen Täuschung dem gebundenen Willen in den Transformationen der Leidenschaften zu dienen scheinen. In dem Maße, in dem die eigene Person aufhört, Wunder und Zweck zu sein, bis sie zuletzt ein kaum gespürtes Zwischenelement wird, gleichsam Schatten eines Körpers, den man nicht kennt, noch erkennen kann, in dem Maße wächst die Schwierigkeit und Gefährlichkeit des Lebens mit und unter den Menschen, sowie der geheimnisvolle Charakter alles dessen, was man Realität und Erfahrung nennt.
Weg- und Merkzeichen bleiben letzten Endes wenige, auch bei der genialsten Rezeption. Es hängt von der Breite des Schicksals ab, wieviel unvergeß- und unverwischbare Spuren es in der Seele hinterläßt.
1
Ich bin in Fürth geboren und aufgewachsen, einer vorwiegend protestantischen Fabrikstadt des mittleren Franken, in der es eine zahlreiche Gemeinde gewerbs- und handelstreibender Juden gab. Das Verhältnis der Zahl der Juden zur übrigen Bevölkerung war etwa 1 : 12.
Der Überlieferung nach ist es eine der ältesten Judengemeinden Deutschlands. Schon im neunten Jahrhundert sollen dort jüdische Siedlungen bestanden haben. Vermehrung und Blüte trat wahrscheinlich erst zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts ein, als die Juden aus dem benachbarten Nürnberg vertrieben wurden. Später wendete sich auch vom Rhein her ein Flüchtlingsstrom der aus Spanien verjagten Juden nach Franken, und unter ihnen vermute ich meine Vorfahren mütterlicherseits, die im Maintal in der Nähe von Würzburg seit Jahrhunderten dorfansässig waren, so wie die von väterlicher Seite in Fürth, Roth am Sand, Schwabach, Bamberg und Zirndorf.
Beziehung zu Boden, Klima und Volk muß also den Generationen, die durch dreißig oder vierzig Jahrzehnte hier hausten, in Fleisch und Bein übergegangen sein, obgleich sie diesen Einflüssen entgegenstrebten und als Fremdkörper vom Volksorganismus ausgeschieden waren. Drückende Beschränkungen, wie das Matrikelgesetz, das Verbot der Freizügigkeit und der freien Berufswahl waren noch bis in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in Kraft. Der Vater meiner Mutter, ein Mann von Bildung und edler Anlage, verblutete an ihnen. Daß finsterer Sektengeist, Ghettotrotz und Ghettoangst dadurch immer frische Nahrung erhielten, versteht sich am Rande.
Als ich geboren wurde, zwei Jahre nach dem Deutsch-Französischen Krieg, war für die deutschen Juden der bürgerliche Tag längst angebrochen. Im Parlament kämpfte die liberale Partei bereits für die Zulassung der Juden zu den Staatsämtern, eine Anmaßung, die auch bei den aufgeklärtesten Deutschen Entrüstung hervorrief. »Ich liebe die Juden, aber regieren will ich mich von ihnen nicht lassen«, schrieb zum Beispiel ein Mann wie Theodor Fontane damals an einen Freund.
Von Pferch und Helotentum spürte ich also in meiner Jugend nichts mehr. Auf der einen Seite hatte man sich eingelebt, auf der andern sich gewöhnt. Wirtschaftlicher Aufschwung begünstigte die Duldsamkeit. Ich erinnere mich, daß mein Vater bei irgendeiner Gelegenheit mit freudiger Genugtuung sagte: »Wir leben im Zeitalter der Toleranz!« Das Wort Toleranz machte mir in Gedanken viel zu schaffen; es flößte mir Respekt ein, und ich beargwöhnte es, ohne daß ich seine Bedeutung begriff.
In Kleidung, Sprache und Lebensform war die Anpassung durchaus vollzogen. Die Schule, die ich besuchte, war staatlich und öffentlich. Man wohnte unter Christen, verkehrte mit Christen, und für die fortgeschrittenen Juden, zu denen mein Vater sich zählte, gab es eine jüdische Gemeinde nur im Sinn des Kultus und der Tradition; jener wich vor dem verführerischen und mächtigen modernen Wesen mehr und mehr ins Konventikelhafte zurück, in heimliche, abgekehrte, frenetische Gruppen; diese wurde Sage, schließlich nur Wort und leere Hülse.
Mein Vater war kleiner Kaufmann, dem es auf keine Weise wie den meisten seiner Glaubens- und Altersgenossen gelingen wollte, Reichtümer zu erwerben. Er hatte in Geschäften eine unglückliche Hand. Er war ein wenig Phantast und hatte immer seine fixe Idee, die ihn der Biegsamkeit der Geldmacher beraubte. Er träumte von großen Spekulationen und großen Unternehmungen, aber was er angriff, schlug fehl. Seine Geistesrichtung war die sentimental-freiheitliche, laues Nachzüglertum der Märzrevolution, das seine verwässerten Tendenzen ins neue Reich getragen hatte. Ich entsinne mich aus meiner Kindheit eines leidenschaftlichen Disputs zwischen ihm und einem seiner Vettern über Ferdinand Lassalle, von dem er wie vom Gottseibeiuns sprach; aber ich entsinne mich auch, daß er manchmal am Abend rührende Lieder zur Gitarre sang. Das war noch in der guten Zeit, als ihn die Sorgen noch nicht gebrochen hatten. Er liebte Schiller und sprach mit Hochachtung von Gutzkow. Auf einer seiner Reisen hatte er in einem thüringischen Badeort zusammen mit Gutzkow an der Gästetafel gespeist; er erzählte oft mit Stolz davon, und in späteren Jahren, als meine Kämpfe um den Schriftstellerberuf ihn erbitterten, sagte er mir einmal, um vermessene Ambitionen zurückzuweisen, als deren Beute er mich sah: »Was bildest du dir ein? Einen Gutzkow kannst du doch nie erreichen!«
Mitte der achtziger Jahre gründete er eine Fabrik in kleinem Stil, mit geringem Kapital, das er mühselig zusammengeborgt hatte, aber mit großen Hoffnungen. Nach wenigen Jahren machte er Bankrott und wurde dann Versicherungsagent, eine Tätigkeit, die trotz unermüdlicher Anstrengung ihn mit den Seinen kaum über Wasser hielt und ihn außerdem mit dem Gefühl einer gescheiterten Existenz belud. Er hat sein ganzes Leben lang schwer gearbeitet; als ich, dreißigjährig, den Sechsundfünfzigjährigen für einige Wochen zu Gast bitten konnte, zeigte er eine beständige stumme Verwunderung, und beim Abschied sagte er zu mir: »Es waren die ersten Ferien meines Lebens!« Nach Hause zurückgekehrt, starb er, acht Tage nachher.
Meine Mutter starb, als ich neun Jahre alt war. Sie war eine Schönheit, von blondem Typus, sehr sanft, sehr schweigsam. Es wurde mir oft erzählt, daß Fremde, die sich in der Stadt aufhielten, durch den Ruf ihrer Schönheit neugierig gemacht, sie zu sehen begehrten. Es wurde mir auch erzählt, daß ihre Jugendliebe ein Christ gewesen sei, ein Maschinenmeister aus Ulm. Es sind noch Briefe von ihr vorhanden, in denen eine kindlich-volkshafte Schwermut atmet, Poesie der Traurigkeit. Ich entsinne mich noch gut, welche Bestürzung ihr unerwarteter Tod hervorrief, und wie die halbe Stadt ihrem Sarg zum Friedhof folgte.
Beide Menschen, mein Vater und meine Mutter, obwohl gegeneinander sehr verschieden geartet, hatten ein Gemeinsames darin, daß sie ihrer Zeit nicht gemäß waren. Sie kamen von der Romantik her, der Vater als geistiger Spätling, die Mutter im Gemüt davon verdunkelt und beschwert. Bei der Mutter äußerte es sich naturhaft und führte eine tragische Lebensstimmung herbei, beim Vater drang es in das Motorische und war von einem grundlosen, alle Sachverhalte verhängnisvoll verschleiernden Optimismus begleitet, der ihm Enttäuschung über Enttäuschung brachte und seinen Mut und seine Kraft zerstörte.
2
Die meinem Judentum geltenden Anfeindungen, die ich in der Kindheit und ersten Jugend erfuhr, gingen mir, wie mich dünkt, nicht besonders nahe, da ich herausfühlte, daß sie weniger die Person als die Gemeinschaft trafen. Ein höhnischer Zuruf von Gassenjungen, ein giftiger Blick, abschätzige Miene, gewisse wiederkehrende Verächtlichkeit, das war alltäglich. Aber ich merkte, daß meine Person, sobald sie außerhalb der Gemeinschaft auftrat, das heißt sobald die Beziehung nicht mehr gewußt wurde, von Sticheleien und Feindseligkeit fast völlig verschont blieb. Mit den Jahren immer mehr. Mein Gesichtstypus bezichtigte mich nicht als Jude, mein Gehaben nicht, mein Idiom nicht. Ich hatte eine gerade Nase und war still und bescheiden. Das klingt als Argument primitiv, aber der diesen Erfahrungen Fernstehende kann schwerlich ermessen, wie primitiv Nichtjuden in der Beurteilung dessen sind, was jüdisch ist, und was sie für jüdisch halten. Wo ihnen nicht das Zerrbild entgegentritt, schweigt ihr Instinkt, und ich habe immer gefunden, daß der Rassenhaß, den sie sich einreden oder einreden lassen, von den gröbsten Äußerlichkeiten genährt wird, und daß sie infolgedessen über die wirkliche Gefahr in einer ganz falschen Richtung orientiert sind. Die Gehässigsten waren darin die Stumpfesten.
Das zunächst nur als Andeutung. Was die Gemeinschaft anlangt, so fühlte ich mit ihr keinerlei tieferen Zusammenhang. Religion war eine Disziplin und keine erfreuliche. Sie wurde von einem seelenlosen Manne seelenlos gelehrt. Sein böses, eitles, altes Gesicht erscheint mir noch jetzt bisweilen im Traum. Sonderbarerweise habe ich selten von einem humanen oder liebenswürdigen jüdischen Religionslehrer gehört, die meisten sind kalte Eiferer und halb lächerliche Figuren. Dieser, wie alle, bläute Formeln ein, antiquierte hebräische Gebete, die ohne eigentliche Kenntnis der Sprache mechanisch übersetzt wurden, Abseitiges, Unlebendiges, Mumien von Begriffen. Positiven Ertrag gab nur die Lektüre des Alten Testaments, aber auch da fehlte die Erleuchtung, vom Gegenstand wie vom Interpreten her. Vorgang und Gestalt wirkten im Einzelnen, Episodischen, das Ganze zeigte sich starr, oft absurd, ja unmenschlich und war durch keine höhere Anschauung geläutert. Vom Neuen Testament brach bisweilen ein Strahl herüber wie Lichtschein durch eine verschlossene Tür, und Neugier mischte sich mit unbestimmtem Grauen. Jene ewigen Bilder und Mythen befruchteten meine Phantasie erst, als ich in ein privates, sozusagen psychologisches Verhältnis zu ihnen treten konnte, ein Prozeß, der sie individualisierte, im Sinne der Aufklärung geistig machte, oder im Sinne der Romantik stofflich, je nachdem, in jedem Falle von der Religion ablöste.
Um den Gottesdienst war es noch übler bestellt. Er war lediglich Betrieb, Versammlung ohne Weihe, geräuschvolle Übung eingefleischter Gebräuche ohne Symbolik, Drill. Der fortgeschrittene Teil der Gemeinde hatte eine moderne Synagoge gebaut, eines jener Häuser im quasi-byzantinischen Stil, wie man in den meisten deutschen Städten eines findet, und deren parvenühafte Prächtigkeit über die fehlende Gemütsmacht des religiösen Kultus nicht hinwegtäuschen kann. Mir war da alles hohler Lärm, Ertötung der Andacht, Mißbrauch großer Worte, unbegründete Lamentation, unbegründet, weil im Widerspruch mit sichtbarem Wohlleben und herzhafter Weltlichkeit stehend; Überhebung, Pfafferei und Zelotismus. Die einzige Erquickung waren die deutschen Predigten eines sehr stattlichen blonden Rabbiners, den ich verehrte.
Die Konservativen und Altgläubigen hielten ihren Dienst in den sogenannten Schulen ab, kleinen Gotteshäusern, oft nur Stuben in einer entlegenen Winkelgasse. Da sah man noch Köpfe und Gestalten, wie sie Rembrandt gezeichnet hat, fanatische Gesichter, Augen voll Askese und glühend im Gedächtnis unvergessener Verfolgungen. Auf ihren Lippen wurden die strengen Gebete, Anruf und Verfluchung, wirklich, die lastbeladenen Schultern sprachen von generationenalter Demut und Entbehrung, die ehrwürdigen Gebräuche wurden in entschlossener Hingabe buchstabengetreu erfüllt, die Erwartung des Messias war ungebrochener, wenn auch dumpfer Glaube. Aufschwung war auch unter ihnen nicht, Trost oder Innigkeit, oder Glanz oder Menschlichkeit, oder Freude, aber Überzeugung und Leidenschaft war unerbittliche Regel und Gemeinschaft.
In eine solche Schule mußte ich nach dem Tode meiner Mutter, als neunjähriger Knabe, jeden Morgen mit Sonnenaufgang, jeden Abend mit Sonnenuntergang, am Sabbat und an Feiertagen auch nachmittags ein Jahr hindurch gehen, um als Erstgeborener vor der Gebetsgemeinde das Kaddisch zu sagen. Zehn männliche Personen über dreizehn Jahren mußten zu dem Zweck versammelt sein, doch waren es meist alte, uralte Leute, die Übriggebliebenen einer früheren Welt. Es war hart, an Wintermorgen bei Schnee und Kälte, im Sommer um fünf Uhr und früher noch, eine Pflicht zu üben, die aufgenötigt und befohlen war, deren Bedeutung ich nicht begriff oder begreifen mochte. Es gab sich niemand die Mühe, sie dem Geist zu verklären und so die Gefahr zu bannen, daß durch die Befolgung eines als grausam empfundenen Brauches das Bild der Mutter, obschon nur vorübergehend, getrübt wurde. Dazu kam, daß im väterlichen Hause, besonders nach der zweiten Verheiratung des Vaters, von einer religiösen Bindung und Erziehung nicht die Rede war. Gewisse äußerliche Vorschriften wurden eingehalten, mehr aus Rücksicht auf Ruf und Verwandte, aus Furcht und Gewöhnung, als aus Trieb und Zugehörigkeit. Fest- und Fasttage galten als heilig. Der Sabbat hatte noch einen Rest seines urtümlichen Gehalts, die Gesetze für die Küche wurden noch geachtet. Aber mit der wachsenden Schwere des Brotkampfes und dem Eindringen der neuen Zeit verloren sich auch diese Gebote einer von der Andersgläubigen unterschiedenen Führung. Man wagte die Fessel nicht ganz abzustreifen; man bekannte sich zu den Religionsgenossen, obwohl von Genossenschaft wie von Religion kaum noch Spuren geblieben waren. Genau betrachtet war man Jude nur dem Namen nach und durch die Feindseligkeit, Fremdheit oder Ablehnung der christlichen Umwelt, die sich ihrerseits hierzu auch nur auf ein Wort, auf Phrase, auf falschen Tatbestand stützte. Wozu war man also noch Jude, und was war der Sinn davon? Diese Frage wurde immer unabweisbarer für mich, und niemand konnte sie beantworten.
Es war ein trübes Medium zwischen mir und allen geistigen und bürgerlichen Dingen. Bei jedem Schritt nach vorwärts stieß ich auf Hemmnisse und Verschleierungen, nach keiner Richtung hin war offener Weg. Wenn ich sagte, daß ich von Pferch und Helotentum nichts spürte, so bezieht sich das natürlich nur auf die rechtliche Konstruktion des Lebens, auf das individuelle Sicherheitsgefühl, innerhalb dessen sich das Tun und Lassen des einzelnen Menschen reguliert. Sind diese beiden Faktoren einmal gegeben und zugestanden, so wird von ungleich höherer Wichtigkeit für ihn die Frage, wie er sich zur Allgemeinheit verhält und wie die Allgemeinheit zu ihm. Daraus erwächst ihm die Erkenntnis seiner Lebensaufgabe und, je nach der Entscheidung, die Kraft zu ihrer Erfüllung. An diesem Punkt begann denn auch mein Leiden.
3
Der jüdische Gott war Schemen für mich, sowohl in seiner alttestamentarischen Gestalt, unversöhnlicher Zürner und Züchtiger, als auch in der opportunistisch abgeklärten der modernen Synagoge. Erschreckend sein Bild in den Köpfen der Strenggläubigen, nichtssagend in den Andeutungen der Halbrenegaten und Verlegenheitsbekenner.
Wenn meine kindlich-philosophischen Spekulationen den Gottesbegriff zu fassen versuchten, einsames Denken und später Gespräche mit einem Freund, entstand ein pantheistisches Wesen ohne Gesicht, ohne Charakter, ohne Tiefe, Resultat von Zeitphrasen, beschworen allein durch das Verlangen nach einer tragenden Idee. In dem Maß, wie diese Idee sich als unbefriedigend erwies, sei es durch ihre Mittelmäßigkeit, sei es durch ihre geahnte Verbrauchtheit, geriet ich in einen nicht minder billigen und flüssigen Atheismus, der der Epoche noch gemäßer war, dieser Zeit heilloser Verflachung und Verdünnung, die mit verstandener wie mit mißverstandener Wissenschaft Idolatrie trieb und ihre ganze Gedankensphäre durch Bildung verfälschte.
Es war keine leitende Hand für mich da, kein Führer, kein Lehrer. Ich verlor mich in mannigfacher Hinsicht, auch indem ich nach Halt und Gewicht dort suchte, wo der wahrhafte Mensch ihrer entraten kann. Ich hatte mich in einer sowohl entseelten wie auch entsinnlichten Ordnung zurechtzufinden. Ein derartiger Zustand der Welt bedingt entweder die Zweckhaftigkeit bis in den kalten Rausch der Hirne hinein, oder die Phantasie gerät in überschwellende Bewegung, und das Gemüt verliert den Mittelpunkt. Wäre ich nicht als fragender Mensch in sehr frühen Jahren nachhaltig eingeschüchtert worden, so hätte ich Brücken und Übergänge finden können. Konventionen wären wichtig gewesen, leichte und respektierte Formen. Die Mutter war zu bald aus dem Kreis geschwunden, den Vater beraubten Tagesplage und Existenzangst immer mehr des Aufblicks. Er ertrug kaum die auf ihn gerichteten Augen seiner Kinder, denn der Umstand, daß die unablässige Plage ihm, ihm allein, wie er wähnte, keinen Erfolg brachte, erfüllte ihn mit Scham, und er sah immer aus wie vom bösen Gewissen gequält. Es war uns geradezu verboten zu fragen, und Übertretung wurde zuweilen streng geahndet. Daher auch wuchs inneres Unkraut ohne Schranke bei mir. Ich erinnere mich, daß ich in krankhafter Weise an Gespensterfurcht litt, an Menschenfurcht, an Dingfurcht, an Traumfurcht, daß in allem, was mich umgab, eine dunkle Bezauberungsmacht wirkte, stets unheilvoll, stets dem Verhängnis zugekehrt, stets darin bestärkt. Ich war oft in einem alten Hause Gast bei einem alten Ehepaare; der Mann war ein Gelehrter; im Zimmer stand ein Bücherschrank, hinter dessen Glastüre die Werke Spinozas in zahlreichen Ausgaben eigentümliche Verlockung auf mich ausübten. Als ich eines Tages die Frau bat, mir einen Band zu geben, sagte sie mit sibyllenhafter Düsterkeit, wer diese Bücher lese, werde wahnsinnig. Lange noch behielt der Name Spinoza in meinem Gedächtnis den Klang und Sinn dieser Worte. So ähnlich war es auch mit allem Frohen, Spielmäßigen, Festlichen, das zu mir wollte, zu dem ich wollte. Es wurde abgedrängt, verdächtigt, verfinstert. Lust durfte nicht sein.
Wir hatten in der Zeit nach dem Tode der Mutter eine treue Magd, die mich gern hatte. Des Abends kauerte sie gewöhnlich vor der Herdstelle und erzählte uns Geschichten. Ich entsinne mich, daß sie einmal, als ich ihr besonders ergriffen gelauscht hatte, mich in den Arm nahm und sagte: »Aus dir könnt’ ein guter Christ werden, du hast ein christliches Herz!« Ich entsinne mich auch, daß mir dieses Wort Schrecken erregte. Erstens, weil es eine stumme Verurteilung des Judeseins enthielt und damit Nahrung für bereits vorhandene Grübeleien wurde, zweitens, weil der Begriff Christ damals noch ein unheimlicher für mich war, halb atavistisch, halb lebensbang Brennpunkt feindlicher Elemente.
In demselben Gefühl befangen ging ich an Kirchen vorbei, an Bildern des Gekreuzigten, an Kirchhöfen und christlichen Priestern. Uneingestandenen Anziehungen strebten ungewußte Bluterfahrungen entgegen. Dazu kam das erhorchte Wort eines Erwachsenen, Wort der Klage, der Kritik, der Verfemung, Ausdruck wiederkehrender typischer Erlebnisse, warnend und signalgebend in Redensarten wie im täglichen Geschehen. Von der andern Seite wieder genügte ein prüfender Blick, ein Achselzucken, ein geringschätziges Lächeln, abwartende Geste und Haltung sogar, um Vorsicht zu gebieten und an Unüberbrückbares zu mahnen.
Worin aber das Unüberbrückbare bestand, konnte ich nicht ergründen. Auch als ich später dasWesentliche daran erfaßte, wies ich es für meine Person fürs erste zurück. In der Kindheit waren ich und meine Geschwister so verwirkt in das Alltagsleben der christlichen Handwerker- und Kleinbürgerwelt, daß wir dort unsere Gespielen hatten, unsere Gönner, Zuflucht in Stunden der Verlassenheit; in Wohnungen der Goldschläger, der Schreiner, der Schuster, der Bäcker gingen wir aus und ein, am Christfestabend durften wir zur Bescherung kommen und wurden mitbeschenkt. Aber Wachsamkeit und Fremdheit blieben. Ich war Gast, und sie feierten Feste, an denen ich keinen Teil hatte.
Nun war aber das Bestreben meiner Natur gerade darauf gerichtet, nicht Gast zu sein, nicht als Gast betrachtet zu werden. Als gerufener nicht, als aus Mitleid und Gutmütigkeit geduldeter noch weniger, als einer, der aufgenommen wird, weil man seine Art und Herkunft zu ignorieren sich entschließt, erst recht nicht. Angeboren war mir das Verlangen, in einer gewissen Fülle des mich umgebenden Menschlichen aufzugehen.
Da aber dies Verlangen nicht nur nicht gestillt, sondern mit zunehmenden Jahren der Riß immer klaffender wurde zwischen meiner ungestümen Forderung und ihrer Gewährung, so hätte ich mich verlieren, schließlich mich selbst aufgeben müssen, wenn nicht zwei Phänomene rettend in mein Leben getreten wären: die Landschaft und das Wort.
4
Erstickend in ihrer Engigkeit und Öde die gartenlose Stadt, Stadt des Rußes, der tausend Schlöte, des Maschinen- und Hämmergestampfes, der Bierwirtschaften, der verbissenen Betriebs- und Erwerbsgier, des Dichtbeieinander kleiner und kleinlicher Leute, der Luft der Armut und Lieblosigkeit im väterlichen Haus.
Im Umkreis dürre Sandebene, schmutzige Fabrikwässer, der trübe, träge Fluß, der geradlinige Kanal, schüttere Wälder, triste Dörfer, häßliche Steinbrüche, Staub, Lehm, Ginster.
Eine Wegstunde nach Osten: Nürnberg, Denkmal großer Geschichte. Mit uralten Häusern, Höfen, Gassen, Domen, Brücken, Brunnen und Mauern, für mich dennoch nie Kulisse oder Gepränge, oder leerer, romantischer Schauplatz, sondern durch vielfache Beziehung in das persönliche Schicksal verflochten, in der Kindheit schon und später gewichtiger noch.
Wenige Bahnfahrtstunden nach Süden: das hügelige Franken, Tal der Altmühl, wo ich in Gunzenhausen bei Ansbach alle Ferien bei der Schwester meiner Mutter verbringen durfte, alle Sommerwochen des Jahres, oft auch herbst- und winterliche. Die Landschaft von zarter Linienführung, mit Wäldern, die gehegtes inneres Bild nicht so beschämten wie jene anderen; Blumengärten, Obstgärten, Weiher, verlassene Schlösser, umsponnene Ruinen, dörfliche Kirmessen, einfache Menschen. Es ergab sich freie Wechselbeziehung zu Tier und Pflanze; Wasser, Gras und Baum wurden mir wesenhaft vertraut; und so der Bauer, der Händler, der Wirt, der Landstreicher, der Jäger, der Förster, der Amtmann, der Türmer, der Soldat. Hier sah ich sie in reinen Verhältnissen zu ihrer Welt, die auch die meine war, wenigstens nie mich ausstieß. Ich konnte ein Entgegenkommen wagen, weil das organisch Gestimmte und Gestufte arglos macht. Ich lebte gewissermaßen in zwei abgetrennten Kontinenten, mit der Gabe, im lichteren zu vergessen, was mich der finstere hatte erfahren lassen. Dort sozial angeschmiedet, sozial erinnert, an die Kaste gepreßt, Parteiung erkennend, Unbill wissend, im Häßlichen verwoben oder in Altes, Uraltes, Ahnenhaftes, krampfig, scheu, isoliert, meidend und oft gemieden; hier der Natur gegeben, in freundlicher Nähe zu ihr, durch ihren Einfluß, wenn auch immer nur vorübergehend, losgesprochen von nicht abzuwälzender Schuld und Anklagebürde, die sonst lähmend, ja zermalmend hätte wirken müssen.
Über diese beiden Erlebnisgebiete hinaus, als Drittes dann die innere Landschaft, die die Seele aus ihrem Zustand vor der Geburt mit in die Welt bringt, die das Wesen und die Farbe des Traumes bestimmt, des Traumes in der weitesten Bedeutung, wie überhaupt die heimlichen und unbewußten Richtwege des Geistes, die sein Klima sind, seine eigentliche Heimat. Nicht etwa nur Phantasiegestaltung von Meer und Gebirge, Höhle, Park, Urwald, das paradiesisch Ideale der unreifen Sehnsucht, der Aus- und Zuflucht alles Ungenügens an der Gegenwart ist unter der inneren Landschaft zu verstehen, vielmehr ist sie der Kristall des wahren Lebens selbst, der Ort, wo seine Gesetze diktiert werden, und wo sein wirkliches Schicksal erzeugt wird, von dem das in der sogenannten Wirklichkeit sich abspielende vielleicht bloß Spiegelung ist.
In diesem Punkt sich auf Erfahrungen zu berufen, ohne zu flunkern oder zu dichten, ist fast unmöglich. Es handelt sich um Gefühlsintensitäten und um Bilder von unfaßbarer Flüchtigkeit. Beinahe alles zu Äußernde muß sich auf ein »ich glaube« beschränken. Man tastet hin, man ahnt zurück; jede Erinnerung ist ja ein Stück Konstruktion. Es scheint mir zweifellos, daß alle innere Landschaft atavistische Bestandteile enthält, und ebenso zweifellos dünkt mich, daß sie bei den meisten Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt zwischen der Pubertät und dem Eintritt in das sogenannte praktische Leben verwelkt, verdorrt, schließlich abstirbt und untergeht.
Ich war sehr naiv in meiner Abhängigkeit von Traum und Vision. Vision darf ich es wohl nennen, da sich mir unerlebte Zustände, unwahrnehmbare Dinge und Figuren in Greifbarkeit zeigten. Im Alter zwischen zehn und zwanzig Jahren lebte ich in beständigem Rausch, in einer Fernheit oft, die den Mitmirgehenden und -seienden bisweilen nur eine empfindungslose Hülle ließ. Es ist mir später berichtet worden, daß man mich anschreien mußte, um mich als Wachenden zu wecken. Ich hatte Anfälle von Verzückung, von wilder, stiller Verlorenheit, und in der Regel war die Abtrennung so gewaltsam und jäh, daß die Verbindungen rissen, und daß ich wie gespalten blieb, auch ohne Wissen, was dort mit mir geschehen war. In beiden Sphären lebte ich mit geschärfter Aufmerksamkeit, wie überhaupt Aufmerksamkeit ein Grundzug meines Wesens ist, aber es waren keine Brücken da; ich konnte hier völlig nüchtern, dort völlig außer mir sein, auch umgekehrt, und es fehlte dabei alle Mitteilung, alle Botschaft. Das erhielt mich in einer außerordentlichen, mich quälenden und erregenden, für die Menschen um mich meist unverständlichen Spannung. Staunen und Verzweiflung waren die Gemütsbewegungen, die mich vornehmlich beherrschten; Staunen über Gesehenes, Geschautes, Empfundenes; Verzweiflung darüber, daß es nicht mitteilbar war. Vermutlich war meine Verfassung die: ich wußte, daß Unerhörtes oder Merkwürdiges mit mir, an mir, in mir geschah, war aber durchaus nicht imstande, mir oder anderen davon Rechenschaft zu geben. Ich war gewissermaßen ein Moses, der vom Berge Sinai kommt, aber vergessen hat, was er dort erblickt, und was Gott mit ihm geredet hat. Noch heute wüßte ich nicht im geringsten zu sagen, worin eigentlich dies Verborgene, verborgen Flammende, geheimnisvoll Jenseitige bestanden hat; ich muß es für ewig unerforschbar halten, trotzdem es mir lockend erscheint, einiges davon zu ergründen; es müßte dann auch zu ergründen sein, was zu den Ahnen gehört und was zur Erde, was vom Blute kam und was vom Auge, und aus welcher Tiefe das Individuum in den ihm gewiesenen Kreis emporwächst.
Mit der Darstellung dieser Kämpfe und Exaltationen ist ein Verhältnis zum Wort bereits angedeutet und seine Entstehung aus der Not und Notwendigkeit heraus zu erklären. Und wie sehr das Wort Surrogat und Behelf ist, erweist sich in meinem Fall nicht minder offensichtlich, da doch das Ding und Sein, worauf es sich bezog, unbekannt geworden und hinter nicht zu entriegelnder Pforte lag. Ich glaube, daß alle Schöpfung von Bild und Form auf einen solchen Prozeß zurückzuführen ist. Ich glaube, daß alle Produktion im Grunde der Versuch einer Reproduktion ist, Annäherung an Geschautes, Gehörtes, Gefühltes, das durch einen jenseitigen Trakt des Bewußtseins gegangen ist und in Stücken, Trümmern und Fragmenten ausgegraben werden muß. Ich wenigstens habe mein Geschaffenes zeitlebens nie als etwas anderes betrachtet, das sogenannte Schaffen selbst nie anders als das ununterbrochene schmerzliche Bemühen eines manischen Schatzgräbers.
Doch: Kunde zu geben, davon hing für mich alles ab, schon im frühesten Alter. Obgleich die entschwundenen Gesichte mich stumm, geblendet und mit Vergessen geschlagen in die niedrige Wirklichkeit verstießen, wollte ich doch Kunde geben, denn trotz ihrer Ungreifbarkeit war ich bis zum Rande von ihnen gefüllt. Bereits als Knabe von sieben oder acht Jahren geriet ich zuzeiten, meine gewohnte Scheu und Schweigsamkeit überwindend, in zusammenhangloses Erzählen, das von Angehörigen, von Hausgenossen und Mitschülern als halb gefährliches, halb lächerliches Lügenwesen aufgenommen und dem mit Zurechtweisung, Spott und Züchtigung begegnet wurde. An Winterabenden halfen wir Kinder oft der Mutter beim Linsenlesen, und es kam vor, daß ich dabei plötzlich zu phantasieren anfing, in den Linsenhaufen hinein Schrecken, Unbill und Abenteuer dichtete, Gespenstergraus und Wunder, harmlose Nachbarn als Zeugen sonderbarer Begegnungen anführte, mir selbst die höchsten Ehren, höchsten Ruhm prophezeite. Die Mutter, ihre Arbeit ruhen lassend, schaute mich ängstlich verwundert an, ein Blick, der mich noch trotziger in das unsinnig Verworrene trieb. Nicht selten nahm sie mich beiseite und beschwor mich mit Tränen, daß ich nicht der Schlechtigkeit verfallen möge.
Wie ich aber aus eigenem Antrieb und wiederum durch eine Not zum Erzähler von Geschichten mit handelnden Figuren und geschlossener Fabel wurde, muß ich festhalten, weil es weit über den kindlichen Bezirk hinaus auf meinen Weg, auf meine Wurzeln wies.