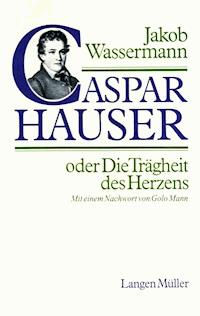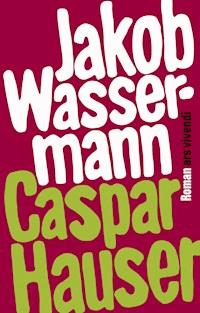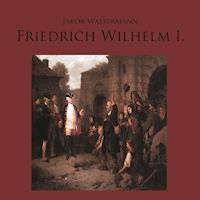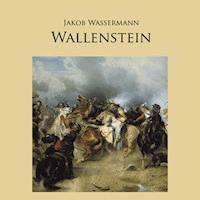Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Etzel Andergast" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Die Senatorin Irlen setzt 1913 durch, dass ihr erkrankter Sohn Johann sich von dem ganz einfachen Hausdoktor Joseph Kerkhoven behandeln lässt. Der junge Arzt überrascht durch stilles und rücksichtsvolles Benehmen, kann aber nicht in das vergiftete Blut hinein, hat die Gewalt nicht und verkleistert seine Ohnmacht mit biederen Redensarten an die Adresse seines neuesten Todeskandidaten. Johann Irlen wird der Freund des wortkargen und verschlossenen Kerkhoven.Major Johann Irlen diente im preußischen Generalstab, unterlag aber 1907 einer Kamarilla und mußte den Abschied nehmen. Danach wurde er kaufmännischer Leiter der Kapellerschen Stahl- und Maschinenwerke. Die Maske des Freundes wirft Fabrikbesitzer Otto Kapeller während eines großen Streiks im Dezember 1910 ab. Es kommt zum unversöhnlichen Zwist. Zudem verwendet sich Irlen für Kapellers Schwester Dagmar, als sie sich dem Bruder nicht fügt. Kapeller beleidigt darauf Irlen während der Arbeiterunruhen in der Öffentlichkeit und wird im Duell von dem Offizier erschossen. Jakob Wassermann (1873-1934) war ein deutsch-jüdischer Schriftsteller. Er zählte zu den produktivsten und populärsten Erzählern seiner Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 993
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Etzel Andergast
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil. Die Vor-Welt
Erstes Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Obschon ich mir bewußt bin, daß die im folgenden erzählten Vorgänge nichts von einer weltbewegenden Katastrophe an sich haben, bin ich doch der Meinung, daß sie beträchtlich in das Leben der Epoche eingreifen; vielleicht stellen sie sogar einen wichtigen Teil jenes Verlaufs dar, den man die innere Geschichte der Menschheit nennen könnte, ein im ganzen genommen wenig erforschter Bezirk. Und wenn die Ereignisse den stürmischen Gang vermissen lassen, der einen solchen Anspruch in den Augen der meisten erst zu rechtfertigen vermag, so ist es möglicherweise die Tiefe, in die sie hinabreichen, wodurch sie den Mangel ausgleichen. Es gibt auch im privatesten Dasein keine Veränderung, die nicht von den größten Wirkungen begleitet sein könnte. Unter Umständen ist es die Minierarbeit einer Kolonie von Mäusen, die einen Berg zum Einsturz bringt.
Der Kreis, den ich zu umschreiben habe, bedeckt eine so ungeheure Fläche, und die Personen, deren Geschicke sich innerhalb seiner Peripherie erfüllen, sind so verschiedenartig und vielschichtig, daß ich schlechterdings daran verzweifle, im einzelnen zu Bild und Figur zu gelangen. Ich muß mich damit abfinden, selbst auf die Gefahr hin, daß mir das Chaos über dem Kopf zusammenschlägt. Ob Figur oder nicht Figur, daran ist zunächst nichts gelegen. Wenn das Element, in dem sie entsteht oder entstehen soll, so stürmisch erregt ist, daß es immer wieder ihre Form und ihren Umriß zerstört, muß man vielleicht seine Aufmerksamkeit mehr auf die Natur der Widerstände richten und erst im Kampf gegen sie die charakteristischen Verschiedenheiten der Individuen festhalten, etwa wie man bei einem Waldbrand rings um ein gefährdetes Anwesen Erdwälle aufschaufelt. Viele behaupten, die Unverwechselbarkeit der Bildung, die man Gestalt nennt, bedeute nichts mehr gegen die Übermacht der Dinge und den Geist der Masse. Am Ende haben sie recht, und es ist unmöglich geworden, aus der einmaligen Art eines Menschen ein gültiges Zeugnis zu schöpfen für seine Zeit und seine Welt. Aber die Entscheidung darüber liegt weder bei ihnen noch bei mir, da walten Gesetze, die zu geheimnisvoll sind, als daß unser kurzer Sinn sie ergründen könnte. Ich weiß nur so viel: der Mensch ist das Dauernde, und aus der Menschenwelt kann ich nicht heraus, sie hängt mir an und umgibt mich wie der Sandhaufen das Sandkorn.
Die Unausweichlichkeit, mit der Irlen seit dem Tage seiner Landung in Europa nach allen möglichen Umwegen und Verzögerungen schließlich zu der Begegnung mit Joseph Kerkhoven geführt wurde, gab ihm später oft zu denken. Je nachdem man metaphysisch gestimmt war, konnte man es Zufall oder Fügung nennen, Instinkt oder Schicksalswillen, es war jedenfalls für ihn wie für Kerkhoven von einschneidender Lebensbedeutung.
Im August 1913 landete er mit einem vom Kongo kommenden Dampfer in Genua. Acht mitgebrachte Kisten enthielten Sammlungen. Er übergab sie einem Spediteur zur Weiterbeförderung nach Deutschland und ließ sie an seine Mutter, Frau Senator Irlen, adressieren. Zugleich schickte er ihr eine Depesche: Seereise glänzend überstanden, komme nächste Woche; dann setzte er sich in den Blauen Zug und fuhr nach Paris.
Warum das? Warum nicht nach Hause? Erstens war dies Zuhause ein wenig fraglich. Bei seiner Abreise von Dresden vor zwei Jahren hatte er seine Wohnung aufgegeben und die Möbel in das Haus der Mutter schaffen lassen, die damals in der Nähe von München wohnte. Vor einigen Monaten war sie, einem ihrer plötzlichen Entschlüsse gehorchend, nach der mitteldeutschen Universitätsstadt übersiedelt, wo ihr Enkel Ernst Bergmann lebte, sein Neffe also, der sich dort als Privatdozent der Philosophie habilitiert hatte. Er bewohnte mit seiner jungen Frau und einem einzigen Kind eine geräumige Villa, deren Erdgeschoß er schon immer für die Großmutter freigehalten hatte und wo auch der zurückgekehrte Irlen, wenn ihn nicht andere Pläne daran hinderten, alle Bequemlichkeit und Ruhe finden konnte, die er sich nach so vielen Beschwerden vermutlich wünschte. So hatte er ihm in einem etwas trockenen und korrekten, dabei außerordentlich respektvollen Brief geschrieben. Aber Irlen hatte augenblicklich geringe Neigung, sich in provinzstädtisches Leben zurückzuziehen, das vielleicht trotzdem störende Anforderungen an ihn stellte.
Diese Überlegungen hätten ihn aber nicht allein zu dem launenhaft scheinenden Entschluß veranlassen können. Er hatte Angst, sogleich nach Deutschland zu gehen. Es war ein Gefühl in ihm, als müsse er zuerst einmal Vorposten beziehen. Er war auf den Eindruck, den ihm Europa machen würde, ungeheuer gespannt gewesen. Er empfand Europa als einheitliches Gebilde, will sagen, in seiner umgewandelten Vorstellung in der Ferne war es nach und nach in ein solches verschmolzen. Er wollte die Probe machen. Gab es eine Möglichkeit, für diese halb geistige, halb sehnsüchtige Konstruktion Stützen zu finden, so war, dünkte ihn, Paris der einzige Ort dafür. Er liebte Paris, er liebte Frankreich. Deutschland war in ihm, ja, er hätte beinah in anderssinniger Abwandlung eines berühmten Wortes sagen können: Deutschland bin ich. Aber das war nicht das wirkliche Deutschland, es war ein geträumtes. Vor dem wirklichen eben hatte er Angst. Das ging weit zurück, war unlöslich mit seinem Charakter und seinem Leben verwoben.
Er verbrachte einen Vormittag im Louvre, den Nachmittag bei den Bücherantiquaren auf dem Linken Ufer, schlenderte über die Boulevards, saß zu den Mahlzeiten in stillen, kleinen Tavernen, immer mit dem Bewußtsein: hinter mir Wildnis, gewaltig Unvergeßbares, Urwelt, Urwald, Urmensch. War er nicht fast erneuert oder doch verwandelt daraus hervorgegangen, weiser, wissender, erfahrener, gehärteter? Voller erschloß sich nun die gehütete und geschichtlich geschichtete Welt, ergriffener schaute er die vertrauten Dinge an, die erlauchten Werke, die gepflegten Gärten, die Dome, Paläste und alten Gassen. In der Stimmung gesammelten Selbstbesitzes, der zugleich Hingegebenheit ist, merkte er nicht, daß er allenthalben auffiel durch seine imposante Gestalt, die kaffeebraune Gesichtsfarbe und die jünglinghafte Geschmeidigkeit seiner Bewegungen und seines Ganges, die in überraschendem Gegensatz zu dem mit Silberfäden untermischten, aus der mächtigen Stirn in peinlicher Glätte zurückfließenden Haar stand. Er sah aus wie ein hoher Marineoffizier in Zivil, der so lange auf See war, daß ihm das feste Land auf Schritt und Tritt erstaunlich und neu ist. Es kam vor, daß ihn ein halbes Dutzend Gassenjungen verfolgte, um ihn neugierig anzustarren. Dann lächelte er bloß geduldig, nach Art der Riesen, die gegen die Zwerge von traditioneller Gutmütigkeit sind.
Die ungeheure Stadt war wie ein Wesen, das mit einer vernehmlichen Stimme sprach. Wer aufmerksam lauschte, dem verkündete sie etwas von der Seelenverfassung des ganzen Kontinents, der Bluttemperatur und der Geistesstimmung seiner Völker. Lange Einsamkeit und Sammlung hatten Irlens Nerven befähigt, auf die feinsten Schwingungen dieses bewegten Organismus zu antworten. Was er zu spüren glaubte, wenn er die Zeitungen las oder die durch die Straßen flutende Menge beobachtete oder nachts bei offenem Fenster in die brausende Dunkelheit hinaushorchte, entzog sich jeder Benennung, war aber beunruhigend wie Meldung von Gefahr. So intensiv wird es nur von dem empfunden, der fremd unter den Menschen ist. Einzelnes Schicksal ist ausgelöscht, und die Gesamtheit bekommt etwas von einer schlagenden Glocke. Vor der Reise zum Kongo war Paris Irlens letzte Station gewesen, jetzt war es die erste; beide Male war es wie Ausschau von einem Wartturm, damals nach rückwärts, heute nach vorwärts. Damals war er vor einer Art Selbsterprobung gestanden, das heißt, er wollte darüber klarwerden, ob er es war, der versagt hatte, oder seine Welt, seine Erziehung, seine Ideale; heute besaß er für sich hinlänglich Gewähr, aus vielen Gründen, seine Welt hatte er neuerdings zu prüfen.
Werfen wir einen Blick auf das »Damals«. Deutschland um 1910 glich einem engen, hohen Haus mit vielen Stockwerken, die untereinander wenig Verbindung hatten, während innerhalb eines jeden der einzelne unter schärfster Aufsicht von allen stand. Das war ein System, wenn man will, war es sogar ein Symptom. Fragte man in gewissen Kreisen nach Johann Irlen, etwa weil der Name da und dort mit besonderer Betonung genannt wurde, so konnte man die widersprechendsten Auskünfte bekommen. Zum Beispiel die: einer von den vielen heimlichen Kaisern, die es bei uns gibt; durch ererbten Reichtum anmaßend geworden, haben sie ihre Hände überall und gefallen sich mit ihren Anhängern in einer hochmütigen Exklusivität. Oder die: Unsicherer Kantonist, geschaßter Offizier, verdächtig, liebäugelt mit allem Ausländischen, protegiert Künstler und Literaten, hat politische Ambitionen, jedenfalls ein gefährlicher Kopf. Oder, von einem würdigen Herrn vielleicht, der dabei die Stirn runzelte und vorsichtig die Stimme dämpfte: Bedenklicher Mann, sehr bedenklicher Mann, von der andern Seite, wissen Sie (Zwinkern), Verführer unserer jungen Leute, fliegen ihm zu wie Motten dem Licht, und er macht sich kein Gewissen daraus, sie dem Staat, der Familie, der bürgerlichen Gemeinschaft zu entfremden.
Man konnte aber auch, freilich seltener und von Seltenen, ganz anders klingende Urteile hören: hoher Geist, lauterer Charakter, mutiger Mensch; kein Wunder, daß alle Kröten vor Wut platzen, wenn er mit stolzer Geringschätzung durch den Pfuhl übler Nachrede schreitet.
Zweifellos war er eine Persönlichkeit, die durch entschiedene Herzenskraft und eigenwillige Bildung ungewöhnlich anziehend wurde. Die das Glück hatten, ihn näher zu kennen, sprachen von ihm wie von jemand, von dem Großes zu erwarten ist. Er war Wege gegangen wie ein verstoßener Fürst, der langsam erwählte Anhänger um sich sammelt, denen er mythisch wird, wenn er ihnen von Zeit zu Zeit in einen andern Bezirk seines Lebens entschwindet. Irlens Freunde, das war ein Begriff, dem etwas von einem geheimen Orden anhaftete, eine Gruppe für sich, aristokratisch abseits, dem Gang der Dinge unmerklich aber heftig widerstrebend.
Bis 1907 hatte er, zuletzt mit Majorsrang, im preußischen Generalstab gedient. Er gehörte zu der kleinen Zahl von Offizieren, die, voller Ahnung, vor dem Einbruch der schamlosen Phrase mit allen ihren Folgen in schmerzlichem Ekel zurückwichen. Es war eine Fronde, die von der vulgären Übermacht erdrückt in sich selbst zerfiel. Er hatte erbitterte Gegner, meist dunkle und heimliche, die nichts unversucht ließen, ihm zu schaden. Seine freundschaftliche Beziehung zu einem Prinzen des kaiserlichen Hauses lieferte einer Kamarilla, die schon längst auf der Lauer lag, die gewünschten Waffen. Er mußte den Abschied nehmen. Der Anlaß war ihm willkommen, ihm war die Freiheit kein Hohlraum.
Er widmete sich vielseitigen Studien. Die Hälfte des Jahres war er auf Reisen, gewöhnlich im Ausland, allein oder mit Freunden. Er wollte Distanz gewinnen. Er hatte ein angstvolles Gefühl von der Brüchigkeit der Fundamente. Seine nächsten Freunde wußten, wie es um ihn stand. Er litt an Deutschland. Deutschland war ihm eine bittere Frucht, die niemals reif und süß werden wollte. Er litt in der Fremde, wenn er um der Zugehörigkeit willen für diejenigen seiner Landsleute eintreten mußte, die ihrerseits durchaus nicht darunter litten, daß sie die Nation kompromittierten. Er litt zu Hause noch viel mehr, weil ihn alles so tief anging, was ihn so tief verletzte. Das Reich war ihm eine Idee, in einem andern Sinn, als sie die Bismarcksche Welt verwirklichte, in einem alten, hohen Sinn, wobei die Geschichte ein Weiterzeugendes war und die Pflicht des gegenwärtigen Augenblicks den Jahrhunderten die Verantwortung von den Schultern nahm. Das macht prophetisch: wissen was gewesen ist und sehen was ist; Gegenstand unendlicher Gespräche zwischen ihm und den Freunden. Einer war darunter, den er um diese Zeit allen übrigen vorzog und auf dessen Zukunft er große Hoffnungen setzte. Es war Otto Kapeller, einziger Sohn von Andreas Kapeller, einer Großmacht, Herrn eines Reiches im Reich, Hauptaktionärs der Kapellerschen Stahl-und Maschinenwerke. Der offensichtliche gute Einfluß, den der Verkehr mit Irlen auf Otto übte, und die Art, wie der junge Mensch seinen Freund und Führer schilderte, erregte in Andreas Kapeller das Verlangen, sich diesen Irlen vorstellen zu lassen. Er war so angetan von der Bekanntschaft, daß er ihm eines Tages den Vorschlag machte, in die Industrie überzugehen, das heißt in seinen Betrieb einzutreten. »Leute wie Sie such’ ich mit der Laterne«, sagte er, »wir verkommen in der Routine, und wissen Sie warum? Weil wir das blödsinnige Prinzip haben, daß jeder Schuster bei seinem Leisten bleiben muß.« Der Versuch lockte Irlen, und der Industriemagnat hatte sich nicht getäuscht. Der neue Volontär entwickelte im Verwaltungs-und äußeren Dienst so ungewöhnliche Fähigkeiten, daß ihm Andreas Kapeller nach sechs Monaten die kaufmännische Leitung der gesamten Werke antrug. Er erbat sich Bedenkzeit, Otto drängte, da nahm er an. Wenige Stunden, bevor den Alten in der Jahresversammlung des Aufsichtsrats der Schlag rührte, unterschrieb er den Vertrag.
Es war eine Überraschung für seine Freunde, für viele eine Enttäuschung. Sie konnten sich einen Irlen, der nicht nach freiem Ermessen seine Zeit verschenkte, nicht mehr vorstellen. Allerdings, in diesem Punkt war er nun zur Sparsamkeit verhalten. Sein Tag hatte sechzehn Stunden Arbeit. Er begann um sieben Uhr morgens mit Besprechungen, Kommissionen, Inspektionen und endete mit Sitzungen am späten Abend. Er nächtigte ebenso oft im Schlafwagen wie in seinem Bett, verhandelte bald mit Ämtern und Banken in Berlin, bald mit den Abgesandten eines Trusts in Paris; ein Telegramm, ein Telefonanruf konnte ihn zwingen, sich ins Auto zu setzen und im Hundertkilometertempo das nächste Schiff zu erreichen, das von Vlissingen oder Hoek nach England ging. Was ihn jedoch nicht hinderte, seine Studien weiter zu führen, wichtige neue Bücher zu lesen, gelegentlich die Freunde bei sich zu sehen oder zu besuchen und junge Menschen, die seine Hilfe suchten, nach Kräften zu fördern. Daher stammte dann auch die Meinung, mit seiner vielbestaunten Arbeitsleistung sei es eigentlich nicht weit her, das ganze Kunststück sei eine virtuos aufgezäumte Geschäftsfähigkeit. Dummes Geschwätz. Nein, das Kunststück war, daß er sich die Zeit gehorsam zu machen verstand und sich nicht von ihr tyrannisieren ließ; weil er nicht keuchte, glaubten die Esel, es sei nichts mit ihm los, und weil er zwischen einer Konferenz mit dem Vertreter des Eisenbahnministeriums und einer Beratung mit den Ingenieuren Muße fand, bei einem Sammler ein interessantes Bild zu besichtigen, erklärten ihn die »ernsten Männer« nicht für »seriös«.
Was aber hatte er im Sinn gehabt, als er sich unter das Joch beugte? Macht? An Macht war ihm nicht gelegen. Was er zu erlangen wünschte, war genau das, was er erlangte: Einblick, Erfahrung, Aufschluß. Er wollte nicht mit dem Ungefähr vorlieb nehmen: Gehörtes, Behauptetes, Überliefertes, Gelesenes genügte ihm nicht. Er brauchte das Unmittelbare und den Augenschein. Er wollte wissen, wie das Volk lebte und unter welchen Bedingungen es arbeitete, und er erfuhr es. Er wollte die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die sozialen Abhängigkeiten, die politischen Richtpunkte, die Haltung der Parteien, das Verhältnis zwischen Kapital und Ware, zwischen Erzeuger und Verzehrer in einem bezeichnenden Ausschnitt und in diesem besondern geschichtlichen Moment kennenlernen, am eigenen Leibe nämlich, und er lernte sie kennen. Er hatte so viel gedacht, mit den Freunden so viel gesprochen, so viel theoretisiert und philosophiert, nun wollte er Gewißheit haben und sehen, wie es stand: mit ihm, mit seinen Träumen, mit seiner Klasse, mit der Nation.
Wie es mit Otto Kapeller zu dem unversöhnlichen Zwist kam, der mit dem Pistolenduell endete, bei dem der junge Industrielle tot auf dem Platz blieb, darüber wurde Zuverlässiges nie bekannt. Vermutungen gab es genug. Als Irlen ein halbes Jahr später die afrikanische Expedition ausrüstete, wurde sogar die kindische Fabel verbreitet, Otto habe von dem Plan gewußt, und weil er den unentbehrlichen Mann nicht verlieren wollte, habe er sich dem Projekt widersetzt und sich schließlich zu Drohung und Beleidigung hinreißen lassen. Manche Leute wunderten sich, daß Irlen bei seinem oft genug kundgegebenen Abscheu vor diesem barbarischen Mittel, einen Streitfall zu schlichten, sich zu dem Zweikampf überhaupt bereit gefunden hatte. Am meisten verübelt wurde es ihm von den Arbeitern, die er durch seine Haltung für sich eingenommen hatte. Es war Verrat und Selbstverrat in ihren Augen, wenn er wirklich der war, der er geschienen, In-die-Knie-Brechen vor den verknöcherten Ehrbegriffen seiner Kaste. Natürlich war es etwas anderes als ein bloßer »Streitfall«, rätselhaft, was; seine Beweggründe waren jedenfalls die allerzwingendsten. Erst viel später sickerten Andeutungen der Wahrheit durch, Gerüchte über eine unheimliche Veränderung, die mit Kapeller vorgegangen war, so als ob sich mit dem Herrentum und der damit verbundenen Machtfülle sein Charakter aus der ursprünglichen Anlage geradezu ins Gegenteil verkehrt hätte. Um diese Zeit schrieb Irlen an Robert Waldstetten in Dresden, den Sohn seines Vetters, einen der jüngsten seines Kreises: »Ich erlebe eine Metamorphose, die meine Anschauungen über die Konstanz jener Summe von Eigenschaften, die wir Charakter nennen, gründlich über den Haufen wirft. Es ist ein gespenstischer Vorgang, Du kannst es mir glauben, mich schaudert. Hast Du einmal nachgedacht über den Einfluß von Standesvorurteilen, Lohnforderungen, Aktien und Repräsentation auf die Fettbildung eines Menschen? Ich ja. Wir steuern einer Herrschaft der Stiernacken und der feisten, blassen Gesichter zu. Ich sehe einen Kampf bis aufs Messer voraus zwischen den Cäsars aus Fett und den Brutussen, die der Haß bei ihrer Magerkeit hält.«
Über den letzten Zusammenstoß mit Otto Kapeller als einer Tatsache, die sich öffentlich abspielte, lagen natürlich authentische Nachrichten vor. Er erfolgte in den Januartagen 1911, während des großen Streiks. Man hatte, überflüssigerweise, um militärischen Schutz ersucht. Der Kommandant der alsbald von Köln herübergeschickten Husarenabteilung hatte durch Anschlag verkünden lassen, er werde bei der geringsten Zusammenrottung den Befehl zum Schießen geben. Der hochfahrende Ton des Manifests erbitterte Irlen. Gegen Abend, als einige hundert Streikende mit fast beängstigender Lautlosigkeit in einen der Fabrikhöfe drangen, ließ der Offizier die Eskadron unter Feuerbereitschaft treten. Irlen stürzte ans Fenster eines Seitengebäudes und rief mit durchdringender Stimme hinunter: »Halt, übereilen Sie nichts, die Leute wollen ja verhandeln!«
Da schallte Otto Kapellers Stimme von einem gegenüberliegenden Tor höhnisch zurück: »Ruhe da oben!« Und nach einer unheilträchtigen Pause: »Oder vielleicht machen Sie mit Direktor Irlen den Anfang, Herr Rittmeister.«
Der einzige, der je erfuhr, warum Irlen die sogenannte ritterliche Form der Genugtuung gewählt hatte, war Joseph Kerkhoven.
Er schrieb an Freunde in Wien, er wolle am übernächsten Tag mit ihnen beisammen sein. Noch ein Mittel, die Heimkehr hinauszuschieben. Er hatte niemand in Paris besucht; für den letzten Nachmittag nahm er sich vor, den Maler Girard aufzusuchen, den er von früher her kannte. Als er in dem alten Montmartre-Haus die steilen Treppen zum Atelier hinaufstieg, bekam er auf einmal so starkes Herzklopfen, daß er im Zwischenstock innehalten und sich aus dem Fenster lehnen mußte, um Luft zu schöpfen. Das war neu. Was war los? Noch nie hatte ihm das Herz störend bemerkbar gemacht, daß es arbeitete, auch bei den ärgsten Strapazen im Urwald nicht. Offenbar vertrug er die Pariser Backofenhitze schlecht, und er hatte die Nerven durch ein Zuvieltun gereizt, vor dem er sie in den Tropen vorsichtig zu schützen sich gewöhnt hatte.
Am Abend, während er auf der Gare de l’Est zum Zug schritt, griff er plötzlich mit beiden Händen nach einem wildfremden Menschen und hielt sich an ihm fest. Mit ein wenig Schweiß auf der Stirn stammelte er eine Entschuldigung. Der Überrumpelte starrte ihn erstaunt an. Er straffte sich, atmete tief, lächelte betreten. Schwindelanfall. Für die Dauer von fünf Sekunden der Kopf leer wie eine Blase, die Kehle abgeschnürt von Angst. Und wieder: Na, was ist los? Ein Gespenst schlich um ihn herum. Widerwillig fingen die Gedanken an, sich mit ihm zu beschäftigen. Jetzt entsann er sich, daß er schon auf dem Schiff zwei-oder gar dreimal einer ähnlichen Attacke ausgesetzt war. Auch schon in Boma, wollte ihn dünken. Ja, auch in Boma. Er hatte Chinin genommen. Dort war Chinin beinahe ein Nahrungsmittel.
Im Schlafwagen befühlte er seinen Puls. Hundertzehn. Er lehnte den Kopf zurück und dachte: Schön, und wie nennt sich das Gespenst? Es gab ein Vierteldutzend, die einem Furcht einflößen konnten, welches war’s?
Er erzählte den Freunden in Wien von einem Avisibbaneger, der ihn am Fluß Ituri vom Tod durch einen Schlangenbiß gerettet hatte. »Es gibt dort Pflanzensäfte, die nur Eingeweihte kennen«, sagte er, »der Mann pflückte das Kraut, zerkaute es im Mund, bis es ein grüner Brei war, den strich er mit feierlichem Gemurmel auf die kaum sichtbare Wunde. Ich hatte von derartigen Kuren gehört, aber ich war skeptisch, meistens ist man verloren, auch Ausbrennen nützt nichts, das Gift ist zu rasant. Man wird da unten furchtbar gleichgültig gegen den Tod. Immerhin war ich gespannt, mir war zumut, als müsse sich’s jetzt entscheiden, ob das Land mich gelten ließ, ob es mich annahm oder nicht, ihr versteht das vielleicht…«
Er stockte. In seinen Ohren sauste es, wie wenn er neben einem Wasserfall stünde. Der Blick war stier. Vor den Augen tanzten zahllose geeckte, schwarze Würmchen. (Oder in den Augen drinnen.) Kurze Zeit verlor er das Gliedergefühl, die Gelenke lockerten sich in den Pfannen. Unruhe überkroch ihn von unten bis zur Brust. Seine Selbstbeherrschung war aber so groß, daß die Gäste kaum etwas merkten. Als er den Anfall bezwungen hatte, wischte er sich lächelnd den Schweiß von Gesicht und Hals und setzte seine Erzählung fort.
Am andern Morgen ging er zu Professor K., berühmtem Internisten. Sorgfältige Untersuchung von Herz, Lunge, Leber, Milz, Harn, Augenschleimhaut, Schlund; Lidreflexen, Patellarreflexen, zwei Stunden lang. Zum Schluß versicherte ihm der Professor mit jener gutmütigen Nachsicht, mit der erfahrene Ärzte hypochondrisch gestimmten Patienten begegnen, er sei der gesündeste Mensch von der Welt. »Hätten Sie mir nicht selbst gesagt, verehrter Herr Major, daß sie vierundvierzig sind, ich hätte Ihnen nach Organbefund und Habitus höchstens fünfunddreißig gegeben.« Er verschrieb ein Medikament, empfahl Ausspannung, kohlensaure Bäder und drückte ihm zum Abschied gleichsam beglückwünschend die Hand. Daß er aus dem tropischen Innerafrika kam, hatte Irlen allerdings unterlassen, ihm zu sagen. Und hatte dabei ein Gefühl, als wäre ihm eine List gelungen.
Drei Tage blieb er verschont. Fast war er geneigt zu glauben, der Arzt habe das Übel durch bloße Leugnung beschworen. Es gibt eine Selbstentzündlichkeit von Krankheiten durch Furcht. So dachte er. Die Einladung der Geographischen Gesellschaft zu einem Vortrag lehnte er ab, und da ihn die Zeitungsberichterstatter ausfindig gemacht hatten und ihn um Interviews bestürmten, fuhr er am Abend des dritten Tages nach Berlin, ziemlich zuversichtlich gestimmt.
Da kam es wieder. Es fing damit an, daß er es in keinem geschlossenen Raum aushielt. Tagsüber lief er gehetzt durch die Straßen. In der Nacht war er benommen, verworrene Bilder liefen im Gehirn wie auf einer Drehscheibe. Einmal zuckte er lauschend auf. Er hatte eine Stimme gehört. Eine Stimme hatte ihm zugeraunt: Afrika rächt sich. »Warum?« Unbeantwortbar, warum. Wie wenn er ihm uralte Geheimnisse entrissen hätte. Als er, gegen Morgen, wieder klaren Kopfes war, vertiefte er sich, den Bleistift in der Hand, in eine Integralrechnung. Probe, ob er seinem Gehirn noch trauen konnte.
Er hatte keinen Antrieb. Viele Bekannte wären froh gewesen, ihn zu begrüßen; was ihn abhielt, zu jemand zu gehen, war die Erinnerung an den Zwischenfall in Wien. Als der Kellner das Frühstück brachte, war es Kaffee anstatt Tee. Er hatte Tee bestellt. Das Blut stieg ihm zu Kopf, er geriet in unbegreifliche Erregung und schrie den verdutzten Menschen wutverzerrt an. Mitten im Ausbruch begann er zu zittern und preßte die Hand an die Stirn. »Verzeihen Sie«, murmelte er, »es ist… ich bin nicht ganz wohl.« Blaß und argwöhnisch zog sich der Mann zurück. Nach einer Weile brachte ein anderer den Tee. Er berührte nichts. Er saß am Fenster und schaute auf den Wilhelmplatz hinunter. Die Steinhäuser rings; absurd, daß er Menschen von hoch oben sah, die sich bewegten, wie wenn Bilderbuchkäfer auf Hinterbeinen schreiten.
War es eine Unordnung der Seele, daß er sich des kleinen Galagos-Äffchens entsann, das er im Urwald gefangen? Es hatte sich zärtlich an ihn angeschlossen. Kirikiri hatte er es genannt. Eines Tages war das Tierchen wahnsinnig geworden. Nicht toll, wirklich wahnsinnig, wie ein Mensch. Ergreifend die Melancholie, das menschenhafte Insichhineinschluchzen und trostlose Im-Kreis-herum-Schleichen. Kranker Geist in einem Affen, was ist dann Geist, und was ist er im Menschen, sobald die unergründlich boshafte Natur das gebrechliche Gefäß verletzt, darin er wohnt? Und so steht es mit jeder Zerstörung von dorther, die Natur erschafft ein wundervoll zartes Gefäß und lauert tückisch darauf, an welcher Stelle es den ersten Sprung bekommt, um es wieder in amorphen Stoff zu verwandeln.
Er ließ sich am Telefon mit Doktor Ahrens verbinden, Generalarzt am Friedrich-Wilhelm-Institut. Er kannte ihn seit vielen Jahren; vertrauenswürdiger Mann, auch von wissenschaftlichem Ruf. Er hatte ein Buch über pathologische Physiologie geschrieben, das in Fachkreisen bemerkt worden war. Er bat Irlen für drei Uhr nachmittags zu sich, überrascht, so unvermutet seine Stimme zu hören, und empfing ihn in der großen, düsteren Stube einer altmodischen Junggesellenwohnung in der Jägerstraße. Irlen berichtete. Afrika zu unterschlagen war hier unmöglich, Doktor Ahrens wußte ja um die Reise. Trotzdem war ihm jedes Wort lästig. Es klang wie auswendig gelernt. Man suchte ärztlichen Rat, auch wenn der Anlaß unbedeutend war; aus Denkfaulheit schließlich; der Körper ist ein Feigling. Kleines Lächeln. Doktor Ahrens hörte aufmerksam zu. Er ließ sich nicht täuschen, da steckte was dahinter. »Der negative Befund des Wiener Kollegen sollte ja genügen«, meinte er, »der Wiener Kollege ist ein großer Mann, was er nicht finden konnte, werd’ ich auch nicht finden. Trotzdem wollen wir eine Blutuntersuchung machen.«
Irlen nickte. Es empfehle sich vielleicht, erwiderte er mit verschleiertem Blick, gewisse Protozoen, oder wie man diese Leute nenne, würde man wohl vor die Linse kriegen; Malaria habe er gleich im ersten Vierteljahr eingewirtschaftet, der entgehe keiner. Natürlich sei ihm bekannt, daß es gewisse Abarten gebe, sogar noch wenig erforschte und um so gefährlichere, das wisse er und sei darauf gefaßt. »Nun, hoffen wir das beste«, sagte der Generalarzt unüberzeugt. »Schüttelfröste?« erkundigte er sich, indem er sich wie zufällig bückte, um eine Sicherheitsnadel vom Teppich aufzuheben. – »Nein, bis jetzt nicht.« – »Einen Moment, Herr Kamerad…«, er umschloß mit Daumen und Zeigefinger Irlens Nacken und drückte leise, »Schmerz?« – »Nein.« – Die beiden Männer blickten einander schweigend an. In dem Schweigen lagen alle Möglichkeiten zwischen Leben und Tod.
Die Blutentnahme geschah am andern Morgen im bakteriologischen Saal. Ein Assistent stach mit der Skalpellspitze in Irlens Ohrläppchen und fing einen winzigen Tropfen Blut im Deckglas auf. Das war alles. Das Ergebnis sollte er am Abend erfahren. Falls sich Fieber einstellte, verordnete Doktor Ahrens zwei Gramm Chinin, ebensoviel an den folgenden vier Tagen. Injektion erübrige sich zunächst, da er ja vermutlich die Dosis vertrage.
Sonderbarerweise wartete Irlen das Resultat nicht ab. Ins Hotel zurückgekehrt, schrieb er an den Generalarzt ein paar Zeilen und bat ihn, den schriftlichen Befund an die Adresse seines Vetters, des Geheimrats Waldstetten in Dresden, zu schicken, eine dringende Angelegenheit verlange seine sofortige Abreise. Vorwand. Mit dem Geheimrat war er nie gut gestanden, nur mit dem Sohn, ich erwähnte es bereits, verband ihn Freundschaft, dem jetzt fünfundzwanzigjährigen Robert. Aber eine Stunde vorher hatte er noch nicht daran gedacht, ihn aufzusuchen.
Er hatte depeschiert, Robert holte ihn vom Bahnhof ab, glücklich, Irlen für sich zu haben. Die Geheimrätin war in Marienbad zur Kur, der Geheimrat den ganzen Tag im Ministerium beschäftigt. Den Abend verbrachten sie in der Oper, danach saßen sie noch lange beisammen. Irlen fühlte sich leidlich wohl. Robert fiel der brennende Glanz seiner Augen auf, aber er hielt es für ein geistiges Feuer. »Du bist noch wunderbarer geworden, Onkel Irlen«, sagte er mitten im Gespräch und mußte über seine Begeisterung selber lachen.
An Schlaf war nicht zu denken. Robert hatte ihm das Manuskript seiner Doktor-Dissertation gegeben, eine historische Abhandlung über die endogene Tragik im Hohenstaufenschicksal. Darin las er. Es berührte ihn. Beim Nachsinnen lag seine ungewöhnlich schmale und knöcherne Hand dunkelbraun auf dem weißen Papier. Den Ringfinger schmückte ein alter Ring aus goldenen Kettengliedern. In der Haltung der Finger drückte sich etwas Bestimmtes aus, ungefähr wie wenn nach einer aufgeregten Versammlung fünf zusammengehörige Leute still nach Hause gehn. Wieviel Feinheit und Kunst in dieser Schrift, ging es ihm durch den Kopf, wieviel Adel und Stil; aber wie soll er damit bestehn? Es ist alles Erbe, vergeblich wird er um den Besitz ringen. Das erste Morgenlicht zwängte sich durch den Spalt zwischen den Gardinen, als er sich zum dutzendsten Male aufrichtete, um den Druck loszuwerden, der auf seiner Brust lastete wie ein Sack Blei.
Er hatte kaum am Frühstückstisch Platz genommen, da brachte ihm Robert einen Brief mit rotem Eilpoststreifen. Auf dem Umschlag stand als Absender das Institut. Irlen legte ihn neben seine Tasse und schien ihn zu vergessen, während er mit Robert über dessen Arbeit sprach. Nach einer Weile wurde der junge Mensch unaufmerksam, mit einem Seitenblick auf den Brief sagte er: »Willst du ihn nicht lesen? Eine wichtige Nachricht wahrscheinlich …« – »Das könnte sein«, antwortete Irlen freundlich, »aber unter uns, ich glaube, es ist besser, ich lese ihn nicht.« Er schmunzelte ein wenig, nahm den Brief und riß ihn mitten durch; dann die Teile wieder und wieder. Das ganze Schnitzelwerk knüllte er in der nervösen Faust zusammen, erhob sich und warf es ins Ofenloch. »Manche Briefe muß man gar nicht aufmachen«, sagte er leichthin, »man weiß im voraus, daß sie Unheil anrichten.« Robert sah verwundert drein, aber er konnte nichts erwidern, da sein Vater eintrat, um endlich den Gast zu begrüßen.
Irlen hatte kaum zwanzig Worte mit dem Geheimrat gewechselt, als er schon wußte, daß er am Nachmittag reisen würde. Das war es ja, was er kaum ertrug, dieses: »Na, auch wieder im Lande?« Und: »Woher? Wohin? Wie geht’s? Wie steht’s?« Und: »Ja, du machst dir’s bequem, guckst aus der Loge zu, unsereiner muß schuften.« Und: »So ‘n bißchen Globetrotten möchte mir auch mal gefallen.« Alles mit der jovialen Miene eines Klassenvorstands, der unschlüssig ist, ob er die Allotria eines sonst nicht übel qualifizierten Schülers billigen soll oder nicht. Robert saß auf Nadeln. »Wenn du gestattest, laß ich dich mit Vater allein«, wandte er sich steif an Irlen und verschwand. Der Geheimrat war seiner selbst gegen Irlen so sicher, daß er den Ton der Überlegenheit für einen Beweis herzlichen Wohlwollens hielt. Im Grunde betrachtete er ihn als einen Fahnenflüchtigen, der sich in eine Abenteurerexistenz gerettet hatte, ohne dadurch seinen Wunsch nach Geltung zu befriedigen. Nach der Anschauung seiner Kreise war man gesellschaftlich gescheitert, wenn man nur mit einem Schritt die Bahn verließ, die durch Geburt und Besitz vorgezeichnet war. Die Verständigung war daher etwas so Schwieriges, daß jedesmal ein »moralischer Ruck« dazu nötig war. Mit diesem »Ruck« erkundigte er sich nach Tante Viktorine, Irlens Mutter; als Irlen gestand, daß er sie noch nicht gesehen habe, trotzdem seit seiner Ankunft in Europa zweieinhalb Wochen verflossen waren, machte der Geheimrat große Augen. Er wußte nicht recht, was er sagen sollte; einerseits war er versucht, den ihm unbegreiflichen Mangel an Pietät zu rügen, da er sich als die berechtigte Instanz dafür hielt, dem Alter und der sozialen Stellung nach, andererseits schüchterte ihn Irlens Art immer ein wenig ein; um nun seine Unzufriedenheit zu bekunden, wählte er einen minder heiklen Angriffspunkt, nämlich die Heirat Ernst Bergmanns mit der geborenen Martersteig. Er wundre sich, daß Irlen es ohne Einspruch habe geschehen lassen, die Eheschließung habe ja noch vor seiner Reise stattgefunden. Da Irlen schwieg, verfiel der Geheimrat in nörgelndes Herumreden. Ernst sei zweifellos ein feiner Kopf, habe auch überraschend schnell Karriere gemacht, scheine aber doch ein bißchen weltfremd, bißchen hoch gestimmt, gegen den Namen Martersteig möge im allgemeinen nichts einzuwenden sein, obwohl… Irlen unterbrach ihn mit der trockenen Feststellung, er kenne Marie kaum, erinnere sich ihrer nur flüchtig, ihr Vater sei immerhin eine Persönlichkeit von Rang gewesen, »und«, fügte er hinzu, sich schroff erhebend, »ein Mann, dem ich viel zu verdanken habe.« Der Geheimrat gab sich den Anschein, als habe er dieses gewichtige Indiz vergessen. »Jawohl ja«, rief er und schlug sich gegen die Stirn, »du hast ja eine Zeitlang fleißig dort verkehrt. War er nicht…« – »Einer unserer ersten Staatsrechtslehrer, gewiß«, sagte Irlen und betrachtete aufmerksam seine Fingernägel. – »Aber politisch nicht ganz zuverlässig, wenn mir recht ist … Radikale Neigungen, was? Demokrat? oder täusche ich mich?« – »Nein, du täuschst dich nicht. Es blieb ihm nichts übrig als die Opposition. Ein ungewöhnlicher Geist und ein großer Charakter. Wäre er uns nicht so früh entrissen worden, er hätte dem Land noch große Dienste geleistet. Wie die Dinge zu liegen scheinen, hätte er freilich auf Dank niemals zu rechnen gehabt.« Das war hinlänglich deutlich. Der Geheimrat räusperte sich. Mit gerunzelten Brauen warf er hin: »Das ist Ansichtssache, ich behalte mir meine vor. Jedenfalls hat die Person, die Marie, keinen Knopf Geld gehabt, und nicht nur das, die Verhältnisse waren auch so zerrüttet, daß dein Neffe fünfundzwanzigtausend Mark nachgelassene Schulden bezahlen mußte. Das hat natürlich einen schlechten Eindruck gemacht. Die Heirat war ein Fehler. Der gute Ernst hätte sich eine ganz andere Position schaffen können durch eine vernünftige Verbindung.« Er schüttelte betrübt den Kopf. Seine rigoroses Mißvergnügen galt nicht dem Einzelfall, sondern der gefährdeten Ordnung überhaupt. Es war die Zeit, wo der Beamte anfing allmächtig zu werden und in der Stille bereits den Diktator spielte.
Während der langen Fahrt im D-Zug verfiel Irlen in einen dumpfigen Halbschlaf, der ihn mit der Vision quälte, der geheimrätliche Vetter stehe mit Gewehr und aufgepflanztem Bajonett im Wagengang, um Beweise für seine sträfliche Gesinnung zu finden. Wenn sie nur den Dünkel nicht hätten, dachte er niedergeschlagen, und das physische Leiden, das er von seinem Bewußtsein abhalten wollte, flüchtete ins seelische hinein; diesen siebenfach gepanzerten Dünkel, wenn sie nur den nicht hätten; er riecht wie Aas und schmeckt wie Leim, er ist ihre Narrenkappe und unser Schafott. Wer uns doch davon befreien könnte! Als ob das schlaflos träumende Auge sich ins Widerspiel versenken wollte, erschien ihm das Äffchen Kirikiri, rührend traurig, weil es nach einer Nuß gegriffen hatte, wo nichts als leere Luft war; dann ein ungeheurer Baum, einer von den Urgiganten, wie sie nur dort entstehen; ein Baumwollbaum; grau und feierlich steigt er empor wie die Säule einer Kathedrale im Abendzwielicht. Um den dornenbesetzten Stamm tanzen im Reigen zahllose nackte, ölglänzende Wambutti, Zwergneger; indem er hinstarrte, wurden sie kleiner und kleiner, schließlich mikroskopisch klein, wie Protozoen so klein …
Er kam zu seiner Mutter ins Haus wie ein verwundeter Wolf, der sich in die erstbeste Höhle schleppt, um sich zu verbergen.
Zweites Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Marie Bergmann erhielt die Nachricht, daß Irlen aus Genua telegrafiert habe, von ihrem Mann. Vor Erregung wurde sie blaß. Seit Jahr und Tag hatte sie auf die Kunde von seiner Rückkehr gewartet, es war eine fortgesetzte innere Spannung gewesen, eine unbewußte; umso stärker empfand sie jetzt die Freude, in der sie sich löste.
Zum ersten Male hatte sie ihn als Sechsjährige bei ihrem Vater gesehen. Es war niemand aufgefallen, wie sie auf einem Schemel in der entferntesten Zimmerecke gesessen war und jedes seiner Worte begierig trank. Er hatte sie dann freundlich angeredet, und man hatte ihr gesagt: »Das ist Onkel Irlen, Marie, gib ihm die Hand.« Niemand erfuhr, daß sie noch lange nachher, wenn sie am Abend gebetet hatte, mit scheuer Andacht die zwei Worte in der Dunkelheit flüsterte: »Onkel Irlen … Onkel Irlen.« Jedesmal, wenn er kam, wußte sie es einzurichten, daß sie ihn wenigstens einen Augenblick sehen konnte. Dann vergingen Jahre, sie war schon vierzehn, als sie ihm in Bad Ems wiederbegegnete, wo er den Vater besuchte, der zur Kur dort weilte. Und schließlich, während ihrer Verlobungszeit, hatte sie ihn im Hause der Senatorin Irlen in Dresden als wirklichen Onkel begrüßen dürfen. Sie hatte nicht den Eindruck gehabt, daß ihm die verheiratete Verwandtschaft etwas bedeutete. Im Gegenteil; es schien, daß es in seinen Augen mehr war, Marie Martersteig als Marie Bergmann zu sein. Aber in ihren Augen war Ernst Bergmann vor allen andern jungen Leuten dadurch ausgezeichnet, daß er Johann Irlens leiblicher Neffe war. So stellte er gleichsam die Verbindung mit den höheren Mächten der Welt dar. (Vergessen wir nicht, daß sie achtzehn Jahre alt war, als sie sich verlobte, sie hatte gerade die Matura hinter sich.) Sie kannte Irlens Lebensweg ziemlich genau. In den letzten Jahren hatte sie alles mit Aufmerksamkeit verfolgt, was in den Zeitungen über ihn zu lesen stand, denn seine Afrikaexpedition hatte die Federn in Bewegung gesetzt. Gelegentlich las ihr die Senatorin Irlen Stellen aus seinen Briefen vor. Er schrieb freilich selten an seine Mutter. Das Verhältnis war kein besonders inniges. Als die alte Dame auf das Bitten der Enkelkinder in der Bergmannschen Villa ihr Quartier aufschlug, war sie ziemlich verwundert darüber, daß an ihre Wohnung anschließend drei geräumige Zimmer für Johann Irlen eingerichtet wurden. Es geschah auf Maries planvolles Betreiben. Sie hatte ihren Mann nach und nach dafür gewonnen. Sie wollte dem Zurückkehrenden ein Heim geben, gleichviel ob er es dauernd oder flüchtig in Besitz nahm. Die Senatorin war ohnehin den größten Teil des Jahres auf Reisen. Sie hatte kein Sitzfleisch. Sie hielt es nirgends lange aus. Sie nannte sich selbst einen unverbesserlichen Vagabunden. Sie war in Japan, in China, in Mexiko gewesen. Überall in Deutschland hatte sie Freunde und war beständig von einer Familie zur andern unterwegs. Etwas von der Unruhe ihres Bluts hatte sich wohl auf ihren Sohn Johann vererbt.
Ernst Bergmann hatte keine tiefere Zuneigung für seinen Onkel Irlen. Er achtete ihn hoch, er beugte sich willig vor seiner geistigen Überlegenheit, aber vieles in seinem Wesen war und blieb ihm fremd, seine politische Haltung war ihm sogar antipathisch, da er selbst trotz seiner Jugend durchaus konservativ gestimmt war und jede Befehdung des Bestehenden ablehnte. Zudem war er katholisch erzogen und konnte eine so durch und durch protestantische Natur wie die Irlens nicht verstehen. Er gab es gerechterweise selbst zu. Bei alledem hütete er sich sorgfältig, Marie in ihrer Verehrung für ihn irre zu machen. Dazu war er zu zurückhaltend, zu vornehm, und hauptsächlich war seine eigene Verehrung für Marie viel zu groß, als daß er Einspruch oder Kritik gewagt hätte. Nur über die Natur dieses Gefühls dachte er zuweilen nach, es zu enträtseln schien ihm schwierig. Es war wohl eine zu einfache Empfindung für seinen an denkerischen Problemen geschulten Geist. Anhänglichkeit, Idealisierungsbedürfnis, Übertragung der Liebe zum Vater auf den Freund des Vaters, das alles war es nicht, konnte es wenigstens nicht ausschließlich sein. Sie war allerdings eine richtige Vaterstochter, ganz in Vaters Bild geworden, und als ihr der abgöttisch geliebte Mensch durch den Tod geraubt worden, hatte sie den ihr ähnlich Scheinenden auf das leere Postament gestellt. So konnte es sein. Erotische Bindung konnte es keinesfalls sein. Bei ihren sicheren Instinkten, unmöglich. Sie war so geartet, daß die Irlensche Art sie von ihm trennen mußte wie ein Wasser ohne Brücke. Davon war er überzeugt. Sie selbst zu fragen hatte nicht viel Zweck. Sie ging so schwer aus sich heraus. Sie war zu intimen Mitteilungen nicht zu bewegen. Sie schaute einen dann mit so verwunderten Augen an, daß man sofort das Gefühl hatte, ihr zu nahe getreten zu sein, und das gesprochene Wort am liebsten zurückgenommen hätte.
Sie hätte ihm sagen können: einen Menschen verehren, an einen Menschen glauben, ist das nicht Erklärung genug? Es ist das Glück schlechthin, das Wunder. (Schließlich war es seine Schuld, wenn er das nicht verstand, muß man denn so etwas ausdrücklich sagen?) Ja, man kann sich krank sehnen nach Verehrung. Auch ein Kind kann es. Als sie ihn zum ersten Male sah, erschien er ihr wie der Graf Almaviva, das Vornehmste, wovon sie wußte. (Der Vater hatte sie kurz vorher zu Figaros Hochzeit mitgenommen.) Sie saß da, starrte ihn an und hatte innerlich den Wunsch, aufzustehen und sich dreimal zu verneigen, wie sie es in Tausendundeiner Nacht gelesen hatte. Er machte eine Bemerkung, die sie nie vergaß. Es gibt Worte, die im Blut bleiben, trotzdem vielleicht nichts Besonderes an ihnen ist. Sie sah ihn vor sich, in der dunkelblauen Uniform, Interimsrock mit der doppelten Reihe Knöpfe, er kam aus dem anstoßenden Zimmer, wo kein Licht war (er hatte ein Buch dort liegenlassen), und sagte zum Vater: wenn ich durch ein finsteres Zimmer gehe, spür’ ich das ganze Universum auf der Haut. Das hatte unheimlich geklungen, unheimlich wahr, das ganz, ganz Wahre wirkte immer unheimlich auf sie. Später hieß sie ihn nicht mehr Almaviva bei sich, sondern Hyperion. Es war keine Schwärmerei. Es war auch keine Lesefrucht. Dazu war sie ganz und gar nicht der Charakter. Man stellt einen bewunderten Menschen so hoch wie möglich, weil man hinaufsehen will. Ist das so schwer zu begreifen?
Nein, sie gehörte nicht zu denen, die sich in Gedichtetem spiegeln. Davon war sie weit entfernt. Sie fand sich manchmal darin. Sie griff manchmal in einer Not danach, das konnte vorkommen. Als sie ungefähr sechzehn war, lief eine possierliche Anekdote über sie um. Die Mutter ihrer liebsten Freundin, die Konsistorialrätin L’Allemand, war eine ungemein aktive Philanthropin, sie hielt sich auch für eine große Rednerin und sprach gern in Versammlungen. Maries Vater, der sehr witzig sein konnte, hatte einmal von ihr gesagt: »Die gute Frau hat etwas von einem auf Humanität dressierten Gendarm, der auszieht, Menschen aus Wohltätigkeit zu verhaften.« Wenn ihr Marie bei ihrer leidenschaftlichen Geschäftigkeit zusah, kam sie ihr wie jemand vor, der auf einem Brandplatz mit dem Flederwisch herumgeht und voll wütendem Eifer die Asche wegfegt. Eines Tages hatte die Rätin sie und ihre Tochter Tina, Maries Freundin, in ein Meeting mitgeschleppt. Sie stand auf der Tribüne und donnerte ihre Rede mit solcher Lungenkraft und solchem Wortschwall in den Saal, daß Marie sich zu Tode schämte. Zwischen Menschen eingekeilt, konnte sie nicht davonlaufen; da wußte sie sich keinen andern Rat, um das gräßliche Zeug nicht mit anhören zu müssen, als hundertmal nacheinander »Füllest wieder Busch und Tal still mit Nebelglanz, lösest endlich auch einmal meine Seele ganz« vor sich hin zu sagen. Sie hatte es Tina nachher gestanden.
Sie kannte Ernst Bergmann seit ihrem dreizehnten Jahr. Er verkehrte im L’Allemandschen Hause, da er mit Tinas beiden Brüdern befreundet war. Sie hatte ihn stets gern gehabt. Jahrelang hatte sie nichts anderes als einen Jugendgespielen in ihm gesehen, den älteren Kameraden. Daß er seinerseits sie mit andern Gefühlen betrachten, daß eine schicksalsvolle Leidenschaft in ihm entstehen könnte, daran hatte sie nie mit einem Gedanken gedacht. Sie war spröd wie alle Unerweckten. In ihrer Führung und Haltung hatte sie eher etwas von einem starkherzigen und etwas verträumten Knaben als vom jungen Mädchen. Niemals hatte sie Flirts gehabt. Sie war so wenig gefallsüchtig, daß sie schon vollkommen zufrieden war, wenn man ihr versicherte, sie sei nicht häßlich. Anbeten, das konnte sie, heimlich bewundern, die herrlichsten Bilder um einen Menschen spinnen und tagelang Pläne schmieden, wie sie es bewirken konnte, einen Blick von ihm zu erhaschen; an diesem Punkt machten Phantasie und Wunsch unbedingt halt. Wahrscheinlich hat Ernst Bergmann sie von der ersten Begegnung an geliebt. Sie war ein höheres Wesen für ihn, unnahbare Diana. Es lag an seiner noblen Gehaltenheit, an seinen Anschauungen von Verantwortlichkeit und Ehre, daß er sein Gefühl als strenges Geheimnis in sich verschloß. Er war reich, einziger Erbe eines großen Vermögens. Der Reichtum dünkte ihn eher ein Hindernis, Marie zu gewinnen, als ein Vorteil, er wußte, wie stolz sie war, wie einfach erzogen, wie wenig sie sich aus Geld und Luxus machte. Indessen die Fügung war für ihn. Eines Tages mußte er für längere Zeit verreisen und nahm Abschied von ihr. In einem Augenblick des Selbstvergessens küßte er sie auf den Mund. Marie war zuerst sprachlos, dann lächelte sie glücklich-bestürzt, dann küßte auch sie ihn. Sie hielt die tiefe Zuneigung, die sie für ihn empfand, für Liebe. Als sie heirateten, schloß sie die Ehe mit einem zärtlich geliebten Bruder.
Woche um Woche verging, sie dachte: am Ende kommt er überhaupt nicht. Was soll ein Irlen in der dummen kleinen Stadt hier? Doch wartete sie, Tag für Tag. Sie ordnete Blumen in den Vasen und prüfte die Zusammenstellungen immer wieder, immer mit dem Hintergedanken, ob sie seinen Geschmack zu treffen fähig sei. Bisweilen trat sie vor den Spiegel, um sich mit den Augen des kritischsten Beschauers zu betrachten, den sie sich nur vorstellen konnte. Sie tat es nicht aus Eitelkeit, sie tat es aus Furcht. In der Furcht, dem zu mißfallen, dessen Urteil alles war, mißfiel sie sich mehr als je. Noch dazu bin ich eine Frau, dachte sie bekümmert, also doppelt reizlos für ihn. Vor ihrer kleinen Bücherei stehend, strich sie mit den Fingerspitzen über die glatten Rücken der Einbände und überlegte, ob er die Auswahl gutheißen würde. Dieses da und dieses liebte sie, ob er damit einverstanden wäre? Täglich zu einer bestimmten Stunde ging sie mit dem Kind auf dem Glacis spazieren, manchmal allein, manchmal von der Pflegerin begleitet. Wie soll ich’s anstellen, daß er Interesse für Aleid faßt? ging es ihr durch den Kopf. (Der richtige Name des Kindes war Adelheid, Johanna Adelheid, die ungewöhnliche Form Aleid hatte sie gewählt, um es den Leuten möglichst zu erschweren, eine Diminutiv-und Koseform daraus zu machen, der bündige Zweisilber setzte Großmüttern und Tanten jedenfalls den größten Widerstand entgegen.) Ein schönes Kind, unleugbar; mit seinem braunroten Lockenhaar, das wie oxydiertes Kupfer aussah, glich es einem venezianischen Putto. Sie erinnerte sich, daß er kleine Kinder nicht leiden mochte. Sie war einmal dabei gewesen, wie ihm eine Dame der Gesellschaft ihr dreijähriges Bübchen präsentiert hatte. Er hatte ein so hilfloses und erschrockenes Gesicht gemacht, daß sich die junge Mutter, mit gutem Humor übrigens, beeilt hatte, das störende Wesen zu entfernen. Schade, dachte sie, womit soll ich ihn fesseln oder erfreuen?
Die Aufgabe für Irlen war, der Mutter seinen Zustand zu verheimlichen. Er überschätzte die Schwierigkeit keineswegs. Sie war eine kühle Natur und von ihren eigenen Angelegenheiten mehr beansprucht als von fremden. Auch um ihre Kinder hatte sie sich über die pflichtmäßige Betreuung hinaus nie viel gekümmert. Vor Johann hatte sie großen Respekt, war in gewisser Weise stolz auf ihn, fühlte sich aber, was Lebensführung, Grundsätze, Urteile über Menschen und Dinge betraf, durch eine Welt von ihm getrennt, verhehlte es auch nicht. Der einzige, den sie ins Herz geschlossen hatte, war Ernst Bergmann. Nach dem Tod der Tochter und des Schwiegersohns, seiner Eltern, die beide bei einem Schiffsunglück im Mittelmeer umgekommen waren, hatte sie versucht, Mutterstelle an ihm zu vertreten, mit unzureichenden Kräften und vielleicht auch überflüssigerweise, denn er war damals schon ein junger Mann von neunzehn Jahren gewesen; aber die bloße Bemühung hatte alle Leute erstaunt, die sie näher kannten, und ihr Gefühl für den stillen, artigen, feinnervigen, charakterfesten Enkel hatte seitdem nichts an Zärtlichkeit eingebüßt, sie fand ihn musterhaft in jeder Beziehung, er war auch der einzige Mensch, dem sie mit Aufmerksamkeit zuhörte, wenn er mit ihr sprach. Über seine Heirat hatte sie sich zuerst gebührend entrüstet, aber nachdem sie sich überzeugt hatte, daß Marie in der Tat eine passende Gefährtin für ihn war, und sie sich sonst nicht übel mit ihr verstand, hatte sie sich zufrieden gegeben. »Eine muß es sein, und die bessere ist besser als die schlechtere«, pflegte sie zu sagen. Sie hatte bereits eine Menge Bekannte in der Stadt, von denen sie Irlen gleich am ersten Tag erzählte. Da waren zum Beispiel Gaupps, reizende Leute, Professor Gaupp, Theolog (»daran darfst du dich nicht stoßen, es ist eine Wissenschaft wie jede andere«), sie werde sie einmal zum Tee bitten, höchst gebildet alle beide, die Frau eine geborene Hiller von Hillersheim (»du erinnerst dich vielleicht, die Hillersheim, die im Jahre sieben den großen Erbschaftsprozeß hatten«). Irlen dachte höflich nach, aber er konnte sich nicht erinnern.
Nein, sie sah ihm nichts an, sie merkte nichts. Groß und stattlich stand sie da, eine Krone schneeweißen Haars auf dem Haupt, einen alten Goldschmuck am Hals, verbindlich-würdig, Bild der Gesundheit, des Behagens an der Welt und an sich selbst. Sie kannte weder Kummer noch Sorge.
Er packte die Kisten aus, wobei das häufige Bücken zur Folter wurde, katalogisierte einzelne Stücke gleich und brachte sie in dem nach dem Garten zu gelegenen Zimmer unter, das etwas kleiner als die andern war. Die Papiere mußten geordnet werden, Notizbücher, Zeichnungen, Stöße von Fotografien. Länger als eine Stunde konnte er’s nicht aushalten, dann mußte er sich hinlegen, schweißüberströmt. Hatte sich der Puls beruhigt und war das schwarze Flimmern vor den Augen vorüber, dann begann er von neuem, bis zum nächsten Erschöpfungsanfall. Er hatte einen Diener aufnehmen wollen, unterließ es jedoch, um nicht von fremden Augen überwacht zu werden. Zu Bergmanns hatte er seine Karte hinaufgeschickt, am nächsten Tag wollten sie ihn begrüßen, er hatte sie bitten lassen, erst am Sonntag zu kommen. Um längeres Zusammensein mit der Mutter zu vermeiden, hielt er sich an geregelte Mahlzeiten, er schützte eine dringliche Arbeit vor, Beitrag für einen geographischen Jahresbericht.
Die Tage waren noch erträglich, das Schlimmste spielte sich in der Nacht ab, die Hochglut des Fiebers, er hatte schon 39,7 gemessen, das gräßliche Ameisenlaufen über Arme und Schenkel, die Erstickungsängste. Er nahm Chinin in Löffeln, das gewöhnliche Quantum war längst überschritten, aber die stärksten Dosen blieben wirkungslos. Er erwog den Gedanken an Abreise. Doch wohin? Er würde den Schwächeeinbrüchen erliegen. In eine Anstalt, sich den Experimenten der Ärzte unterwerfen, monatelange Krankenhaft auf sich nehmen für eine unsichere Hoffnung? Vielleicht half die Zeit, vielleicht die Natur. Das Übel hatte seine Perioden, seine Kurven, oft kam gerade dann Erleichterung, wenn man meinte, beim nächsten Zugriff sei alles aus. Das kannte man. (Er glaubte in jenen Tagen noch an eine der schweren Formen von tropischer Malaria.) Und versagte die Natur, was sollte die Wissenschaft ausrichten mit ihrem Ungefähr von Regel und Nachweis? Man wird den vorbestimmten Tod sterben, das ist alles.
Allein das Schwere ist nicht der Tod, sondern der Gang zum Tod.
Da er nachmittags zwischen fünf und sieben noch am meisten auf sich zählen konnte, bestimmte er diese Stunde für den Besuch des jungen Paares. Als sie kamen, entschuldigte er sich lebhaft, daß er nicht schon bei ihnen gewesen war, doch sei er von der Reise noch ermüdet und könne sich kaum entschließen, das Zimmer zu verlassen. »Ein entzückendes Heim, das ihr euch da geschaffen habt«, sagte er und blickte Marie forschend an, als sei er unsicher, wie diese das etwas unartige »ihr« aufnehmen würde. Aber die Sprache gab keine Möglichkeit, das Du für Ernst und das Sie für die junge Frau in der Anrede auseinanderzuhalten. Marie war außerordentlich gehemmt. Sie nahm ein paarmal einen Anlauf, etwas nicht ganz Törichtes oder Banales zu sagen, aber es gelang auf keine Weise. Da begnügte sie sich, einfach da zu sein und um seine Nähe zu wissen. Ernst sprach über die Verhältnisse an der Universität, über die verschiedenen studentischen Gruppen und die Beeinflussungen, denen sie unterlagen. Er übte Kritik nie. Er stellte alles sachlich und möglichst wahrhaftig dar. Er sprach gut, mit einer weichen, angenehm diskreten Stimme. Marie betrachtete ihn aufmerksam und sogar etwas neugierig, gleichsam mit Irlens Blicken. Seine schmale, flache Stirn stand unter dem korrekt gescheitelten, blonden Haar wie ein reines Blatt Papier. Die Stirn war das Auffallendste und das Edelste an ihm. Der Mund war groß und unschön. Wenn er lächelte, sah man das blasse Zahnfleisch. Es war, als koste ihn jedes Lächeln immer erst einen kleinen Entschluß. Er ist ungeheuer sympathisch, schloß Marie ihre ängstliche Musterung und atmete beruhigt auf. Irlen lauschte seinem Neffen mit artigstem Interesse. Bisweilen wandte er sich mit einer Frage an Marie, wobei er ihr nicht in die Augen, sondern auf den Mund sah. Sie hatte dieselbe Beobachtung schon bei andern Menschen gemacht; sonst war es ihr gleichgültig, wenn nicht lästig, in diesem Fall hob es ihr Selbstgefühl. Sie hatte ein ungemein gewinnendes Lächeln, die Lippen entblößten dann in einem hübsch gebogenen Oval die kräftigen Zähne (ich will nicht behaupten, daß starke Zähne bei Frauen immer ein Zeichen von Verstand sind, aber dumme Frauen haben in der Regel Zähne wie eine Maus), und ihre Züge erhellten sich in einer fast ansteckenden sinnlichen oder sinnenhaften Lebensfreude. Sie bemerkte in Irlens Gesicht Zeichen von Ermüdung und gab ihrem Mann einen Wink. Sie verabschiedeten sich. Als sie in ihrer Wohnung waren, fragte Ernst: »Findest du ihn nicht sehr gealtert?« – »Ich weiß nicht«, antwortete Marie betroffen, »kommt es dir so vor? Er sieht wundervoll aus.« – »Ja, er sieht aus wie die Ritter auf mittelalterlichen Grabmälern.« Marie dachte ein wenig nach, dann nahm sie seinen Kopf zwischen beide Hände, vielmehr sie berührte nur seine Wangen mit den Fingern und hauchte einen Kuß auf seine Stirn. Es war eine charakteristische Liebkosung, die genau ihr Gefühl zum Ausdruck brachte.
Unter den Dutzenden von Briefen, die auf Irlens Schreibtisch lagen, war einer, dessen Beantwortung er nicht hinausschieben wollte. Die Freunde hatten erfahren, daß er zurückgekehrt war, jeder wollte Nachricht haben. Sie mußten sich gedulden. Nur diesen einen, den er seit zwanzig Jahren kannte und der vor einer heiklen Lebensentscheidung stand, durfte er nicht warten lassen. Sein Brief war von der liebenswürdigsten Ausführlichkeit, und nachdem er mit seiner eilenden, schwachgrundierten, rundungreichen Schrift viele Seiten über die Angelegenheit des andern geschrieben, berichtete er auch von sich selbst, hauptsächlich von der Schwierigkeit, dort wieder fruchtbar anzuknüpfen, wo er vor mehr als zwei Jahren die Fäden so jäh abgeschnitten hatte. Von seinem körperlichen Leiden keine Silbe. Wozu auch? War er invalid, so hatte er abzudanken wie die spartanischen Könige, die ihre Würde nur so lange innehatten, als sie stark und wehrhaft waren. Kranksein hieß verzichten und die Geschäfte berufeneren Händen übergeben. Pflege dich, wenn du siech bist, laß dich pflegen, aber verlange nicht von der Welt, daß sie noch mit dir rechnet. Der Schnellzug muß seine Fahrzeit einhalten, die Passagiere können sich nicht darauf einlassen, auf einen zurückgebliebenen Mitreisenden zu warten.
An ernste Krankheit hatte er im Innersten bis jetzt nicht geglaubt. Als er am nächsten Morgen aus somnolentem Zustand mit einem schmerzhaften Druck im Nacken erwachte und die tastenden Finger eine Geschwulst unterschieden, war ihm zumut, als ob er langsam in eine mit Schleim gefüllte Grube sinke. So eisernen Gemüts war er nicht, um die Bedeutung des Zeichens unbeachtet zu lassen, so unerfahren nicht, um danach an der bisherigen, immerhin noch glimpflichen Annahme festzuhalten. Ein wenig später zog er das durchnäßte Hemd vom Leib und bemerkte auf der Brust drei handtellergroße ziegelrote Flecken.
In der zweitfolgenden Nacht erwachte Marie gegen drei Uhr, und es kam ihr vor, als habe sie im Schlafe beständig über Johann Irlen nachgedacht. Etwas beunruhigte sie an ihm, aber sie wußte nicht was. Der hohe Begriff, den sie in all den Jahren von seiner Person in sich getragen, hatte sich bestätigt, noch über ihre Erwartung hinaus. Definieren konnte sie den Eindruck nicht, aber es war alles so selbstverständlich, und das Selbstverständliche hat keine Formel. Seine Nähe gab ihr ein Gefühl vollkommenen Einklangs, sie entsann sich nicht, je ein so geistiges Glück verspürt zu haben. Das Sonderbare dabei war, daß ihr seine körperliche Erscheinung beinah gänzlich aus dem Gedächtnis entschwand, schon beim Verlassen des Zimmers hatte sie sich besinnen müssen, wie er aussah; das passierte ihr sonst nie, konnte sie doch den gleichgültigsten Menschen, der ihr in Gesellschaft begegnet war, oft noch lange nachher bis auf die unscheinbarsten Einzelheiten beschreiben. War es das, was sie beunruhigte, dieses Zerfließen der Form in das Empfundene hinüber? Sie vermochte es nicht zu ergründen.
Da hörte sie dumpfes Stöhnen, als ob im Garten jemand hilflos läge. Es war eine schwüle Nacht, das eine Fenster stand weit offen. Sie richtete sich auf und lauschte: wieder. Behutsam schlüpfte sie aus dem Bett, eilte zum Fenster und beugte sich hinaus. Wieder. Die Kronen der Bäume ragten still und schwarz, der Springbrunnen rieselte. Sie konnte feststellen, woher der Laut kam: aus dem offenen Fenster schräg unten, aus Irlens Schlafzimmer. Ihr Mund verzog sich bang. In unregelmäßigen Pausen wiederholte sich das dumpfe Stöhnen unaufhörlich. Sie ging ins Zimmer zurück, warf hastig den Schlafrock über, schlich auf Zehenspitzen zur Tür, um ihren nebenan schlafenden Mann nicht zu wecken, lief in den Flur, riß an der Eingangstür den Sperrhaken aus der Schiene, rannte barfuß die teppichbelegte Treppe hinaus und läutete unten, zweimal, dreimal, zuletzt so lange, daß die Spitze des Zeigefingers auf dem Taster weh tat. Endlich erschien ein verschlafenes Mädchen, sie schob es beiseite, um die Großmutter zu wecken. Aber die war bereits aufgestanden, sie trat eben aus ihrem Zimmer und fragte ungehalten nach dem Grund der nächtlichen Störung. »Geh mal sofort zu Onkel Irlen hinein, Großmutter«, stammelte Marie, »ich glaube, er braucht jemand …«
Irlen lag im Pyjama zusammengekauert, die Knie an den Bauch gedrückt, auf dem Diwan. Er war dorthin gekrochen, aus dem glühendheißen Bett herausgekrochen. Er sah zu, wie aus einer Hüftenwunde sein Blut rann. Es war eine eingebildete Wunde, sie ähnelte jener des gekreuzigten Christus. Das Blut floß in ein riesiges Marmorbecken, wo es sich als scharlachroter Teich ausdehnte, dessen Oberfläche in konzentrischen Ringen vibrierte. Die Bewegung wurde durch zahllose langschwänzige Geschöpfe verursacht, die sich wie Aale durcheinander schlängelten und die er nur deshalb wahrnehmen konnte, weil seine Augen als Mikroskope funktionierten. Er konnte beobachten, wie sie sich verdickten und aufschwollen, offenbar nährten sie sich vom Rot des Blutsees, denn an den Stellen, wo sich größere Massen von ihnen zu Knäueln geballt hatten, verwandelte sich das Rot in ein schleimig-bleiches Grau. Er hatte das Bedürfnis zu schreien, brachte es aber nur zu erstickten Kehllauten, und als er feststellen wollte, was ihn am Schreien verhinderte und den Unterkiefer anrührte, fand er, daß die Muskeln dort steinstarr waren. Er hörte vier Schläge vom Domturm aus der Stadt und empfand eine melancholische Befriedigung darüber, daß sich ihm die Zeit noch verkündete. Auf einmal wurde es hell, das elektrische Licht war aufgedreht worden. Er wandte das Gesicht ab, als er seine Mutter erkannte. Marie saß regungslos auf einem Stuhl im Vorplatz. Bei Tagesanbruch war der Anfall vorüber. Die Senatorin ging mit unerwarteter Energie ins Zeug. Die Versuche Irlens, sie zu beschwichtigen, schlugen fehl. Umsonst bemühte er sich, sie glauben zu machen, es sei die übliche Tropenmitgift und der Höhepunkt bereits überschritten (was er bis vor drei Tagen selbst geglaubt, heute nicht mehr), sie ließ sich nicht beirren. Sie sagte: »Wozu haben wir die größten Kapazitäten bei der Hand?« und wollte gleich nach dem Frühstück den Professor L. anrufen, den Kliniker. Irlen beschwor sie, es zu unterlassen. Um ihr zu beweisen, daß er die Sache nicht vernachlässigt, erzählte er von der Ordination bei Ahrens in Berlin. »Nun?« fragte die alte Dame. »Und?« – »Er hat mir genaue Verhaltungsmaßregeln gegeben. Eine Geduldprobe, weiter nichts.« Er preßte die Finger um die Kehle; er fürchtete einen Erregungsausbruch wie neulich im Hotel, wenn sie noch länger auf ihn einredete. Sie verzichtete auf weitere Debatten, und ohne sich an seinen Widerstand zu kehren, läutete sie gegen neun Uhr die Wohnung des Professors an. Sie erhielt die Auskunft, er befinde sich auf einer Nordlandsreise, von der er erst in zehn Tagen zurückerwartet werde. Schon wollte sie nach den Namen des Stellvertreters und des ersten Assistenten fragen, da besann sie sich eines andern. Sie hängte den Hörer auf, ging ins Zimmer zu ihrem Sohn zurück, der gerade eine schön geschnitzte Gewürzbüchse aus der Landschaft Avatiko anschaute, und sagte in ihrer verbindlich überredenden Art: »Ich habe dir doch von Gaupps erzählt. Nun hör mal. Die haben eine zwölfjährige Tochter, die seit Monaten gelähmt war. Nachdem sie es mit allen möglichen Kapazitäten versucht hatten, wandten sie sich an einen hiesigen Arzt, einen ganz einfachen Hausdoktor, wie es ihrer Dutzende gibt, und denke dir, dieser unbedeutende kleine Doktor ist im Begriff, das arme Kind völlig wiederherzustellen. Es ist wirklich zu merkwürdig, Gaupps sind selig, am liebsten möchten sie den Mann in Gold fassen. Ich möchte ihn kommen lassen, Johann. Schaden kann es keinesfalls, und ohne jede Behandlung kannst du nicht bleiben, das mußt du einsehen. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, aber man braucht ja nur bei Gaupps anzurufen.«
Es erwies sich später, daß die Heilung der kleinen Gaupp kein solches Wunder war, wie die Senatorin Irlen glaubte. Joseph Kerkhoven selbst schilderte Irlen den Fall bei einem seiner ersten Besuche. Das Mädchen war verhalten worden, dauernd im Bett zu liegen, angeblich wegen chronischer Nephritis. Ihm seien Zweifel an der Richtigkeit der Diagnose aufgestiegen, nach sorgfältiger Untersuchung und Beobachtung habe er eine ganz andere Ansicht gewonnen. Er ließ das Kind, das schon ganz muskelschwach und anämisch war, eines Tages aufstehen, ernährte sie »furchtlos« (das war sein eigener Ausdruck: furchtlos) und gewöhnte sie an regelmäßige Turnübungen. »Es war gewagt«, schloß er mit gesenkten Augen seinen Bericht, »aber es glückte. Ein Einfall eben; manchmal hat man so einen Einfall…«
Die Senatorin hatte ihren Willen durchgesetzt. Irlen hatte ermüdet nachgegeben und erlaubt, daß Doktor Kerkhoven kam, trotzdem er sich nach dem schweren nächtlichen Anfall bedeutend besser fühlte als vorher und wieder Hoffnung schöpfte. Der junge Arzt überraschte ihn durch sein ungewöhnlich stilles und rücksichtsvolles Benehmen. Von Mal zu Mal empfand er seine Gegenwart wohltuender; es ging von dem Mann etwas Friedlichmachendes aus, eine geheimnisvolle Ruhe, wie er sie noch bei keinem Menschen gespürt hatte.