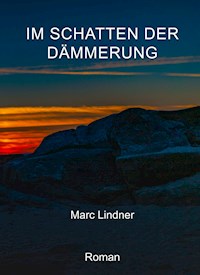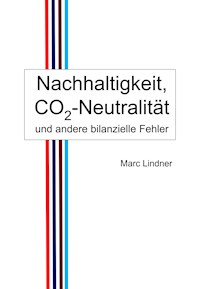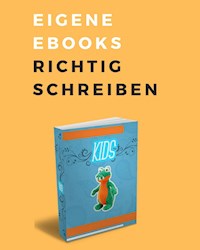Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
KURZGESCHICHTEN Szenen aus dem Alltag bilden die Grundlage, um der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. So wird der Wartesaal einer Arztpraxis zu einem Bildnis dafür, wie wir in der Gesellschaft nebeneinander her leben, und dabei gleichzeitig Distanz wahren. Ein Fahr-stuhl wird zu einem Spielplatz für ein kleines Mädchen und lässt unterschiedliche Welten aufeinander stoßen. Ein Vater erklärt seiner Tochter das Thema ihres Referates und ist gleichsam gegen seine eigenen Erklärungen immun. BUSFAHRT Eine Busfahrt ist normalerweise eine eintönige Angelegen-heit. Nicht so für den Protagonisten dieser Novelle. Minutiös registriert er seine Umgebung, nimmt Menschen wahr, die ihn auf seine Fahrt begleiten. Detailliert schildert er seine Eindrücke und selbst das Kleinste bleibt ihm nicht verborgen. Oft tiefgründig erzählt und manchmal auch zum Schmunzeln. Eine Busfahrt, eine Reise durchs Leben. ZUR TANZENDEN KEGEL Stellen Sie sich vor, Sie sehen Schulfreunde wieder, die Sie viele Jahre lang nicht mehr sahen. Ein Klassentreffen. Was ist aus ihnen geworden? Was geht in diesen und Ihnen vor? Was denken und fühlen Sie? Einige waren Freunde, manche verhasst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marc Lindner
Busfahrt / Zur tanzenden Kegel und mehr
Novellen und Kurzgeschichten
© Marc Lindner
Lektorat: Mandy Hemmen
Coverbild: Tanja Schröder
www.wortzeichner.wordpress.com
https://kurzgeschichtensammelsurium.blogspot.lu
Busfahrt
Das Gesicht gegen kaltes Glas gedrückt schaue ich aus dem Fenster. Tief nach unten ist mein Blick gerichtet. Grau. Grau liegt der leere Bürgersteig vor mir. Hellgrau die Straße, die in die Stadt führt. Es ist trocken. Es hat noch nicht zu regnen angefangen. Vorsichtig löse ich meine Haut von der Scheibe. Der Abgrund vor mir verschwindet. Ich sehe in den Himmel. Grau. Dunkle Wolken türmen sich vor meinem Zimmer auf. Sie warten auf mich. Warten darauf, dass ich es wage, dieses Zimmer zu verlassen.
Mit einem letzten Blick löse ich mich von dem Bild, das sich mir zeigen will. Drehe mich um. Greife, als wäre es eine unbewusste Bewegung auf das Fensterbrett. Kalt fühlt es sich an. Ich berühre etwas Hartes. Auch kalt. Meine Hand schleift den Schlüssel mit. Ich brauche ihn. Mag ihn aber nicht. Er ist kalt.
In nur wenigen Schritten durchquere ich das Zimmer. Vor der Tür verharre ich. Drehe mich um. Was suche ich? Es ist leer. Habe ich alles aus? Ich lasse meinen Blick wie in Trance durch den Raum gleiten. Es blinkt. Ein kleines grünes Licht leuchtet mich an. Ich habe vergessen, den Bildschirm auszumachen. Ich beuge mich vor und drücke, fast schon erleichtert, den Knopf neben der grünen LED. So, geschafft. Er ist aus. Der Bildschirm, meine ich. Ruckartig schaue ich erneut ins Zimmer. Habe ich noch was vergessen? Nein!
Ich öffne die Tür und gehe in den Flur. Es ist dunkel. Ich nehme den kalten Schlüssel und stecke ihn ins Schloss. Metallisches Knacken ertönt. Ich will den Schlüssel wieder herausziehen. Doch ich kann nicht. Eine Stimme sagt mir, ich dürfe es nicht. Habe ich das Licht ausgemacht? Schnell schließe ich wieder auf. Ich öffne die Tür einen Spaltbreit. Nur der graue Himmel von draußen spendet Licht. Ach ja. Ich mache nie Licht an. Ich schließe die Tür. Erleichtert ziehe ich den Schlüssel heraus. Ich betrete die Marmortreppe. Ob es echter Marmor ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall Stein. Und kalt. Ich gehe hinunter. Einen Stock. Ich höre Schritte. Sie sind ganz nah. Ich bleibe stehen. Horche. Stille. Es sind wohl meine Schritte gewesen. Und noch einen Stock. Ich begegne keinem. Keiner, der mir einen guten Tag wünscht. Ich bin allein. Bevor ich die Haustür öffne, stecke ich den Schlüssel, den ich immer noch in der Hand habe, in meine Hosentasche. Er ist nicht mehr ganz so kalt.
Draußen empfängt mich ein scharfer Wind. Aber ich friere nicht. Ich bin es gewohnt. Ich vergrabe meine rechte Hand in meine Jackentasche. Ich suche etwas. Ah! Da ist es. Ich ziehe es heraus. Es ist ein schwarzes Gerät. Etwas Weißes umschnürt es. Ich wickele es los. Das gespaltene Ende des weißen Kabels halte ich in der linken Hand fest, während ich das schwarze Gerät oben am Hals unter meinem Pullover verschwinden lasse. Doch es kommt wieder zum Vorschein. Unten am Pulli lugt es hervor. Rasch stecke ich es in die Hosentasche. Zu dem Schlüssel. Er soll ja nicht allein sein. Während ich schon die ersten Schritte gehe, stöpsele ich die Kopfhörer in meine Ohren. Es gibt einen für das linke und einen für das rechte Ohr. Doch das stört mich nicht. Einfach rein. Ich nehme das Gerät, das ich übereilt weggesteckt habe, wieder hervor. Lange drücke ich eine Taste. Es leuchtet auf. Ich drücke play. Sofort ertönen Bässe in meinem Kopf. Ah. Diese Stille. Sie ist weg.
Nun erst habe ich wieder einen Blick für etwas anderes. Ich schaue nach oben. Die Wolken sind immer noch da. Solange sie auch da oben bleiben, stören sie mich nicht. Doch während sie auf mich herabsehen, erwecken sie den Eindruck als würden sie zu mir herunter wollen. Sollen sie nur kommen. Ich bin vorbereitet.
Ich stolziere los. Bleibe strickt auf dem Bürgersteig. Auch wenn die Straße leer ist. Keiner da. Keiner, der mich begleitet. Die Musik in meinem Kopf diktiert meinen Rhythmus. Mit jedem Beat stampfen meine Füße auf. Einmal der linke. Einmal der rechte. Sie tun es, ohne meinen Willen. Ich gehe weiter. Nur weiter. Ich male mir nicht aus, wo ich ankommen werde. Ich beabsichtige nicht einmal anzukommen. Der Bus. Das ist mein Ziel. Nur den Bus will ich nehmen. Er wird schon wissen wohin.
Mit gesenktem Kopf gehe ich weiter. Doch meine Augen scheinen dem grauen Anblick entfliehen zu wollen. Sie heben meinen Kopf. Ich merke es nicht einmal. Da fällt mir ein Detail auf. Ich kenne diese Straße. Ich wohne hier. Und doch ist sie mir fremd. Ein Farbfleck lässt mich für einen Moment aufwachen. Eine Tulpe strahlt mich an. Eine einzelne hat sich bei meinem Nachbar eingenistet. Sie fällt mir auf unter dem üppigen Grün der Hecke, die sie zu verschlucken versucht. Es ist Frühling, stelle ich fest. Einen Blick nach oben. Nein wohl doch nicht. Der Himmel ist immer noch grau. Ich bleibe nicht stehen. Wieso auch? Ich muss den Bus schaffen. Ich habe keine Zeit.
Der Weg führt mich weiter. Der Weg?, denke ich. Der Bürgersteig, meine ich. Denn die Straße betrete ich ja nicht. Grau ist der Boden, auf dem ich gehe. Einzig die Bordsteine begleiten mich. Sie verfolgen mich. Hindern mich daran, über sie hinwegzugehen. Ich bin gefangen. Ich gehe weiter.
Ein Friseurladen taucht neben mir auf. Ich weiß, dass er da ist. Ich meine hier. Hier am Kopf meiner Straße. Ich gehe seit Jahren an ihm vorbei. Dennoch drehe ich meinen Kopf ihm zu. Die Fenster sind schwarz. Er ist noch geschlossen.
Ich wundere mich. Nicht wirklich, aber dennoch. Ich kann mich in diesem Moment nicht daran erinnern, ihn jemals offen gesehen zu haben. Naja vielleicht bin ich nur zur falschen Zeit hier. Vielleicht bin ich immer nur zur falschen Zeit da.
Ich schaue genauer ins Fenster. Nur Schemen lassen sich erkennen. Alles ist düster. Fast alles. Ich sehe einen jungen Mann, fast noch ein Kind mich uninteressiert anglotzen. Er ist ganz blau. Blaue Jeans. Dunkelblaue Jacke. Ich beachte ihn nicht. Und gehe weiter.
Der Bürgersteig zwingt mir eine Kurve auf. Ich gehorche. Die Straße, in der ich wohnte, mündet in eine andere. Eine Größere. Meine Schritte ändern sich. Werden etwas langsamer, dafür aber größer. Ich habe mich nicht geändert. Nur das Lied. Als das alte geendet hat, ist eine Pause eingetreten. Eine Pause, in der die Welt für mich stumm geworden ist.
Auf meiner Rechten sehe ich ein Gebäude. Oder besser, ich erinnere mich an eines. Es ist vor Monaten schon abgerissen worden. Nun klafft dort ein Loch. Sandfarben erfüllt es die Welt, in der ich wohne. Ich sehe gerne in dieses Loch. Es hat so etwas Hoffnungsvolles, wie ein Versprechen. Es ist einfach gehalten. Nicht aufdringlich. Nur unübersehbar. Ich gehe weiter.
Schon nach wenigen Schritten, oder soll ich Bässe sagen, sehe ich auf die andere Straßenseite. Ich muss rüber. Dort sehe ich die Bushaltestelle. Ich will in die Stadt. Ich bin auf der falschen Seite. Jeden Tag komme ich auf der falschen Seite an. Jeden Tag wechsele ich die Seite. Wieder beschränken mich die Bordsteine.
Doch diesmal lehne ich mich dagegen auf. Ich laufe gegen sie Sturm. Ich laufe ins Leere. Bevor mein Fuß die Straße berührt, schaue ich hinter mich, aus Angst es könne ein Auto kommen. Vielleicht aber hoffe ich auch, es würde mal eins kommen. Es kommt keines. Ich bin allein.
Lässig überquere ich die Straße. Eine Hand in der Hosentasche, bei dem kalten Schlüssel. Die andere baumelt lebhaft an der Seite meines Körpers hin und her. Ich gehe immer so.
Auf der anderen Seite sehe ich einen Schatten spendenden Baum mich erwarten. Ich betrete den Bürgersteig. Geschafft! In Sicherheit. Gefangen. Nur noch wenige Schritte bis zum Häuschen der Haltestelle. Ich bin nun unter dem Baum. Im Schatten. Ich gehe weiter. Nur wenige Schritte. Ich bleibe stehen. Ich stehe in der Sonne, hätte sie denn geschienen. Vor mir sehe ich das Häuschen. Es ist leer. Keiner da. Ich bin allein.
Doch ich trete nicht ein. Ich bleibe draußen. Ich will den Wind in meinem Gesicht spüren. Ich will etwas fühlen. Ich wende mich von dem Glashäuschen ab und der Straße zu. Ich blicke nun wieder auf das sandige Vermächtnis des Gebäudes, das da einmal stand.
Man hatte das Gebäude abgerissen. Nicht aber die drei Bäume, die davor standen. Die stehen immer noch. Unter ihnen kann ich den Horizont sehen. Sie stehen darüber. Sie wirken wie Schirme. Als wollten sie den Staub vor dem Regen, der droht, beschützen. Ich fürchte den Regen nicht. Ich friere nie. Nur den Wind kann ich spüren. Irgendwie freue ich mich schon auf den Regen. Male mir schon die zahlreichen Berührungen aus. Wie die Tropfen mich liebkosen würden. Ich muss lachen. Nein, nicht laut. Nur für mich. Ich weiß nicht warum. Ich bin glücklich. In meinem Glück senke ich meinen Blick. Schaue auf meine Füße. Sehe sie aber nicht. Ich sehe mich nicht. Nur den Boden. Es ist kein Asphalt. Pflastersteine liegen mir zu Füßen. Kleine. Ich sehe sie genau. Sie sind nicht ganz grau. Eher schon braun. Dunkel, aber nicht trist. In den Fugen ist Erde. Endlich kein Beton. Vereinzelte Grashalme kämpfen sich hervor. Ich weiß, wie sie sich fühlen müssen. Ich lache.
Ich muss meinen Blick abwenden. Nun sehe ich wieder das Häuschen an. Es ist aus Glas. Es ist gebaut für die Gesellschaft. Nicht für mich. Ich bleibe draußen. Ich will nicht. Nicht ins Glashaus. Ich will meine Freiheit. Auf dem Bürgersteig. Gefangen. Aber im Wind. Ich mag Glas nicht. Es ist kalt. Nicht wie der Wind. Der streichelt mich. Glas kommt nie auf mich zu. Es ist hart. Das Glas ist gehalten von eisernen Stangen. Auch hart. Und kalt. Ein Käfig. Nicht golden, aber durchsichtig. Ich will nicht, dass man mich beobachtet. Ich bleibe draußen. Ich lache. Ich bin frei.
Mein Blick fällt wieder auf den Boden unter mir. Ich stehe drauf. Die Pflastersteine drehen sich unter mir. Nein, sie bewegen sich nicht. Sie sind im Kreis angebracht. Fast rund. Und auch nur fast ein Kreis. Kaputt, alles kaputt. Man hat sie zerteilt. In Viertel. Gerade Linien durchtrennen die Kreise. Gerade, immer alles gerade hier. Ich will nicht. Ich stehe im Kreis. Nein in einem Viertel. Mehr bleibt mir nicht. Ich bin gefangen.
Nicht aber mein Blick. Und so wandert dieser weiter. Ich starre eine Weile die Straße entlang. Mal Richtung Stadt. Mal in die Richtung, aus der der Bus kommt. Ich warte nicht darauf, dass dieser jeden Augenblick kommt. Ich habe Zeit. Ich weiß, er wird kommen. Noch früh genug. Und ich werde hier sein.
Es kommt ein Auto. Es ist rot. Welche Marke? Keine Ahnung. Es interessiert mich nicht. Es sitzt ein Mann drin. Etwa doppelt so alt wie ich. Er hat keine Zeit, denke ich. Er sieht mich nicht. Er fährt an mir vorbei. Er hält den Blick starr vor sich gerichtet. Auf die Straße. Er ist auf der Straße. Ich nicht. Er kommt aus der Stadt. Er ist ihr entflohen. Er sieht müde aus. Ich schaue ihm nach, bis er hinter einer Kurve und hinter den grünen Bäumen verschwindet. Ich bin wieder allein.
Als ich meinen Blick von der grauen Straße löse, bleibt er an dem Glashäuschen kleben. Eine silbrig glänzende Bank steht da drin. Das löchrige Metall bietet einem einen Platz an. Es will, dass man sich auf es setzt. Ich kenne das. Es will einem nur seine Wärme stehlen. Ich bleibe stehen. Draußen. Im Wind. Diesmal sehe ich mir den Käfig etwas länger an. Er ist freizügig. Die vordere Front fehlt. Ich traue ihm trotzdem nicht. Die metallenen Streben warnen mich. Es wird mir unheimlich.
Ich verstecke mich. Nein, ich laufe nicht weg. Ich bleibe stehen. Senke nur den Kopf. Sehe zur Erde. Ah, mein Kreis. Ich bin frei. Nein bin ich nicht. Er ist kaputt. Warum hat man nicht wenigstens dem Kreis seine Freiheit schenken können. Warum all die Gewalt? Ich will frei sein. Ich will weg. Doch ich kann nicht. Die Geraden halten mich auf. Ich bin gefangen.
Ich konzentriere mich auf den Teil, auf dem ich stehe. Vergesse, dass er abgetrennt ist. Vergesse die Welt. Ich beruhige mich. Ich grinse. Nicht mit dem Mund, oder so. Nur innerlich. Ich bin glücklich. Doch stimmt das? Ich weiß es nicht. Ich bin zufrieden. Ist das nicht genug? Ich beklage mich ja nicht. Ich schweige. Wie immer. Ich bin ja auch allein. Wer sollte mir schon zuhören? Wer soll mich verstehen? Höre ich mir eigentlich selbst zu? Mir doch egal. Ich bin zufrieden, was soll ich noch wollen? Ich ärgere mich. Über mich selbst. Ich habe doch alles. Ich grinse. Und schweige. Ich höre zu. Der Musik in meinem Kopf. Sie ist da. Sie ist immer da. Ich bin nicht allein. Nur einsam. Was denke ich da nur? Ich rege mich auf.
Fast schreckhaft hebe ich den Kopf. Ich bin wieder da. Die Welt auch. Mit ihrem Loch. Dem Sand auf der anderen Seite der Straße.
Ich stelle mir vor, wie das wohl aussehen wird, wenn man da was baut. Groß, bunt und warm. Vor allem warm. Nein Lüge! Ich denke nicht daran. Ich will daran meine Gedanken festmachen. Sie sollen schweigen. Doch sie tun es nicht. Sie laufen mir weg. Sie hassen mich. Warum wollen sie es nicht verstehen? Es ist besser für mich, wenn sie schweigen. Wenn sie nicht einmal da sind. Doch sie sind es. Und sie bleiben. Es tut weh. Ich platze. Ich bin so voll. Und die Welt um mich so leer. Alles kaputt. Nur Sand. Ich weine. Nein, stimmt nicht. Ich weine nie. Warum auch? Ich bin doch glücklich. Ah nein. Zufrieden. Ist doch auch gut. Ruhe! Aber die Träne? Der Wind. Es ist nur der Wind. Es ist doch nur eine Träne. Es ist der Wind. Es muss der Wind sein. Stimmt, es ist der Wind. Er ist rauer geworden. Ich bin beruhigt. Ich habe doch nicht geweint. Ich bin stark. Ich schweige. Ich lache nicht. Ich halte mich am Bass fest. Er trägt mich. Er erfüllt mich. Er ist da. Ich auch. Aber nicht hier. Irgendwo anders. Neben mir. Ich sehe mich nicht.
Etwas ertönt. Nein, nicht in meinem Kopf. Nicht die Musik. Heller, fröhlicher. Lebendig. Ich halte inne. Halte den Atem an. Die Musik dröhnt weiter. Ich höre nicht hin. Da. Und wieder. Zwitschern. Vögel. Ich höre sie genau. Ich drehe mich um. Sehe nach oben. Kann sie aber nicht erblicken. Aber höre, dass sie im Baum sind. Ich weiß es genau. Es muss Frühling sein.
Sie sind frei. Ich freue mich. In diesem Hochgefühl badend, reisse ich meine Nase höher in den Wind. Ich kann sie riechen. Die Freiheit. Dunkle Wolken über mir. Doch kein Frühling.
Wo bleibt der nur. Der Bus, meine ich. Das erste Mal, seit ich hier bin, schaue ich auf die Uhr. Ah, zwanzig nach. Gut. Ich bin nicht zu spät. Ich lache. Ich bin immer zur rechten Zeit hier. Ich warte immer. Gerne. Aus Vorfreude. Am Reisen. Ich reise gern. Wohin? Keine Ahnung. Weg halt.
Also noch zwei Minuten. Dann sollte er da sein. Wird er auch sein. Er ist meistens pünktlich. Ich bin sicher. Ich kann mich auf ihn verlassen. Und das tue ich auch. Mehr noch. Ich vertraue ihm. Er wird mich hier wegbringen.
Schade eigentlich. Es ist grad doch so schön. Im Wind. Und der Regen. Er naht. Bald wird er mich berühren. Er weicht mir nicht aus. Er mag mich wohl.
Die Vögel. Ich kann sie immer noch hören. Die Musik auch. Die Töne verschmelzen. Ich bade mich in ihnen. Ich bin zufrieden. Nein. Glücklich! Ich liebe Glück. Es ist so vergänglich. Ich mag es, wie es mit mir spielt. Und freue mich über jeden seiner Besuche. Nicht wie bei Menschen. Die mag ich nicht immer. Glück schon. Glück ist immer anders. Aber immer schön.
Ich lache. Wieso bin ich glücklich? Eine Nichtigkeit. Nein. Wenn es mich glücklich macht, kann es keine Nichtigkeit sein. Ich bin frei. Ich weiß es genau. Aber der Kreis. Er ist kaputt. Alles kaputt. Und gerade. Nein, nicht in mir. Mein Kreis. Keine Geraden, die ihn teilen. Ich vergesse sie alle. Keine Bordsteine. Keine Welt. Ich vergesse auch sie. Unwichtig. Ich brauche keine Gerade. Nicht in mir. Auch wenn die Welt mir sie geben will. Ich nehme sie nicht. Mir geben sie keinen Halt. Ich bin allein. Ohne sie. Nicht verloren. Aber ich finde mich nicht. Ich sehe mich nicht. Nicht in der Welt. In der geraden, meine ich. Ich habe meine Welt. In mir. Bunt. Mit Kurven. Vor allem bunt. Nicht grau. Nicht kalt. Ich friere nicht. Ich friere nie. Der Wind, das einzig Ungerichtete aus der geraden Welt. Ich liebe Wind. Er kühlt mich. Er hüllt mich. Er liebt mich. Die Musik in meinen Ohren. Auch Wind. Aber gerichtet. Ah. Ruhe. Lass mir die Freude. Jemand, der mit mir redet. Nein, nicht mit mir. Aber wenigstens keine Stille. Kein Schweigen.
Vor mir der Sand. Ich baue. Nicht wirklich. In Gedanken. Ich habe jetzt die Kraft. Ich stelle es mir vor. Diesmal wirklich. So wirklich, wie es meine Welt zulässt. Die ohne Geraden. Man könnte so viel bauen. Doch keiner da. Ich bin allein. Und nur Sand. Viel Sand. Steine gibt es keine. Gibt es doch. Doch die Menschen brauchen sie schon. Für Bordsteine. Für Geraden. Immer weiter. Man hat keine Zeit. Keine Zeit, dieses Loch zu füllen. Es klafft. Es schmerzt. Mich. Nur mich. Die anderen sehen es nicht. Wie auch? Es ist ja nichts da. Nur Leere. Freiheit. Ich sehe sie. Auf der anderen Seite. Wieder falsch. Immer falsch. Ah, nein. Ich will doch in die Stadt. Keine Zeit. Zum Bauen, meine ich. Es muss warten. Immer warten. Auch auf den Bus. Aber das tue ich ja gerne. Ich will in die Stadt. Da gibt es Häuser. Keine Löcher. Die stopft man immer. Ist es die Erfüllung des Wunsches, in die Stadt zu kommen, auf die ich warte? Oder warte ich nur auf den Bus? Ich entscheide mich für den Bus. Er ist greifbarer. Er ist da. Nein, ist er nicht. Aber er wird kommen. Das weiß ich.
Ich baue weiter. Es ist schön. Meine Welt wächst. Wird größer. Bald schon werde ich ganz in ihr leben können. Es auch tun. Ich verschwinde. Ich sehe mich nicht. Nicht in dieser Welt. Kein Platz für mich. Nicht einmal für den Kreis. Er stört doch keinen. Warum? Warum er und nicht ich? Ich bin doch auch nicht gerade. Nein, das sieht man nicht. Ich bin gerade. Ich halte mich so. Ich glaube es nicht, aber die Menschen. Sie sind blind. Und stumm. Ich schweige.
Ich schließe meine Augen. Wo bin ich? Mir doch egal. Ich fühle mich gut. Frei. Der Wind. Er verführt mich. Ich gebe mich ihm hin. Es ist schön. Nicht kalt. Er trägt mich. Nicht wie die Geraden. Er hält mich nicht fest. Ich kann mich nicht lösen. Er schlingt sich um mich. Ich bin glücklich. Ich träume. Nein, ich bin wach. In meiner Welt. Der bunten. Ich lebe. Ich stehe doch. Nein, ich fliege. Ich bin frei. Keine Bordsteine. Die Vögel. Sie singen mir zu. Ich höre zu. Ich verstehe sie. Der Wind. Sie sind frei. Ich auch.
Ich lebe? Ohne Gerade? Ohne Straße? Die Straße des Lebens. Das Leben ist eine Reise, sagen die Weisen. Sagen die Dummen. Alles gerade. Wie solle man da reisen. Blind, alle blind. Flüsse. Gerade, gerichtet. Tot. Die gerade Kurve. Gibt es nicht? Gibt es wohl. Die Kurven der Menschen sind gerade. Tot. Folge der Straße. Der Kurve. Immer weiter. Immer geradeaus. Du hast keine Wahl. Du legst dich in die Kurve und doch führt dich die Straße. Die Kurve ändert nichts. Sie ist tot. Begradigt. Wie alles. Nimm doch den Bus. Da reist es sich schneller. Und du musst dir keine Gedanken machen. Er kennt den Weg. Und er hält für dich an. Das Leben ist eine Reise. Nächste Haltestelle: Hochzeit. Oh, schöne Frau. Wer ist sie? Keine Ahnung. Es wird schon richtig sein. Ist doch eine Haltestelle. Der Bus verfährt sich nicht. Er tut es nie. Er weiß alles. Du fährst weiter. Du liest die Anzeige. Beerdigung. Du springst auf. Stopp. Du drückst. Wie verrückt. Der Bus fährt weiter. Bis zur Haltestelle. Nie vorher. Du bist da. Viele Leute. Oh, du hast es geschafft. Du warst wichtig. Doch wo sind meine Freunde? Tot? Alle tot. Ich auch.
Ich öffne meine Augen. Sie sind feucht. Böser Wind heute. Ich schaue die Straße entlang. Erleichtert. Kein Bus. Ich bin nicht tot. Ich bin hier. Ich stehe. In meinem Viertel. Warum habe ich schon wieder meinen Blick gesenkt? Ich betrachte wieder die Pflastersteine. Sie sind klein. Und kariert. Auch die in meinem Kreis. Die wenigstens nicht geordnet. Rebellen. Alles Rebellen. Gefangen. In den Geraden. Jetzt verstehe ich es. Die Geraden müssen sein. Sonst würde Chaos herrschen. Ich bin beruhigt. Die Geraden beschützen mich. Vor mir. Ich bin nicht gefangen.
Ich bin frei. Ich habe es schon immer gewusst. Der Wind hat recht. Ich bin draußen. Nicht eingesperrt. Ich bin ja nicht im Glashaus. Glück gehabt. Ich schweige.
Meine Schuhe. Ich sehe sie. Schwarz. Sie sind schwarz. Und stehen im Kreis. Im Viertel, meine ich. Meine Fersen an der Geraden. Ich gehe weiter. Nein. Ich bleibe stehen. Die Richtung, meine ich.
Ich komme von der Geraden. Ich kenne sie. Doch jetzt? Chaos. Ich bin mir fremd. Oder nein. Ich lerne mich kennen. Meine Maske wird mir fremd. Die gerade, meine ich. Der Wind. Ich bin frei. Nein, meine Gedanken. Sie kosten mich diese Welt. Sie wollen einfach nicht schweigen. Sie wollen es einfach nicht verstehen. Ich ärgere mich über den Wind. Seine Liebkosung wird immer heftiger. Meine Augen tränen. Ich schließe sie. Reiße sie aber gleich wieder auf. Meine Gedanken werden zu stark.
Ich muss bauen. Meine Welt. Ah! Sand. Da drüben. Ich muss hin. Ich bleibe stehen. Und baue. Die drei Bäume im Vordergrund. Sie bleiben. Ich auch.
Wo bleibt der Bus? Ich will nicht mehr warten. Ich schaue in den Himmel. Wolken. Immer noch grau. Sie werden immer dunkler. Bald wird es regnen. Dann wird die Welt wieder sauberer sein. Ich erschrecke. Habe ich das Fenster geschlossen? Das im Badezimmer, meine ich. Ich bleibe stehen. Ich bewege mich nicht. Mache keine sichtbare Regung. Keiner könnte meine Panik sehen. Ich bleibe gerade. Sie glauben es. Sie glauben es immer. Sie sind blind. Jetzt sicher auch. Keiner da. Ich bin allein.
Ich beruhige mich. Panik wird mir nicht helfen. Ich werde eh nichts ändern können. Ich kann nicht mehr weg. Ich muss den Bus bekommen.
In Gedanken betrete ich mein Zimmer. Ich versuche, mich zu erinnern. Ah. Ich sehe mich das Fenster schließen. Gut. Alles in Ordnung.
Nur wo bleibt der Bus? Ich stutze. Ich sehe auf die Uhr. Zweiundzwanzig. Ich habe es im Gefühl gehabt. Es ist an der Zeit. Ich habe aufgehört, meinen Blick hin und her zu wenden. Ich starre vor mich. Ich bekomme nichts mit. Ich versinke in der Musik. Sie erfüllt mich. Ich bin blind. Ich schweige. Meine Gedanken auch. Ich bin zufrieden.
Meine Augen sind nicht mehr feucht. Der Wind hat wohl nachgelassen. Er ist aber noch da. Er berührt mich. Er liebt mich. Er liebt mich immer. Ich ihn auch. Er ist sanft. Nicht kalt. Nicht für mich. Ich friere nie.
Ich stecke meine zweite Hand in die Hosentasche. Strecke meinen Körper und rolle mit den Schultern. Ich entspanne mich. Und träume. Nein. Ich schlafe. Und schweige. Meine Gedanken auch. Ich fühle mich wohl. Zufrieden. Ja, das bin ich wirklich. Nur den Wind spüre ich. Und die Vögel. Alle da. Bei mir. Sie singen. Ich schlafe. Höre zu. In meiner Welt. Sie sind schon eingezogen. Ich auch. Ich lebe. Kein Sand. Alles fertig. Nicht kaputt. Nicht gerade. Warm. Ich friere nicht. Ich friere nie. Nie mehr. Ich lache.
Ein Brummen. Tief, sehr tief. Ich höre es. Im Bauch. Nur im Bauch. Es ist nicht laut. Ich kenne es. Ich sehe wieder. Nun zur Kurve. Ich weiß er kommt. Ich kann ihn noch nicht sehen. Nicht einmal hören. Mit den Ohren, meine ich. Der Bus. Er kommt. Und ich bin hier. Kein Traum. Ich kann hinter den Bäumen nicht ausmachen, wo er ist. Alles Erfahrung. Nur noch Sekunden. Er wird kommen. Ich weiß es genau. Ich kann meine Augen nicht mehr von der Straße abwenden. Ich will ihn sehen.
Mein Bauch vibriert. Aufregung. Nein, nur Vibrationen. Vom Bus. Er kommt. Ich spüre ihn. Und den Wind. Alle da. Meinetwegen. Auf sie kann ich mich verlassen. Sie lieben mich. Auf ihre Art. Sie müssen mich lieben. Wieso sollten sie sonst immer kommen? Immer da sein? Ich liebe sie auch. Ich bin ja auch da. Immer. Ich stehe hier. Nicht meinetwegen. Wegen des Busses. Er weiß das. Er weiß das genau.
Ich kann ihn hören. Nur schwach. Die Bäume dämpfen das meiste. Nicht die Vibrationen. Die tiefen Töne. Die spüre ich. Er kommt. Mehr als nur ein Versprechen. Ich starre immer noch auf die Kurve. Bald. Bald ist es soweit. Ich stehe wie eine Statue. Gerade. Lüge. Ich glaube es nicht. Aber die Menschen. Die glauben alles. Alle blind.
Nicht der Bus. Er kommt. Seine Augen erstrahlen. Er muss mich schon gesehen haben. Es ist Tag. Und doch leuchten seine Lampen. Aus Vorfreude wohl. Ich warte, bis er ganz um die Ecke gebogen ist. Er kommt auf mich zu. Auf einer Geraden. Ich wende meinen Blick ab. Sehe wieder vor mich. Auf meine Füße. Noch einmal ein kurzer Blick gen Bus. Ja er kommt wirklich. Ich empfinde nichts. Die Uhr, ich schaue drauf. Vierundzwanzig. Er ist zu spät. Er hat mich warten lassen. Immer warten. Auch jetzt. Es ist eine lange Gerade. Ich schaue Richtung Stadt. Ich will ihm nicht zeigen, dass ich auf ihn gewartet habe. Ich bin nur zufällig hier. So macht man das, wenn man sich liebt. Alles ein Spiel. Lüge. Angst. Ja ich habe Angst. Aber das darf ich nicht. Genauso wie denken. Alles Gift. Ich sehe die Stadt nicht. Da sind Kurven. Viele Kurven. Alle im Weg. Alle gerade.
Der Bus kommt näher. Ich spüre es. Ich spiele weiter. Sehe immer noch in Richtung Stadt. Tue als interessiere er mich nicht. Ich höre ihn. Trotz all der Musik. Ich drehe mich um. Er kommt. Sehr nahe schon. Ich tue überrascht. Eine Hand aus der Tasche. Die zweite auch. Frei. Ich greife wieder in die Tasche. Nehme meine Brieftasche. Das tut man so. Alles geregelt. Es steht auf der Tür. Vorn einsteigen. Fahrkarte vorzeigen. Ich kenne das. Ich öffne meine Geldbörse. Sie hat ein durchsichtiges Fach. Für meine Fahrkarte. Alles hat seinen Platz. Ich halte es so, dass man die Fahrkarte gut sehen kann. Es ist eine Semesterkarte. Solange bin ich mit ihm zusammen. Dem Bus. Verlobt. Wir lieben uns ja.
Ich stehe nicht nah beim Bordstein. Aus Angst. Nicht vor dem Bus. Vor dem Bordstein. Der Bus hält immer etwas weiter unten. Richtung Stadt. Ich weiß das. Meistens jedenfalls. Es hängt vom Fahrer ab. Ich stecke eine Hand wieder in die Hosentasche. In der anderen die Brieftasche. Mein Blick auf den Bus geheftet. Ich versuche seine Geschwindigkeit abzuschätzen. Wo mag er heute wohl stehen bleiben? Ich gehe los. Nur wenige Schritte. Langsam. Lässig. Wie immer. Er überholt mich. Bremst fester. Nicht der Bus. Der Fahrer natürlich. Er bleibt stehen. Weiter unten. Ich gehe. Er wartet auf mich. Er wartet. Der Gedanke gefällt mir. Die Tür noch geschlossen. Ich bin bei ihm. Das Glas dunkel. Nein nicht ganz. Ich sehe da was. Einen jungen Mann. Ganz blau. Blaue Jeans. Dunkelblaue Jacke. Er steht gerade. Wieder so einer. Immer gerade. Alles kaputt. Auch er. Ich ärgere mich.
Die Tür öffnet sich. Der Mann verschwindet. Ah. Sein Glück. Den hätte ich mir heute vorgeknöpft. Doch so schweige ich. Ich hebe mein Bein. Trete ein. Der Bus hilft mir über den Bordstein. Geschafft. In Sicherheit.
Meine Fahrkarte halte ich dem Fahrer hin. Er muss sie sehen. Er schaut nicht. Er schaut manchmal. Sieht aber nie. Er, sage ich. Es gibt auch Frauen. Nicht etliche. Einige sind es schon. Vier, ja vier glaube ich habe ich schon gesehen. Hier, meine ich. In meiner Straße. Doch heute ist es ein Mann. Ich kenne ihn. Ich lache. Kennen? Ich habe ihn schon oft gesehen. Mehr nicht. Kennen. Ich lache noch mal. Wen kenne ich schon? Und wer mich?
Ich gehe einen Schritt auf ihn zu. Er dreht sich nicht um. Er wartet nur. Vor langer Zeit habe ich immer gegrüßt. Keiner grüßte zurück. Okay. Fast keiner. Ich habe es schon lange aufgegeben. Ich grinse nur.
Manchmal grinsen sie mir auch zurück. Oder nicken. Diesmal nicht. Er sieht mich nicht. Nur stur vor sich. Ich sehe nach draußen. Dunkle Wolken am Himmel. Trübes Licht. Düster. Ich kenne das. Den Menschen gefällt das nicht. Sie sind wie das Wetter. Ich nicht. Ich mag Regen. Ich lache. Ja sicher, Sonne mag ich auch.
Ich bin wieder allein. Keiner, der mit mir redet. Ah nein. Die Vögel. Sie begleiten mich. In meiner Welt. Lüge. Ich habe sie schon vergessen. Ich sehe nicht in den Bus. Wieder ein Spiel. Nein Angst. Ich fürchte mich davor, dass er leer ist. Ich schiebe es vor mir her. Ich sehe nach draußen. Nach rechts. Mein Sandloch. Es liegt da. Alles kaputt. Nur noch Sand. Leer. Ah. Das Versprechen, ich sehe es wieder. Ich werde wiederkommen. Ich lache. Ich bin ja noch nicht einmal weg. Vielleicht hilft mir morgen ja wer. Beim Bauen, meine ich.
Die Wolken treiben meinen Blick wieder rein. Vor mich. Ich hebe den Kopf. Vorn sitzt keiner. Eine Hand in der Tasche. Lässig. Mit der anderen versuche ich meine Brieftasche zu verstauen. Der Bus fährt an. Es ist eine Automatik. Die Schaltung, meine ich. Ich weiß das. Der Fahrer wohl nicht. Er tritt aufs Gas. Doch er tut als sei es die Kupplung. Voll durch. Vollgas. Geradeaus. In die Kurven. Ihm egal. Mir auch. Gibt ja eh nur eine Richtung. Es rumpelt. Heftig. Ich komme aus dem Tritt. Eine Hand in der Hosentasche. Bei dem kalten Schlüssel. Für einen Augenblick bin ich unsicher. Meine gerade Maske wackelt. Eine Hand lasse ich in der Hosentasche. Mit der anderen greife ich nach einer Stange. Rot. Und kalt. Doch sie hilft mir. Ich gewinne wieder mein Gleichgewicht. Der Versuch, meine Brieftasche wegzustecken ist gescheitert. Vorerst. Ich werde es noch einmal versuchen. Später. Es muss warten. Ich bin noch nicht sicher. Nicht bei dem Fahrer. Er rast als gäbe es kein Morgen. Nur in die Stadt. Was anderes zählt nicht. Ich lache. Er hat ja auch recht. Er ist schließlich zu spät. Zwei Minuten. Eine Ewigkeit. Sein Problem. Nicht meins. Ich kann warten. Im Bus.
Ich komme voran. Ich bin schon fast bei dem Ausgang. Dort sitzt eine alte Frau. Alt. Ich lache. Für mich. Sie fühlt sich vielleicht jung. Ich sehe sie mir an. Nur ein Blick. Aber egal. Sie hält sich mit einer Hand krampfhaft an der Stange vor ihr fest.
Sie sitzt gleich hinter der Tür. Beim Ausgang. Sie blickt nach draußen. Nach links. Von mir aus. Da gibt es keinen Sand. Sie baut wohl nicht mehr. Gefangen. Auch Geraden. Ich weiß es nicht. Sie sitzt am Mittelgang. Nicht am Fenster. Sie hat wohl Angst. Vor der Kälte. Ich lächele ihr zu. Sie sieht mich nicht. Mir egal. Arme Frau. Auch blind. Ich schweige.
Ich gehe weiter. Immer noch die Brieftasche in der Hand. Ich habe noch keine Zeit. Ich will noch weiter. Nicht so weit vorn. An der Frau vorbei, sammele ich all meinen Mut zusammen und hebe meinen Blick. Ah. Eine junge Frau. In meinem Alter. Allein. Sonst ist keiner da. Sie sitzt ganz hinten. Wie immer. Ich kenne sie. Ich lache. Nein, ich habe noch nie mit ihr gesprochen. Sie sitzt zu weit hinten. Soweit kann ich nicht gehen. Zu weit. Keine Zeit. Es ist ein städtischer Bus. Was auch Sinn macht. Er fährt schließlich in die Stadt. Hinten hat er drei Sitzreihen, die in den Bus gerichtet sind. Da sitze ich immer. Man sitzt da nicht so verbunden. Ja zwei können neben einem sitzen. Aber nicht so verbindlich. Nicht so wie bei den Zweiersitzen. Die in Fahrtrichtung und die in die andere. Ich entscheide mich nicht für eine Richtung. Soll das der Bus machen. Ich setze mich auf die linke Seite. Erster Sitz von der Dreierreihe. Dort sitze ich immer. Wenn er frei ist. Der Sitz, meine ich. Er ist es meistens. Endlich mal ein Platz für mich. Für mich. Nicht für den Kreis. Kein Wind. Im Bus, meine ich. Er ist tot. Ich setze mich. Kurve. Der Bus bremst. Unelegant nehme ich Platz. Ich ärgere mich. Ich will doch so lässig wirken. Ich muss mich gerade halten. Ich stecke meine Brieftasche ein. Jetzt habe ich Zeit. Ich muss meine Beine strecken. Die Hosentasche ist eng. Kein Platz.
Ich sitze nun. Endlich. Angekommen. Im Bus, meine ich. Darauf habe ich ja gewartet. Ab jetzt wird er auf mich aufpassen. Ich muss nicht mehr denken. Aber das muss ich ja nie, denke ich jetzt. Fängt das schon wieder an. Ich ärgere mich.
Habe ich denn nirgends Ruhe. Ah. Die Musik. Die habe ich auch hier. Kein Wind, den Ungerichteten, meine ich. Aber den Gerichteten. Ich lasse mir die Freude. Und schweige.
Meine Gedanken auch. Erst einmal ausruhen. Von dem vielen Bauen. Alles unnötig, das sehe ich jetzt. Hinter Glas. Ah. Ein Fenster. Kein Käfig. Ich bin frei. Vor mir Platz. Sogar für meine Beine. Und die sind lang. Ich bin zufrieden. Ich kann mich entspannen. Ich bin nicht in einem Glashaus. In einem Glasbus. Das ist etwas anderes. Man beobachtet mich hier nicht. Nur ich sehe die Welt. Und bald die Stadt. Ich freue mich.
Es dauert aber noch. Wir sind gerade erst losgefahren. Er ist, meine ich. Der Bus, er tut nun alles. Ich nichts. Ich bin frei.
Mein Kopf bewegt sich. Ich merke es nicht. Meine Augen sind es wieder. Böser Kopf. Dass der auch nie Ruhe gibt. Naja, soll er nur, solange er schweigt.
Mein Blick verfängt sich im Fenster. Nein, nicht im Glas. Es lässt mich ja raus. Den Blick, meine ich. Ich schaue in Fahrtrichtung seitlich aus dem Bus. Er fährt langsam. Er hat Angst. Den Fahrer, meine ich. Ich nicht. Der Bus hat keinen Platz. Es ist eng auf der Straße. Deshalb fahre ich gerne Bus. Alles nicht mein Problem. Ich werde gefahren. Wohin? Mir doch egal. Ich sitze.