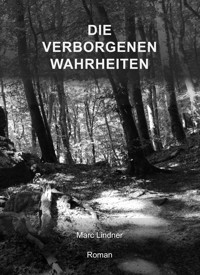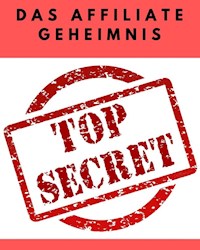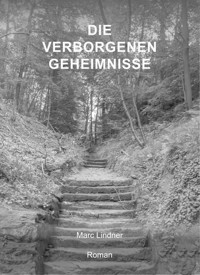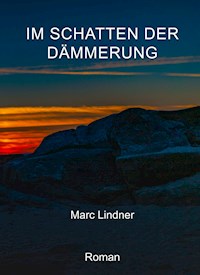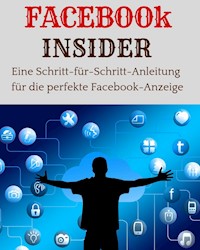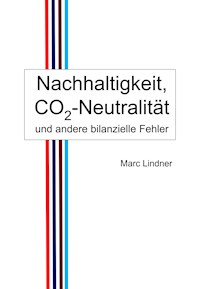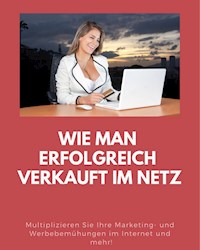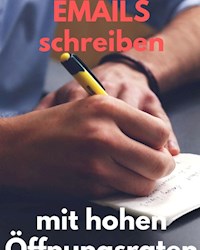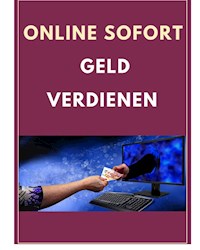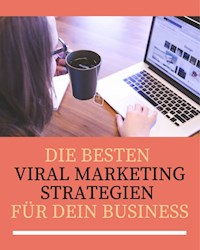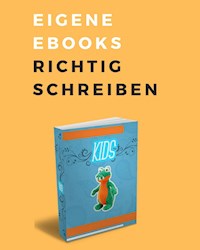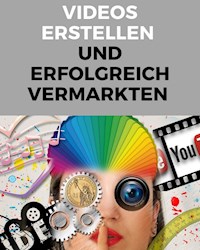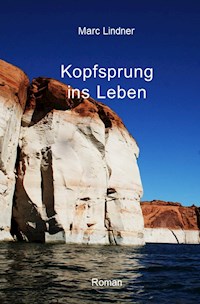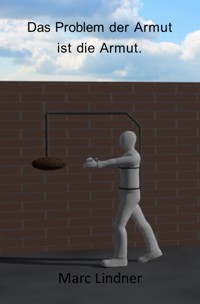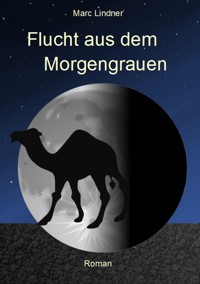Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Vieles in unserem Leben und in unserer Gesellschaft ist geregelt. Doch welchem Ziel dienen diese Regeln und auf welche Weise beeinflussen sie unser Handeln? Wissen wir um die sozialen Folgen der Regeln oder sprechen wir ihnen einen Selbstzweck zu, weil wir uns an sie gewöhnt haben? Regeln müssen sein. Aber ebenso müssen Regeln und ihr Wirken verstanden werden. Es ist wichtig, die richtigen Regeln zu finden und diese derart in Kraft zu setzen, dass sie die gewünschte Wirkung entfalten. Dazu ist nicht die Politik gefordert, sondern in erster Linie die Gesellschaft, die durch ihre Wünsche, aber auch ihre Abneigung gegenüber Änderungen das politische Handeln maßgeblich beeinflusst. Dieses Buch ist eine Textsammlung mit dem Ziel, Gedankenanstöße zu geben, indem es einzelne Bereiche unseres gemeinschaftlichen Lebens beleuchtet und aufzeigt, wo Potenziale vergeudet werden, und Regeln ihr eigentliches Ziel verfehlen. Dazu zählen Automobilverkehr, Bausektor, Steuern und Subventionen und unser Konsumverhalten. Das Werk gibt als solches keine Antworten, es fordert vielmehr auf, den Selbstzweck von Regeln zu leugnen, die Regeln als Richtlinie, aber nicht als Rechtfertigung zu verstehen, aber auch zu akzeptieren, dass Einschränkungen notwendig sind, die uns fragwürdige Rechte wegnehmen und Strafen erforderlich sind, damit diese Regeln eingehalten werden. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir aufhören, unseren Alltag mit Regeln zu pflastern und dem Menschenverstand mehr Gewicht zu kommen lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marc Lindner
Spiegelbild der Gesellschaft
Regeln oder Vernunft
© Marc Lindner, 2017
Cover: Marc Lindner
Lektorat: Mandy Hemmen
Einführung
Zielstrebigkeit ist eine wichtige Tugend. Das gilt ebenso für ein Individuum, wie auch für die Gesellschaft, oder eben den Staat mit seinen Handlungen und Regeln. Bedeutend wichtiger ist allerdings einerseits das richtige oder vernünftige Ziel für sich gefunden zu haben, und andererseits nicht über das Ziel hinaus zu schießen.
Es gilt, sein eigenes Handeln auch immer wieder kritisch zu überdenken. Es heißt zwar, der Zweck heilige alle Mittel, aber spätestens dann, wenn die Zielstrebigkeit sich gegen die Vernunft und gegen das Ziel richtet, ist dringend anzuraten, einmal stehen zu bleiben, zu betrachten wo man eigentlich ist, und seine Handlungen nachzujustieren. Viele gravierende und teils schwerwiegende Fehler wurden in der Geschichte begangen, weil ein Ziel auserkoren worden ist, und kritische Stimmen tabuisiert und kriminalisiert worden sind. Wo Kritik nicht erlaubt ist, kann kritisches Denken nicht zum Erreichen unserer Ziele führen.
Aus diesem Grund möchte ich mit diesem Buch aufzeigen, wo wir uns selbst im Weg stehen, nicht konsequent handeln, oder wo wir über das Ziel hinausschießen, damit ein Ansatz und Anreiz entsteht, inne zu halten und unsere Handlungen nachzujustieren. In zunehmendem Maße leben wir in einer globalisierten Welt. Wenn wir nicht achtgeben und uns leichtfertig in ein Meer aus Regeln stürzen, werden wir eines Tages in einer pauschalisierten Welt leben, in der wir den Regeln dienen und nicht sie uns.
Beton oder Unwissen in Stein gemeißelt?
Wenn wir uns umsehen, dann erkennen wir, dass ein Großteil unserer erschaffenen künstlichen Welt aus drei Stoffgruppen besteht. Glas, Metall sowie Beton und Stein. Glas und Metall sind dabei im Konsum weniger kritisch, weil sie recht hochwertig recycelt werden können. Bei Steinen sieht es schlechter aus, weil sie mit jedem Vorgang kleiner werden und beschädigt werden, aber meistens sieht die Wiederverwendbarkeit besser aus, wie bei Beton oder Asphalt. Dieser kann nämlich nur noch zerkleinert werden und als wertarmer Füllstoff verwendet werden. Ein kostbarer Rohstoff kann daraus nicht mehr gewonnen werden, erst recht nicht, wenn es mit der aufwendigen Produktion von Zement verglichen wird. Umso wichtiger erscheint es, mit dieser Rohstoffgruppe besonnen umzugehen, denn mit jedem Fehler wird unnötig die Qualität unserer nutzbaren Rohstoffe unwiderruflich geschmälert.
Auch wenn in der heutigen Zeit ein besonderer Augenmerk unserem Konsum und der Gewinnung von Energie gilt sollten unsere Materialpotenziale nicht fahrlässig unbeachtet bleiben. Genauso, wie es erneuerbare und nicht erneuerbare Energien gibt, kann man auch zwischen erneuerbaren, wiedergewinnbaren und nicht erneuerbaren Rohstoffen unterscheiden. Wenn wir uns bewusst werden, wie bedeutend die Potenziale an erneuerbaren Energien sind und deren Nutzung ein rein finanziell lösbares technisches Problem ist, scheint das Problem der im Kreislauf geführten wiedergewinnbaren Rohstoffe gleichsam mit dem Energieproblem lösbar zu sein. Abgesehen von der Müllproblematik, den Giftstoffen, die in die Umwelt gelangen, bleibt der Umgang mit nicht regenerativen Rohstoffen ein wichtiger Punkt, damit wir mit den Potenzialen, die uns heute zur Verfügung stehen möglichst viel Nutzen generieren können.
Eine Unachtsamkeit oder Leichtfertigkeit heute kostet uns morgen Nutzen. Wenn wir mit Stein, Beton oder Asphalt hantieren und bauen, dann wählen wir diesen Wertstoff vor allem wegen seiner Beständigkeit und seiner bedeutenden Lebensdauer. Deshalb sollten wir achtgeben, dass wir indem was wir bauen nichts bauen, das die Generation nach uns als Monument unserer Verschwendungssucht empfindet, so wie die meisten Bauten aus den 60er und 70er Monumente für eine Zeit stehen, in denen der Energieverbrauch scheinbar gleichgültig war. Wir bauen, was wir sind.
Abriss gut integrierter Gebäude
Wenn von Sozialstaat gesprochen wird, ist oft davon die Rede, dass die Reichen den Ärmeren Geld geben und oft genug schwingt auch mit, dass die Schwachen durchgefüttert werden. Nicht selten wird es im abwertenden Sinne angeführt.
Etwas, das dabei in den Hintergrund fällt sind die sozialen Größen, die sich nicht monetär äußern. Vieles aus dem sozialen Bereich hat nichts mit reich oder arm zu tun, beziehungsweise nur so viel, als dass ein armer Mensch andere Sorgen hat als die, sich um soziale Werte zu sorgen, weil ihm der alltägliche Kampf um das Überleben zu sehr in Anspruch nimmt. Bevor wir von einem Sozialstaat mit einer dementsprechenden Gesellschaft sprechen können, denke ich, dass es wichtig ist, auch soziale Werte zu erkennen, zu erhalten oder zu schaffen.
Wenn wir uns ein zu Hause einrichten, ist es uns wichtig, dass wir dieses individuell gestalten, dass wir uns wohlfühlen und uns darin wiedererkennen. Ebenso sieht es aus, wenn wir ein Haus bauen oder kaufen. Es wäre kaum vorstellbar, dass wir alle irgendwann in Containern leben würden, obwohl dies wirtschaftlich gesehen durchaus von Vorteil wäre, aber so etwas würde zweifelsohne zu einem sozialen Aufstand führen, wie wir uns alle vorstellen können. Also hat die Individualität, der Charakter von Häusern und Ortschaften einen sozialen Wert. Ein Ort hat ein Gesicht, einen Charme und eine Geschichte, die uns die Möglichkeit geben, uns mit ihm zu identifizieren und das Gefühl zu haben, dorthin zu gehören. Fehlt dieser soziale Wert, kann man die Gebäude ebenso gut wegsprengen und in einer anderen Gegend aufbauen, ohne dass jemand mehr belastet wird als durch das Schleppen seiner Koffer.
Es ist nicht meine Absicht zu sagen: „Früher war alles besser“ oder dass wir wieder wie damals ortsverbunden, um nicht zu sagen verwurzelt leben sollten. Aber wir sollten doch die Werte erkennen und nicht achtlos den Charakter auslöschen, indem wir sterile Fassaden schaffen. Investoren, die nicht an den Gebäuden und nicht am Ort interessiert sind kaufen einzelne Häuser, die während Jahrzehnten das Gesicht der Gegend mitgeprägt haben. Diese werden abgerissen und gegen Mehrfamilienhäuser nach Schema F ausgetauscht, in denen später Mietswohnungen entstehen. Übergangsweise werden diese vielleicht auch gekauft und erst nach 6-8 Jahren weiterverkauft oder vermietet – bleiben will aber kaum einer, schließlich fehlt der Bezug. Es sind Wohnungen, ein Dach über dem Kopf, aber nicht der Ort, mit dem man sich identifizieren kann. Identifikation eines späteren Nutzers ist aber nicht primär Triebkraft für Investoren. Es gilt die arge Not zu stillen, Wohnraum zu schaffen, die durch fortwährend steigende Preise für Grundstücke Ausdruck findet. Der Preis, den die Gesellschaft dafür zu zahlen hat, ist eine schwindende Ortsverbundenheit und auch Bindung mit der lokalen Gesellschaft, was früher auch mal Gemeinschaft genannt worden ist. In den „modernen“ investitionsgetriebenen Mehrfamilienhäusern wächst der Stolz, den Nachbarn nicht zu kennen. Der Kontakt beschränkt sich auf die akustische Teilnahme am Familienleben aufgrund von mangelhaftem Schallschutz. Es passt dazu, dass unsere Gesellschaft immer weniger Zeit zu haben scheint, dass wir uns immer fremder werden. Das soziale Miteinander geht verloren, was wir aber erhalten ist sozialer Wohnungsbau. Wobei sich die Frage stellt, was das eigentlich mit sozial zu tun haben soll? Wir sollten es vielmehr beim Namen nennen. Es sind Dächer über dem Kopf für jene, die sich noch nichts anderes leisten können.
Was aber hält uns davon ab, den Charakter von Ortschaften zu erhalten? Sind die Gebäude derart schlecht? Nun für manche trifft es wohl zu. Aber eine andere Wahrheit sieht etwas trauriger aus. Oft genug wohnen ältere Menschen in solchen Gebäuden, in denen sie aufgewachsen sind und in denen längere Zeit nichts mehr investiert worden ist. Nach deren Ableben stehen sie kurze Zeit leer und die Erben vor der Frage, in das Haus zu investieren oder das Grundstück zu verkaufen, sodass ein viel lukrativeres Mehrfamilienhaus errichtet werden kann, von dem sie sicherlich finanziell profitieren möchten, aber keineswegs darin leben wollen.
In einem Sozialstaat sollten soziale Werte vor der kapitalistischen Übermacht geschützt werden. Wenn Baugesetze Identität von Ortschaften schützen, dann bliebe viel mehr von dem erhalten, was uns ausmacht. Was heute unsere Gebäude schützt, ist die Voraussicht der Älteren, ihre Häuser vor ihrem Ableben beim Sites et Monuments klassieren zu lassen oder der Idealismus der Erben, der dem Verzicht von viel Mietseinnahmen gleichkommt.
Wohnen bedeutet vielmehr als ein Dach über dem Kopf. Das, was eine Gesellschaft ausmacht, sind ihre sozialen Werte. Prägnant für unsere Zeit ist es, alles was mit sozial zu tun hat – Sozialstaat, sozialer Wohnungsbau – mit Armut in Verbindung zu setzen. Dabei ist eine Gesellschaft nichts weiter als das soziale Zusammenleben von Individuen. Was hat das mit Armut zu tun?
***
Ein weiterer Aspekt bei älteren Gebäuden ist oftmals der völlig unterschiedliche Bezug zur Lebensdauer. Werden demgegenüber Gebäude insbesondere aus den 60-iger und 70-iger betrachtet, so ist es hier meistens hinfällig, sich über eine Renovierung Gedanken zu machen. Bezüglich Schallschutz ist wenig investiert worden. Der Energieverbrauch und die Bausubstanz sind kurzfristig geplant und entsprechend ist gebaut worden. Die Architektur ist mit minimalistisch wohlwollend umschrieben. Nicht so bei Gebäuden, die bereits um die hundert Jahre oder länger stehen. Sie sind gebaut worden, um solide stehen zu bleiben. Zweihundert, dreihundert Jahre Nutzungsdauer, das bedeutet Materialien mit langer Lebensdauer zu nutzen. Das ist kein Vergleich mit dem, was vor einem halben Jahrhundert gebaut wurde und nicht mit dem, was heute errichtet wird. 15-20 cm Mauermerk eingeklebt mit Styropor. Kaum vorstellbar, dass einer das alle 40 Jahre neu mit Styropor einkleidet, dann vielleicht doch lieber zwischendurch den Abreishammer schwingen.
Was macht ein altes Gebäude aus? Ein wichtiger Faktor ist, dass sich alte Gebäude bewährt haben, denn ansonsten würden sie längst nicht mehr stehen. Zwar gibt es einige Mängel bezüglich Komfort und Energieverbrauch. Aber vieles davon lässt sich leicht beheben. Undichte Fenster und Türen sowie nicht gedämmte Dächer stellen bei der Sanierung keine große Herausforderung dar. Ohnehin sind alte Gebäude weit weniger schlecht als ihr Ruf, was sich insbesondere dann zeigt, wenn Energiestudien von einem deutlich höheren theoretischen Verbrauch ausgehen. Eine andere negative Eigenschaft, dass nämlich die Räume oft klein und dunkel sind, lässt sich nur bedingt verbessern, wenn es sich um historisch wertvolle Wohngebäude handelt. Hier ist es aber auch eine Geschmacksfrage und mit dem individuell empfundenen Charme aufzuwiegen. Bei alten Scheunen und Ställen sollte das allerdings in den wenigsten Fällen ein Problem sein.
Von hohem Wert jedoch sind die darin enthaltenen Materialressourcen, die ohne großen Aufwand an neuem Material, Arbeit und Energie verwendet werden können. Auch spricht das Konzept der Dauerhaftigkeit dafür, dass das Gebäude mit den darin verbauten Ressourcen noch lange genutzt werden kann.
In diesem Kontext wird immer häufiger auch von der grauen Energie gesprochen. Doch ist dies in meinen Augen zu eindimensional gedacht, denn abgesehen von Energie, die durchaus regenerativ und schadstoffarm gewonnen werden kann, ist dies bei vielen Materialien nicht der Fall. Das Abbruchmaterial muss mittels dem schadstoffintensiven Transportsektor zur Deponie geführt werden, die ihrerseits große Flächen beansprucht. Auf der anderen Seite müssen neue Materialien gewonnen werden und dies bedingt den Raubbau in neuen Gebieten. Hier nur die graue Energie zu berücksichtigen bedeutet, vorhandene Potenziale nicht wertzuschätzen.
Alte Gebäude sind äußerst massiv errichtet worden, weil das oberste Gebot Standhaftigkeit war und nicht mittels Rechnungen optimiert worden ist. Dies führt zu einem thermischen Vorteil, der bei modernen Gebäuden oft aufgegeben wird, und insbesondere im Sommer eine Überhitzung vermeidet und ebenso im Winter eine größere Robustheit gegenüber kurzfristigen Kälteeinbrüchen aufweist. Das bedeutet zwar nicht, dass alte Gebäude energetisch überlegen sind, aber es stellt durchaus einen weiteren Vorteil dar, den man sich zu Nutzen machen kann.
Eines sollte zumindest jedem klar werden. Bestandsgebäude sind ein enorm großes Materiallager, welches uns schadstoffarm und anwendungsbereit zur Verfügung steht. Es gilt mehr als nur die Frage des Sparens von Energie zu beantworten. Über allem steht nämlich nur ein Grundgedanke: Die effiziente Nutzung unserer Potenziale. Und ja, Gebäude sind für etwa 40 % unseres Energieverbrauches verantwortlich. Ebenso beanspruchen sie allerdings auch 50 % unseres Materialkonsums und sind für 60 % unserer Abfalls verantwortlich.
Voll asphaltierte Parkplätze
Vieles, das aus Beton oder Asphalt gebaut wird, soll sehr lange halten. Meist wird jedoch nicht daran gedacht, dass die Nutzung irgendwann doch geändert werden muss oder die Flächen – wenn auch nur kurzfristig – stören, z. B. wenn Leitungen verlegt oder ersetzt werden sollen. Aber auch lokale Beschädigungen der Oberflächen können eine großflächige Erneuerung bedingen.