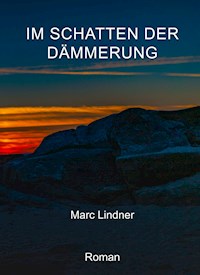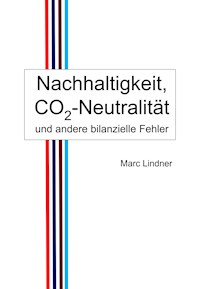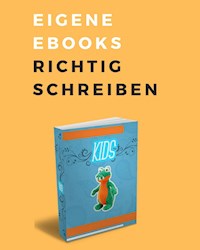3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die verborgenen Geschichten
- Sprache: Deutsch
Ismar und Clara haben Entscheidungen getroffen, die ihr Leben unwiderruflich ändern. Gemeinsam mit ihren Gefährten müssen sie einen gefährlichen Winter überstehen und ihren Platz noch finden. In den Wäldern ist es schwer Freund von Feind zu unterscheiden. Auf der Suche nach seinem Freund Haman lernt Ismar einen alten Mann kennen. Wenzel traut ihm nicht und dieser muss sich erst beweisen, bevor ihnen alle sein Geheimnis offenbart wird. Clara stößt auf Umwegen auf Veyt, der ein dunkles Geheimnis hütet. Seine Bruderliebe fordert von Clara mehr als sie jemals bereit gewesen wäre zu zahlen. Am Ende bleibt ihr eine Entscheidung und die Flucht in ihr neues Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Marc Lindner
Die verborgenen Wahrheiten
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Das ausgegrabene Gepäck
Winterrückzug
Nachtlager
Die Ankunft
Der Stall
Gerüchte
Die Tochter des Schreibers
Das Lager
Die Suche
Die Einstellung
Der nahende Winter
Der vergessene Weg
Winterabende
Das Wiedersehen
Überwintern
Wintereinbruch
Veyt und das Geheimnis
Die Warnung
Timors Geschichten
Der winterliche Felsen
Die Strafe
Timors Schatz
Dieters Erbe
Impressum neobooks
Das ausgegrabene Gepäck
Es war eine kalte Nacht. Ihr Körper wollte nicht zur Ruhe kommen und der Schweiß auf ihrer Haut brauchte lange bis er trocknete. Sie war so tief im Wald, dass sie von dem schwachen Wind nichts zu spüren bekam. Sie hörte nur, wie er mit den Baumkronen spielte. Selbst bei Tagesanbruch kostete es Clara viel Überwindung, aus ihrem Versteck zu kommen. Wie in der Nacht glaubte sie, Stimmen zu hören, die nach ihr riefen. Doch da war niemand.
Torkelnd vor Müdigkeit ließ sie das Gestrüpp hinter sich und auch den breiten Pfad verlor sie rasch aus ihrem Gesichtsfeld, da sie es nicht wagte, auf ihm zu weilen. Mehr als einmal musste sie sich an einem Baum stützen, da ihr schwindlig war. Wenn sie die Augen schloss, lag eine blutüberströmte Nonne vor ihr und sie riss panisch die Augen auf. Die durch ihre Schuldgefühle ausgemalte Erinnerung und die Angst wollten sie dennoch nicht loslassen. Manchmal stand sie nur da und starrte auf ihre zitternden und zerkratzten Hände und sie fragte sich, wie sie das nur hatte tun können. Ihr Herz pochte wild und ihre Kehle schnürte sich zu, sodass sie glaubte, zu ersticken.
Wie lange sie umherirrte, wurde ihr erst bewusst, als sie sah, wie hoch die Sonne bereits stand. Da erst riss sie sich so weit zusammen, dass sie einen klaren Gedanken fassen konnte. Die Orientierung hatte sie fast gänzlich verloren, sie wusste nur, dass sie seit ihrer Flucht im Wald immer wieder bergauf gelaufen war.
Es fiel ihr schwer, konzentriert zu bleiben. Von dem Weg, den sie einschlug, war sie nicht ganz überzeugt. Sie hoffte nur, dass die Richtung passte. Der Rest würde sich ergeben, wenn sie aus dem Wald fand. Während der Tag verging, stellte sie mehr als einmal fest, wieviel sie bei Bruder Johannes gelernt hatte. Auch wenn es nützlich war, schmerzten sie die Erinnerungen. Er hatte sie im Stich gelassen. Eigentlich war er der einzige Grund, warum all das passiert war, denn sie wollte nicht zu den Nonnen – und nun war eine von ihnen tot, und an ihren Händen klebte Blut, das sie nie wieder loswerden würde.
Am späten Nachmittag stieß sie auf den Bachlauf, an den sie sich zu erinnern glaubte. Dieser würde sie zurück zum Dorf führen. Sie atmete tief ein und aus, erfrischte sich und folgte schließlich dem Wasser. Sie erreichte den Waldrand und wagte einen flüchtigen Blick auf das friedlich wirkende Dorf. Nirgends waren Rufe zu hören und auch ansonsten drangen keine Geräusche bis zu ihr durch. Ohne aus dem Schatten der Bäume zu treten, drehte sie sich um und wandte sich vom Wasser ab.
Es kostete sie viel Mühe sich daran zu erinnern, was vor einigen Tagen war, ohne dass die Bilder des Vortages sie übermannten. Sie hatte sich einige auffällige Wegmarker ausgesucht und so fand sie rasch zu ihrem Versteck.
Die letzten Schritte setzte sie zögerlich und ihr Herz rutschte ihr sprichwörtlich in die Hose, als sie ihre Befürchtung bestätigt fand. Sie ließ sich auf die Knie fallen und strich über den Haufen Erde, der eigentlich das Versteck bedecken sollte. Bruder Johannes war bereits hier gewesen und hatte es geleert. Auch wenn er den Standort nicht genau kannte, hatte er inzwischen mehr als genug Zeit gehabt, um danach zu suchen. Er war damit nicht mehr an sein Versprechen gebunden, weil er ihrer nicht bedurfte, um seine geschätzten Bücher wiederzufinden. Wütend ließ sie ihre Faust auf den Haufen Erde einschlagen. Doch es half nichts. Die Bücher waren weg und Bruder Johannes auch. Sie würde ihn nie finden können und war nun völlig auf sich allein gestellt.
Mit allem überfordert sackte sie nach vorne und blieb liegen, so wie sie hinfiel.
„Ich weiß, dass dir dein Kleid nicht gefällt“, ertönte eine Stimme hinter ihr. Erschrocken sprang sie auf, doch wegen ihrer Tracht und der aufgelockerten Erde fiel sie gleich wieder hin.
„Trotzdem solltest du besser darauf achtgeben“, wahrte Bruder Johannes die Ruhe, die Clara vollends verloren hatte.
„Du…“, schafften es ihre Gedanken nicht, einen Satz zu formen. Sie lag auf dem Rücken und ihr schmutziges Gesicht war mit Tränen überlaufen.
„Wie ich es versprochen habe“, war der Mönch froh, ihr endlich begreiflich zu machen, dass er Wort hielt.
„Aber …“, unterbrach ein Schluchzen ihre Frage. Es war alles zu viel, und die gute Laune des Mönches war für sie unbegreiflich.
„Na was ist denn?“, begriff der Mann in der Kutte, dass seine Begrüßung ihre Wirkung verfehlte. Nun ebenfalls verwirrt, setzte er sich zu Clara und wollte sie mit einer Umarmung beruhigen. Doch Clara stieß sich nach hinten und ließ den verdutzten Mönch auf Distanz.
„Clara“, hauchte Bruder Johannes und kratzte sich überfordert am Hinterkopf. „Ich habe dir mein Wort gegeben“, verstand Bruder Johannes nicht, wie Clara derart daran hatte zweifeln können. „Du bist jetzt hier und du musst nie wieder in ein Kloster“, erklärte er ihr, dass ihr Wunsch nun in Erfüllung ging. „Wir werden gemeinsam die Welt bereisen und Gutes tun.“ Er streckte ihr seine Hand entgegen, doch sie wisch nur noch weiter zurück.
„Geh, ich habe Schreckliches getan“, brach eine neue Flut an Tränen aus ihr hervor. Sie drehte sich um und versteckte ihr Gesicht in ihren erdverklebten Händen.
Bruder Johannes hielt inne. „Das wird alles wieder gut“, gab er mit gerunzelter Stirn zurück.
„Nichts wird gut“, heulte Clara auf und war kurz davor wegzulaufen. Doch ihre Beine brachen weg, da ihr die Kraft fehlte.
„Clara“, sprach Bruder Johannes nun lauter. „Clara“, wiederholte er und seine Stimme wurde gar streng. Mit Verständnis glaubte er nicht weiterzukommen. „Reiß dich zusammen“, forderte er sie auf. „Wir werden den Weg, der vor uns liegt, gemeinsam gehen, egal was passiert ist.“ Seine Stimme wurde ruhiger. „Du wolltest dein Leben selbst bestimmen“, rief er ihre Erinnerung wach. „Jetzt beginnt dein Leben, und es ist deine Entscheidung, was du tun möchtest, deine Entscheidung, wer du sein möchtest.“
„Nein, ist es nicht!“, schluchzte Clara auf.
„Doch Clara, keiner …“ Bruder Johannes wurde jäh unterbrochen, als Clara sich aufrichtete und ihn finster ansah.
„Nein, ist es nicht“, brüllte sie ihn an. „Ich bin eine Mörderin!“ Ihre Stimme verlor an Kraft. „Daran wird sich nie etwas ändern.“
Bruder Johannes blieb der Mund aufstehen und er spürte, wie sich ihm die Kehle zuschnürte.
Clara stand unvermittelt auf und der Mönch hob seinen Blick.
„Ich bin eine Mörderin“, torkelte Clara davon und für den kurzen Moment, indem sich ihre Blicke trafen, überkam den Mönch das Gefühl, in die Augen einer Wahnsinnigen zu schauen.
„Clara“, rief er ihr hinterher, als er sich bewusst wurde, dass er anders reagieren musste, als nur mit offenem Mund, auf den Knien sitzen zu bleiben. „Clara“, stand er auf und fühlte sich so hilflos, wie schon lange nicht mehr.
Clara fehlte die Kraft, um weiterzugehen, aber mehr noch fehlte ihr die Kraft, den Mönch an sich heranzulassen und so mühte sie sich, Schritt für Schritt weiterzugehen.
Plötzlich spürte Clara eine Hand auf ihrer Schulter. Mit einem Beben blieb ihr Körper stehen, nur um Augenblicke später auf die Knie zu fallen. Erneut vergrub sich ihr Gesicht in ihren Händen.
„Clara“, flüsterte der Mönch, während er an ihr vorbei ging. Seine Hand ließ ihre Schulter nicht los. „Clara“, wiederholte er, als er auf den Knien vor ihr saß. Deutlich vernahm er das unterdrückte Schluchzen und ohne darüber nachzudenken, zog er sie zu sich heran. Die Hände immer noch vor dem Gesicht, lag sie in seiner Umarmung und das Schluchzen wurde lauter.
„Es tut mir leid“, flüsterte Bruder Johannes in ihr Ohr. „Ich habe von dir verlangt, was ich nicht hätte verlangen dürfen“, sprach er nach einer Weile weiter. Erneut trat eine Pause ein, in der einzig ihr Weinen zu hören war. „Es ist allein meine Schuld.“ Er strich ihr sanft über den Rücken.
„Ist es nicht“, stieß sie sich mit letzter Kraft nach hinten. Der Mönch ließ es zu und blickte in ein tränen- und schmutzverschmiertes Gesicht. „Ich habe sie getötet, ich allein“, sprach sie ihren Schuldspruch aus. „Ich bin eine Mörderin“, versteckte sie sich diesmal in seiner Umarmung. Der Mönch fuhr ihr erneut über den Rücken und schwieg für eine lange Weile.
„Es wird nichts ungeschehen machen, aber teile deine Last mit mir. Erzähl mir, was passiert ist. Ich werde nicht über dich urteilen.“
Es dauerte lange bis keine neuen Tränen kamen. Ihre Muskeln spannten sich. Sie ließ sich auf den Hintern fallen und zog ihre Beine eng an ihren Körper. Wieder verstrich viel Zeit und Bruder Johannes setzte sich ihr gegenüber hin.
Clara begann mit ihrer Geschichte ab dem Moment, in dem sich ihre Wege trennten. Auch Bruder Johannes erzählte seinen Teil und gab Clara weniger das Gefühl bei der Beichte oder auf der Anklagebank zu sitzen. Es mischte sich viel aufgestaute Wut in Claras Erzählung, doch als diese sich ihrer Flucht näherte, brachen neue Tränen hervor und sie konnte den Mönch nicht länger ansehen.
„Danke für dein Vertrauen“, hielt Bruder Johannes Wort und erlaubte sich weder einen Kommentar noch ein Urteil.
„Als du nicht herauskamst, habe ich mir erlaubt, die Bücher zu suchen und hier auf dich zu warten. Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass die Nonnen dich derart übel behandeln könnten“, endete er mit seinem Teil. „Ich habe ein Versteck gefunden und dort ein Lager aufgeschlagen. Lass uns dorthin gehen. Es ist besser, wenn uns keiner sieht, und du brauchst Ruhe.“
„Wie kannst du tun, als sei nichts passiert?“, brach es aus ihr hervor.
„Du verurteilst dich selbst schon genug“, sprach der Mönch ruhig. „Ich habe dich in diese Notlage gebracht, doch du hast mir mit keinem Wort die Schuld gegeben.“
Clara wollte antworten, doch die Worte stimmten sie nachdenklich.
Der Mönch stand bereits vor ihr und reichte ihr die Hand zum Aufstehen. „Die Vergangenheit kannst du nicht ändern“, blickte er zu ihr herab. „Aber was du an Schuld geladen hast, kannst du versuchen an Gutem aufzuwiegen.“ Er lächelte ihr zu. „Wähle deinen Weg, Clara.“ Ihr Blick blieb zur Erde gerichtet. „Du wolltest doch Gutes bewirken?“, rief er ihr in Erinnerung. „Nun hast du einen Grund mehr dazu“, fasste er ihr Schicksal zusammen. Sie sah ihn finster an, doch sein Lächeln wurde nur breiter. „Die Clara, die ich kennengelernt habe, gibt nicht auf und hinter Ausreden versteckt sie sich erst recht nicht.“
„Das ändert nichts daran, dass ich eine Mörderin bin“, presste sie hervor, griff Bruder Johannes' Hand und wischte sich mit der zweiten Hand die Tränen weg.
„Glaub mir Clara, auch mein Weg ist nicht ohne Sünde.“ Mit diesen Worten zeigte er in Richtung Lager.
Es verlangte Clara viel ab, sich ihre Schwäche nicht zu deutlich anmerken zu lassen. Keiner der beiden sprach ein Wort auf dem Weg, der sich länger zog, als Clara gehofft hatte. Dichtes Gestrüpp tauchte vor ihnen auf und als sie in eine davor liegende Mulde hinabgestiegen waren, zog der Mönch zwei Äste auseinander und gab so einen Spalt zwischen zwei Felsen preis. Er legte sich auf die Erde und kroch hindurch, während Clara sich aufrecht hindurchzwängen konnte.
Die Felsen waren an vielen Stellen ausgehöhlt und nach oben hin klafften Rissen teils schmaler, teils breiter auseinander. Eine Stelle aber schützte nicht nur gegen unliebsame Blicke, sondern auch gegen Wind und Regen. Hier hatte der Mönch sein Lager aufgeschlagen. Vom Feuer kündete nur noch die erlöschende Glut.
„Komm setz dich“, lud Bruder Johannes sie ein und hockte bereits neben der Feuerstelle, um mit feinem Geäst das Feuer zu beleben. Dankbar hielt Clara ihre Hände an die wachsenden Flammen. Wellen der Kälte durchströmten ihren Körper und ihr wurde nun erst klar, wie sehr sie die Nacht über gefroren hatte. Ihre Hände kribbelten schmerzhaft, dennoch zog sie sie nicht zurück, sondern versuchte durch Reiben, das Gefühl zu vertreiben.
„Bruder Johannes?“, brach Clara nach einer Weile das Schweigen.
Dieser ließ ein Brummen ertönen. „Damit ist es wohl auch an der Zeit aufzuhören“, meinte er schließlich. „Ich bin Hönnlin“, stellte er sich vor. „Das Klosterleben liegt endgültig hinter mir.“
„Hönnlin“, wiederholte Clara unsicher. Es fiel ihr schwer in ihm etwas anderes zu sehen als einen Mönch. „Aber wie soll ich jetzt weiterleben?“
„Wie meinst du das?“, fragte Hönnlin.
„Ich bin eine Mörderin“, hauchte Clara in die Flammen.
„Du bist immer noch Clara“, gab Hönnlin nach einer Weile als Antwort.
Clara sah ihn finster an. Es waren ihre dunklen Gedanken, die auf ihre Miene durchfärbten. Vor ihrem geistigen Auge lag die tote Nonne, dahinter unzählige Kerkertüren, unter denen die Feuer der Hölle hervorzüngelten. Die Nonnen waren nie sparsam mit den finsteren Geschichten umgegangen, wenn es darum ging, Sündern Angst und Bange werden zu lassen.
„Wolltest du die Nonne töten?“
Clara sprach die Antwort nicht aus.
„Freust du dich über ihren Tod?“ Abermals ließ eine Kopfbewegung das Nein erahnen. „Warum hast du sie getötet?“
„Es ging alles so schnell. Ich wollte nur vorbei“, presste Clara wütend hervor.
„Da hast du deine Antwort, die du brauchst.“ Hönnlin lächelte aufmunternd. „Viele würden in dir eine Mörderin sehen, selbst du möchtest es so.“ Hönnlin wandte seinen Blick den Flammen zu. „Du wolltest frei sein.“ Er stocherte im Feuer. „Das ist dein gutes Recht, Clara. Die Nonnen wollten es dir verweigern, und soweit ich das erahnen kann, war Gier ihre Motivation dahinter.“ Clara schwieg.
„Der Tod der Nonne wiegt schwer, Clara, aber sie wollte dir rauben, was nur dir allein gehört. Es war ein Unfall, Clara, und gleichzeitig der Preis für deine Freiheit.“
Clara sah ihn stirnrunzelt an.
„Um deine Frage zu beantworten: So solltest du leben, frei, aber bleib dir des Preises bewusst, den du gezahlt hast.“
„Ich soll es mir so einfach machen?“, entgegnete Clara fassungslos.
„Versteh mich nicht falsch, du hast eine Schuld zu begleichen!“
„Wann wird die Schuld beglichen sein?“
Hönnlin blickte Clara in die Augen. „Nie, Clara“, er legte seinen Kopf schräg und lächelte milde. „Aber das sollte dich nicht davon abhalten, es zu versuchen.“
„Begleichst du auch eine Schuld?“, wollte Clara wissen.
„Eine?“, erwiderte Hönnlin mit einem tiefen Seufzer. „Ich habe längst aufgehört zu zählen, wie viele Schulden ich begleiche.“
„Pflanzt du deshalb all die Nussbäume?“ Es tat Clara gut über etwas anderes, als ihre Schuld zu sprechen.
Der ehemalige Mönch dachte darüber nach. „Ja und nein“, musste Hönnlin leise lachen. „Weder du noch ich sollten uns nur von unserer Schuld treiben lassen. Gutes zu tun, sollte nicht daraus gründen, Schlechtes getan zu haben.“
Clara dachte darüber nach.
„Erinnerst du dich noch, was ich dir über Abtrünnige erzählt habe?“, wollte Hönnlin wissen.
Clara zuckte mit den Schultern und so sprach Hönnlin aus, was Clara noch nicht in Worte fassen wollte. „Wir sind nun auch Abtrünnige. In gewisser Weise sind die Bäume nun wohl auch für uns“, machte er sich über die Ironie des Lebens lustig.
„Dann hast du das alles geplant?“ Clara kam aus ihrer Verwunderung nicht mehr heraus und sie stellte nun alles infrage.
„Nein“, wurde Hönnlin schlagartig ernst. „Nein, Clara.“ Eine Weile war nur das Knistern des Feuers zu hören.
„Es gibt eine Weise wie ich wünschte, dass die Welt funktionieren würde. So ist es nicht, und wahrscheinlich wird es auch nie so sein. Aber so lebe ich, dann wenn ich nicht so lebe, wer bin ich, dass ich wünsche, dass die Welt so lebt?“ Hönnlin atmete schwermütig aus. „Mein Glaube lehrt mich Brüderlichkeit und Nächstenliebe. Vor Gott sind wir alle gleich Clara, also behandele andere, wie du selbst behandelt werden möchtest. Manchmal wirst du ernten, was du sähst, aber zögere nicht, wenn du weißt, dass dem nicht so ist.“
„Aber du hast mit der Kirche gebrochen“, erinnerte Clara ihn an seine Entscheidung.
Hönnlin hielt Claras Blick stand. „Mit der Kirche ja“, nickte er nachdenklich. „Aber nicht mit meinem Glauben.“ Sie verstand nicht, was er sagen wollte. „Mein Glaube könnte nicht fester sein und ich habe der Kirche zugehört, wenn sie sprach. Das, was ohne Eigennutzen ist, das ist der Glaube, Clara. Nächstenliebe, das Leben und die Welt achten. Das bedeutet es, das Geschenk Gottes wert zu schätzen. Nenn es, wie du es nennen möchtest. Christen oder jene, die die Kirche als Heiden bezeichnet, erzählen viele Lügen, doch jede Lüge hat ihren wahren Kern. Ich habe nur einen Teil dieser Welt bereist und bin dabei vielen Religionen begegnet. Glaub mir“, er lächelte aufmunternd, da er ihren überforderten Gesichtsausdruck bemerkte. „Von vielen, wenn nicht gar von ihnen allen, kannst du lernen.“
„Steht das alles in deinen Büchern?“, versuchte Clara mehr zu verstehen.
„Das und noch mehr“, erklärte Hönnlin. „Andere Religionen verbieten keine Wissenschaft. Es gibt Länder in dieser Welt, da gelten unsere Gebildeten als Unwissende. Es gibt Heiler, die bei uns am Scheiterhaufen landen würden, weil sie die Krankheiten verstehen, die sie heilen. Unsere Kirche kennt nur Gott als Antwort. Aber es ist nicht Gott, der entscheidet, ob Wundbrand entsteht oder ein Fieber tödlich ist. Viel wichtiger sind die Heilmethode und die Heilstoffe.“
„Das ist Blasphemie“, stöhnte Clara auf und hielt sich wohl zum ersten Mal in ihrem Leben an dem fest, was ihr eingebläut wurde.
„Die Kirche nennt es Blasphemie. Ich glaube an Gott, Clara, und daran, dass jeder das Geschenk Gottes achten sollte. Es ist unsere Aufgabe, um das Leben zu kämpfen, und nicht die Verantwortung mit einem Gebet an Gott zurückzugeben.“
Clara schwieg. So viele Gedanken galt es zu ordnen.
Hönnlin legte ihre Mönchstracht heraus und ließ sie ansonsten unbehelligt.
Die durch unzählige Risse unbrauchbare Tracht der Novizinnen war längst zu Rauch geworden, als Hönnlin ihr einen Teller Suppe reichte.
Sie stocherte durch die dampfende Masse und brach schließlich das Schweigen.
„Aber was passiert mit einer Mörderin?“, wollte sie wissen und suchte Hönnlins Blickkontakt.
„Ich weiß es nicht“, gestand Hönnlin offenherzig. „Du kennst die Antwort der Kirche. Was keiner von uns kennt, ist die Entscheidung Gottes.“ Hönnlin ließ eine Pause entstehen. „Wiegt eine Tat schwerer, als die Taten eines ganzen Lebens?“ Er lächelte mitfühlend. „Gleichwohl musst du eine Entscheidung für dein Leben treffen.“ Hönnlin hielt ihren Blick fest. „Wie möchtest du leben, hätte die Kirche Recht?“
„Ich möchte meine Schuld begleichen und für Gerechtigkeit sorgen“, meinte Clara entschlossen.
„Und hättest du keine Schuld zu begleichen?“
„Auch dann möchte ich Gutes tun“, bekräftigte Clara, nachdem sie ihr anfängliches Stutzen überwand.
„Dann hast du deine Entscheidung getroffen und an dir ist es nun, dieses Leben zu führen und die Entscheidung über dein Schicksal, musst du Gott überlassen.“
„Aber was ist“, begann Clara, doch Hönnlin unterbrach sie.
„Die Antwort wirst allein du herausfinden, aber nicht, solange du auf Erden wanderst.“
Clara seufzte schwer.
„Es tut mir leid, wenn ich dir keine Antworten geben kann“, lud Hönnlin die Schuld auf sich. „Nun iss, dein Körper muss zu Kräften kommen.“
Winterrückzug
„Irgendetwas müssen wir tun“, begann Hönnlin unvermittelt. Sie saßen am Feuer und nachdem Clara bis zum Mittag geschlafen hatte, waren an diesem Tag keine großen Taten mehr zu erwarten.
Stirnrunzelnd sah Clara ihn an. „Was ist dein Plan?“ Sie wunderte sich über seine Aussage, da sie so gar nicht nach dem Mann klang, den sie kennen gelernt hatte. „Du hast doch sicher einen Plan?“, fragte sie, als er nach einer Weile immer noch schwieg.
„Nicht wirklich.“ Er schmunzelte, als er Claras große Augen sah. „Ich hatte Pläne, aber die waren für mich bestimmt. Nun sind wir zwei und ich kann nicht für, und noch weniger über dich entscheiden.“ Das klang schon eher nach dem Mönch, den sie kennen gelernt hatte. Doch es half nicht, ihre Gedanken zu entwirren.
„Ich weiß nicht.“ Sie zögerte eine Antwort hinaus. Das war eine ungewohnte Verantwortung, derer sie sich stellen musste. Selbst bestimmen, ohne einfach nur wegzulaufen. „An was hast du denn gedacht?“
„Bis zum Herbst wollte ich über die Landesgrenze sein.“ Er ließ vieles im vagen, da er selbst keinen detaillierten Plan besessen hatte. „Ich habe einige Bekannte, die ich besuchen möchte. Aber das wird ohnehin bis nächstes Jahr warten müssen.“
„Das war dein Plan?“
„So in etwa“, schmunzelte Hönnlin, da er sich ausmalte, wie eigenartig das klingen musste. „Du hast vieles über den Kopf geworfen.“ Sein Lachen verriet, dass er ihr das keineswegs übelnahm. „Erst der Umweg, dann haben wir uns auch noch Zeit gelassen.“ Er beschäftigte seine Finger damit, dass er eine neue Schüssel schnitzte. „Jetzt verspüre ich weder eine Eile, noch möchte ich es sein, der allein plant. Es ist dein Leben.“
„Aber ich habe noch nie“, begann sie und wusste dann nicht, wie sie es aussprechen sollte.
„Dann wird es Zeit, damit anzufangen.“
„Wie plant man sein Leben?“ Clara versuchte sich etwas darunter vorzustellen, doch alles, was ihr einfiel, waren Gesichter von Personen, die bisher über sie bestimmt hatten.
„Nun“, begann Hönnlin verständnisvoll. „Erst einmal musst du entscheiden, ob dein Leben geplant sein soll oder ob du ungeplant leben möchtest.“
„Ungeplant!“, antwortete Clara prompt.
„Das macht vieles einfacher.“ Hönnlin nickte nachdenklich. „Also brauchst du einen Grundsatz oder gleich mehrere.“
„Welchen Grundsatz kann mein Leben haben?“ Hönnlin sprach wie in Rätzeln für sie.
„Du möchtest Gutes bewirken, das waren deine Worte. Das ist ein erster Grundsatz. Nach diesem soll sich dein Leben richten.“
„Ja“, stimmte Clara zu und nickte mit einem wachsenden Lächeln.
„Vielleicht auch eine Idee, wohin es dich hinziehen soll?“
Clara schüttelte den Kopf, dachte nochmals darüber nach und schüttelte ihn erneut. „Nein, ich möchte mehr von der Welt sehen.“
„Also können wir überall bleiben und müssen nirgends hin. Ebenso müssen wir nirgends bleiben und können überall hin.“ Hönnlin grinste zufrieden. „Das klingt ganz nach meinem Plan.“
Clara löste den Knoten in ihrem Kopf mit einem kurzen Kopfschütteln und erwiderte sein Grinsen.
„Also müssen wir uns nur Gedanken um unsere ersten Schritte machen, den Rest entscheidet das Leben für uns.“
Damit tat sich Clara dann doch schwerer als sie es gedacht hätte. Hönnlin zählte ihr einige Vorschläge auf, und schließlich entschlossen sie, für einige Tage hier Rast zu machen und Pilze und Kräuter zu sammeln, die sie später eintauschen würden. Clara gefiel die Vorstellung erst einmal keine Menschen zu sehen.
Ihre Wut auf und ihre Zweifel an Hönnlin waren weg. Er hatte Wort gehalten und mehr zählte nicht länger. Nun begann ihr neues Leben, rief sie sich ständig in Erinnerung. Das worauf sie gehofft, aber an das sie nie hatte glauben können, war eingetroffen. Seltsam daran war, dass sie nicht wusste, wie sie damit umgehen sollte. Sie hatte bisher dafür rebelliert, dass sie Entscheidungen treffen durfte. Doch nun wusste sie nicht, ihre Möglichkeiten zu benennen.
Eine Woche später brachen sie auf. Es gab kein Kloster, das auf sie wartete und keine Entscheidung, die sie erwartete. Nur eine grobe Richtung schwebte Hönnlin vor – Nordwesten. Doch für die ersten Ziele würde das ohne Bedeutung sein.
„Wir müssen dir und mir neue Kleidung besorgen.“ Hönnlin spürte, dass das Verhältnis, das zwischen ihr und ihm bestand in keiner Weise mit dem zu vergleichen war, als sie noch in Italien aufgebrochen waren. Clara war nicht länger seine Schutzbefohlene. Sie war auch kein unbeschwertes Kind mehr. Er sah sie oft und lange nachdenklich gestimmt. Sie sprang nicht verspielt umher und die Fragen, die sie stellte, waren tiefgründiger oder praktischer geworden.
Sie sah zu ihm herüber und versuchte sich Hönnlin in etwas anderem als seiner Mönchskutte vorzustellen. Sie schüttelte die Vorstellung mit einer Kopfbewegung weg. „An was hast du gedacht?“
„Praktischere Reisekleidung und etwas für dich, mit dem du auch unter Menschen umherlaufen kannst, ohne dass wir riskieren, dass einer ein Geheimnis lüftet, das uns in Schwierigkeiten bringen kann.“
„Du meinst, dass ich eine Mörderin bin?“ Clara sprach es nüchtern aus und zog eine Augenbraue hoch.
Hönnlin biss sich unbewusst auf die Lippe. „Ich hatte eher daran gedacht, dass du kein Mann bist.“ Er fuhr sich über seinen wachsenden Bart. Auch dieser irritierte ihn. „Eine Mörderin erkennt man nicht an ihrer Kleidung.“ Er versuchte ebenso nüchtern zu klingen wie Clara, und so, als wäre dieses Gespräch völlig selbstverständlich.
Clara schmunzelte. „Was soll ich denn sein?“
„Eine Bäuerin kauft dir keiner ab und es würde sich schlecht erklären lassen, wieso du auf Reisen bist.“ Hönnlin dachte über ihre Frage nach. Er hatte an Frauenkleidung gedacht und sich über die Art keine Vorstellung gemacht, aber sie hatte natürlich Recht. Irgendetwas musste sie sein. „Du kochst nicht schlecht. Du könntest über den Winter als Küchenmagd eine Einstellung finden.“
Clara wog den Gedanken ab und schmatzte übertrieben mit ihren Lippen. „Wenig schmackhaft“, lachte sie auf. „Wenn ich schon etwas Neues sein kann, dann sollte es mehr Spaß machen.“
„Was machst du denn gerne?“
Erneut eine Frage auf die sie nicht vorbereitet war. Lange gab sie keine Antwort. Hönnlin fragte auch nicht nach. Ihre Gespräche zogen sich oft lang, ohne dass einer sprach. Wenn es etwas gab von dem sie reichlich besaßen, dann war es Zeit.
„Ich möchte mehr von dem Wissen, was in deinen Büchern steht.“ Das war keine Beschreibung mit der Hönnlin direkt etwas anfangen konnte. „Ich möchte mehr von dem Lesen, was die Kirche nicht möchte, dass ich lese.“
„Warum das?“ Hönnlin war über diesen Wunsch verwundert. Er passte zu Clara, allerdings hätte er nicht gedacht, dass es sie so beschäftigte.
„Um zu verstehen, wovor sie sich fürchten. Und um zu helfen. Du hast gesagt, dass in diesen Schriften viel steht, was einem helfen kann zu heilen.“
„Es reizt dich nicht, weil es verboten ist?“
Clara grinste. „Das hilft natürlich. Aber diese Nonnen verbieten eigentlich alles und ich möchte schließlich nicht alles tun, was verboten ist.“
„Das soll ein Versuch sein, vernünftig zu wirken?“
Clara wägte eine Antwort ab, entschied sich aber für ein Schweigen.
„Nun, das ist weder ein Beruf, noch hilft es uns, eine passende Kleidung für dich zu finden.“ Er versuchte ihre Antwort ernst zu nehmen.
„Lesen ist kein Beruf?“ Clara spielte zutiefst erschüttert. „Warum wollten die Nonnen denn, dass ich lesen und schreiben kann?“
„Schreiber ist ein Beruf, in gewisser Weise“, lenkte Hönnlin ein. „Aber dann liest und schreibst du nicht, was du möchtest.“
„Besser als Rüben schälen, wird es aber allemal sein!“ Damit stand auch fest, was Clara nicht mochte, dachte Hönnlin und verkniff sich mit Mühe ein Grinsen.
Diesmal ließ sich Hönnlin länger Zeit mit einer Antwort.
Sie machten eben an einem Bachlauf Halt, füllten ihre Flaschen und ruhten sich aus. „Dann sollte ich auch Schreiber sein“, nahm er das Gespräch erneut auf. „Du könntest meine Tochter sein.“
Sie sah ihn stirnrunzelnd an.
„Warum sollten wir sonst zusammen reisen und nach einer Anstellung suchen?“ Hönnlin band sie in seine Überlegungen mit ein.
Sie hatte ihre Eigenart der übereilten Antworten abgelegt. Übrig geblieben war das Öffnen des Mundes, dem dann ein rasches und manchmal hörbares Zuklappen folgte.
„Da spricht nichts dagegen.“ Sie musste lachen. „Vater.“
Hönnlin musste ebenfalls lachen.
„Aber ich bin kein einfaches Kind.“ Daran musste sie ihn nicht erinnern.
Diesmal klappte Hönnlins Mund zu. In letzter Sekunde hatte er seinen Fehler bemerkt und seine Gedanken daran gehindert auszusprechen, dass er sie dann in ein Kloster schicken könnte.
Clara verbuchte das Schweigen als rhetorischen Sieg und war damit äußerst zufrieden.
„Wollen wir nicht für die Nacht hierbleiben?“ Er lenkte ab und gönnte ihr die Freude. „Meine Tochter.“
Sie zuckte mit den Schultern. Sie wollte sich darüber keine Gedanken machen.
„Es wird rasch kühl.“
„Dann entzünde ich ein Feuer.“ Sie freute sich über praktische Aufgaben. Sie wäre Hönnlin auch bis tief in die Nacht gefolgt, ohne sich zu beschweren. Nur tatenlos umhersitzen gefiel ihr nicht. Dann kamen Gedanken auf, die sie schwer zu verdrängen vermochte.
„Wie kommen wir an Kleidung für Schreiber und Schreiberstöchter“, fragte Clara, als sie den Nussbaum gepflanzt hatte und sie darauf wartete, dass Hönnlin mit der Suppe zufrieden war. Es gab Pilzsuppe, so wie die Tage zuvor, doch jedes Mal schmeckte sie anders, weil Hönnlin scheinbar jedes Kraut kannte, das aus dem Waldboden wuchs.
„Mit Glück und Geduld. Wir können froh sein, wenn wir anfangs etwas anderes als diese Kutten tragen können. Dann werden wir weniger Aufsehen erregen. Zur Not wird uns einfache Reisekleidung auch reichen, um eine Anstellung zu finden.“
„Das Wetter schlägt um.“ Hönnlin kam von Claras Esel zurück, den er an einen anderen Baum gebunden hatte, damit er frische Nahrung fand. „Morgen sollten wir dem ersten Weg folgen, auf den wir stoßen.“ Clara nickte. „Jetzt sind die Kräuter schön trocken.“
Claras Herz schlug schneller, als sie sich vorstellte, am folgenden Tag fremden Menschen gegenüberzustehen.
„Wir müssen gewahr werden, wo sich die nächste Stadt befindet. Auf dem Land werden wir das hier nicht los.“ Hönnlin wollte ihr seine Gedankengänge erklären, auch wenn sie am Gespräch nicht teilnahm.
Clara ging zum Bach und spülte das benutzte Geschirr. Als sie zurückkam, wickelte sie sich in ihre Decke ein und stocherte mit einem Ast im Feuer.
„Früh schlafen gehen schadet nicht, dann brechen wir morgen in aller Früh auf.“ Hönnlin spürte, dass etwas nicht stimmte, auch wenn er nicht genau wusste, was.
Clara nickte dankbar, legte Holz nach und machte es sich nah am Feuer bequem. „Gute Nacht, Vater.“ Sie lächelte und atmete tief aus, bevor sie die Augen schloss.
„Schlaf gut, mein Kind.“ Hönnlin bereitete leise sein Nachtlager und folgte Claras Beispiel.
Nachtlager
„Bald ist es so weit“, brach Ismar das Schweigen und konnte seine Aufregung nicht verbergen. Sie saßen an einem großzügig brennenden Lagerfeuer zwischen dicht aneinander stehenden Tannen. Sie waren des Regens überdrüssig. Selbst im Wald waren sie ihm den ganzen Tag über nicht entkommen, doch zumindest blieb ihnen hier der peitschende Wind erspart, mit dem dieser Herbststurm ihnen hartnäckig nachstellte. Das Ächzen der Äste ließ sie den Sturm aber nicht vergessen. Ab und an schüttelte der Wind neue Wasserschauer aus den Ästen auf sie herab. Auch wenn es kaum noch regnete, wollten ihre Kleider nicht mehr trocknen. Das Feuer knisterte lebhaft und war die einzige Antwort die Ismar erhielt. Der stumme Wenzel schnitzte unbekümmert an dem zweiten Bogen. Dieser war deutlich schmächtiger als seiner und war für Ismar gedacht. Wenzel wusste, wohin es ging, doch war ihm dies alles unwichtig. Er folgte Ismar treuer als ein Schatten und ebenso widerstandlos. Wenzel machte keine großen Pläne. Dennoch ließ er Ismar nicht im Stich. Das junge Wildschwein, von dem sie noch immer zehrten, war sein bisher größter Erfolg mit seinem fertigen Bogen gewesen und Wenzel hatte bewiesen, dass er mit dem Bogen ebenso geschickt umgehen konnte, wie er ihn hergestellt hatte.
Ismar schaffte es nicht seine Gedanken ganz für sich zu behalten, auch wenn er Wenzel nicht ständig daran erinnern wollte, dass er nicht antworten konnte. Ismar betrachtete die starken Hände des Mannes, der nun mit äußerstem Feingefühl und größter Geduld mit dem Messer den dünnen Stamm bearbeitete. Seine Miene war wie stets ausdruckslos, auch wenn das Leben viele Spuren hinterlassen hatte.
„Dies sollte die zweitletzte Nacht hier draußen sein“, wollte Ismar sie beide ermutigen.
Wenzel hielt das Holz prüfend vor sich.
Sie waren vor drei Tagen durch ein Weiler gekommen und hatten ein wenig Kleinwild eingetauscht und wussten sich endlich dem Ziel greifbar nahe. Einen guten Monat zu reisen, war wenig geeignet ihn daran glauben zu lassen, dass sie auf kürzestem Weg hierher gefunden hatten. Umso erleichterter war Ismar gewesen, als die Wegbeschreibung Details enthielt, an die er sich selbst noch erinnerte und diese ihnen eine baldige Ankunft versprach.
Plötzlich hob Wenzel eine Hand und ballte sie zur Faust. Ismar schüttelte verwirrt den Kopf, doch Wenzel gebot ihm zu schweigen. Wenzel lauschte nach Geräuschen, die Ismar entgangen waren. Besorgt zog Ismar die Augenbrauen zusammen. Es war kein gutes Zeichen, wenn Wenzel sich um etwas Sorgen machte.
Ismars Anspannung wurde nicht geringer, als sich Wenzel nach einer Weile geduckt aufrichtete und Ismar die Hand auf die Schulter legte, um ihn am Aufstehen zu hindern. Er deutete ihm, dass er allein gehen würde und er solle wachsam sein.
Mit beängstigender Geräuschlosigkeit schlich sich Wenzel in die Dunkelheit des Waldes und war für Ismar bereits nach wenigen Metern nicht mehr zu sehen. Ismar spitzte die Ohren, doch was er zu hören glaubte war trügerisch. Der Wind spielte mit den Ästen und sein Hauchen verlieh der Dunkelheit eine neue Bedrohlichkeit, nun, da Ismar allein im Schein des Feuers saß und das Gefühl nicht loswurde, überall um ihn herum wären Augen auf ihn gerichtet.
Dann ging alles sehr schnell. Es kam Unruhe auf, auch wenn nur ein Rascheln zu hören war, und Wenzel aufgehört hatte zu schleichen. Ismar traute seinen Augen nicht, als Wenzel mit einem Jungen im Arm zurückkam. Dieser wollte schreien, doch Wenzels große Pranke hinderte ihn daran und bedeckte dabei beinahe sein gesamtes Gesicht. Allmählich gab der Junge den Versuch auf, sich dem übermächtigen Griff zu entwinden und das Rascheln wurde leiser. Die Panik in seinen Augen überstieg alles, was Ismar je gesehen hatte. Ismar konnte es ihm nicht verdenken.
Wenzel nickte Ismar zu und versuchte diesem etwas mitzuteilen, doch Ismar war für den ersten Moment wie gelähmt. Dann sprang er auf, während Wenzel den Jungen vor sich abstellte.
„Wir wollen dir nichts Böses“, erklärte Ismar, als er schließlich begriff, was seine Aufgabe sein sollte. „Wenzel wird dir gleich die Hand vom Mund nehmen, damit wir miteinander reden können.“ Dem Jungen schlug das Herz bis zum Hals. Sein Einatmen war so panisch, dass er zu ersticken drohte, würde Wenzel ihm nicht die Hand vom Gesicht nehmen. „Du darfst nicht schreien“, mahnte Ismar und versuchte Wenzels Blicke zu deuten. „Es wird dir nichts geschehen.“
Wenzel öffnete seine Hand, doch noch bevor diese sich von der Haut des Kindes lösen konnte, schloss sie sich, um den Schrei im Ansatz zu ersticken.
Nervös sah Ismar Wenzel an, da er nicht wusste, was er tun oder sagen sollte. Der Mann schloss beruhigend die Augen und setzte sich auf seine Decke. Das Kind konnte sich seiner Kraft nicht widersetzen und wusste nicht, wie ihm geschah als es unvermittelt neben dem Hünen saß.
Auch Ismar nahm Platz, und der zweite Versuch war von mehr Erfolg gekrönt.
„Ich habe nicht spioniert“, stotterte der Junge wenig später, doch sein Protest war wenig überzeugend.
Es war mühselig aus dem Jungen schlau zu werden und gleichzeitig zu wissen, was Wenzel eigentlich wissen wollte. Schließlich wussten nur Wenzel und das Kind, was eben im Wald vorgefallen war und keinem der beiden gelang es im Augenblick sich Ismar glaubhaft verständlich zu machen.
„Ich bin allein!“, versuchte der Junge Ismar zum vierten Mal begreiflich zu machen.
„Wie alt bist du? Acht, neun?“ Ismar war keineswegs bereit ihm diese Lüge abzukaufen.
„Zehn“, log der Junge und sah bei dem Versuch stark auszusehen, Mitleid erregend aus. Er zuckte zusammen als Wenzel ein bizarres Lachen ertönen ließ.
„Also sieben!“, vermutete Ismar und fand die Bestätigung in den Augen des Kleinen. „Also nochmal“, erklärte Ismar geduldig. „Wir wollen dir nichts antun. Aber ebenso wenig wollen wir heute Nacht eine unangenehme Überraschung erleben.“ Ismar sprach offen ihre Sorgen aus.
Der Junge gab stückchenweise zu, dass er nicht allein war, und sie ihnen seit dem späten Nachmittag folgten. Sie waren sechs Kinder, auch wenn der Junge abermals so tun wollte, als wären zwei von ihnen bereits erwachsen. Der Junge war ein leidenschaftlicher, aber dennoch schlechter Lügner.
Wenzel sah Ismar mit entspannter Miene an, als der Junge mehr und mehr preisgab. Er glaubte wohl, was sie nun zu hören bekamen, wenn man die Übertreibungen wegließ. Zumindest sorgte er sich nicht mehr und er gab Ismar zu verstehen, was er dem Jungen auftragen sollte.
„Das ist kein Wetter, um sich allein im Wald herumzutreiben“, beruhigte Ismar den Jungen weiter, während Wenzel seine Umarmung gänzlich löste. Der Junge überlegte, ob er weglaufen sollte. Prüfend sah er in den Wald, doch als er Ismars Blick erwiderte, erkannte Ismar die Resignation, dass er nicht entkommen würde. Darum schenkte er ihm ein aufmunterndes Lächeln. „Geh und ruf deine Freunde. Sie sollen sich alle um das Feuer setzen und mit uns essen.“ Der Junge traute seinen Ohren nicht. Sein Gesicht zuckte und verdeutlichte die Verwirrungen seiner Gedanken. Ängstlich blickte der Junge zu Wenzel, doch auch dieser nickte zustimmend.
„Ihr könnt kommen“, versuchte Ismar sein Glück und rief in den Wald. Doch außer, dass der Junge zusammenzuckte, regte sich nichts. Wenzel legte dem Jungen eine Hand auf den Rücken. Das Herz des Jungen schlug ihm gegen den Hals, doch wenn Wenzel glaubte, den Jungen damit zu ermutigen, so war genau das Gegenteil der Fall. Wie gelähmt blieb der Junge sitzen.
„Hier nimm.“ Ismar reichte ihm eine Rippe, an der reichlich Fleisch hing. Gierig nahm der Junge sie entgegen und zerrte mit wilden Bissen große Stücke herunter.
„Ruhig“, redete Ismar auf ihn ein. „Es nimmt dir keiner etwas weg.“ Das Kind traute den Worten nicht. Nur was im Bauch war, würde ihm keiner wegnehmen. Mit dieser Einstellung verriet er viel über seine Vergangenheit.
Geraschel ertönte, das nicht vom Wind stammte. Wenzel brauchte den warnenden Blick Ismars nicht, als drei Kinder hinter ihm auftauchten. Mit unglaublicher Geschwindigkeit sprang er auf und mit einer geübten Bewegung seines Fußes hielt er seinen Stab kampfbereit in der Hand. Mit drei großen Schritten stand er vor dem Anführer und keine Sekunde später flog diesem der Knüppel aus der Hand und landete in Wenzels ausgestreckten Hand. Auch Ismar war aufgesprungen und erblickte drei Gesichter, die so leichenblass aussahen, als wären sie eben dem Tod persönlich begegnet. Die beiden anderen Angreifer ließen ihre Knüppel fallen, als hätten diese eben Feuer gefangen. Ismar war sich Wenzels Wirkung durchaus bewusst und empfand Mitleid für die beiden Jungen und das Mädchen. Der Junge hatte wahrlich übertrieben. Es waren alles noch Kinder. Im Augenwinkel erkannte Ismar gerade noch, wie der Junge sich auf die Fleischschale stürzte und damit weglaufen wollte. Ismar ließ ihn gewähren und sorgte sich mehr darum, dass jemand in seinem Rücken auftauchen würde. Doch das Feuer verhinderte, dass er etwas im Dunkeln des Waldes ausmachen konnte.
Er drehte sich um, und sah eben noch, wie Wenzel seinem unfähigen Angreifer den Knüppel reichte und die drei ans Feuer einlud. Ismar verlieh der Einladung Worte. Doch es war der zuvor gewonnene Eindruck von Wenzel, der sie widerstandlos ans Feuer führte. Selbst der geflohene Junge wagte sich nicht gänzlich fort und verharrte am Rande des Lichtscheins.
„Wir werden euch nichts tun“, versuchte sich Ismar an einem Gespräch mit den Ankömmlingen. Mit dem Schreck in den Knochen, war kein Wort aus ihnen herauszubekommen. „Ich würde euch etwas zu essen anbieten“, lächelte Ismar. „Doch ich fürchte, euer Freund ist dabei, damit weg zu laufen.“ Die vier wechselten ängstliche und verwirrte Blicke. Sie waren mit der Situation völlig überfordert. Was auch immer sie sich für diesen Abend vorgestellt hatten, war grundlegend anders als das, was nun geschah.
Dementsprechend lange dauerte es, bis der Junge mit zitternden Händen den Rest vom Wildschwein zurückbrachte und sich zu ihnen setzte. Was auch immer nun geschehen mochte, war ihm wohl lieber, als ohne seine älteren Kameraden zu sein.
Doch das Essen lockerte schließlich ihre Zungen und lockte auch zwei weitere Kinder aus dem Wald. Es waren zwei Mädchen, noch jünger als der Knabe, der ihnen aufgelauert hatte.
„Sie waren verkauft worden“, erklärte Valentin ihre Mission. Es war nicht einfach ihren Schilderungen zu folgen. Mit sich füllenden Mägen und der Wärme des Feuers, begannen sie sich ihre Ängste von der Seele zu reden. Sie waren keine Wilden und doch waren sie nun heimatlos. Sie stammten alle aus einem kleinen Weiler. Sie waren die Geschwister aus zwei Familien. „Wir mussten sie befreien!“, rief das älteste Mädchen dazwischen als müsste sie die Truppe immer noch auf ihre Mission einschwören. Immer wieder warf sie einen Seitenblick auf Wenzel, als könnte dieser sich jeden Augenblick daran erinnern, dass sie ihn hinterrücks überwältigen wollte und sich deswegen rächen.
„Wer weiß, was sie mit ihnen angestellt hätten“, rechtfertigte sich einer der Brüder bei Ismar, als wäre er für ihre Bestrafung verantwortlich. Dabei waren beide in einem Alter. Doch auch in Ismars Bauch loderte die Wut, die die Geschwister empfanden, denn es war nur zu deutlich, warum die Mädchen gekauft worden waren.
„Und ihr könnt nicht zurück?“, fragte Ismar nach.
„Nein“, schüttelte Diether resignierend den Kopf. „Wir sind verflucht“, fasste Valentin ihr Schicksal zusammen. Diether sah ihn mitleidig an, fand aber keine Worte, um ihn zu trösten. „Unsere Eltern haben uns kaum mehr ernähren können, und die Männer wissen, dass wir Johanna und Ursel entführt haben“, erklärte Diether ihre Lage.
„Hmm“, grübelte Ismar mitfühlend. „Ihr habt dennoch richtig gehandelt.“ Bei seinem Vater hätte es so etwas nicht gegeben. Doch die Zeiten waren nun wohl andere und hier waren sie ohnehin nicht auf den Ländereien seines Vaters. „Was habt ihr vor?“
Die Geschwister sahen sich hilflos an. „Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht“, presste Diether hervor und betrachtete seine Füße.
„Aber irgendetwas müsst ihr doch geplant haben?“ Ismar sah sie reihum an.
„Euch zu überfallen?!“, gestand Valentin kleinlaut und musste glucksen.
„Klasse Plan“, lachte Ismar auf und selbst Wenzel ließ sein verstörendes Lachen ertönen. Alle Kinder zuckten gleichermaßen zusammen, auch wenn sie inzwischen begriffen hatten, dass sie von ihnen nichts zu befürchten brauchten. Doch Gedanken und Angstgefühle gingen oft getrennte Wege. Vor allem zu dieser späten Stunde fernab von zu Hause im Wald bei Fremden.
„Heute Nacht bleibt ihr jedenfalls bei uns“, redete Ismar beruhigend weiter und grübelte über eine mögliche Lösung nach. Außer der Erleichterung in ihren Gesichtern, bekam Ismar keine Antwort.
„Ihr könntet auch mit uns kommen“, meinte Ismar schließlich. „Wir gehen nach Fierantstein. Vielleicht könnt ihr dort neu anfangen.“
„Und was sollen wir dort tun?“, fragte Diether skeptisch.
„Besser als im Wald zu sitzen und jeden zu fürchten, dem wir begegnen.“ Fronicka war keinesfalls erpicht darauf, noch einen wie Wenzel überfallen zu wollen. Sie sah Ismar an und Schatten der Sorge huschten über ihr Gesicht. „Es wird bald Winter“, fasste sie ihre Lage zusammen. Sie hatten gehandelt, weil sie handeln mussten, doch nun erst wurden sie sich allmählich bewusst, in welcher Lage sie waren.
Vom Wildschwein war längst nichts mehr übrig und auch der restliche Proviant war aufgebraucht, als sie sich zum Schlafen hinlegten. Wenzel legte nochmals Holz nach und während sich die Flammen zischend und knistern darüber hermachten, wickelten sich die Kinder in ihre Decken. Es dauerte nicht lange, bis sie einschliefen. Sie hatten viel Schlaf nachzuholen und mit Wenzel an ihrer Seite fühlten sie sich sicherer als an den Tagen zuvor und auch das Feuer ließ die Lider rasch schwer werden.
Ismar war das letzte der Kinder, das noch seine Augen offen hatte. Nachdenklich betrachtete er ihre Gäste und fühlte eine neue Form von Verantwortung, und auf einmal wurde er sich bewusst, wie unbeschwert sein Leben als Sohn des Stadthalters gewesen war. Neue Gedanken kamen in ihm auf. Gedanken, die er seit längerem nicht mehr hatte führen müssen. Doch er hatte eine Aufgabe, eine die ihm sein Vater aufgetragen hatte. Es war sein Erbe, es war seine Verantwortung. Sein Blick schweifte zu Wenzel, der aufrecht saß und weiter am Bogen schnitzte. Wenzel erwiderte den Blick und schloss kurz die Augen und nickte vielsagend, bevor er sich erneut dem Bogen zuwendete. Ungesehen nickte auch Ismar und legte seinen Kopf voller schwerer Gedanken endlich auf das feuchte Kissen. Wenzel würde über sie wachen, das wusste er. Für die Nacht waren sie sicher, aber die Kinder hatten ein schweres Los gezogen. Wie schwer, würden ihnen wohl erst die nächsten Monate zeigen. Würde sein Vater noch leben, wäre so vieles einfacher gewesen. Dabei war es nicht einmal sein Vater, drängte sich ein Gedanke dazwischen, den Ismar gleich verdrängte. Das war nicht gerecht. Sein Vater war sein Vater, nur dass er nun wusste, dass er auch einen zweiten hatte. Einen, der so arm war, dass er ihn verkaufen musste. Sein letzter Blick erhaschte das Gesicht des jungen Mädchens. Das Leben konnte wahrlich ungerecht sein.
Die Ankunft
Drei Tage später passierten sie die alte Eiche und wenig später erhaschte Ismar nach beinahe einem Jahr zum ersten Mal den Anblick der Stadtmauern Fierantsteins. Erinnerungen an jenen Tag wühlten ihn auf. Hier hatte Ells Vater ihn an Wigandus übergeben. Seine Knie wurden weich und er musste sich zusammenreißen. Es sah alles so friedlich aus und nichts erinnerte an das Jahr, das seither vergangen war.
Er blickte zu Wenzel auf und er wollte ihm noch so viel sagen, doch er brachte kein Wort heraus. Ohnehin hätte nichts von alledem für Wenzel eine Bedeutung haben können. Er würde nur Fremde in dieser Stadt finden und auch die Stadt selbst war ihm fremd.
Es zerriss Ismar zu wissen, dass er nach Hause ging und es doch nicht tat. Er schluckte den Kloß hinunter und ging langsam weiter, um sich vor den Kindern keine Angst anmerken zu lassen. Die sechs Kinder wussten nur so viel, wie sie unbedingt wissen mussten, damit sie nicht unnötig auffielen. Daran, dass Ismar seit dem Morgen mit einer Mönchskutte reiste, hatten sie sich mittlerweile gewöhnt. Die Kleinen waren aufgeregt, weil sie wussten, dass sie nun bald in der Stadt umherschleichen würden und keiner wissen durfte, wer Ismar war – selbst sie wussten es nicht.
Das Stadttor war offen und die Wächter interessierten sich vor allem für jene, die viel Ware bei sich hatten. Ihnen wurden gelangweilt einige Fragen gestellt, während ihre arg gebeutelten Taschen flüchtig durchsucht wurden. Die Blicke der Wächter waren weit mehr verwundert als misstrauisch bei der seltsamen Truppe, die Fierantstein offenbar zum ersten Mal aufsuchte.
Mit der Stadtmauer im Rücken schwand Ismars Überzeugung, dass es eine gute Idee gewesen war, hierher zu kommen. Mit der Mönchskutte fühlte er sich wie ein Betrüger und mit jedem Blick, der auf ihn fiel, glaubte er erkannt zu werden. Etliche Gesichter kamen ihm vertraut vor und mehrmals rutschte ihm das Herz in die Kniekehle, doch niemand schien ihn zu erkennen. Die Blicke galten der Kutte, die hier selten zu sehen war. Ein Novize und ein Hüne dieser Größe, mussten hier auffallen und gleichzeitig würde niemand in diesem Novizen den jungen Ismar vermuten, der seit einem Jahr verschwunden war.
Sie hatten sich am Stadttor von den Kindern getrennt und würden sich später mit ihnen treffen, um bis dahin weniger aufzufallen. Ismar wagte es nicht gleich, einen seiner engeren Freunde aufzusuchen, doch als er merkte, dass seine Kutte gute Dienste leistete, traute er sich in den Stall.
„Was suchst du bei den Pferden?“, fuhr ein Mann Ismar von hinten an. Ismar erstarrte und wusste gleich, dass mit diesem nicht gut Kirschen essen war. Mit hochstehenden Nackenhaaren drehte sich Ismar um, und sah sich einem übelgelaunten und dickbäuchigem Stallmeister gegenüber. Sein geröteter Kopf zeigte die Spuren von langjährigem Saufen. Seine Mistgabel hielt er kopfüber und stemmte sie gegen den Boden, um sich an ihr zu stützen. Der Mann stand so dicht hinter Ismar, dass dieser einen Gestank wahrnahm, der eindeutig nicht von den Pferden stammte.
„Ich“, setzte Ismar an und sah in seinem Gegenüber die Lust an jemandem seinen Ärger auszulassen, den er im Alkohol nicht hatte ertränken können. „Ich wollte nachsehen, ob Vater Albrecht bereits eingetroffen ist.“
„Das gibt dir immer noch kein Recht, hier bei den Pferden zu schnüffeln“, blaffte der Mann beherrschter, dem jetzt erst die Kutte aufgefallen war.
„Verzeiht gütiger Mann“, erlaubte sich Ismar eine leichte Verneigung mit vor der Brust gefalteten Händen. „Ich war in Sorge und habe nicht nachgedacht.“
Der Mann brummte irritiert und wusste nicht wohin mit seiner Wut, die er, trotz allem, nicht an einem Mann des Glaubens auslassen wollte, auch nicht, wenn es noch ein Knabe war.
„Dürfte ich gegen Abend noch einmal vorbeischauen und nachfragen, ob er eingetroffen ist?“ Ismar war froh, dass er sich bereits eine Geschichte ausgedacht hatte, denn mit dem flauen Gefühl im Bauch und dem rasenden Herzen, wäre ihm sicher nichts eingefallen. Das darauffolgende Brummen ließ nicht zu, dass Ismar dies als Einverständnis verstehen konnte. „Ich mache mir große Sorgen, weil Vater Albrecht bereits heute Morgen hätte eintreffen sollen und ich nun nicht weiß, an wen ich mich wenden soll“, legte Ismar nach.
„Meinetwegen.“ Der Mann drehte sich schließlich um und ging, da die Auseinandersetzung nicht nach seinem Geschmack verlaufen war und er wohl lieber Frieden in einem Schlauch suchen wollte.
Ismar ließ sich Zeit, um hinauszufinden und schielte nach allen Seiten, um nicht doch einen Hinweis auf Michael oder Casper zu finden. Dass ein Fremder nun hier das Sagen hatte, war kein gutes Zeichen.
Sein klammes Gefühl wollte nicht mehr weichen, als er wenig später auch bei den beiden zu Hause keinen antraf, der ihm bekannt war. Viel fragen konnte er nirgends, da die neuen Hausbesitzer ihm gleich mit ungesundem Argwohn aufwarteten.
Als Ismar nach einem weiteren gescheiterten Versuch zu Wenzel zurückkehrte, der stets in einiger Entfernung auf ihn wartete, drehte sich Ismar ratlos um, da er Wenzels Blick nicht ertragen konnte. Wenzel legte Ismar eine Hand auf die Schulter. Ismar hob den Blick und Wenzel schloss vielsagend die Augen. Ismar verstand es gleich, doch er wollte es nicht wahrhaben. Sie sollten verschwinden. Wenzel sprach mit einem angedeuteten Nicken das aus, was Ismar plagte.
„Nur noch einer“, hielt Ismar flüsternd dagegen und sah den Hügel hinauf. Zumindest Haman musste noch da sein, doch eine innere Stimme fragte ihn, wieso er sich erst nun zur Schmiede wagte.
Der Hügel hinauf zog sich lang und seine Beine wurden mit jedem Schritt schwerer. Dabei war es nicht die lange Reise, die sich bemerkbar machte, sondern eine wachsende Sorge. Er sah von weitem die Rauchsäule, doch sie verriet, dass das Feuer nicht heiß loderte. Das musste nichts bedeuten, doch es machte ihn unruhig. Die Schmiede war eindeutig erneuert worden. Sie war deutlich größer. Doch der Hammer schwieg. Mit wild klopfendem Herzen vernahm Ismar Stimmen aus dem Innern. Der Junge erstarrte als er den Streit vernahm. Dies waren weder Haman noch Magdalena, soviel stand fest. Neben der neuen Schmiede waren großzügig Lagerräume vorgesehen worden, doch es war offensichtlich, dass sie nicht gebührend genutzt wurden. Ismar musste schlucken. Solche Unordnung wäre in Hamans Gegenwart nicht möglich. Ismar ballte die Hände voller Verzweiflung. Ein weiteres Mal geriet seine Welt ins Wanken. „Das darf nicht sein“, hauchte Ismar und rieb seine Hände, um sein Erscheinungsbild zu entspannen. Er hielt den Atem an. Verwirrt drehte er sich um und fing Wenzels mahnenden Blick auf. Er klammerte sich an einem letzten Halm Hoffnung, ignorierte Wenzels Blick sowie eine innere Stimme und trat unter das hervorstehende Dach der Schmiede. Es war dunkel, da nur der glimmende Rest eines Feuers für Licht sorgte.
„