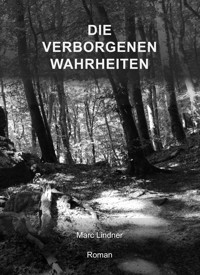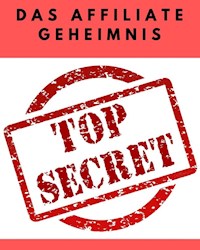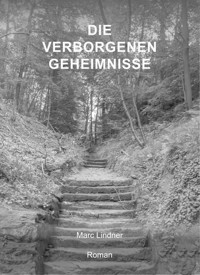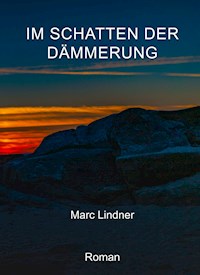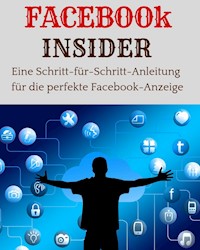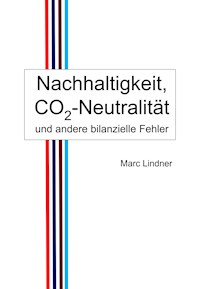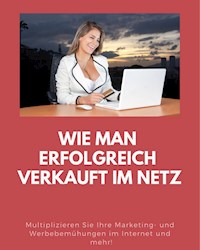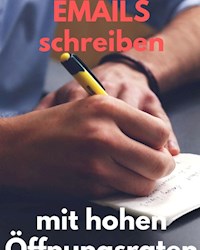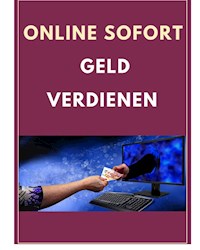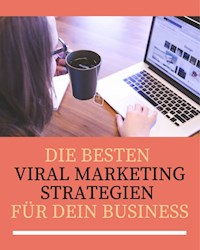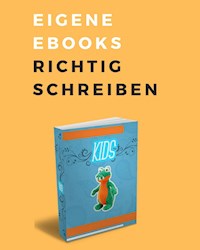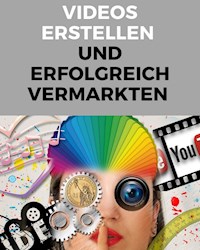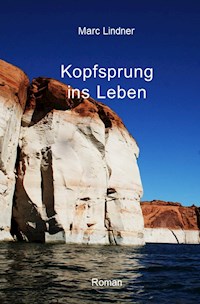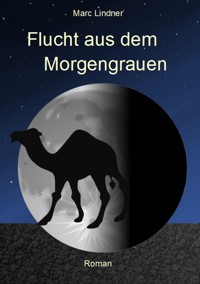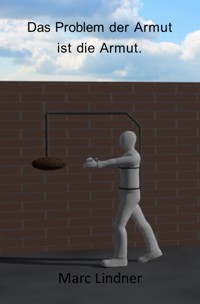
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch versucht die Problematik der Armut aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Leider werden im Kontext mit bestehenden Wirtschaftsstrukturen oft Zusammenhänge gesehen, die nicht existieren. In den Diskussionen werden Dinge gefordert, die für die Lösung der Armutsproblematik nicht von Relevanz sind, uns auf anderer Seite davon abhalten, gesellschaftliche Ziele wie Umweltschutz und gerechte Löhne zu erreichen. Die triviale Lösung erkennen wir nicht, weil wir Ängste in uns tragen, die ganz andere Ursachen haben, mit denen das Armutsproblem aber nichts zu tun hat – im Gegenteil. Weil wir das Problem der Armut nicht verstehen wollen, obschon es unsere Absicht ist, dieses zu lösen, schaffen wir Probleme, die dann zu Diskussionen über Sozial-schmarotzer führen. Weil wir zu geblendet sind, um die Zusammenhänge zu sehen, beschimpfen wir die Armen verallgemeinernd und schrecken nicht davon zurück, ihnen an ihrer misslichen Lage die Schuld zu geben oder sie als das Problem zu erachten. Sozialschmarotzer entstehen nicht aus Armut, sondern aus der Unfähigkeit, das Problem der Armut zu lösen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 88
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marc Lindner
Das Problem der Armut ist die Armut
© Marc Lindner, 2017
Cover: Marc Lindner
Lektorat: Mandy Hemmen
www.wortzeichner.wordpress.com
Vorwort
Dieses Buch beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Problemen, und muss sich dementsprechend einer eindeutigen Ausdrucksweise bedienen. Die Begriffe Armut oder arme Menschen stellen hier einen Bezug zur wirtschaftlichen Kaufkraft dar und sind in keiner Weise beschuldigend oder diskriminierend gemeint.
Ich möchte hiermit klarstellen, dass ich persönlich nicht arme Menschen problematisiere, noch dass in den Begriffen ein Bezug zur Wertigkeit von Menschen gefunden werden kann. Wenn von dem Problem der armen Menschen die Rede ist, dann unterstelle ich, dass alle Menschen gleichwertig sind, und das Problem darin besteht, dass einige nicht den Wohlstand haben, der ihnen zusteht.
In diesem Werk wird die systematisch bedingte Armut betrachtet, wodurch es sich um eine allgemeine Betrachtung handelt. Menschen, die aufgrund einer Spielsucht arm sind, oder wegen der bewussten Entscheidung, nicht zur Gesellschaft gehören zu wollen, weil sie nicht bereit sind eine gesellschaftlich orientierte Leistung zu erbringen, werden hier ausgeklammert. Dieses Phänomen hat per se nichts mit der systematisch bedingten Armut zu tun, und führt allzu oft dazu, dass in Diskussionen arme Menschen verallgemeinert negativ konnotiert und mit Sozialschmarotzern gleichgestellt oder zumindest verglichen werden. Armut hat rein gar nichts mit „sozialschmarotzen“ zu tun! Vielmehr entsteht das „Sozialschmarotzen“ erst dadurch, dass das Problem der Armut falsch verstanden wird, und dadurch versucht wird, es auf ungeeignete Weise zu beseitigen.
Das Wort asozial und seine Abwandlungen stehen hier für Anti-sozial, und meinen einen Mangel an sozialen Fähigkeiten sowie sozialem Verständnis oder ein gesellschaftsschädigendes Denk- oder Handlungsverhalten.
Bei den im Folgenden getroffenen Aussagen und Einschätzungen handelt es sich um meine persönliche Meinung und ich möchte erneut betonen, dass ich niemanden persönlich treffen oder beleidigen möchte.
I. Vermögensschichten
Es liegt unter anderem systembedingt am Kapitalismus, dass es Einkommensschichten beziehungsweise Einkommensunterschiede gibt, wie dies in der Darstellung 1 aufgezeigt ist. Diese wären nur durch echten Kommunismus zu beseitigen. Einen solchen hat es aber noch nie gegeben, und selbst wenn es ihn gäbe, dann wären die Probleme, die dadurch entstünden viel bedeutender als bei einem richtig verstandenen, und gesteuerten Kapitalismus.
Darstellung 1: Vermögensunterschiede als Konsequenz des Kapitalismus, in Abhängigkeit dessen, was die Gesellschaft anstrebt und toleriert.
Dem Kapitalismus ist nämlich zu Eigen, dass er am besten mit den inneren Trieben des Menschen harmonisiert, und dadurch einer Gesellschaft dazu dienlich sein kann, den maximalen Nutzen für sich zu erzielen.
Weil das Streben, das Können und die Interessen eines jeden Individuums unterschiedlich sind, ist es nicht möglich und nicht sinnvoll, eine finanzielle Gleichheit zu erzielen. Dadurch wird es immer finanzielle Schichten, entsprechend einer vielerorts aufgezeigten Einkommenspyramide, geben. Dies ist an- und fürsich nicht zu beanstanden, wenn die einzelnen Schichten für einzelne Individuen nicht von Geburts wegen definiert sind. Ebenso wichtig ist auch, dass im Vergleich zu der linken Pyramide in der Darstellung 1, es nicht dazu kommt, dass Reichtum aufgrund von bitterer Armut entsteht und systembedingt Armut in dem Ausmaß entsteht, wie wir es heute kennen.
Der Kapitalismus und das Armutsproblem ist dann verstanden, wenn unterschiedliches Einkommen dazu führt, dass der Einkommensschwache würdevoll von seiner Arbeit leben kann, so wie es die rechte Pyramide der Darstellung 1 zeigt. Denn zu sagen, dass die Menschheit die Vermögensungleichheit des Kapitalismus benötigt, um als Gesellschaft voran zu kommen, bedeutet nicht, dass wir menschenunwürdige Lebensbedingungen brauchen.
a. Durchlässigkeit der Schichten
Es mag immer wieder Beispiele geben, die zeigen, dass Menschen aus ärmeren Schichten zu Wohlstand gefunden haben. Denn durch Kreativität oder sonstige besondere Fähigkeiten und glückliche Umstände, kann theoretisch jedes Individuum Wohlstand für sich erringen. Auch wenn dies von vielen Befürwortern des Kapitalismus angeführt wird, um diesen als Maxime unseres Handels zu verteidigen, so betrifft dies nur einzelne arme Menschen, aber keinesfalls die Armut an sich.
Jede Grenze ist in irgend einer Weise durchlässig. Das gilt auch für die einzelnen Gesellschafts- und Wohlstandsschichten.
Dem Kapitalismus ist es zu eigen, dass jeder Alles erreichen kann, wenn die notwendigen Voraussetzungen gegeben sind.
Trotz aller Genialität kann es aber für viele auch allein daran scheitern, dass sie nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Vielleicht braucht die richtige Idee auch jemanden, der sie vermarktet. Ein Talent muss gesehen werden, und von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, bevor dieses im kapitalistischen System aufsteigen kann.
Darin kommt bereits die erste Einschränkung unseres Systems zum Ausdruck. Die Genialität, die Fähigkeiten und das Bestreben zu besonderen Leistungen ist nutzlos, wenn dem Individuum keine Bühne geboten wird, seine Leistungen anzubieten, sprich kein Unterstützer vorhanden ist, der in den Einzelnen investiert und an dessen wirtschaftlichen Aufschwung mit verdient.
Aber selbst wenn jeder Mensch mit außergewöhnlichen Talenten oder Fähigkeiten entdeckt und gefördert würde, würde dies helfen etliche Menschen aus ärmlichen Verhältnissen hin zu Wohlstand zu bringen – aber es würde das Problem der Armut nicht lösen. Denn das Problem der Armut ist und bleibt die Armut, und das in mehrfacher Hinsicht.
b. Auswirkungen einer Schere zwischen Arm und Reich
Der Unterschied zwischen arm und reich ist die viel gepriesene Treibkraft des Kapitalismus, die Menschen, und dadurch auch Unternehmen zu mehr, und höher qualitativer Leistung anspornt.
Auch deshalb wird dem Kapitalismus eine sehr bedeutende effizienzsteigernde Wirkung zugesprochen, die eine Planwirtschaft niemals erreichen kann. Diese Triebkraft, die die meisten zu mehr Leistung motiviert, kann durchaus als positiv und wünschenswert angesehen werden. Dabei ruft sie auch Auswüchse wie Betrug, Diebstahl und Unzufriedenheit hervor. Letztlich gilt wie bei allem: Alles in Maßen. Werden die Unterschiede zu groß, so wie es derzeit ist und eigentlich immer war, so nehmen die negativen Auswirkungen überproportional zu, bis die Situation so gravierend ist, dass es zu einem Aufstand kommt – zurecht.
Gleichzeitig ist es aber auch so, dass eine ungleiche Verteilung von Vermögen zu einer Reduktion von gesellschaftlichen Nutzen führt. Dies lässt sich sehr einfach von dem Grenznutzen des Geldes ableiten.
Bei den meisten Dingen, die man besitzen, benutzen oder genießen kann, ist es so, dass mit zunehmender Menge der Nutzen sich nur unterproportional steigern lässt. Sprich, wenn sich die Menge verdoppelt, ist der Nutzen weniger als doppelt so groß wie zuvor. Dieses allgemein beobachtbare Phänomen versteht man unter abnehmendem Grenznutzen. Das bedeutet, dass mit jeder zusätzlichen Einheit, der erzielbare zusätzliche Nutzen geringer ist, als noch bei der Einheit zuvor.
Wir wissen nun also um den abnehmenden Grenznutzen des Geldes. Wir wissen auch, dass Geringverdiener zunächst ihre Grundbedürfnisse mit ihrem Lohn erwirtschaften müssen, und genau hier wird mit dem Ausgeben des Geldes am meisten Nutzen geschaffen. Deshalb kann es nicht für die Gesellschaft optimal sein, dass körperlich produktiv arbeitende Menschen, die die Produkte und Dienstleistungen anfertigen oder anbieten, die wir alle konsumieren, auf gerechten Lohn verzichten, damit die Wirtschaft wächst – eine nüchterne, nichts aussagende Zahl wie das BIP. Erst recht nicht, wenn dadurch Millionengehälter für Spekulanten und Wirtschaftsbosse ermöglicht werden sollen. Der Lohn der Arbeit muss so aufgeteilt sein, dass jeder davon leben kann, und damit meine ich nicht nur das reine Überleben. Das ist eine der wichtigsten Forderungen für die Nutzenmaximierung der Gesellschaft und für soziale Nachhaltigkeit.
Wenn wir uns in der Skizze 1 anschauen, welche Folgen es hat, bewusst ungleiche und ungerechtfertigte Gehälter zu haben, wird deutlich, wie wichtig ein nachvollziehbarer Mindestlohn für unsere Gesellschaft ist.
Skizze 1: Auswirkung der Verteilung des Vermögungs auf den Gesamtnutzen der Gesellschaft. Bild links: Nutzen als Funktion des Vermögens. Bild mitte/rechts: Gleich-/Ungleichverteilung
Denn wenn ein Vermögen X zu gleichen Teilen auf hier 5 Personen aufgeteilt wird, resultiert für diese 5 Personen in der Summe mehr Nutzen, als wenn 4 Personen einen geringeren Teil erhalten, während der Fünfte einen Großteil erhält. Aufgrund des abnehmenden Grenznutzens des Geldes, der aus dem linken Teil der Grafik abgeleitet werden kann, führt eine ungleiche Verteilung des Vermögens zu einem reduzierten gesellschaftlichen Nutzen, hier in Höhe von B anstelle von A bei einer gerechten Verteilung des Vermögens.
Es ist deshalb aus gesellschaftlicher Sicht unabdingbar, ein zu starkes Auseinanderklappen von arm und reich zu unterbinden. Denn mit dem wenigen Vermögen, das die Armen besitzen, entsteht relativ gesehen mehr Nutzen, weil sie es sinnvoller investieren. Sie kaufen sich Nahrungsmittel und sie erlauben es sich, sauberes Trinkwasser zu nutzen. Wenn dann noch etwas übrig bleibt, ermöglichen sie sich und ihren Kindern Bildung und den Zugang zu Gesundheitseinrichtungen. Demgegenüber verschwenden reiche Menschen (Ausnahmen bestätigen die Regel) ihr Vermögen, indem sie wenig nutzbringend Ressourcen aufbrauchen, oder sie lassen das Geld auf ihren Bankkonten liegen. So unterstützen sie im heutigen System das fortwährende Fließen von Geld zu Geld und die Ausbeutung der untersten Einkommensschicht.
Es gibt folglich im gesellschaftlichen Sinne eine Forderung, die besagt, dass es zur Nutzenmaximierung unserer Gesellschaft unabdinglich ist, den Unterschied zwischen arm und reich klein zu halten.
Gleichzeitig kann aber auch festgehalten werden, dass derjenige, der Gleichheit für alle fordert, die Triebkraft unserer Gesellschaft zu zerstören droht. Dann hätten wir kaum noch Innovationen und Qualität für uns zu erwarten, sprich unser gesellschaftlicher Nutzen würde zerfallen.
Der Schere zwischen Arm und Reich kommt eine wichtige Aufgabe zu. Sie ist in gewisser Weise notwendig, um unsere Gesellschaft funktionsfähig zu halten, weil sie als Triebkraft für Innovations- und Handlungsfreude erforderlich ist. Gleichzeitig zerstört sie aber auch gesellschaftlichen Nutzen, indem sie auf der Seiten der Reichen zur Ineffizienz der Rohstoffnutzung führt und auf Seiten der Einkommensschwachen eine Unterversorgung sinnvoller Bedürfnisse bedingt. Vor allem aber ist es Armut, die in unverhältnismäßigem Maße gesellschaftlichen Nutzen zerstört.
c. Lobbyismus und die Regel des Geldes
Dabei geht es darum, dass derjenige, der viel Geld kontrolliert, auch die Regeln in seinem Interesse beeinflussen kann. Dabei wird er die Regeln so zu verändern versuchen, dass es ihm Vorteile verschafft, die ihm direkt oder indirekt dazu verhelfen, Geld zu erlangen. Auch ist es dazu nicht unbedingt notwendig, dass er viel Geld besitzt oder dieses großzügig in Form von Bestechung verteilt. Direkte Korruption in Form von Geldüberweisungen oder dem Versprechen später einen lukrativen Posten kleiden zu können (ich vermeide hier bewusst Worte wie Arbeitsplatz oder arbeiten) hat es immer gegeben und wird es auch immer geben, aber das ist nicht einmal die Wurzel des Problems.