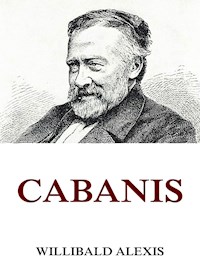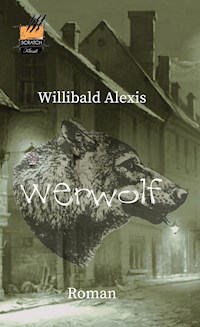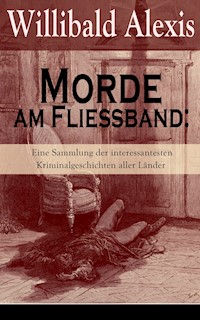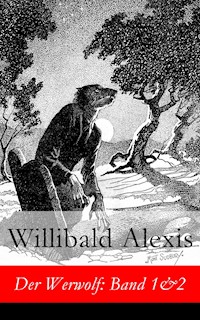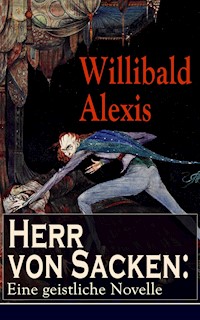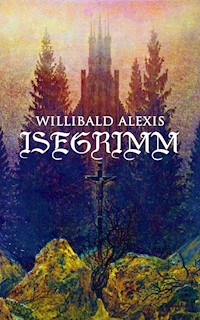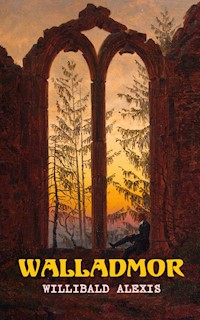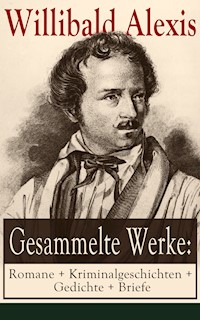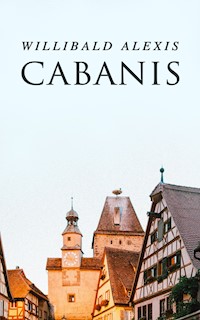
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Cabanis" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Ohne Zweifel waren die Refugiés weit gebildeter als die wackeren Brandenburger, in deren verwüstetem Lande der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm ihnen ein Asyl eröffnete. Es müssen auch geistesstarke Männer und Frauen gewesen sein, die um ihre Überzeugung den väterlichen Fluren, dem teuren Herd, Wohlstand, Freunden und Verwandten den Rücken kehrten. Es hätte keiner äußeren Bevorzugung bedurft, um sie höher, besonders zu stellen, es verstand sich von selbst, daß sie zusammenhielten. Aber man hatte ihnen nun einmal im Sinne des Zeitalters eigene Kirchen, eigene Prediger, sogar einen eigenen Gerichtsstand gegeben. " Willibald Alexis (1798-1871) war ein deutscher Schriftsteller, der als Begründer des realistischen historischen Romans in der deutschen Literatur gilt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 640
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cabanis
Erstes Buch Die Knabenzeit
1. Der junge Adler
Die Erinnerungen aus meinen Kinderjahren reichen weit zurück. Ich habe keine frohe Jugendzeit verlebt; mitten aus dem Kreise meiner Kinderspiele wuchs mein Schicksal auf, und während ich noch zu spielen wähnte, hatte mich seine eiserne Hand gefaßt und den Knaben hinausgeschleudert aus dem Vaterhause in den Strudel des Lebens. Besonders deutlich entsinne ich auch eines Vorfalls aus meinem neunten Jahre, weil ich in dem an sich unbedeutenden Ereignis den ersten Quell zu der seltsamen Wendung meiner Lebensgeschichte suchen muß.
Als wäre es heute erst geschehen, so sehe ich noch die Straße, die Häuser, die Gesichter, die aus den Fenstern blickten, die rauchenden Schornsteine. – Es war eine der Straßen von Berlin, welche erst unter dem vorigen Regenten fertig gebaut wurden. Wir spielten Murmel, eine bei unserer Schuljugend von alters her beliebte Lustbarkeit. Auf das strengste wird der Spieler beobachtet und um den Gewinn einiger Kügelchen oft Angstschweiß vergossen. Es herrscht eine Totenstille, und erst wenn ein glücklicher Wurf entscheidet, bricht der langverhaltene Knabenjubel los, der sich dann nicht immer mit Schimpfreden begnügte. Nicht selten kam es zu jenen kleinen Kriegen, die alle Lustigkeit beenden und doch auch wieder die Würze derselben werden. Der Knabenhaß gegen einen langen Schlagetot, von dem ich oder mein Freund blaue Flecke aufzuweisen hatten, wurde mit Ernst gehegt. Ich hatte von meinem älteren Bruder die Lehre erhalten, nie etwas auf mir sitzenzulassen. »Wenn du einmal eine Memme warst, hören sie nie auf, dich zu necken!«, und ich fürchte, ich bin dieser Weisung zu sehr in meinem Leben gefolgt. Der lange Schlagetot bekam es zu seiner Zeit richtig wieder, doch zu unser beider Vorteil, denn Haß und Groll wurden mit den Schlägen ausgeschüttet, und wir waren desto bessere Freunde für eine andere Gelegenheit. Nur wer bei Lehrern oder Eltern angab, mit dem war kein Friede zu schließen nach unserem Völkerrecht.
So war auch diesmal Welt und Berlin, Schule und Straße über dem Spiel vergessen, und die Aufmerksamkeit auf die Murmel ließ uns übersehen, was dicht um uns vorging.
Aus allen Nachbarhäusern waren die Leute zusammengetreten, die Vorübergehenden stehengeblieben, und aus den geöffneten Fenstern blickten Hauben und Frisuren, wobei ich bemerken muß, daß Anno 1740 die Zahl der Müßiggänger sehr gering in Berlin war. Denn allzu gefährlich war es, dem alternden Könige zu begegnen, wenn ihn etwa die üble Laune trieb, einen, der ihm auffiel, heranzuwinken und ein Examen mit ihm anzustellen. Wer nicht bestand, wer geckenhafter gekleidet war, als es ihm erlaubt schien, und keine nützliche Beschäftigung nachzuweisen wußte, hatte eine üble Behandlung zu fürchten, wovor ihn Stand und Familienrücksichten am wenigsten schützten. Wußten doch alle, wie es in der eigenen Familie des Königs aussah. Die bewunderungswürdige Kontrolle, welche durch Friedrich jetzt in den preußischen Ländern eingeführt ist, kann nicht so genau sein, wie es der hochselige König gegen seine Umgebung war, wobei ihn ein erstaunenswürdiges Gedächtnis unterstützte. Singen und Lachen auf der Straße gehörten daher zu den Seltenheiten, und wenn es die Laune des Fürsten einmal wollte, konnte man merken, daß der Jubel nur erzwungen, immer mit einer Art Peinlichkeit vermischt war.
Um so auffallender war das Zusammentreten an der Ecke der Jägerstraße. Mehrere mögen stehengeblieben sein aus keinem ändern Grunde, als weil sie andere auch stehen sahen. Man meint, dies liege seit uralter Zeit im Charakter der Berliner. Ein Peruquier, den wir Kinder nur gewohnt waren, treppauf, treppab laufen zu sehen – für uns der Repräsentant eines Perpetuum mobile –, hielt inne, zwei Tischlerburschen, welche einen Sarg trugen, ließen ihn mitten auf dem Straßendamm nieder, und es hätte nur gefehlt, daß auch ein Leichenzug stillgestanden wäre, um seinem Toten noch dies überirdische Schauspiel zu zeigen, das meinen Zuhörern vielleicht sehr gleichgültig dünkt, welches aber – und nicht allein bei unseren Köchinnen und Ammen – ein großes Aufsehen erregte und Stoff zu vielem Nachdenken gab. Die Sonne war so tief herabgesunken, daß ihre Strahlen, abgeschnitten von scharfen Dächern, nur noch den oberen Teil des Horizontes glänzend durchleuchteten. Man konnte die Schicht zwischen Schatten und Licht in der Luft wahrnehmen, und der erhellte Teil glühte ganz ungewöhnlich für einen nordischen Himmel. Die tiefe Röte am zweiten Stockwerk des Fürstenhauses lockte aus den Fensterscheiben Goldfeuer und Scharlachflammen, und das königliche Schloß dünkte an dem Abend, während die unteren Stockwerke in Schatten, Nacht und Asche versanken, in seinen oberen Teilen wie ein Feenschloß aus Luft und Feuerstoff gewebt. Die steigende Dunkelheit riß zwar Zoll um Zoll von diesem Gebäude aus Flammenguß an sich, aber das luftige Bild, wie es damals die Sinne empfingen, steht noch heute vor meiner Phantasie.
Die Blicke unserer guten Nachbarn gingen weit höher, denn sie verfolgten einen Vogelschwarm, den ich anfänglich für Tauben hielt. Aber sie stiegen zu hoch und kühn, und als sie in rascher Wendung wieder herabstürzten und das helle Sonnenlicht ihr dunkles Gefieder beschien, ward ich meines Irrtums inne. Es waren Raubvögel in großer Zahl und unter ihnen – eine seltene Erscheinung für unsere flache Gegend – ein junger Steinadler, der eben erst flügge geworden sein mochte. Sie kreisten bald als schwarze Punkte in den höchsten Lufträumen, dem Auge kaum erkennbar, bald schossen sie bis da hinab, wo Licht und Schatten sich trennten und die Sonne glänzte von den schwarzen Federn des schönen Adlers und dem bunten Gefieder der Habichte, Falken oder Reiher. Die alten heimischen Raubvögel machten sichtbar Jagd auf den fremden Eindringling in ihre Regionen, in ihre bis da unangefochtenen Rechte.
»Nun ist’s um ihn geschehen«, rief der Hufschmied, dessen Amboß in seiner Schmiede an der Ecke zu meiner Mutter Ärger vom frühen Morgen bis in die späte Nacht nicht ruhen wollte, und es klang zwischen Wehmut und Verdruß in des rauhen Mannes Kehle.
»Ja, jetzt haben sie ihn«, setzte ein anderer bedauernd hinzu. »Wie kann auch ein einzeln Tier gegen solche Hetze sich wehren?«
»Wenn’s eine Eule wäre!« sagte ein alter Jäger. »Aber wißt ihr, was ein Adler ist? Sie haben einen Adler aufgescheucht.«
»Oder ein Adler sie«, warf der vierte ein.
»Das ist egal, er durfte ihnen nicht ins Revier kommen«, bemerkte eine mir nur zu wohlbekannte Stimme, von der ich leider noch oft zu reden genötigt sein werde.
Der Adler hatte seinen Verfolgern einen Vorsprung abgewonnen, und diese, in Schuß geraten und jetzt eingeschüchtert durch die Nähe der Menschen, stoben auseinander. Der Adler war gerettet. Als befinde er sich unter den Seinen, als verstehe es sich von selbst, daß keine Hand das königliche Tier berühren könne, so war er mit einer majestätischen Ruhe über den Köpfen fortgeschwebt. Wie er nun aber wieder aufstieg in schönen, kühnen Kreisen, frisch und kräftig, als schüttle er die Drangsale ab, und seine stolzen Flügel in den letzten Sonnenstrahlen wiegte, brach eine unwillkürliche Lust aus den hundert und aber hundert Kehlen. Ein Triumphgesang wurde ihm nachgesandt und ein schallendes Gelächter, ein Spottlied den Habichten, die zu spät dumpf krächzend ihm folgten.
Ich gaffte noch immer in den leeren Raum, wo der verschwundene Adler geschwebt, als ein Spielgenosse mich aufrüttelte. »Du bist dran.« Meine Phantasie aus den Wolkenräumen sammelte sich schnell zu der Entscheidung auf platter Erde. Ein großer Gewinn hing von meinem nächsten Wurfe ab. Adler und Habichte waren vergessen, als die Murmel aus meinen Fingern glitt und meine Kameraden mit weit aufgerissenen Augen die rollende Kugel verfolgten. »Sie geht hinein«, schrie es, und die ganze kleine Genossenschaft fiel mit den Vorderleibern vor, die Hände auf dem Pflaster. Er wäre auch hineingerollt und ich der Sieger des Abends geblieben, wäre nicht im entscheidenden Moment ein grober Schnallenschuh dazwischengetreten. Die Kugel berührte die rindslederne Sohle, prallte ab, und das Spiel war nicht gewonnen. Ein lautes »O weh!«, ein unwillkürliches Aufjauchzen! Doch sei es zur Ehre meiner Kameraden gesagt, ihr Jubel verstummte im Augenblick; sie schämten sich. Allein ein heiseres Hohngelächter und der unbewegliche Fuß sagten mir, daß hier von keinem Zufall die Rede war. Erbittert, meiner selbst nicht mächtig, griff ich nach dsn Murmeln neben mir, sie dem Spielverderber an den Kopf zu werfen. Ich weiß nicht, ob ich es ausgeführt, wenn ein anderer vor mir gestanden, als der vor mir stand; aber wie kühlte sich schnell mein hitziges Blut, als ich einen Mann vor mir sah, den ich unter allen Männern am wenigsten gern sah.
»Schmeißen, Patron?« sagte die hagere Gestalt im kurzen Advokatenmantel und legte die langen Arme auf den Rücken, als erwarte sie nicht ungern das straffällige Attentat, während es sie doch nur eine Handbewegung gekostet, meinen bewaffneten Arm festzuhalten. Meine Bestürzung freute ihn. Er holte die eine Hand langsam vor und strich sich wohlgefällig über das ungeheure Kinn seines olivenfarbenen, langen Gesichtes. »Warum schmeißen wir denn nicht zu, Patron, wir machen unseren Verwandten und Paten noch nicht genug Ehre.«
Mit seinen dürren langen Fingern klopfte er mir auf die geschlossene Hand, und die Kugeln – ich weiß nicht, ob vor Schmerz oder Ekel – fielen heraus. Er hob sie grinsend auf, und wie ein gefundenes corpus delicti glitten sie in des Advokaten Westentasche. – »Wir sitzen wohl schon recht lange hier bei der noblen Vergnügung? Auf dem Wege, ein Straßenjunge zu werden! – Ist ja eine gute Aussicht bei der Erziehung. – Werden es bald so weit gebracht haben wie unser Taugenichts von Bruder. – Und die Hosen, die Stiefeln, wie sieht das aus! – Freilich, wer den lieben langen Tag auf dem Straßenpflaster rutscht, da sind Ellenbogen und Knie bald durch, die Spitzen von den Schuhen kommen nach. – Herr Vater und Frau Mama nur immer neue machen lassen, das würde uns gefallen. – Nicht wahr?«
Es ist schwer zu sagen, ob der gedehnte, schneidende Ton des Herrn Paten widerwärtiger war oder sein persönlicher Anblick. Mein Vater war ein mehr als strenger Mann. Er hatte uns gewöhnt, ihn nur mit Zittern anzusehen, ich habe nie ein freundliches Wort von ihm gehört, nie einen väterlichen Blick erhascht, es lag in seinen Grundsätzen, uns nur durch die Furcht zu erziehen, die Liebe hielt er nicht für nötig. Dennoch war seine herbe Erscheinung für mich eine Wohltat, wenn ich sie mit der des Herrn Paten verglich.
Advokat Schlipalius gehörte zu unseren Verwandten. Wie nahe er es eigentlich war, kann ich nicht angeben; auch war er es nur von selten meines Vaters; vor meiner Mutter sollte der Ehrenmann, ehe sie dem Vater die Hand reichte, selbst auf Freiersfüßen erschienen sein. Ich mag nicht glauben, daß es nur der empfangene Korb gewesen, der ihn zu dem Störenfried gemacht, als der er nur zu häufig bei uns auftrat. Scheelsucht und Neid müssen schon an seiner Wiege gesessen haben. Er war geizig in hohem Grade, aber noch weit mißgünstiger als geizig. Behutsam, auflauernd, nachtragend, kriechend, wenn es sein mußte, und mit allen Eigenschaften eines Schleichers, nur nicht mit den angenehmen, wußte er sich doch so wenig selbst zu beherrschen, daß man ihm die Schadenfreude in den Augen las. Es verriet wenig Zartgefühl, daß er ungeachtet seiner Verhältnisse zu meiner Mutter der tägliche Gast in unserm Hause wurde. Die stille, gute Mutter mochte dies in einer Zeit, über die ich keine Rechenschaft geben kann, schmerzlich empfunden haben; jetzt war ihr seine Gegenwart doppelt zuwider, indem er fast nie über die Schwelle trat, ohne den Angeber zu spielen.
Der Haß des vorigen Königs gegen die Advokaten ist bekannt. Jeder Advokat mußte als Uniform einen kurzen Mantel tragen, damit die Leute ihm schon von weitem aus dem Wege gehen konnten, und wehe dem, welcher sich ohne diese Tracht auf der Straße sehen ließ. Für die hohe, hagere Gestalt unseres Herrn Paten mit seinen überlangen Armen und Storchbeinen, die in noch ungestaltetere Füße ausliefen, war sie besonders ungünstig. Wenn er sie nicht in den Westentaschen hielt, hingen ihm die Hände unter dem Mantel heraus wie zwei immer drohende Strafruten. Er selbst hatte nicht das mindeste dazu getan, seinem widerwärtigen Aussehen abzuhelfen; seine Manschetten, die geblümte Schoßweste waren selten rein, an der hier und da zerstörten Perücke fehlte der Puder, ja es schien, als wenn er ein eigenes Vergnügen darein setze, durch seine Gegenwart zu erschrecken. Meine Spielkameraden, anfangs kaum weniger als ich selbst erschreckt, fingen an einzusehen, daß es doch nur Worte waren; die besseren schämten sich, daß ich wegen des häßlichen Mannes verloren haben sollte, und einer reichte mir meine Murmel wieder: »Wirf noch mal, Etienne, das soll nicht gelten.«
»Es gilt nicht!« wiederholte die kleine Schar. »Den Fuß weg!« schrie schon ein Beherzterer. Ich zitterte, die Tränen standen mir in den Augen; es waren aber mehr Tränen der Wut über ein erlittenes Unrecht als der Furcht. »Wirf dreist zu, Etienne!« schrie man mich an. »Was hat er ein Recht, uns das Spiel zu verderben.« – »Fort der lange Laban!« – »Fort da!« rief ich nun auch, und Lust und Bosheit hatten in der Knabenbrust gesiegt. Der Herr Pate hatte den Fuß fortgezogen, ich zielte, und meine Kugel glitt in das Loch. Allgemeiner Jubel! ich hatte gewonnen; doch jetzt, wo niemand mir die Ehre bestritt, blickte ich schüchtern zum Advokaten auf, um zu wissen, was sie mich kosten würde. Er grinste freundlich, schmunzelte etwas von »charmanten Kindern«; ach, aber im Augenblick, als ich nach meinen Kugeln fassen will, als die ändern rufen: »Zählt sie!« war es abermals geschehen. Seine Fußspitze schaufelte die ausgeworfene Erde in das Loch und seine rindslederne Sohle trat die Murmel fest. Da stand der lange, häßliche Mann, und seine noch häßlicheren Beine stampften wie zwei Pflasterschläger auf unser verlorenes Spielzeug.
Da lagen alle meine Trophäen begraben, und die hellen Tränen stürzten aus den Augen. Auch damit war der grausame Mensch noch nicht zufrieden. »Wir wollen doch den Herrn Polizeisergeanten rufen, ob er die Permission gegeben hat, hier Steine auszureißen, das obrigkeitliche Pflaster zu lädieren und Gruben zu graben, wo ein Mensch stolpern kann. – Was würden wir sagen, Patron, wenn man uns auf die Vogtei brächte, bei Wasser und Brot eine Nacht einsperrte und am Morgen eine Lektion aufzählte?« Der Pate gehörte zu dem Schlage Menschen, die, je weniger Widerstand sie finden, um so dreister werden. Die Gelenke seiner dürren Finger hämmerten mir jetzt, wie eben noch seine Beine auf das Pflaster, auf den Scheitel. Es tat empfindlich weh. Ich schrie. Meine Kameraden murrten, sie blickten sich fragend an, indessen noch war die Autorität auf des Advokaten Seite. Als aber einige Vorübergehende stillstanden und Miene machten, sich des mißhandelten Knaben anzunehmen, erwachte auch ihr Mut. Man schrie, tobte, man umringte den Herrn Paten, laute Anklage gegen den Spielverderber brachen heraus. Der mutige Fritz raffte schon eine Handvoll Erde auf, sie ihm in sein gelber werdendes Gesicht zu schleudern, ich schluchzte, diesmal weniger aus Schmerz als aus Politik, um die Mittelspersonen zu gewinnen, und der Straßenskandal war auf dem besten Wege sich zu vergrößern und vielleicht in eine große Verfolgung und Hetzjagd auf den Advokaten auszuarten, als plötzlich etwas in buchstäblichem Sinn dazwischen trat und uns zum Vorteil des Letztem auseinander trieb.
Es war diesmal kein himmlisches, sondern ein sehr irdisches Schauspiel. Um die Ecke der Wallstraße tönten schon eine Weile gedämpfte Trommeln, und einige Kompanien von Friedrich Wilhelms Riesengarde lenkten nach dem königlichen Schlosse zu. »Platz da!« rief der vorderste Unteroffizier und stieß den Advokaten beiseite, mit seinem blinkenden Sponton zwischen uns fahrend. Seltsam mochte es ihm vorkommen, daß nicht alles schon auseinandergeflogen war, denn die Potsdamer Riesen waren an solche schweigende Verehrung gewöhnt. Der Handwerksmann zog vor einer Ablösung den Hut, und vor einem Bataillon machte groß und klein auf der Straße Front. Man konnte es wohl tun, ebenso vor Bewunderung als aus Respekt, denn nie in der ganzen Welt mögen so viel gigantische Männergestalten sich an einem Ort zusammengefunden haben als dazumal in Berlin. Uns Kindern erschienen diese Riesen immer wie Wesen anderer Art. Wußte doch jeder, wie sie gehätschelt und gepflegt wurden. Sie allein wurden in der arbeitsamen Zeit nicht zur Arbeit angehalten. Mancher dieser wohlgenährten Soldaten ließ sich sogar sein Gewehr zur Parade nachtragen. Wie sonderbare, märchenhaft klingende Erzählungen zischelte man sich zu über Art und Weise, wie sie aus ihrer Heimat hergelockt und in die Montur gesteckt wurden! Der hochblonde Schwede marschierte neben dem dunkeln Sarmaten, und in den schwarzen Augen des Südländers glühte ein Feuer, verurteilt, hier nutzlos zu verdampfen. Das bequeme Leben gab Haltung und Mienen, aber nicht den behaglichen Ausdruck des wohllebigen Weltmannes. Ich hatte einmal einen fremden Offizier äußern hören, alle diese Sechsellensoldaten wären im Felde nicht mehr nütz als bleierne, und bleierne, wußte ich, konnten nur stehen und fallen. Wenn sie vorübermarschierten, ein Gegenstand staunender Ehrfurcht für jung und alt, wandte kaum einer sein Auge rechts oder links, so gleichgültig schien ihnen alles. Und denken Sie nicht, die Verdrossenheit sei immer der nachhallende Schmerz über eine, gewaltsame Einsteckung gewesen. Die Mehrzahl hatte sich ja kaufen lassen, zum Teil zu ungeheuren Preisen; ihnen ging nichts ab als eine Sache, für die sie fechten, eine Sache, für die sie sich begeistern konnten.
Man war diese Garde fast nur im feierlichsten Parademarsch zu sehen gewohnt, heute war darin etwas anders; sie schienen rascher sich zu bewegen und doch nicht so sicher. Weil ihr Dienst so regelmäßig, die Straße, die Stunde, wo sie passierten, seit Jahren so bestimmt war, fiel dieser außergewöhnliche Marsch jedem andern als uns Kindern auf. Ich sah nichts, als daß mir die langen Leute heute noch trauriger schienen, und Fritz meinte nachher, sie seien sehr zur unrechten Zeit gekommen, denn ohne sie hätten wir einmal sehen sollen, wie der böse Mensch es von ihm abbekommen hätte. »Siehst du, Etienne«, sagte er, »der Kerl machte schon Miene auszuziehen, und dann hätten wir alle hinterdrein gesetzt. Geschrien hätte ich, was das Zeug hält, und alle Straßenjungen wären mitgelaufen, daß es eine Lust war. Und wenn auch einer nachher geklatscht hätte, und ich auf einen Tag ins Karzer gemußt, was tut das, wenn man seine Pflicht tut und recht hat!«
Das wurde freilich erst gedacht und gesprochen, als die letzten Reihen der Grenadiere längst um das Fürstenhaus verschwunden waren und hinter ihnen her, wie Eisenspäne vom Magnet angezogen, was auf der Straße Beine hatte. Der Herr Pate war eine große Autorität, die berufene Polizei eine noch weit größere, aber Friedrich Wilhelms Garde waren Wesen, in deren Gegenwart es wohl erlaubt war zu denken, wer damals denken mochte, doch nicht zu sprechen, kaum zu atmen. Der Herr Pate hatte sich unter ihrem Schutz längst davongeschlichen.
2. Frau Kurzinne
Es war ein buntes dumpfes Gewoge in der Stadt, an den Ecken standen die Leute und steckten die Köpfe zusammen, der Abend kam, und die Läden wurden nicht geschlossen, die Bürger gingen nicht nach Hause. Feldjäger und Läufer sprengten durch die Straßen, die Karossen fuhren nach dem Schlosse, das Militär stand aufmarschiert, und bei allem diesem Aufruhr war es doch eigentlich still. Mit dem ganzen Troß meiner Kameraden war ich gaßauf, gaßab gelaufen, wo etwas zu sehen war. Man sprach von der Majestät des Königs, der Majestät der Königin, von des Kronprinzen königlichen Hoheit, von der Gruft in der Domkirche, Gott weiß wovon, mir war alles gleichgültig. Ein reichbordierter Leibjäger spornte an mir vorbei, die hängende Peitsche dem Pferde auf die Schenkel legend; dem Reiter rief ein Bürger nach: »Glück zu, Herr Mestag, der Ritt nach Rheinsberg kann Euer Glück machen.« Der Reiter hörte nicht, und ich auch nicht, denn mir summte immer nur Fritzens Frage im Ohr: »Hat er denn ein Recht, dir auf den Kopf zu klopfen?« Er hatte ja kein Recht. Er war nicht mein Vater, nicht meine Mutter, nicht mein Lehrer, nicht Wachtmeister bei der Polizei. Immer noch sah ich den verzogenen weiten Mund, die zwei häßlichen langen Vorderzähne, die blinzelnden grauen Augen, ich hörte das heisere Gelächter, auch das Lachen der Gassenjungen, und wurde blutrot, daß jemand über mich gelacht haben konnte.
Selige Unschuld des jugendlichen Hasses! Ich hätte ihn zerfleischen können in dem Augenblick, und im nächsten jubelte mein Herz auf, und meine Wange wurde rot, nicht vor glühender Scham, sondern weil mir ein alberner Schabernack einfiel. Ich hatte mich von den andern führen lassen ohne Willen, ohne zu wissen, wohin. Da fiel mir am andern Ende einer verlassenen Quergasse plötzlich ein Lichtschein ins Auge. Er kam von der Blechlampe aus einem Eckladen. An dem ovalen Widerschein am grauen Hause gegenüber erkannte ich, wo wir uns befanden, und schrie aus vollem Halse: »Frau Kurzinne steckt ihre Blechlampe an.«
Die unglückliche Frau Kurzinne, deren Name, oder vielmehr ihre Blechlaterne, einen düsteren Racheplan in uns erweckte, hielt den bescheidenen Materialladen an der Ecke, wo auch zuweilen Branntwein geschenkt wurde, schon fast seit Anfang des Jahrhunderts. Das kleine bucklige, rotäugige Weib mit der keifenden Stimme und den großen Händen war der argen Jugend weit umher nicht viel anders bekannt als eine Hexe, über die man lacht und vor der man sich fürchtet. Es war eine rührige Frau, die ihr Geschäft verstand und schon zwei Männer, welche entweder sie oder ihren Branntwein nicht hatten vertragen können, in Ehren hatte vors Tor tragen lassen, aber selbst noch gar keine Lust zeigte, ihnen zu folgen, obgleich ihr dritter es mit ihr und ihrem Aquavit aushielt. Haushälterisch und sparsam in jedem Dinge, war sie nur in einem verschwenderisch, in Worten. Jeder Kunde bekam seine Ladung Klagen auf die schwere Zeit, auf die argen Abgaben, auf das Wetter, es mochte schneien oder die Sonne scheinen, auf die Bosheit der Menschen, bisweilen selbst auf den lieben Gott, gratis in den Kauf. Man meinte, viele Käufer träten nur dieser Gratiszugabe wegen vor ihren Ladentisch, der in Berlin berühmt war.
Ich brauche kaum anzuführen, daß ein Weib, das mit jedermann Lust verriet, anzubinden, nie ihren wirklichen Rechten etwas vergab. Sie war auf dem Rathause zu Hause, und ihre Sachen müssen immer gut gewesen sein, denn sie soll nie einen Prozeß verloren haben. Übrigens hüteten sich die Nachbarn vor einem Rechts-wie vor einem Wortstreite, und sie mochte gegen zehn Jahre ihren immer kochenden Ärger vor keinem grünen Tische ausgeschüttet haben, als der rechte Mann erschien, der ihr völlig gewachsen war. Advokat Schlipalius kaufte nämlich das große, ihrem Laden gegenüber gelegene Eckhaus, und er hatte kaum eine Nacht darin geschlafen, als gegen die verwitwete Kurzinne eine Klageanmeldung von besagtem Advokaten eingereicht wurde. Die Sache verhielt sich so:
Frau Kurzinne steckte Sommer und Winter, sobald es finster wurde, die einzige schon erwähnte Blechlampe in ihrem Laden an. Seit 1701 fiel der Widerschein dieser Lampe auf das Haus gegenüber, und seit 1701 war es keinem Besitzer eingefallen, sich deshalb zu beschweren. Der Advokat aber behauptete, das Licht habe dergestalt gegen die Scheiben seiner Studierstube geblendet, daß er abends keinen Federstrich habe tun können; als er sich darauf an das Fenster begeben, nach der Ursach’ auszuschauen, seien ihm seine Augen völlig geblendet worden, und er habe hierauf die Nacht an beträchtlichen Schmerzen gelitten, die ungewiß machten, ob er ferner den vollen Gebrauch seiner Augen behalten werde. Darauf erging folgenden Tags von seiner Seite eine mündliche Aufforderung durch den Schreiber an die Witwe, des Inhalts: sie solle stehenden Fußes die Lampe umdrehen oder so hängen, daß das Licht gegen die Erde falle. Frau Kurzinne schickte dem Advokaten zur Antwort eine jener derben deutschen Redensarten über die Straße, welche sich in keine andere Sprache übersetzen lassen und auch in unserer Schriftsprache nur durch die Umschreibung ausgedrückt werden kann: »Er solle sich seinen Schaden selbst ersetzen.« Dies tat denn auch, wenngleich nicht auf die von der Witwe angegebene Art, der Advokat, und der Prozeß Schlipalius contra Kurzinne schwebte mehrere Jahre, von beiden Seiten mit allen erdenklichen Schikanen geführt. Ihren Kunden versicherte die Bürgerin oft: der große Herzog Malpruch von England sei, ehe er ins Fürstenhaus logiert worden, in demselben Hause abgestiegen, und dem großen Feldmarschall, vor dem die Franzosen siebenmal gelaufen, sei es nie eingefallen, über die Lampe zu klagen, sondern er habe sie einmal, als sie ihm einen Knicks gemacht, eine gute Frau genannt, und der Tintenkleckser, der vor einer Fledermaus sieben Meilen laufe, der sich zur Ehre schätzen müsse, wenn ihm eine rechtschaffene Frau ins Haus leuchte, wolle sich unterstehen, zu klagen, aber er wäre ja – und nun folgte ein Strom von Ausdrücken von einer donnernden Kraft und Schwere, daß er die Batterien des gemeinten Marlborough und des noch großem Eugen übertönt hätte.
Wie erstaunte man daher, als eines Morgens Advokat Schlipalius in den Eckladen trat und mit nichts weniger als fürchterlicher Miene einen Schluck wider den argen Nebel forderte. Er trank die Flüssigkeit langsam herunter, hielt das Glas gegen das Licht und versicherte, nirgend ein solches Danziger Magenwasser gefunden zu haben. Innerhalb einer Stunde schlürfte er, den Ellenbogen auf den Ladentisch gestützt, drei Gläser aus, und als er in die Tasche griff, sagte Frau Kurzinne mit aller Freundlichkeit, die ihr möglich war, er solle sich nicht inkommodieren, das würde sich ja schon »alles« finden. Darauf führte sie ihn selbst zur Türe hinaus und wünschte dem Herrn Advokaten über die Straße hinüber einen gesegneten Appetit. Zwei Tage später war dies »alles« in Richtigkeit, und am dritten steckte die Verlobungsanzeige schon am vergoldeten Spiegelrande in meiner Eltern Putzstube. Die alte Susanne hat mir oft von dem seltsamen Brautzuge erzählt, der im weitesten Umwege über die offene Straße ging. Unsere Straßenjungen jubilierten, und der Küster am Werder hatte Mühe, sie nur so weit abzuhalten, daß sie die heilige Handlung nicht störten.
Über die Motive der Heirat gab es verschiedene Vermutungen. Beim Gericht meinte man, der Advokat habe gewittert, daß es mit seinem Prozeß schlecht stand, pfiffigere Leute wollten wissen, er habe in Erfahrung gebracht, daß Frau Kurzinne eine Partie sei, mit der sich eine märkische Gütergemeinschaft ohne Schaden eingehen lasse. In unserem Hause wollte man leider einen ändern Grund ahnen. Die famose Heirat war nicht lange nach der meines Vaters erfolgt, und als der Herr Pate seine Braut der Mutter vorstellte, sagte seine höhnische Miene: »Habe ich Sie nicht bekommen, Frau Muhme, habe ich doch eine andere, und Frau ist Frau.«
Was half es der armen Frau heut abend, daß sie die Gattin des Herrn Advokaten war? Die schwache Frau sollte das Unrecht entgelten, welches wir an dem stärkeren Manne nicht zu rächen imstande waren! Darum jauchzten wir auf beim Schein ihrer Blechlampe, und ich war das Haupt der dunklen Verschwörer, die an der ändern Straßenecke ihre Köpfe zusammensteckten.
Der Eckladen hatte zwei klingelnde Glastüren. Einer von uns sollte nun nach dem andern zur einen Tür eintreten und, wenn die Frau Kurzinne aus der Stube käme, ihr einen guten Abend wünschen und zur anderen sehr schnell wieder hinauslaufen. Das dünkte uns sehr witzig, aber man wollte Variationen. Der eine sollte sich erkundigen, wie sich ihr Herr Gemahl befinde, der andere fragen, wieviel ein Dreier Pfennige hat, ein dritter für einen Heller Kleingeld einwechseln. Ich, als nur zu bekannt, sollte den Vexierreigen schließen. Ich glaube, ich war der dreizehnte und entging denn auch nicht dem Lose, welches nach dem Ammenglauben den dreizehnten trifft.
Alles ging vortrefflich. Der erste, mit schüchterner Stimme sich nach dem Befinden des Herrn Advokaten erkundigend, bekam eine ebenso freundliche Antwort und noch ein Stückchen Zuckerkant auf den Weg, brachte uns aber die nicht ganz angenehme Nachricht, daß statt der Frau Kurzinne nur ihr kleiner Ladendiener gekommen war. Der zweite mit der kalkulatorischen Frage und dem Dreier erhielt zur Antwort, das sei eine dumme Frage, der, dritte mit dem Heller aber schon den Bescheid, er solle sich hinausscheren und nicht wiederkommen. Als nun aber die eine Klingeltür sich öffnete, wenn sich die andere schloß, es klingelte, klappte, stürzte, lachte und man kam und lief, als wäre es eine Feuerprobe, fing auch der kleine Ladenhüter etwas zu ahnen an. Und da grade, als ich die erste Tür öffnete, mußte die Frau Advokatin herausstürzen.
»Aber, Musje Maßmann, sollen Ihnen die Jungens noch auf der Nase ‘rumtanzen, bis Sie merken, daß Sie ein Maulaffe sind? Steht mir wie ein abgekochtes Zimtröhrchen und rührt sich nicht! Wozu hat Ihnen der liebe Gott zwei Arme gegeben und zwei dicke Hände dran? In den Schwarzseiftopf, Musje Maßmann, reingegriffen mit beiden, und den Rangen hinter die Ohren gerieben, daß sie gewaschen nach Hause kommen!«
Musje Maßmann bedurfte nur dieses Anstoßes. Er stemmte sich mit den Armen auf den Tisch, und war im Nu hinübervoltigiert. Ach, kaum daß ich die Tür hinter mir zugeschlagen, als sie auch schon wieder aufflog. Mein Herausstürzen gab das Signal zur Flucht. Das Feldgeschrei war: »Die Kurzinne ist hinter uns!«, und mir blieb nichts übrig, als – wie ein guter Feldherr den Rücken zu decken. Da hielt mich der kleine Musje Maßmann, an meinem Haarbeutel hielt er mich, ich schrie aus Leibeskräften, ich rief um Hilfe, Beistand, vergebens. Musje Maßmanns ausgestreckte Rechte und sein: »Wer sich untersteht!« wirkte mehr. Mich schleifte er halb an den Haaren, halb an den Ohren, und der Barbar achtete nicht, wie ich in letzter Angst ihm in die Schenkel kniff.
Da standen wir vor dem Laden und schon darum eine beträchtliche Anzahl Müßiggänger, alle begierig, Zeugen zu werden einer exemplarischen Exekution. Es stand mir niemand bei, nicht einmal das gute Bewußtsein. Frau Kurzinne leuchtete auf der Ladenschwelle mit ihrer Blechlampe, und schrie und schrie: »Nur recht stark, Musje Maßmann, daß er’s empfinden tut. Der lange Inspektor ist sein Papa und die zierige französische Madame seine Mama. Wollen vornehm tun die Leute, weil sie an der Kolonie hängen und der liebe Herrgott sonntags französisch zu ihnen spricht, aber es ist nichts dahinter. Da soll ich Respekt vor haben! Nein, ich habe keinen vor. Mein Vater war ein Trompeter und konnte ihnen was vorblasen, mein Mann ist ein Advokat und kann ihnen zeigen, was ein X ist und ein U, und mir hat der liebe Gott eine Lunge gegeben und eine Zunge. Schlagen Sie zu, Musje Maßmann.«
»Patron, will Er nun Abbitte tun?« Ich biß die Zähne zusammen und bat meine Tränen, daß sie nur ein bißchen warten sollten.
»Sieh die verstockte Brut!« schrie die Kurzinne. »Tüchtiger, tüchtiger, Musje Maßmann; ihn mit einem Denkzettel nach Hause geschickt für die superkluge, feine Frau Mama.«
Der boshafte blonde Mensch begegnete mit einem unerhörten Vorschlage der Aufforderung seiner Meisterin: »Frau Prinzipalin, den Schwarzseiftopf her, schnell den Schwarzseiftopf«, schrie er. »Ich will ihn einseifen, daß sie’s acht Tage lang riechen sollen!«
Das war zuviel. Ehe noch Frau Kurzinne handrecht den Topf niedergestellt, ehe Herrn Maßmanns Hand hineingetaucht, stieß ich einen entsetzlichen Schrei aus. Wie Simson die Tempelsäulen erschütterte, packte ich mit letzter Kraft die Beine meines Peinigers. Ein anderer Schrei mischte sieh in meinen, es war Herrn Maßmanns, über den noch eine dritte Gewalt gekommen war. Man rang, und Musje Maßmann stürzte über mich weg zu Boden. Ehe ich noch wußte, wie dies zugegangen und wem ich die unerwartete Rettung verdankte, hörte ich eine Stentorstimme: »Wer dem Kinde was tun will, der komme her.«
Es war mein athletischer Bruder Gottlieb, der dastand, den linken Fuß auf dem Leibe des Herrn Maßmann und den rechten Arm drohend der Menge hinhielt. Die dem Ladendiener zu Hilfe eilen wollten, fanden Widerstand, man tobte, schimpfte, stieß sich, Frau Kurzinne holte ihren Seiftopf, daß er nicht zu Schaden komme, und mein Bruder Gottlieb riß mich auf. Im allgemeiner werdenden Tumult und der Dunkelheit machte er sich mit mir auf und davon.
3. Bruder Gottlieb
Der gute Bruder Gottlieb! – Ich habe ihn wenigstens nie anders genannt, denn gegen mich war er ein guter Bruder. Er schnitzte mir die ersten Haselstöcke zu Reitpferden, er brachte mir die Pfeife aus dem Rohr, er spielte Pferd mit mir und ließ mich immer Reiter sein. Es war nicht das erstemal, daß er mir beigestanden hatte; mein bester Spielkamerad, den ich den mutigen Fritz nannte, gestand mir in einer vertrauten Stunde, sie würden mich arg gehänselt haben, als ich das erstemal zu ihren Spielen gelassen wurde, weil ich ihnen so apart ausgesehen, wenn nicht der starke Gottlieb dabeigestanden hätte. Sie hatten sich damals in mir geirrt, denn ich wurde bald der Tollste unter ihnen. Wie manche dumme Streiche, die von mir ausgingen, wurden vom starken Gottlieb durchgeführt. Er sah mir die Lust an den Augen ab, und nie, wenn es herauskam, gab er jemand an.
Gottlieb galt für einen verlorenen Sohn, für einen, der eigentlich nicht mehr zur Familie gehöre. Einige Familienglisder rechneten die Kosten nach, die der Ungeratene verursacht, sie tadelten, daß der Vater ihn so lange in seinem Hause geduldet. Einiges Licht über ein Verhältnis, das dem Kinde natürlich nicht aufgeklärt wurde, kam mir durch einen Vorfall, welcher sich ungefähr ein Jahr früher ereignet hatte. Gottlieb kam damals wirklich aus dem Hause, und zwar als Alumnus oder Pensionär auf das Joachimsthalische Gymnasium. Bei der Gelegenheit waren unsere mütterlichen Verwandten sehr aufgebracht. Wenn er den Buben eine Profession lernen ließe, so habe der Vater schon übergenug getan, hörte ich laut äußern. Ihn studieren zu lassen, sei Hochmut, eine Kränkung der Familie. Ich erfuhr dann noch, daß meine Mutter nicht Gottliebs Mutter war, und nun schloß ich weiter, daß Gottliebs Mutter eine schlechtere Mutter gewesen sein müsse als meine. Denn sein Rock war von weit gröberem Zeug als meiner, er saß immer unten am Tische und mußte zuweilen aufwarten; ja er putzte dem Vater und mir die Schuhe, und – was mir damals das Merkwürdigste war – er bekam selten etwas von den feineren Gerichten ab.
Auch vom Gymnasium her kamen bald Klagen, Gottlieb sei faul und verführe seine Mitschüler. Der Herr Pate war der gewöhnliche Zwischenträger; doch mußte es wahr sein, denn zuweilen kam ein Herr Inspektor selbst ins Haus und berichtete dem Vater, der dann dem jungen Lehrer schonungslose Strenge anempfahl. »Einen breiten Rücken hat er zwar«, hörte ich einmal den jungen Mann mit bedenklicher Miene antworten, »aber ich unterstehe mich, zu zweifeln, ob Prügel allein erziehen. Der Junge hat einen unruhigen Geist und Riesenglieder, wer weiß, ob ihn die Natur zum Studieren bestimmt hat.« – Da wurde mein Vater sehr zornig, der überhaupt das Wort Natur nicht leiden mochte. Er sagte, der Vater habe zu bestimmen und müsse wissen, was für den Sohn tauge und wofür der Sohn tauge. Die Eltern schon seien zu nachsichtig gegen ihre Kinder, was sollte aber aus der Erziehung werden, wenn fremde Lehrer noch weichherziger sein wollten? Nur die Strenge und die Furcht mache den Mann, und wehe der Nachkommenschaft, wenn die alte Zucht und Sitte nicht mehr mit eiserner Festigkeit gehandhabt werde. Der junge Mensch mußte schweigen, von Bruder Gottlieb wurden aber die Nachrichten immer böser. Er stiftete Aufruhr, verhöhnte die Lehrer, preßte durch körperliche Übergewalt Schwächere zu seinen Komplotten, verkaufte seine Schulbücher und ging oft, was wir nennen: hinter die Schule. Dabei fehlte es denn nicht an wöchentlichen Zeugnissen, wie er dafür gezüchtigt worden, im Karzer gesessen, und es schien mir oft, als sei der Vater mehr über die abgemessene Richtigkeit der letzteren erfreut als über jene Nachrichten betrübt.
Nun hatte ich den Bruder Gottlieb schon recht lange nicht gesehen. Er zerrte mich so hastig fort, daß ich kaum mit seinen langen Beinen Schritt halten konnte. »Hast du auch schon Lust, eine Prügelei anzufangen?« sagte er in dem rauhen Tone, der ihm seit einiger Zeit eigen war. »Da mußt du dir erst andere Knochen anschaffen, du bist doch noch ein Kind.« Das war ein Vorwurf, der mich mit jedem Jahre mehr verdroß. »Bruder Gottlieb!« antwortete ich ihm, »ich hätte nicht geschrien, wenn er mich nicht mit schwarzer Seife reiben wollte.«
»Das wäre freilich ein Elend gewesen, wenn ein so vornehmer Junker gestunken hätte. Du spitzest dich wohl drauf, wenn du einen Hut mit einem Federbusch tragen wirst und einen Degen mit einem Klunker dran?«
So lieblos und rauh hatte er noch nie zu mir gesprochen. Ich warf es ihm vor.
»Ich bin ja kein feiner Herr, und für unsereins braucht nicht so gesorgt zu werden. Habe mir etwas Luft gemacht draußen in der Hasenheide. – Was siehst du mich so bedenklich an, Fritz Hasenfuß? Courage, ich hab einen Schnaps getrunken. – Siehst du’s mir an, Junker? Ja, das ist nun mal geschehn, am ›dustern Keller‹. Lauf, was du laufen kannst, Etienne; bin schlechte Gesellschaft für dich.«
Branntweintrinken war mir von der Mutter als das äußerste Maß irdischer Gottlosigkeit vorgestellt worden. Dem Herrn Paten Advokaten wurde wohl des Morgens ein Glas Likör präsentiert, das trank er aber nur für seine Gesundheit. Unsern betrunkenen Küster hatte ich einmal vor Vaters Haustür gesehen im Rinnstein liegen, und ihn fluchen gehört auf die Leute, die ihn forttragen wollten. Das Bild hatte mehr gewirkt als alle Vorstellungen meiner Mutter. Und nun trank Gottlieb auch Branntwein! Jetzt erst fiel mir ein, was sie damit sagen wollten, als sie ihn einen verlornen Sohn nannten. Ich sah ihn schon von der Bank fallen, im Rinnstein liegen, gegen die Bürger losschlagen: Ich umfaßte ihn und bat ihn mit Tränen im Auge so sehr, nicht mehr Branntwein zu trinken.
»Sei ohne Sorge, ich habe keinen Dreier mehr in der Tasche.«
Ich fragte ihn, ob er denn Erlaubnis erhalten, heut nachmittag vors Tor zu gehn?
»Was sie uns nicht geben, muß man sich nehmen. Wird so bald damit aus sein. Wenn mich der Vater nicht losläßt, lauf ich fort. Ich mag nicht ein solcher roter Federfuchs werden, und einen Priesterrock zieh’ ich auch nicht an, weiß oder schwarz. Ich will nicht studieren und will sehen, wer mich dazu zwingen kann. Der Vater hat auch nicht studiert, sein Vater auch nicht, was soll ich’s denn ausbaden? Ein Gelehrter ist nie ein ganzer Kerl, hat der König selbst gesagt; darum nur sperren sie mich ein, sie wollen mich immer am Gängelband haben und keinen Mann aus mir machen, sondern einen Hund, der ihnen apportiert. Ich will’s ihnen aber beweisen, daß man selbst wollen muß. Warum geben sie mich nicht zu einem Förster in den Wald, da hätt’ ich hingehört. Hinter dem alten Könige drein, Wetter, wie hätt’ ich wollen über Stock und Block peitschen, die Sau hetzen, ihr das Messer an die Gurgel halten, und ›Vivat der König!‹ hätt’ ich geschrien aus voller Kehle, wenn die alte Majestät einen Keiler niederstach.«
Er gab mir einen herzhaften Kuß: »Das versprich mir, Fritz«, sagte er, »wenn du mal ein großer Herr und ich Gott weiß was bin, schäm’ dich nicht, wenn ich dich dann ›Fritz‹ anrede. Denn wenn ich dich Etienne heißen muß, so bist du nicht mehr mein Bruder.«
Ich bin nämlich außer Etienne und einigen anderen französischen Kalendernamen auch Friedrich getauft, meinem Vater oder dem Königshause zu Ehren. In der Familie wurde ich aber nie so gerufen.
»Aber du«, sagte Gottlieb im Scheiden, »mach’, daß du nach Hause kommst, denn bei dir wär’s zu früh, wenn du ihnen so antworten wolltest wie ich. Laß dich nur nicht sehen vor dem Paten, und wenn sie von deinem Streich schon wissen, so steck’ dich hinter die Mutter.«
Er ging langsamen Schritts über den Lustgarten der Friedrichsbrücke zu. Es war dunkle Nacht geworden. Ein sanfter Regen fiel herab, und ein ferner Donner verkündete ein heranziehendes Gewitter, aber noch immer war Bewegung auf den Straßen, Militärpatrouillen marschierten, Reiter mit Fackeln sprengten über die Brücke, und an den Fenstern des großen Schlosses und in den meisten Häusern war Licht. So machte auch ich mich auf den Rückweg nach Hause.
4. Von der Kolonie
Ohne Zweifel waren die Refugiés weit gebildeter als die wackeren Brandenburger, in deren verwüstetem Lande der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm ihnen ein Asyl eröffnete. Es müssen auch geistesstarke Männer und Frauen gewesen sein, die um ihre Überzeugung den väterlichen Fluren, dem teuren Herd, Wohlstand, Freunden und Verwandten den Rücken kehrten. Es hätte keiner äußeren Bevorzugung bedurft, um sie höher, besonders zu stellen, es verstand sich von selbst, daß sie zusammenhielten. Aber man hatte ihnen nun einmal im Sinne des Zeitalters eigene Kirchen, eigene Prediger, sogar einen eigenen Gerichtsstand gegeben. Ihre Kinder und Kindeskinder sahen nun eine Notwendigkeit darin, dies ehrende Verhältnis fortzusetzen und zu bleiben, was ihre Väter waren – fremde, bessere Wesen. Man wollte nichts mehr mit dem Frankreich zu tun haben, das die Väter grausam verstoßen und auch seitdem wenig zu einer toleranten Milde eingelenkt hatte, man wird ihm von Jahr zu Jahr fremder, so daß echte Franzosen über das Kolonie-Französisch sich lustig machen – und doch wollte man kein Deutscher, kein Preuße, kein Brandenburger werden, sondern in der Kolonie bleiben. Das wäre ein unbestimmtes Wesen geworden, da ihm mehr und mehr alles Positive abging. Um nun doch etwas für sich zu bleiben, spannen sich unsere Stammverwandten immer fester in ihre Gewohnheiten, ihre hergebrachten Ansichten ein. Man sah es ungern, wenn einer von der Kolonie herausheiratete. Man verschmähte zwar nicht den Staatsdienst, der Ehrenämter abwarf, aber es schien doch, als bliebe die Verbindung zwischen dem Beamteten und seinen Stammgenossen eine innigere als die zwischen ihm und dem Staate. Man suchte das Vermögen in den Familien zu bewahren, zusammenzubringen. Daher heiratete man nur zu gern Kusins und Kusinen, und es ward wie eine Art Verbrechen behandelt, wenn ein reiches Mädchen jemandem außerhalb der Familie ihre Hand reichte, denn alle ihre unverheirateten Vettern glaubten, nach der Nähe des Grades, ein gewisses Recht auf sie zu haben, ein Verhältnis, welches die große Familienverbindung immer aufs neue verknüpft und verschlingt, doch wenig geholfen hat, uns Kraft, Ansehen, Einfluß nach außen zu verschaffen. Im Gegenteil fehlt es bei dieser immer engeren Zirkulation des Blutes an frischen Säften. Was man so häufig bei Familien bemerkt, die nur ineinander heiraten, trifft auch bei uns zu, eine gewisse physische und moralische Erschlaffung.
Genug der Abschweifung! Ich sah jetzt die Laterne vor unserer Haustür. – Da knarrte die Tür, und der Herr Pate trat aus dem Hause. Mit welchem listigen Schleicherschritt stieg er die Stufen herab, fast mich streifend, ohne mich gewahr zu werden.
Den Atem anhaltend und kaum den Boden berührend, huschte ich die Treppe hinauf und wollte im Halbdunkel warten, bis mich einer bemerkte. Es keimte in mir auch die Hoffnung, daß man mich nicht bemerken werde, denn es war viel Unruhe im Hause. Auf der Treppe nach unserer Erkerkammer scheuerte die Magd, der Hausknecht, sonst mein guter Freund, lief treppauf, treppab an mir vorüber, ohne mich zu sehen, und drinnen im Wohnzimmer ging der Vater – ich kannte seinen Tritt – mit heftigen Schritten auf und nieder. Ich guckte durchs Schlüsselloch, aber so böse hatte ich ihn noch nie gesehen. Die Hände auf dem Rücken, das Gesicht feuerrot, maß er das Zimmer. Die Mutter stand, halb verlegen, halb ängstlich, am Fenster.
»Junkerchen! Junkerchen!« rief mit einem Male die Scheuermagd, die mich jetzt erst bemerkte, von oben herab. »Da drin ist nichts Gutes für Sie; machen Sie, daß Sie fortkommen.«
Darüber hatte ich überhört, was weiter drinnen gesprochen wurde, und schreckte nur zurück, als der Vater jetzt barsch herausbrach: »Wo ist Etienne?«
»Ich will ihn suchen«, sagte die Mutter und öffnete schnell, wie froh, mit guter Art fortzukommen, die Tür. Die Mutter riß mich rasch vom Treppengeländer, wohin ich retirierte: »Für dich ist hier nichts zu suchen«, und statt mich mütterlich in ihre Arme zu schließen, eilte sie mit mir nach der oberen Treppe. Christel, die Scheuermagd, mußte die alte Kinderfrau, die Susanne, rufen, der mich die Mutter ohne Abschied übergab. »Bring’ ihn schnell ins Bett«, sagte sie auf französisch, »er darf ihm heut nicht mehr vor Augen kommen.«
Also aufgeschoben war die Exekution. Ein Stein fiel mir vom Herzen. Die alte Susanne keuchte mit mir die Treppe hinauf und stöhnte und hielt inne bei jeder dritten Stufe.
»Ja, mein guter Junker, ja, mein Junkerchen, du hast wohl recht, zu zittern und zu beben. Was wird nun alles über uns kommen? Sie glauben’s nicht, aber Sie werden’s sehen, morgen am Tage. Morgen am Tage, da wird man’s sehen auf heller Gasse. Alte Leute verstehen das.«
»Auf heller Gasse?« rief ich erschreckt, denn was konnte man anders sehen, was anders denken, als wie der Vater mich schlug?
»Ja, ja, auf heller Gasse, es kommen wieder die bösen Zeiten. Sieben Habichte hinter einem Adler, ach, du meine Zeit, das kommt davon!«
Man wußte also von mir.
»Das bedeutet Krieg, sagen sie, ja Krieg«, fuhr sie fort, »aber was für einen Krieg! Ach, der gute protestantische König, sie haben unsern König umgebracht, das war ja vorauszusehen, das war alles abgekartet, die Jesuiten kommen wieder ins Land, die Dragoner reiten schon durch die Straßen, morgen klopfen sie ans Tor, und ehe die Sonne untergeht, gib acht, müssen wir aus den Toren ‘raus, wir alle, wie wir stehn und gehn, wir alle, es wird keiner geschont, und die Susanne kann nicht mehr laufen.«
»Warum kannst du denn nicht hierbleiben, Susanne?« fragte ich.
»Der gute König Wilhelm ist tot, der gute protestanische König! Sonntags und wochentags ging er in die Kirche und duldete nichts Katholisches um sich. Da waren wir sicher. Darum haben sie ihn vergiftet. O, alte Leute merken so was.«
»Dann kriegen wir einen jungen König«, fiel ich ein.
»Ja, aber was für einen! Der wohnt in Rheinsberg und geht nie in die reformierte Kirche. Hat lauter Männer aus Paris, alles römische Katholiken, um sich. Alle Wochen, das weiß man –- der gottselige König wußt’ es aber nicht – , alle Wochen kriegt er Schriften und Bücher aus der gottlosen Stadt. Da stehn die Anweisungen drin geschrieben, wie man uns wieder katholisch machen soll. Was hätte denn der große Adler bedeutet? Und die Raben hinter ihm her? Es setzt wieder eine Verfolgung.«
Mit gefalteten Händen saß ich im Bett und betete, was mir aus Bibelsprüchen und Kirchenliedern in den Mund kam. Dabei sah ich unverrückt, denn ich wagte mich nicht umzukehren, auf die Wand, wo zufällig ein Bild des Kronprinzen hing. Die Blitze beleuchteten es, und die Erschütterung des Donners bewegte das Porträt mit dem kühnen Gesichte des Knaben. Es kam fast heraus, als betete ich zu ihm: »Mache du mich nicht katholisch«, und mein wunderlicher Heiliger nickte dazu. Es mischte sich zwar damit unwillkürlich immer noch eine andere Bitte: »Mache es morgen mit mir gnädig«, aber auch dazu nickte der Kronprinz, der seit gestern nicht mehr Kronprinz war. Es kam mit einem Male ein sehr starker Donnerschlag, und etwas fiel mit einigem Geräusch zu Boden. Als ich inne ward, daß dies die drei spanischen Röhrchen waren, welche man hier auf dem Ofensims verwahrte, wurde mir leichter ums Herz, als wäre die Bitte schon halb gewährt.
5. Die Familie
Die Susanne rüttelte mich aus dem Schlaf. »Auf, auf, Junkerchen, sie kommen schon zusammen, daß du nicht der letzte bist.«
Die Frühstücksmilch verschüttete ich zur Hälfte, die Semmel konnte ich nicht ‘runterwürgen. Die Susanne schalt und zog mich mit sich hinaus. Auf dem ersten Treppenabsatz konnte ich schon nicht weiter; ich zerrte sie am Rock und bat sie, nicht so schnell zu gehen.
»Schämst dich nicht, Etienne?« sagte sie, die über Nacht ihre Ketzerangst ganz verschlafen zu haben schien. »Du bist ein großer Junge, was werden die Verwandten dazu sagen?«
Ich wußte wohl, was ein Familiengericht war, es hatte weit mehr zu bedeuten, als daß der König tot war; ach, in dem Augenblick war es schrecklicher als das Katholischwerden.
Ich huschte fast unbemerkt in den großen Saal. Und weil es so unbemerkt geschehen konnte, ward ich doch ordentlich zweifelhaft, ob denn um meine kleine Person die vielen Umstände gemacht würden. So glänzend, so vollständig war noch keine Hochzeit, keine Kindtaufe gewesen. Die Frauenzimmer, wenn auch für ihren Leib, konnten doch kaum in dem, was die Mode und der Schneider dazugetan, auf den Stühlen längs der vier Wände, die Herren mit ihren spitzen Degen kaum ohne sich zu spießen, an den Pfeilern und Fenstern Platz finden. Doch wurde daran fürs erste noch gar nicht gedacht. Meine Mutter bekomplimentierte sich, wie es sein mußte, mit den Eintretenden, die vorher unter sich, auf dem Flur, einen Kampf der Höflichkeit über den Vortritt bestanden hatten. Die kerzengerade Haltung der Damen bei den tiefen Knicksen, der Wellenschlag ihrer Reifröcke, in denen ihr Leib versank, die ernsten Mienen unter den turmhohen Frisuren und die wallenden Federn oben, ich hätte schon damals gelacht, wäre nicht alles auf meinen Rücken abgesehen gewesen.
Es verging eine Viertelstunde, ehe dies wogende Meer auseinander kam, ehe ein jeder einem jeden ein verbindliches Wort gesagt und seinen Platz gefunden hatte. Man sah meiner Mutter die Angst an; sie konnte doch aus Versehen einen Vornehmeren zu tief, einen Geringeren zu hoch placiert haben! Die Ordnung hier war kein leichtes Geschäft, da nicht allein Rang und Reichtum an sich, sondern die verschiedene Abstammung zur Sprache kam. Ein deutscher und ein französischer Rat, von einem Dienstalter, ein deutscher und ein französischer Kaufmann, von gleichem Vermögen, wie sollten sie rangieren? Wie oft hatte meine Mutter den Vorwurf der Verwandten des Vaters gehört: sie begünstige ihre Kolonie, wie deutlich hatten dagegen die näheren Blutsfreunde es ihr zu verstehen gegeben: sie halte nicht genug Familienehre, sie sei zu nachgiebig gegen die Anmaßungen der Sippschaft ihres Mannes.
Man reichte die Schokolade herum. Die grauen Augen des Paten flogen schielend über den weiten Kreis, und der große Mund blieb in einem immerwährenden leisen Lächeln. Er schien der heimliche Dirigent oder gar der Autor des traurigen Schauspiels zu sein; wenigstens merkte man ihm an, daß er im voraus wußte, was kommen sollte. Sein unansehnlicher, fast schmutziger Anzug paßte aber wenig für eine so glänzende Versammlung.
Unfern von ihm stand der Onkel Rat, gewiß der erste Stern in der Familie, obschon er noch keinen auf der Brust trug. Sein Haar war am feinsten frisiert, seine Schnallen waren die blanksten, sein Anzug der polierteste, gewiß war es auch seine Rede. Auf dem Degengriff ruhte seine linke Hand und auf seinen Lippen ein wohlgefälliges Lächeln. In seiner Milde und Behutsamkeit war der Onkel Rat der Gegensatz zu meinem strengen, herb auffahrenden Vater. Sein Bruder, der Geistliche, war ein bejahrter Witwer und sonst ein stiller Mann. Er trug eine rötliche, glatte Perücke und begrub sich den ganzen Tag in sein Studierzimmer, dessen vier Wände mit allen Ausgaben des Horaz sich füllten; das ist ziemlich alles, was ich von ihm wußte und weiß.
Aber der eigentliche Glanz unserer Familie strahlte vom Kanapee aus. Dort saßen drei Frauen, und das war ein Anblick, der auch jedem Fremden Ehrfurcht gebot. Die an den beiden Ecken hatte die Natur mit junonischer Schönheit bis ins Groteske ausgestattet; die mittlere, älter an Jahren, konnte kaum, vermöge ihrer hohen Frisur und den Federn auf derselben, mit den beiden Riesinnen Reih und Glied halten. Es war hier eine schwierige Vereinigung zwischen dem Stolz der Deutschen und der Kolonialverwandten zustande gekommen. Die mittlere Dame war nämlich die Tante Rätin, welche noch viel besser als ihr Gatte wußte, was es zu bedeuten hat, königlicher Rat zu sein.
Die beiden anderen Damen hatte ein besonderes Glück in die deutsche Familie meines Vaters versetzt. Ich konnte aber dem Himmel für diese besondere Gunst nie so dankbar sein, wie mein Vater es verlangte. Der Wechsler und Bankhalter Splittegarb hatte nämlich zwei einzige Töchter, die, was die Größe anlangte, seinem angefüllten Geldkasten nichts nachgaben. Von ihrer zwiefachen Höhe hatten sie die Schar der kleinen Freier mit hochmütigem Blick übersehen, ohne unter ihnen einen Gegenstand bemerkenswert zu finden. Auch der Vater, einer der reichsten Männer der brandenburgischen Hauptstadt, der viel auf Gleichheit hielt, fand unter allen Bewerbern in der Nähe keinen würdigen Eidam, der in die andere Waagschale so viel werfen könnte, wie er seinerseits hineintat. Er hatte aber nach Wien und Amsterdam geschrieben und vertröstete seine Töchter. Da wollte das launenhafte Glück, daß der König bei einer Bärenhetze beide jungen Damen sah. Er hatte schon viel von ihrer Größe gehört, fand aber seine Erwartung noch übertroffen, und ein Gedanke stieg in ihm auf, der sich noch am selbigen Abend zu einem festen Entschluß gestaltete. Er wollte ihr Glück machen und des Kaufmanns beide große Töchter mit den beiden Flügelleuten der Garde verheiraten. Aus seiner Schatulle selbst wollte er eine bedeutende Aussteuer geben, denn aus einer solchen Ehe konnten doch füglicherweise nur wiederum große Männer und Frauen für das Land hervorgehen! Herr Splittegarb liebte zwar auch die Gleichheit, hatte aber andere Begriffe als der König von den gleichen Ehen. Sein wohlfundiertes Handelshaus schien ihm keine Stützen oder Säulen an den beiden baumhohen Grenadieren zu gewinnen, Noch weniger freuten sich seine Töchter auf die Männer mit Musketen. Ein Widerspruch gegen den ausgesprochenen höchsten Willen lag für den Hofwechsler außer Frage; das leuchtete allen Teilen gleich ein. Es mußte daher eine vermittelnde Auskunft gesucht werden. Die verschriebenen Bräutigams aus Wien und Amsterdam wären selbst auf Fausts Zaubermantel nicht schnell genug eingetroffen, in der Stadt selbst aber waren keine tauglichen Bewerber in der Eile aufzutreiben.
Nun traf es sich, daß zwei Vettern meines Vaters als bescheidene Kommis im Kontor des Herrn Splittegarb gerade noch arbeiteten, als der Wächter schon die zehnte Stunde ausrief. Sie waren nur an hohen Festtagen zur Tafel ihres Prinzipals gezogen worden und mit den Töchtern des Hauses in keine andere Berührung gekommen, als daß sie ihnen beim Einsteigen in den Wagen den Kutschenschlag hielten. Man denke sich daher ihre Verwunderung, als beide, »wie sie da wären«, in des Prinzipals Wohnstube zitiert wurden. Hier fragte man sie, ob sie geneigt seien, Herz und Hand den Töchtern ihres Herrn zu überlassen. Da eine verneinende Antwort nicht wohl denkbar war, stand der Notar schon bereit, die Verlobungsringe lagen auf dem Tisch, die Protokolle waren bald in Richtigkeit, und die Damen schrieben in schlecht verhehltem Zorn ihre Namen darunter. Da nun soll es sich begeben haben, behauptet der böse Leumund, daß eine Verwechslung vorfiel. Jungfrau A verlobte sich durch ihre Schrift dem Kommis und Vetter B, da doch vorher bestimmt war, daß sie den Vetter A heiraten solle, und Jungfrau B, dem B bestimmt, jenen A. Der Notar wollte, als dies beim Vorlesen bemerkt wurde, den Bogen zerreißen, die Erbinnen erklärten aber, das sei im Grunde gleichgültig, sie hätten nicht Lust, zweimal zu unterschreiben, es müßte nun schon dabei bleiben, und meine Vettern waren noch allzu verblüfft von dem Glück und viel zu demütig, um etwas dagegen einzuwenden. So bekam jeder meiner Vettern erstens eine reiche Frau, er wußte nicht wie, und zweitens statt der bestimmten eine andere. Am ändern Morgen um sieben Uhr schon – es war im Winter – saßen die Neuverlobten in zwei Kutschen und gaben ihre Karten in der Stadt ab. Um neun Uhr erhielt Herr Splittegarb die Aufforderung, vor dem König zu erscheinen. Er war außer sich vor Zerknirschung, als er das Anerbieten des Monarchen vernahm, sprach vom gerührten Vaterherzen, das ihm nicht länger erlaubt, den Tränen seiner geliebten Töchter zu widerstehen, von der aufopfernden Liebe der beiden Jünglinge, erbot sich aber, wenn Seine Majestät es gutheiße, das kaum geknüpfte Band wieder zu zerreißen. Der Monarch war ärgerlich, aber eine Verlobung, als Vorbereitung zu einem Sakrament, ihm eine viel zu ernste Sache, um dies zuzugeben. Auf diese Weise hatten unsere Vettern die reichsten Erbinnen von Berlin gewonnen, und das Glück war mit einem Male, wir wußten nicht wie, in unserer Familie!
Wenigstens hieß es so. In den engeren Familienkreisen unserer Vettern befand es sich nicht jederzeit. Außerhalb des Hauses zog man freilich von nun an vor ihnen als vor reichen Leuten tief die Hüte, im Hause waren sie aber nicht mehr als vorher, das heißt die gehorsamen Diener ihrer Prinzipalstöchter. Sie mußten, wenn sie in die Wohnzimmer ihrer Frauen treten wollten, sich melden lassen, sie wurden zum Essen gerufen und mußten Fächer und Tücher halten.
Der Vater sah ruhiger aus, als ich es mir vorgestellt. Die Hände auf dem Rücken, stand er nicht weit von mir, und ich behorchte manches von dem, was er mit dem Oheim Rat im Vertrauen sprach, während die Schokoladebecher noch klapperten und die Mitteilungen der Gevatterinnen und Nachbarinnen in ein dumpfes Gesumme ausliefen.
»Bis zwölf ist es abgetan«, bemerkte der Vater. »Wir warten nur auf den Inspektor von Joachimsthal.«
»Die Herren werden heut’ auch zu tun haben«, sagte der Oheim.
»Warum verschoben wir es nicht wenigstens? Daß gerade an einem so wichtigen Tage die Familie zusammenkommen mußte.«
»Für mich ist ein Tag so wichtig wie der andere, wenn ich meine Pflicht tue«, rief der Vater. »Selbst die neue Majestät soll mich darin nicht hindern. – Ist sie schon aus Rheinsberg eingetroffen?«
»Gewiß, gewiß.«
»Die Herren denken vielleicht schon daran, daß eine neue Zeit kommt«, hub mein Vater nach einer Pause an. »Nun, das ist etwas früh, der alte Herr hat sich kaum schlafen gelegt; man sollte meinen, schicklichkeitshalber sollten sie doch traurig scheinen, bis er in der Gruft liegt. Aber das wird unserer Jugend zu lang. Hübsch schnell abgeworfen die alte, strenge Zucht, die Aufsicht ist fort. Ja, wir werden andere Zeiten bekommen, Herr Schwager. Die deutschen Männer aus der guten Zeit von ehemals können immer ihr Plätzchen hinterm Ofen bestellen. Der alte Dessauer soll gestern schon sehr bedenklich den Kopf geschüttelt haben. Für den wird auch keine Ehre mehr abfallen. Die bleibt den modischen Ausländern!«
»Es weiß ja noch niemand, was kommen wird«, sagte der Rat.
»Ich meine, wir können es raten. Unser magerer Sandboden, denk’ ich, wird jetzt fett werden von Unrat. Die nichts zu beißen und zu brechen haben auswärts, werden zu uns laufen, wenn sie nur Verse machen können und einen Witz reißen über die Ehrbarkeit. Es wird ein sauberes Gesindel ins Land kommen. Berlin wird ein Magnet werden für alle schlechte Sippschaft. Alfanze und Tanzmeister kommen in den Geheimen Rat, der brave deutsche Mann wird sich nicht tief genug bücken können und doch nichts abkriegen als Spott. Man wird einen Verdienstorden stiften für ungehorsame Söhne. Die Zucht-und Arbeitshäuser werden sich füllen, wenn man’s noch der Mühe wert hält, für sie was auszugeben. Die schöne Armee, die das Königreich bei den Potentaten in Respekt hielt, sehe ich schon entlassen, denn für die Soldatenzucht soll der junge Herr so wenig Sinn haben wie für Kirchenzucht und Ordnung. Die Akademie wird ins königliche Schloß logiert. Im Staatsrat wird man wohl Konzerte geben. Der Tag wird Nacht und die Nacht zum Tage von den lustigen feinen Gesellschaften. Ein ehrbarer Mann wird nicht mehr am Schloßplatz wohnen können, und der Große Kurfürst auf der Brücke kann sich nur umkehren, weil er nicht mehr aufs Schloß wird sehen wollen. Ja, Herr Schwager, das sehe ich kommen: König Fridericus der Erste, gottseligen Andenkens, hat das Königreich Preußen gestiftet, und unter Fridericus dem Andern wird es in Schimpf und Schande untergehen.«
»Herr Schwager sind in einer irritierten Stimmung«, sagte der Rat, während seine Augen mit dem Ausdruck inneren Entsetzens umherforschten, wer die Blasphemie mit angehört haben könne.– »Sollten doch bedenken«, setzte er hinzu, »mit wem man sich unterhält; auch bedenken, daß der Kronprinz in letzten Tagen in löblichem Vernehmen mit der Majestät ihres höchstseligen Herrn Vaters standen.«