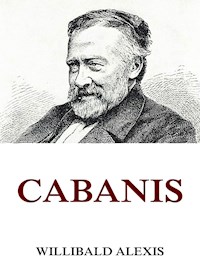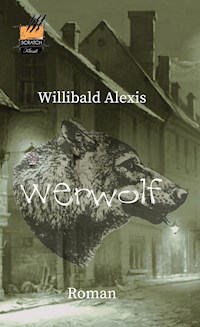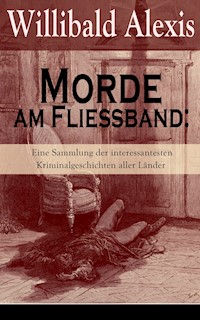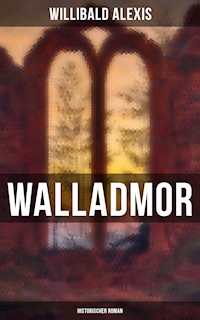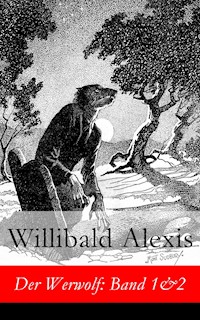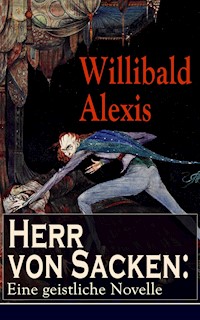Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Willibald Alexis' historischem Roman 'Die Hosen des Herrn von Bredow' taucht der Leser ein in das preußische Leben des 18. Jahrhunderts. Der Autor beschreibt detailreich die gesellschaftlichen Strukturen, politischen Intrigen und persönlichen Dramen, die das Leben des adeligen Hauptmanns von Bredow prägen. Alexis' literarischer Stil ist geprägt von einer präzisen Sprache und lebendigen Beschreibungen, die die Leser in die Welt des 18. Jahrhunderts eintauchen lassen. Der historische Roman ist nicht nur eine spannende Erzählung, sondern auch ein historisch akkurates Porträt der preußischen Gesellschaft seiner Zeit. Willibald Alexis, ein deutscher Schriftsteller und Historiker, wurde von seiner eigenen Leidenschaft für die preußische Geschichte inspiriert, als er 'Die Hosen des Herrn von Bredow' schrieb. Seine gründlichen Recherchen und sein umfassendes Wissen über die Zeitperiode machen das Buch zu einem faszinierenden Werk historischer Fiktion. Alexis' Liebe zum Detail und seine meisterhafte Erzählkunst machen den Roman zu einem unvergesslichen Leseerlebnis für Historienfans und Literaturliebhaber gleichermaßen. 'Die Hosen des Herrn von Bredow' ist ein Muss für alle, die historische Romane und fesselnde Geschichten lieben. Mit seiner packenden Handlung, seinen authentischen Charakteren und seinem faszinierenden Einblick in das preußische Leben des 18. Jahrhunderts überzeugt das Buch sowohl durch seine literarische Qualität als auch durch seinen historischen Wert. Willibald Alexis' Werk ist ein Meisterstück historischer Fiktion, das den Leser in eine vergangene Epoche entführt und dabei zeitlose Themen von Macht, Liebe und Verrat erforscht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Hosen des Herrn von Bredow: Historischer Roman
Erster Teil
Erstes Kapitel
Die Herbstwäsche
Wenn du aus einem langen, bangen Kiefernwalde kommst, der von oben aussieht wie ein schwarzer Fleck Nacht, welchen die Sonne auf der Erde zu beleuchten vergessen, und nun fangen sich die hohen Bäume zu lichten an, die schlanken, braunen Stämme werden vom Abendrot angesprenkelt, und die krausen Wipfel regen sanft ihre Nadeln in den freier spielenden Lüften, da wird dir wohl zumut ums Herz. Das Freie, was du vor dir siehst, sind nicht Rebengelände und plätschernde Bäche aus fernen, blauen Bergen über ein Steinbett schäumend, ‘s ist nur ein Elsenbruch, vielleicht nur ein braunes Heidefeld, und darüber ziehen sich Sandhügel hinauf, in denen der Wind herrscht, das magere Grün, das von unten schüchtern heraufschleicht, anheulend, wie ein neidischer Hund, der über seine nackten Knochen noch murrend Wache hält. Eine Birke klammert sich einsam an die Sandabhänge, ein Storch schreitet vorsichtig über das Moor, und der Habicht kreist über den Büschen. Aber es ist hell da, du atmest auf, wenn der lange, gewundene Pfad durch die Kiefernnacht hinter dir liegt, wenn das feuchte Grün dich anhaucht, das Schilf am Fließe rauscht, die Käfer schwirren, die Bachstelzen hüpfen, die Frösche ihren Chor anheben und dein Auge dem Luftzug folgt, der leis über die Heidekräuter streift.
Es ist der stille Zauber der Natur, die auch die Einöden belebt, und ihr Auge ist auch hier, denn dort hinter dem schwarzen, starren Nadelwald liegt ein weiter, stiller, klarer See. Er hüllt sich ein, wie ein verschämtes Weib, in seine dunkelgrünen Ufer und möchte sie noch fester um sich ziehen, daß kein unberufener Lauscherblick eindringt. Er spiegelt sie wider in seinem dunkeln Wasser, mit ihrem Rauschen, mit ihrem Flüstern. Aber das dunkle Wasser wird plötzlich klar, wenn die Wolken vorüberziehn, ein Silberblick leuchtet auf; der blaue Himmel schaut dich an, der Mond badet sich, die Sterne funkeln. Dort ergießt der volle See sein Übermaß in ein Fließ, das vom Waldrande fort durch die Ebene sich krümmt. Hier bespült es Elsenbüsche, die es überschatten und gierig seine Wellen ausschlürfen möchten, sickert über in nasse Wiesen und wühlt sich dort im Sande ein festeres Kiesbett, um Hügel sich windend, an Steinblöcken vorübersprudelnd und durstige Weiden tränkend. Die vereinzelten Kiefern, Vorposten des Waldes, wettergepeitscht, trotzig in ihrer verkrüppelten, markigen Gestalt, blicken umsonst verlangend nach den kühlen Wellen; nur ihre Riesenwurzeln wühlen sich unter dem Sande nach dem Ufer, um verstohlen einen Trunk zu schlürfen.
Wer heut von den ferneren Hügeln auf dieses Waldeck gesehen, hätte es nicht still und einsam gefunden. Zuerst hätte ein weißer, wallender Glanz das Auge getroffen, dann ringelten Rauchwirbel empor, und um die schwelenden Feuer bewegten sich Gestalten. Schnee war das Weiße nicht, denn die Bäume röteten sich zwar schon herbstlich, aber sie schüttelten noch sparsam ihre welken Blätter ab, und die Wiesen prangten noch in kräftigem Grün. Schnee war es nicht, denn es blieb nicht liegen; es flatterte und rauschte auf, hellen Lichtglanz werfend und dann wieder verschwindend. Schwäne waren es auch nicht, die aufflattern wollen und die Flügel wieder sinken lassen. Das hätten Riesenvögel sein müssen, deren es im Havellande und der Zauche nie gegeben hat. Auch Segel nicht, die der Wind aufbläht und wieder niederschlägt; denn auf dem Fließe trieben nur kleine Nachen. Auch Zelte nicht, denn es bewegte sich hin und her, und wer näher kam, sah deutlich zwischen den Feuern Hütten aufgerichtet, zierliche von Stroh und rohere von Kieferngebüsch.
Eine Lagerung war es, aber der einsame Reisende brauchte sich nicht vor Raubgesellen zu fürchten; die paar Spieße, die in der Nachmittagssonne glänzten, standen friedlich an die Hüttenpfosten oder Bäume gelehnt. Räuber lachen und singen nicht so heitere Weisen, und die Lüderitze lagerten, wenn sie ausritten, auch nicht in entlegenen Winkeln, zwischen Heide und Moor, wo Kaufleute nicht des Weges ziehen. Ja, wär’s zur Nachtzeit gewesen, der Ort war verrufen, auf unheimliche Weiber hättest du schließen können, die ihre Tränke brauen, wo keiner es sieht. Aber es war noch ein heller Nachmittag, und ebenso hell schallte bisweilen ein frohes Gelächter herüber, untermischt mit anderm seltsamen Geräusch, wie Klatschen und Klopfen. Kurz es war ein Lager allerdings, aber nicht von Kriegsknechten oder Wegelagerern, nicht von Kaufleuten oder Zigeunern, welche die Einsamkeit suchen; es war ein Feldlager, wo mehr Weiber als Männer waren, und das Feldlager war eine große Wäsche.
Von den Sandhöhen nach Mitternacht, deren nackte Spitzen über das Heidegestrüpp vorblickten, konnte man es deutlich sehen. In einem Sattel dieser Sandhügel stand nämlich ein bepackter Karren. Sein Eigentümer, der Krämer, hatte ihn hier untergebracht außer dem Wege, damit kein Späheraug Gäule noch Wagen entdeckte, bevor er sich versichert, was da unten vorging. Selbst war er geräuschlos, vorsichtig, auf eine Kiefer geklettert, um auszuschauen, und sein ängstliches Gesicht heiterte sich auf. Denn was er sah, hatte nicht allein gar keinen Anschein von Gefahr, sondern sogar für ihn etwas Lockendes. Der weiße, wallende Glanz kam von den an Seilen trocknenden Leinwandstücken her, die der Wind dann und wann hoch aufblähte. Andere größere Stücke lagen zur Bleiche weithin verstreut am Fließ, an den Hügelrändern bis in den Wald hinein. Überall war Ordnung und das wartende Auge der Hausfrau sichtbar. Jeder, Mägde, Knechte, Töchter, Verwandte und Freunde, bis auf die Hunde hinab, schien sein besonderes Geschäft zu haben. Die begossen mit Kannen, die schöpften aus dem Fließ, die trugen das Wasser. Jene nestelten an den Stricken, welche zwischen den Kieferstämmen angespannt waren; sie prüften die Klammern, sie sorgten, daß die nassen Stücke sich nicht überschlugen. Dort hingen gewaltige Kessel über ausgebrannten Feuerstellen, und daneben standen Tonnen und Fässer. Aber diese Arbeit schien vorüber; nur auf den einzelnen Waschbänken, die in das schilfige Ufer des Fließes hineingebaut waren, spülten noch die Mägde mit hochaufgeschürzten Röcken und zurückgekrempelten Ärmeln. Es war die feinere Arbeit, die man bis auf die Letzt gelassen, die jede für sich mit besonderer Emsigkeit betrieb. Da gab es mancherlei Neckereien zwischen dem Schilf. Wollte aber ein Mann in die Nähe dringen, ward er unbarmherzig bepritzt. Ja, einem Herrn im geistlichen Habit, der Miene machte, sich durch das Schilf zu schleichen, ward von einer der losen Dirnen ein ganzer Eimer gegen den Kopf gegossen. Ein Glück, daß er beizeiten ausbog, und mit ein paar Tropfen aufs Gesicht kam er davon, und die Dirne mit einem drohenden Finger. Den andern legte der geistliche Herr schnell auf den Mund, mit einem bedeutungsvollen Blicke, denn er sah die gebietende Hausfrau herankommen.
»Ach, meine gnädige Frau von Bredow auf Hohen-Ziatz!« mit den Worten und einem frohen Atemzuge ließ sich der Krämer schneller, als er hinaufgeklettert, von seinem Baume herab. Darauf ging er an sein Geschirr, putzte die Pferde und schirrte sie an zum Aufbruch. »Die hält ihre große Herbstwäsche ab; hätte ich das früher gewußt, es hätte was zu verdienen gegeben. Aber ‘s ist ja noch nicht zu Ende, und fällt wohl noch zuletzt was ab.« Er brachte die Hand an die Stirn, und ehe er in den Weg einlenkte, lüftete er die Wagendecke, schnürte und schnallte und packte Unterschiedliches um. Einiges versteckte er, und andere Packen legte er obenauf, wie es ein guter Kaufmann tun muß, der seine Kunden kennt und weiß, was ihnen ins Auge sticht und was ihnen mißbehagt.
Die große Herbstwäsche war’s der Frau von Bredow auf Hohen-Ziatz. »Der Winter ist ein weißer Mann«, sagte sie. »Wenn er ans Tor klopft, muß das Haus auch weiß und rein sein, daß der Wirt den Gast mit Ehren empfangen mag.«
Ihr Gast, der Dechant, hatte zwar gesagt: »Der Winter ist ein ungebetener Gast, den stellt man hinter die Tür«; aber die Edelfrau hatte erwidert: »Das mag vor alters gepaßt haben, ehrwürdiger Herr, als es noch keine geistlichen Herren gab. Itzund wissen drei ungebetene Gäste in jedwed Haus zu dringen; wie man’s auch zuschließt, sie finden immer eine Ritze: der Winter, die Wanzen und die Pfaffen.«
Der Dechant hatte dazu gelacht; hatte doch die Edelfrau beim großen Kehraus in der Burg auch sein Bündel mit auf die Wagen werfen lassen, was ihn der Mühe überhob, daß er’s nach Brandenburg mitnahm, wenn er mit dem einen ungebetenen Gaste, dem Winter, in seine warme Klause zurückkehrte.
Eine Herbstwäsche war im Schloß Hohen-Ziatz eine Verrichtung. Eine große Arbeit war es, wo die Knochen sich rühren mußten, aber ein Fest auch. Die Hausfrau meinte, alle tüchtige Arbeit sei immer ein Fest, und wir meinen’s auch. Wie hatte sie das alte Haus aus-und umgekehrt; auf Hühnerleitern war sie selbst gestiegen, denn darin traute sie keinem andern Aug, in alle Kammern und Winkel, daß jedes Wollen-und Linnenstück, bis zum geringsten hinab, ein Sonntagsgesicht anlegen sollte. Drei Austwagen waren gepackt worden, und nachdem sie zugeschnürt mit Stricken und saubere Bastmatten darübergelegt, hatte sich die Edelfrau selbst auf den vordersten gesetzt. Das war ein Auszug aus der Burg. Die drei Austwagen voran, die Mägde und Töchter der gnädigen Frau auf den zwei andern. Der Junker Hans Jochem wollte eine Leiter ansetzen, daß Evchen und Agnes leichter hinaufkämen. Frau Brigitte hatte es aber nicht gelitten; wie ein Ritter aufs Pferd müsse zur Not sonder Steigbügel und Prallstein, so sei eine große Wäsche der Dirnen ihr Ehren-und Schlachttag; müßten sich selbst zu helfen wissen, sonst wäre es nichts mit ihnen. Und ehe Hans Jochem zuspringen konnte, waren Evchen und Agnes auf den großen Zeugwagen hinauf und lachten den Junker von oben aus.
Drei Austwagen vorauf, der vorderste von zwei Knechten mit Pickelhauben und Spießen geführt, dazu ein Hornbläser, um den eine Koppel Hunde klaffte. Dahinter noch andere Wagen mit Bottichen, Kesseln, Stroh, Bänken, Decken, Fässern, Körben und was zur Lebensnotdurft diente, vollauf. Die Frau sprach lächelnd zu denen, die sich drob wunderten: »Du sollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden.« Und hintenan und zur Seiten Reiter und Fußgänger mit Jagdspießen, Armbrüsten; ja einer trug sogar einen schweren Muskedonner.
So zogen sie über die krachende Zugbrücke unter Musik und Gelächter, und der Türmer blies ihnen noch eine Weise nach, bis sie im Walde verschwunden waren. Daß sie Hunde und Spieße und gar ein Feuergewehr mitnahmen und bald ein Dutzend rüstiger Männer bei einem Geschäft waren, das anderwärts nur die Frauen angeht, darüber wird niemand sich wundern, der weiß, wie es zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts in der Mark Brandenburg aussah. Wer außer den Mauern einer Burg oder Stadt war, und er trug nicht den Bettlermantel um die nackten Schultern, tat recht, wenn er den Leib umgürtete, auch wenn der Stahl dann etwas zu lang hinter dem Manne klirrte. Denn zu jeder guten Verrichtung gehört, daß der sie verrichtet, in Sicherheit schaffe. Aber daß auch dieser und jener von der Sippschaft, des Hände zu fein waren, um die Seile zu spannen oder die Laken aufzuhängen, ja daß sogar ein geistlicher Herr mitzog, könnte verwundern, wenn wir nicht eben wüßten, was es mit einer großen Herbstwäsche dazumal im Edelhofe von Hohen-Ziatz für Bewandtnis hatte.
Die Räume zwischen den Lehmwänden und Steinmauern waren viel zu eng für eine solche Verrichtung. Wo sollte das fließende Wasser herkommen, wo die freie Luft zum Trocknen und wo der Rasen zum Bleichen? Unsere Vorväter liebten die festlichen Zusammenkünfte im Freien, und wie es vor alters gewesen, mußte es in Hohen-Ziatz noch heute sein. Da zog denn mit, wem’s in den Mauern zu beklommen war, wer Scherz liebte und Spiel und Jagd und Neckerei; denn etwas davon fiel immer ab. Aber auch Gottesfurcht mußte dabei sein, meinte der Dechant und die Edelfrau auch, nur daß jeder etwas anderes dabei meinte.
Außerdem war es der Hausfrau auch vielleicht nicht unangenehm, einmal unumschränkte Herrin zu sein; denn war sie es zwar, wie der böse Leumund sagte, auch im Schlosse, so war sie es doch nur durch Klugheit und Kunst, hier nach alten Rechten; denn wer in aller Welt will einer Frau die unumschränkte Herrschaft bei der Wäsche abstreiten, wenn schon kein Gesetz sagt, daß es so sein soll. Und welche Herrin sie war! Sie trug keinen Federbusch und keine Schürze, aber jeder Fremde fand sie auf hundert Schritt heraus. Das war ein Blick, eine Falke sieht nicht schärfer. Wenn sie auf einer Anhöhe stand, den linken Arm nachlässig in die Seite gestemmt, die Rechte, die sonst mit dem Schlüsselbunde spielte, ruhig niederhängend, die Füße ein wenig auseinander und Schuhe darunter, die den Boden um einen halben Zoll eindrückten, und ihr Hals lugte aus dem Mieder, der wie ein Panzer saß, da sah die Frau von Bredow doch wie ein Feldherr aus, der sein Heer musterte, und die Mägde sprachen: »Unsere Gestrenge die versteht’s.«
Das sagten sie auch, nur in einem anderen Ton, wenn sie faul oder nachlässig gewesen oder etwas so getan, wie die Frau von Bredow meinte, daß es nicht geschehen müsse. Stand sie zwar, wie wir sahen, fest auf dem Boden, wenn sie sah, daß alles in Schick war, so war sie doch wie das Wetter herunter, wo etwas außer Schick kam. Lang reden und zurechtweisen liebte sie nicht, und wo sie meinte, daß einer schwer hörte, da hielt sie auch die paar Worte noch für zuviel. Noch wußte der verdrossene Knecht nicht eigentlich, wie es gekommen, aber jetzt hörte er vortrefflich und verstand alles, und rieb nur ein klein wenig über das Ohr oder die Schulter. Eine so rührige Frau war die Frau von Bredow. Loben tat sie nicht viel, sie hielt’s vom Überfluß, denn das jeder täte, als er muß tun, hielt sie für Lohns genug; aber wem sie mal auf die Schulter klopfte, wenn sie durch die Reihen ging, dem war es wie ein Tropfen starken Weines, der nach langer Mattigkeit und Bangigkeit durch die Adern rinnt und die Glieder wieder stärkt.
So war es mit der Hauswäsche am Lieper Fließ bestellt. Eine gute Stunde abwärts von der Burg war das Lager, und ein dichter Wald und ein tiefer, weiter Morast lagen dazwischen; also mußte im Lager nicht allein gewaschen und gebleicht, auch gekocht und gebettet und gewacht werden, alle Verrichtungen, wie es in einer Stadt Art und Sitte ist. Das Gebet verrichtete morgens der Dechant für alle, wenn die Schelle über der Hütte der Edelfrau läutete; das Waschen und Kochen geschah einen Tag wie den anderen, das Singen und Spielen machte sich von selbst, und für das Wachen sorgte die Frau von Bredow. Kein Zigeunerbub hätte einen Strumpf von der Leine, kein Fuchs aus dem Korbe ein Huhn stehlen dürfen.
Eine Woche weniger denn einen Tag dauerte schon die Wäsche. Vor dem Klopfen und Klatschen waren die Fische aus dem Fließ auf eine Meile entflohen. Von den hohen Kiefernstämmen, wo sie nisten, hatten zu Anfang die Fischreiher mit ihren langen gelben Schnäbeln neugierig herabgeschaut. Da gab es Jagd und Kurzweil für die jungen Burschen.
Vor den Bolzen und Pfeilen, die durch ihre luftigen Burgen sausten, hielten die zähen Tiere aus; selbst wenn der Pfeil einem den Flügel durchbohrt, wenn sein Herzblut hinabträufte, er gab in banger Todesangst nicht nach, er krallte sich an dem Ast fest, bis die Bolzen wie der Hagel kamen und endlich Holz, Leib und Gefieder miteinander hinabstäubten und splitterten. Aber des Lärmens war ihnen doch zuviel geworden. Wie viele Hunderte auch am ersten Tag über den Wipfeln gekreist, mit ängstlichem Geschrei fortflatternd und wiederkommend, ob der Wirrwarr unten kein Ende nähme; das Klopfen und Hämmern, das Spritzen und Wringen, das Klatschen und Schwenken, das Singen und Lachen hielten sie nicht aus, und am dritten Tag hatten die Tiere den Menschen Platz gemacht, und die Luft war still. Auch die Frösche auf der Wiese schwiegen am Tage; nur wenn abends die Feuer ausgingen und der Gesang verstummte, wenn die hölzernen Klöpfel ruhten und das Wasser im Fließ still fortrann, sich erholend von der Arbeit des Tages, dann mischte sich ihr dumpfes Geächze mit dem Schnarchen der Mägde, mit dem Geheul der Rüden, die den aufgehenden Mond anbellten, und dem Winde, der gegen die Wäsche an den Seilen schlug und die Kiefernstämme, daran sie gebunden waren, knarren machte.
Nun am sechsten Tag, es war der Samstag, war die Arbeit zumeist getan, und ehe denn die Abendmette von den fernen Klostertürmen von Lehnin über die Wälder klänge, sollte aufgepackt werden. Die Morgensonne am Tag des Herrn sollte keinen Strumpf mehr an den Leinen anröten und die erste Mondsichel schon einen wüsten Lagerplatz bescheinen. Wie eifrig waren die Mägde, die Klammern abzustecken, die Körbe zu häufen und die Bleichstücke zu wenden; was hasteten sich die Knechte, die Stricke von den Bäumen zu lösen und zusammenzurollen, und schon rüttelten sie an den Pfosten der Hütten, um zu prüfen, wie fest sie noch säßen. Auch das Zeichen zum Aufbruch erscheint als ein Fest dem, der zu lange beim Feste saß; ist doch jede Veränderung dem Menschen willkommen, wann er des Genusses überdrüssig wird.
Die Edelfrau sah zufrieden auf das Werk hin und wie zu ihren Füßen die Haufen immer größer wurden, reine, saubere Tücher, auf welche die Nachmittagssonne mit milder Wärme schien.
»Ich glaube, in der ganzen Zauche gerät in keinem Edelhofe die Wäsche wie bei meiner Frau von Bredow, wie pur weiß das ist!« sagte der Dechant, der sich vom Feldtisch erhob, wo er mit einem Edelmann aus zinnernen Bechern gewürfelt hatte.
»Die Hexen hier bleichen’s«, sprach der Junker, der sich auch erhob, ein Mann in mittleren Jahren, der aber etwas älter aussah, als er sein mochte. Sein blonder Bart spielte ins Rötliche, seine krausen Haare ins Graue über; das Gesicht war nicht grob, aber auch nicht fein, die Züge schlaff, aber aus den hellblauen, matten Augen schielte zuweilen ein lauernder Blick. »Die Hexen hier bleichen’s«, sagte er, »der Ort ist verwünscht. Das weiß jedes Kind. Muß einer den Mut haben wie meine Base, daß sie’s mit den Unholden aufnimmt.«
»Hat’s Euch in den Nächten aufgelesen, Vetter Peter Melchior?«
»Ich trug mein Amulett. Aber an solchem Platz waschen lassen! Es haben’s Leute gesehen, wenn auch diesmal nicht, doch vor Jahren, nächtig, wenn sie aufwachten. Zwei graue hagere Weiber mit langen Spinnebeinen schritten übers Zeug mit Gießkannen, und draus kamen pure Strahlen Mondenschein. Davon kann das Zeug wohl weiß werden, aber –«
»Aber Peter Melchior, Ihr wißt ja, daß der ehrwürdige Herr alle Morgen seinen Segen darüber spricht.«
»Wird die Wäsche etwa davon weiß! Der Dechant spricht gewiß auch seinen Segen über die Würfel, wenn er doppelt, und der heckt, denn er trägt ihn jedesmal blank in der Tasche fort, aber die Würfel werden immer brauner.«
»Der Segen des Herrn schafft das Beste in allen Dingen«, fiel der Dechant ein und wollte, wie er zu tun pflegte, die Hände vor dem wohlgerundeten Bauche falten, aber es traf ihn einer der feinen, schlauen Blicke der Edelfrau, welche bisweilen auf die, welche sie trafen, eine ähnliche Wirkung übte, als wenn ihre nicht so feinen Hände mit der Wange einer Magd in Berührung kamen. Sie lächelte und der Dechant lächelte auch, worüber er die fromme Bemerkung verschlucken mußte, zu der sein Mund sich schon gespitzt hatte.
»Wer sähe meiner Frau von Bredow den Schelmen an, der unterweilen aus ihrem Auge blitzt.«
»Ich meine, ein Schelm sieht den andern«, entgegnete sie, »und wenn man in manchem Haus aufräumen täte, fände man mancherlei darin, was nicht dahin gehört, z. B. in einem Priesterhaus die Weiberröcke.«
Der Dechant, welcher die Augen jetzt wirklich niederschlug, wollte von dem Gesetz anheben, welches zwar besage – aber die Edelfrau ließ ihn nicht zu Worte kommen. Wir wissen nicht, was gerade jetzt ihr die Laune zur Strafpredigt für den langjährigen Hausfreund eingab, der doch ihrer Wäsche so treulich beigestanden hatte.
»Das Gesetz sagt«, unterbrach sie ihn, »tue recht und scheue niemand, und wenn du schmutzig bist, wasche dich. Wasser fließt überall, und jeder hat Hände zum Reiben, aber er muß nicht reiben, wie Pilatus tat. Wer ein gut Gewissen hat, braucht nichts zu verstecken, aber wem was im Schrank tut hängen, da es nicht sein soll, der muß die Türe schnell zuschlagen, wenn einer ‘nein sieht. Blank gescheuert hat mancher; ja von außen, aber wie es drinnen aussieht, das kommt auch einmal an den Tag.«
»Nur zu, Muhme«, rief lachend der Junker Peter Melchior, »wascht ihn einmal recht, er schenkt’s uns auch nicht, wenn er auf der Kanzel steht.«
»Dem Tage, welchen unsere verehrte Wirtin meint, wird der Gerechte, wenn auch mit Bangen, doch mit Vertrauen entgegenblicken. «
»Na, hochwürdiger Herr!« hub die Frau von Bredow an und sah ihn recht scharf aus ihren großen Augen an. »Wenn an jenem Tage alle die Unterröcke, so in den Priesterschränken in die Winkel sich verkriechen, oben am Himmel hängen werden bei der großen Wäsche in Gottes Sonnenlicht, da möchte ich sehen, wie die Herren vom Klerus den Kopf aufrichten wollen. Da könnt ihr schwenken lassen alle eure Weihrauchkessel, daß den lieben Engelein die Augen tränen, ‘s ist zuviel. Da muß Petrus die Hände übern Kopf zusammenschlagen und rufen: Herrgott Vater, wenn wir das gewußt, daß sie auch das Kinderzeug mitbringen, ich hätte ihnen ja das Himmelstor nicht aufgeschlossen.«
»Und Sankt Petrus schloß es dennoch auf, und das Unreine und Sündhafte fällt ab, wie der Tau von den Pflanzen, wenn Gottes Sonne strahlt. Das ist das Mysterium, die unerforschliche Weisheit und Gnade des Herrn, daß er in seiner großen Haushaltung, der Welt, wo alles in Ordnung ist, auch seine Geweihten in ihren menschlichen Schwächen bisweilen sündigen läßt, aber nur zu seinen unerforschlichen Zwecken. Ich mag sagen, es geschieht zuweilen, ihnen unbewußt, aber er weiß es und weiß warum. Und wenn dann ihr Herz bange schlägt vor der Sündenlast, die sie darauf wähnen, da mit einem Zauberschlag macht er die Brust frei. Das befleckte Kleid, dessen wir uns schämen, fällt wie Plunder vor seinem Hauche, und dieweil wir noch zittern vor dem Glanz, der uns umgibt, reicht er uns die Hand und spricht: Tretet ein, denn ihr seid rein.«
»Ohne Wäsche, Dechant?«
»Wer wäscht die Nebel fort am Herbstmorgen, wer das schmutzige Winterkleid der Erde, und der Frühling steht da vor dem Herrn in seinem reinen Blumenkleide, von würzigen Düften umsäuselt. Des Menschen Hand hat nichts dazu getan.«
»Dechant, ich meine, in jedem guten Haus ist Reinlichkeit die erste Tugend, und wer sich auf Erden nicht gewaschen hat, der kommt auch nicht rein in den Himmel. Wie’s in einem geistlichen Haus steht, das weiß ich nicht, dafür laß ich andere sorgen. Aber wenn ich zu sorgen hätte, wißt Ihr, was ich täte?«
»Nur zu, Base,«, rief der Junker, die Hände reibend, »steckt ihn in den Waschkessel.«
»Ach was, ihn allein! Das müßte ein Kessel sein wie der Müggelsee, und die ganze Klerisei hinein mit allen euren Salben und Öl, Äbte, Bischöfe, Klöster, Nonnen und Mönche. Und Lauge dazu, bitter salzige, und umrühren wollte ich –«
»Kochen, Base! Ein Feuer darunter, das der Gottseibeiuns heizen müßte, sonst werden sie nicht rein.«
»Das Wasser würde schwarz werden schon von euren kleinen Verstecksünden, von der Eitelkeit, der Hoffart, dem Fraß, der Gleisnerei und Spiel und Trunk. Aber Wasser ist genug in der Mark. Abgeschäumt, ich würfe euch in einen neuen See. Da sötte ich aus eure Fleischessünden, doch das ist noch nicht das Größte, eure Habsucht und Herrschsucht und wie ihr verredet und verlästert, und nun wieder umgerührt.«
»Base, das überlaßt dem Teufel«, fiel Peter Melchior ein. »Ihr hieltet den Geruch nicht aus. Laßt dem Gottseibeiuns, was ihm gehört, ihm ist’s ein Opferduft.«
Der Dechant hatte mit freundlicher Ruhe der Edelfrau zugehört, ohne auf die roheren Ausfälle des Ritters zu achten. »Auf diese Weise würden wir also rein werden vor den Menschen. Wenn wir aber so ausgebleicht vor dem Herrn erschienen, ob uns dann Petrus noch das Himmelstor öffnen würde? Ob er nicht vielmehr spräche: Ihr seid zwar rein vor den Menschen, aber die Gnade, die ich euch mitgab, ist auch ausgebleicht. Ich erkenne euch nicht mehr als die, welche ich aussandte. Vor mir waret ihr rein, auch in euren Flecken. Weil ihr euch von den Menschen nach deren Wohlgefallen waschen und putzen ließet, so kehret zu ihnen zurück. Mir gehört ihr nicht mehr an.«
»Da wäre vielleicht etwas dran«, entgegnete die Frau nach einigem Besinnen. »Aber ihr wißt auch dem Petrus ein X für ein U zu machen, denn das ist eure Hauptsünde, das Worteverdrehen. Aus Süß macht ihr Sauer und aus Sauer Süß, je wie’s euch frommt, und was euch frommt, das macht ihr zu Gottes Willen. Und was ihr uns zeigt, ist nicht, was ihr versteckt habt, und wenn ihr einen guten Zweck im Auge habt, nämlich was ihr so nennt, oh! da wißt ihr zu schwänzeln und mit den Augen zu zwinkern und mit der Zunge zu schlängeln, bis euch der Teufel auf den Buckel nimmt und hinträgt. Und das ist alles schön und gut, um der guten Absicht willen.«
Der Dechant wurde der Mühe zu antworten durch einen kleinen Aufstand überhoben, welchen die Ankunft des Krämers mit seinem Wagen im Lager veranlaßte. Ein Krämer, der seine Waren auf dem Lande ausbietet, war in jenen Tagen ein willkommener Gast. Wer nicht kaufen wollte oder konnte, freute sich doch am Anschauen der Herrlichkeiten, die ausgekramt, aufgestellt und angepriesen wurden. Der wandernde Krämer war zugleich der Neuigkeitsträger, die Zeitung des Landes. Er wußte auch seine Erzählung zu Gelde zu machen. Aber es bedurfte der Erlaubnis der gnädigen Frau, und sie erteilte sie nur nach einigem Zögern, denn sie meinte, daß die Kaufleute wie die Pfaffen mit ihren Waren die Leute anführten. Indessen ist es auch für einen so unumschränkten Regenten, als Frau von Bredow in ihrem Lager war, mißlich, gegen den allgemeinen Wunsch ihrer Untergebenen anzustreben; Evchen bat so dringend, Hans Jochem brauchte einen neuen Gurt zu seinem Degen und sie selbst blanke Knöpfe zu einem Etwas, von dem noch viel in unserer Geschichte die Rede sein wird.
Zweites Kapitel
Die Beichte
»Das funkelt ja wie Silber«, sprach der Dechant, indem er einen der Knöpfe gegen das Licht hielt. »Wie wird’s unsern Ritter freuen, wenn sie ihm so an der Seite blitzen.«
»Das wäre gar! Er darf nichts von wissen. Der Knecht soll sie stumpfreiben, daß sie wie die alten Bleiknöpfe aussehen. Die sind bei der Wäsche abgesprungen. Dann merkt er’s nicht.«
»Was merkt er nicht?«
»Daß es in der Wäsche war.«
»So weiß er davon nichts?«
»Gott bewahre! Als er ins Bett getragen ward und sich noch sträubte, streiften sie ihm die Büchsen ab. Da kam ich gerade zur rechten Zeit und schnappte sie weg. Wenn er ein bißchen Besinnung noch gehabt, hätte er sie in die Kissen gelegt unterm Kopf, wie er immer tut seit der fatalen Geschichte an der Mühle. Wie ein Ungewitter kam er mir doch da nachgeritten, als ob’s ein Unglück wäre, wenn die Elenshaut einen Tropfen Wasser kostete.«
»War es so nötig?«
»Nötig! Seit Kurfürst Johannes Cicero zur Freite ritt, da ließ meines Götz Frau Mutter selige sie zum letztenmal waschen.«
»Freilich, wenn das Leder schmutzig war!«
»Man konnte das Braun nicht vom Sattel unterscheiden.«
»Nun, der Junker ist ein gottesfürchtiger Ritter, und wenn es einmal geschehen ist und er sie wieder rein und wohl imstande sieht, wird er sich auch recht freuen.«
»Ehrwürdiger Herr, da kennt Ihr meinen Götz nicht. Manchmal ist er ein Brummbär, aber wenn’s ihm recht in die Quer kommt, kann er auch wolfstoll werden. Wie damals an der Mühle. Er hielt sie in der Hand gepreßt wie ‘nen Plumpsack; so ritt er zurück und schlug um sich. Meine Eva kriegte doch ‘ne Weffe um den Nacken. Acht Tage konnte man’s sehen.«
»Das liebe Kind! Warum denn die Eva?«
»Die hatte sie ihm ja weggestohlen, als er anfing zu druseln. Sie kitzelte ihn hinterm Bart, wie er’s so gern hat; derweil reichte mir’s der Schelm zum Fenster raus.«
»Die kleine Eva!« sagte der Dechant mit nachdenklichem Gesicht.
»Nein, ehrwürdiger Herr! er darf’s nimmermehr wissen; sonst gäb’s wieder eine solche Geschichte. Er schläft.«
»Noch! Seit sechs Tagen!«
»Lieber Gott, nach solchem Gelage! So kam er auch noch von keinem Landtage zurück. Ich denke immer, wozu sind denn die Landtage! Und wer muß das Schmausen und Saufen bezahlen? Das Land doch am Ende.«
»Aber vor drei Tagen hörte ich –«
»Da hat er sich ein bißchen geregt. Nach drei Tagen tut er’s immer. Dann gibt ihm der Kasper ‘ne Suppe, und dann dreht er sich wieder um und schläft noch ein paar Tage. Morgen wird er wohl aufwachen. ‘s ist alles in der Ordnung. Vetter Peter Melchior, wie lange saßen sie’s letztemal in Berlin?«
»Grad acht Tage, Muhme.«
»Nun ja, dann ist schon alles recht.«
»Der Götz hat wie ein guter Edelmann allen Bescheid getan, bis auf einen. Dem Marschall tat’s ordentlich leid, daß er den Holzendorf nicht auch noch austrank. Es war ein so schöner Landtag gewesen.«
»Man hört viel Rühmens davon«, warf der Dechant hin. »Einmal muß doch aber der gute Herr von Bredow aufwachen!«
»Dann liegen sie vor seinem Bett, als wenn er sie ausgezogen hätte, und er soll nicht merken, daß sie gewaschen sind. Ich lasse sie leicht durch die Asche ziehen und auf die Knie ein bißchen Feuerherdsrot.«
»Base, was hilft denn die Wäsche, wenn Ihr sie wieder schmutzig macht!« lachte der Junker auf, und auch der Ernst, in welchen der Geistliche sein Gesicht gezwungen hatte, löste sich etwas.
Die Edelfrau schien zum ersten Male um eine Antwort verlegen: »Ei was – sie sind aber doch gewaschen.«
Es war ein eigenes Gesicht, mit welchem der Geistliche und die Edelfrau am Saume des Waldes auf und ab gingen. Wer sie jetzt beobachtete, hätte eine Veränderung in beider Mienen bemerkt. Der Dechant blickte ernst, mit geschlossenen Lippen, vor sich nieder, während die Edelfrau mit etwas verlegenen Blicken ihn zuweilen ansah.
»Und es trieb wirklich meine Frau von Bredow noch nicht zur Beichte!« sagte er, den Kopf schüttelnd, doch nicht in unfreundlichem Tone.
»Hier im Walde!«
»Auch der Wald ist Kirche, wenn das Herz drängt, eine Schuld zu bekennen.«
»Hochwürdiger Herr, aber sie mußten doch gewaschen werden. Das Leder war versessen und braun durch und durch, daß es eine Schande war, und nicht wie ein christlicher Ritter gehen soll. Im Kriege, nun ja, da tut’s nichts. Aber Ihr wißt ja, was er auf das alte Lederstück hält, er läßt’s nicht los. Er wäre damit zu Hof geritten.«
»Herr Gottfried reitet ja nicht mehr zu Hofe.«
»Aber zu Kindelbier, zu den Landtagen. Ja, zum hochwürdigsten Bischof ritt er mir zur Schande Mariä Lichtmeß, auf den Dom nach Brandenburg in den Büchsen, und wie er beim Heimreiten dreimal vom Prallstein aufsteigen mußte und dreimal runterfiel –«
»Ist dem von Kerkow auch begegnet. Auch Wilkin Stechow. Der Bischof hatte herrschaftlich auftischen lassen.«
»Aber die Weiber haben nicht über sie gelacht; sie trugen reines Zeug am Leibe. Daß mein Gottfried vom Prallstein fiel, tut ihm auch keine Schande, und dem Bischof tut’s Ehre; aber die Weibsen, die schnippischen von Brandenburg, haben sich zugezischelt: ob’s denn in Hohen-Ziatz kein Wasser gäbe! Das ging auf mich, das ist meine Schande. Das konnt ich als ehrliche Frau nicht dulden. Mit Gutem gibt er sie ja nicht. Ihr wißt warum. Ist denn Waschen eine Sünde!«
»An und für sich betrachtet, ist Reinlichkeit sogar eine Tugend, aber jede Tugend kann durch Übermaß zur Sünde werden. Zum Exempel, wenn man am Sonntag wäscht und die Messe darüber versäumt.«
»Heut ist’s ja zu Ende.«
»Oder die irdische Reinigung für wichtiger hält als die der unsterblichen Seele. Wie meine Frau von Bredow treffend bemerkte, hat der Herr das Wasser geschaffen zum Waschen, und gleichwie der Mensch durchs Wasser muß, d. h. durch die Taufe zum ewigen Heil, so mag aller Kreatur das Waschen zu ihrem Zeitlichen dienen. Ja, es ist nichts Schlimmes dabei, so der Mensch die Geschöpfe, die ihm untergeben sind, dazu zwingt. Er mag die Pferde und die Schafe durch die Schwemme treiben, denn von selbst gehen sie nicht, auch seine Kinder bürsten und begießen, auch wenn die Kleinen sich sträuben und schreien. Auch ist nichts natürlicher, als daß eine gute Hausfrau das Kleidungsstück, auf welches ihr Eheherr so viel gibt, einmal gereinigt wünscht, selbst wenn er es nicht wünscht. Es ist sogar löblich; ja zugeben möchte ich, daß sie als Hausfrau ein Recht hätte, es in die Wäsche zu tun gegen den eigentlichen Willen des Mannes, ich meine, wenn er das Verbot nicht bestimmt ausgesprochen hätte. Aber in diesem Falle hatte er es getan. Nicht wahr, er jagte es Euch damals an der Färbermühle ab und war sehr zornig?«
»Das wohl, ehrwürdiger Herr, aber –«
»Ihr unternahmt es dennoch: einmal gegen seinen Willen, wohl wissend, wie sehr es ihn kränken mußte, welchen Wert er darauf legte, daß niemand ihm das Kleid berühre. Ihr nahmt es auch gegen seinen Willen, mit einer Hinterlist, die sogar an einen Diebstahl erinnert, während er schläft oder seiner Sinne nicht mächtig ist; ja mehr noch: die eigene Tochter habt Ihr verleitet, mitzuspielen, sie mußte, während sie dem Vater schmeichelte, ihm hinterrücks das Kleidungsstück entwenden. Ei, ei! welche Saat in das unschuldige Herz eines Kindes gestreut! Das alles zusammengenommen erwäge meine Tochter und antworte sich dann selbst, ob das nicht gegen das Gesetz ist, das den Mann über die Frau setzte, nicht gegen die christliche Moral, die keine Arglist will, Summa, ob es nicht eine Sünde ist?«
Der Dechant war stehengeblieben. Auch die Edelfrau war stehengeblieben.
»Ja, ehrwürdiger Herr, sie mußten aber doch gewaschen werden.«
»Warum?«
»Warum! Ja, ich will nicht sagen darum, weil sie schmutzig waren. Denn meinethalben hätten sie’s bleiben mögen bis an den Jüngsten Tag, wenn er ein so eigensinniger Narr ist. Aber konnt ich’s mir denn selbst vergeben, wenn er mir länger zum Gespött so rumging! Seine Ehre ist ja auch meine, seiner Kinder Ehre. Ein Hauswesen ohne Ordnung ist kein Hauswesen. Ja, nur der Kinder wegen! Es war meine Pflicht als Mutter. Es ging nicht anders, Herr Dechant. Aus purer guter Absicht hab ich’s getan.«
»Darum also.«
Die Edelfrau wußte nicht, wie sie den Blick verstehen sollte.
»Die großen Herren in Friesack, wenn sie einmal in die Zauche kommen, oder wir kommen mal alle Jubeljahr zu ihnen, ach, man muß sich ja in der Seele schämen! Wir sind doch ein Blut, aber wie sehen sie uns über die Achseln an! Nun ja, lieber Gott, wir haben kein Schloß Friesack, wo sie mit Hellebarden stehen an der Treppe und das Herz einem manchmal ordentlich puckert, wenn man auf die Teppiche tritt. Schnäbelschuhe, das schickt sich nicht für unsereins. Der alte Herr Bodo mit seinem weißen Haar, der ist schon freundlich. Aber die jungen Herren, wenn sie so dastehen, die Hände zur Seite in den Pluder gesteckt, und uns ansehen, es fehlte ihnen nur noch ein Rauchstück im Maule, wie der Menschenfresser aus der Neuen Welt, von dem sie erzählen tun. Siebzig Ellen Tuch hat der älteste darin stecken, der zweite sechzig, und so geht’s runter, nicht aus Brandenburg, feines holländisches, geschlitzt ist’s und mit bunter Seide gefüttert; wenn sie galoppieren, glitzert’s in der Sonne wie Wolken von Morgenrot, und mein Götz dagegen in dem alten Leder!«
»Wenn Ihr es ihm vernünftig vorhieltet, was sagte er dazu?«
»Er sagt, um solche Hosen sollte man mal den Beinharnisch schnallen. Aber wie oft kommt es noch! Fehden soll’s ja nicht mehr geben! Wir verbauerten ganz, sagen die von Friesack. Das soll man von leiblichen Vettern sich sagen lassen, und hat ein christlich Herz im Leibe. Weil wir nicht reich sind!«
»Es ist gewiß ein löblich Streben, vor den Blutsfreunden in Ehren zu bestehen.«
»Ach, Herr Dechant, wer auf sich hält vom Adel, der schafft sich Pluderhosen an. Und wenn wir nach Berlin reiten, die Bürgersleute schon, was prunkt das in Tuch und Seide, und wie sehen sie uns an! Wir haben nicht viel, aber ehrlich und adelig sein, das ist unsere Schuldigkeit. Und verlange ich denn, daß mein Herr Pluderhosen anlegen soll! Ich weiß ja, was das kostet. Unvernünftig bin ich nicht. Nur was zur Ordnung gehört. Weiß ich nicht so gut wie jeder, was sie von uns im Schloß zu Kölln denken. Mein Götz liegt nicht auf der Landstraße. Seit wir Mann und Weib sind, ein einzigmal hat er mit Adam Kracht einen von Magdeburg geworfen. Seitdem nimmermehr. Ich halte nichts davon, und wenn’s auch nicht so streng verboten wäre. Was kostet das Halten von Rüstzeug, die Knechte und Pferde, und unsicher bleibt’s immer, und wie lohnt es denn, wenn sie wochenlang in der Heide lungern und fangen solchen Schelm von Krämer. Die anderen schlagen ihre Waren dafür auf, man muß‘s doppelt bezahlen, wenn man’s braucht. Ich kenne das, wer nicht hören will, mag fühlen. Die Itzenplitz sind wieder wie toll draußen und könnten so gut leben. Seine Kurfürstliche Gnaden haben neulich zu Spandow gesagt, sie könnten’s jedem Edelmann anriechen, wer im Graben liegt. Darum sehen sie jeden mißtrauisch an, der in Leder geht, und nun gar in solchem Leder! Da kommen wir in schlechten Leumund ohne Schuld und können nichts dafür. Bei den heiligen elftausend Jungfrauen, Herr Dechant, man muß auf sich halten, und wenn’s der Mann nicht tut, muß die Frau. Es ging nicht anders.«
Der Dechant schlug die Hände zusammen, und in väterlichem Tone sprach er:
»Meine liebe Frau von Bredow, wer sollte denn daran zweifeln, daß es nicht anders ging. Ihr tatet es für Eure Kinder, Eure Sippschaft und Euren Gatten. Ihr waret es ihnen sogar schuldig. Ein Edelmann muß vor den Menschen, von denen die Ehre ausgeht, in Ehren bleiben. Wohlverstanden, vor den Menschen, denn der Herr im Himmel sieht durch jedes schmutzige Kleidungsstück auf den reinen Körper und durch den Körper auf die Seele. Aber die Menschen urteilen nach dem Schein. Wäret ihr auf einer wüsten Insel, und der Waschteufel hätte Euch geplagt, die Kleider Eures Mannes zu stehlen, um sie zu reiben und zu spülen; da wäret Ihr im Unrecht, Ihr hättet es getan, nur um Euren Waschkitzel zu frönen, wie es Weiberart ist. Hier aber ist es ganz etwas anderes. Hier hattet Ihr Rücksicht zu nehmen auf Nachbarn, Blutsfreunde und das Ansehen der Familie, ja mehr noch auf den jungen Kurfürsten und seine Räte, welche in dem vernachlässigten, rohen Anzuge der Edelleute ein Zeichen roher Gesinnung erblicken. Ihr setztet den, der Euer Herr sein soll, der Gefahr aus, mißliebig vom Hofe betrachtet zu werden, ja daß er beim nächsten Anlaß gefahndet, gerichtet, vielleicht verurteilt werde. Denn niemand weiß, wozu in diesen schlimmen Zeiten kleine Dinge führen. Sichtlich wollte der Herr, darf man sagen, durch Eure schwache Hand das Haupt Eurer Familie retten, Schmach, vielleicht Blutschuld von ihr abwenden. Sichtbar wird da eine Kette von Fügungen, die wir recht betrachten müssen: daß der gottesfürchtige Herr Gottfried sich in einen Zustand versetzen mußte, wo er nicht mehr Herr seines Willens war, daß er hinaufgetragen ward, als meine Frau von Bredow gegenwärtig war, daß sie über den Gang kommen mußte, grad als sie ihn entkleideten, daß der Allmächtige gerade auf das bewußte Kleidungsstück ihr Auge lenkte, dergestalt, daß sie es rasch aufgriff, bevor der mit dem Willen seines Herrn vertraute Diener es merkte und in Verwahr brachte. Und die große Herbstwäsche mußte zur selbigen Zeit sein. Das sind alles Winke von oben, wie eine Kette ineinandergefügt, die uns irrenden Menschenkindern Zuversicht und Trost in unseren Zweifeln gewähren müssen.«
»Es war also keine Sünde!«
»Sagte ich das, meine Freundin? Aber sintemal jedes Ding zwei Seiten hat, und alles Irdische dem Wechsel unterworfen ist, also sind es auch unsere Handlungen und Pflichten, und wir von der Vorsehung angewiesen, auch die andere Seite ins Auge zu fassen, ehe wir urteilen.«
»Sie trocknen aber schon. Hans Jürgen steht bei der Leine Wacht«, sagte die Frau von Bredow, die wirklich nicht wußte, was sie sagen sollte. – »Was soll’s nun aber, Herr Dechant!«
»Nur uns erinnern, meine Freundin, daß wenn wir jemand etwas verstecken sehen, ehe wir ihn darum verdammen, uns zu bedenken, ob wir nicht selbst etwas anderes versteckt halten, erinnern, daß die Sünde uns Sterbliche von allen Seiten anschleicht, und daß, was auf dieser Betrug scheint, auf jener Fügung in Gottes Willen ist; daß diese Fügung uns aber als letztes Ziel vor Augen schweben muß bei allen unsern Wegen, und daß, wenn wir mit allen den Kräften, so der Herr uns gab, in guter Absicht auf das Ziel losgehen, eine christliche Frau noch nicht zu denken braucht, daß wir auf des Teufels Buckel dahinreiten.«
Das war nun wohl der Frau von Bredow verständlich, aber wo es hinaus sollte, doch noch nicht ganz. Ihre Frage verriet es:
»Wenn’s Sünde war, ich meine das von der Seite, soll ich’s denn meinem Götz sagen?«
Der Dechant faßte vertraulich ihre Hand und klopfte mit seiner darauf: »Ich meine, wir bleiben vorläufig auf der anderen Seite stehen.«
»Aber mit Küchenrot soll ich sie nicht wieder bestreichen.«
»Wenn das die Täusch – ich wollte sagen, den stillen Glauben unseres wackeren Herrn Gottfried länger erhält, warum nicht.«
»Doch die Eva – das Kind, mein ich – ob die den Vater –«
»Sie wird doch nichts ausplaudern! Wenn meine Freundin es ihrem kindlichen Sinne nur recht vorstellt –«
»Was!«
»Ei, nun,« – der Dechant hatte den Arm der Edelfrau in den seinigen gelegt, um sie nach dem Lager zurückzuführen, wo es laut wurde – »das wird meine Frau von Bredow am besten wissen, wie man den Sinn eines Kindes über kleine Bedenklichkeiten hinüberführt zu seiner höheren Pflicht gegen die Eltern, ich meine, zumal gegen die Mutter.«
Drittes Kapitel
Die Waschbank
Auch die Sonne hat ihre Flecken, auch die beste Haushaltung ihre Mängel, und was wir glauben, daß es ganz in der Richte sei, mag unmerklich wo einen kleinen Stoß bekommen haben, und der Bau wird schief.
Frau Brigitte Bredow meinte, es sei alles in Ordnung, weil sie alles geordnet und jeden auf seinen Platz gestellt. Aber sie hatte sich darin verrechnet, daß auch der wachsamste Wächter einmal einschlafen kann und daß der beste Mensch ein Mensch bleibt. Und wer gibt denn einem Gebieter, ob er über ein Königreich das Regiment hat oder über eine große Herbstwäsche, das Recht, daß er nur gute und tüchtige Leute unter sich habe. Die Welt ist bunt; wir müssen sie nehmen, wie sie ist. Zwischen Riesen und Zwergen ist die Auswahl, und die Krummen und Lahmen, die Tauben und Blinden gehören auch dazu. Der Meister über eine große Arbeit zeigt sich darin, daß er jeden hinstellt, wo er hingehört, und jeden zu nutzen weiß nach seiner Kraft und nach seiner Schwäche.
Hans Jürgen ist zu nichts gut! Darum hatte man ihn hingestellt auf die äußersten Sandhügel am Fließ, wo der Wind am schärfsten wehte. Da sollte er achthaben. Worauf? – Wie hatten alle den armen Hans Jürgen ausgelacht, und die Edelfrau hatte mitgelacht und ihm den Rücken gedreht.
Der arme Hans Jürgen! Er hatte doch schon sechzehn Sommer hinter sich, ach nein, er zählte nach Wintern und war eines Edelmannes Sohn, eines Edelmannes, so gut als einer in den Marken zwischen Elbe und Oder, und doch sagten die Leute auf Hohen-Ziatz, er sei zu nichts gut, und hier mußte er Wache stehen vor einem Stück alten Leders, das wie ein Galgenmann zwischen zwei Kiefern hing. Fünf Fuß war er hoch und noch einen Zoll darüber, stark genug, eine junge Buche mit den Wurzeln auszureißen; auf das Fohlen in der Koppel konnte er sich werfen, und wenn die Frau es gebot, ritt er drei Meilen ohne Sattel, um zur Sippschaft eine Botschaft zu tragen. Sein Auge war wie der Luchs, sein Bolzen traf den Vogel im Fliegen, und über Hecken und Gräben setzte er ohne Anlauf, und doch wollten sie ihn nicht ritterlich aufziehen, wie seines Standes war. Der alte Herr Gottfried sagte zwar, wenn er brummig war, mit den Rittern sei es aus; wozu sich Sporen verdienen, da es keine Sporen mehr gäbe. Aber warum ließ er Hans Jürgens Vetter, den Hans Jochem, der war nicht schlechter und nicht besser von Geburt, Reiten lehren und Tanzen in Brandenburg, und nahm ihn auch zum Ringelrennen mit, wo es eines gab; ja, zu einem Turnier nach Meißen hatte der alte Herr ihn einmal geschickt mit seinem Verwandten, dem edlen Herrn von Lindenberg, daß er sich dort umschauen solle, was gute Sitte sei.
Hans Jürgen war eine Waise; aber Hans Jochem war ja auch ohne Vater und Mutter. Herr Gottfried und sein Eheweib hatten beide Kinder, ihre Vettern, zu sich genommen in ihr Haus und versprachen, sie als ihre Söhne aufzuziehen. War es darum, daß Hans Jochem von der Mutter noch eine fette Erbschaft liegen hatte, die ward verwaltet beim Dom zu Havelberg, und Hans Jürgen war blutarm? Die Edelfrau hatte doch gesagt, als sie die Waisen ins Schloß nahm, sie sollten sein, da der Herrgott ihr und ihrem Gottfried keine Söhne geschenkt, als ihre eigenen Söhne, und viel Liebes und Gutes hatte sie noch gesprochen über die armen Kindlein, denen der Herr erst die Mütter genommen und dann die Väter.
Die Edelfrau war eine wackere Frau, und was sie sprach, das meinte sie, aber Worte sind Wind, wenn die Taten nicht darauf folgen, und der Sinn des Menschen ist wandelbar. Hans Jochem hatte ein glatt Gesicht und ein Paar muntere Augen, er wußte es allen recht zu machen, und sie lachten und waren ihm gut; aber Hans Jürgen – man weiß nicht, wie man mit ihm dran ist, sagten, die nichts Schlimmes sagen wollten. Böses wußte man nicht von ihm, aber warum tat er nichts Gutes? Andere hätten fragen mögen: aber warum tat er nicht, was gut war, daß es die Leute sahen? Er ist tückisch, sagten einige, denn er tut das Maul nicht auf. Aber wenn er es auftat, ließen ihn die anderen nicht zu Worte kommen. Er kann nichts Gescheites vorbringen. Er hatte ja nicht Zeit dazu; sein Mundwerk ging langsam, und wenn er anfangen wollte, setzte ein anderer fort, was er sagen wollte, aber nicht, wie er es wollte, und wenn er ein ernstes Gesicht machte, lachten sie aus vollem Halse. Ihm fehlen die Gedanken, sagte der Dechant. Sie ließen ihn ja nichts denken, dachte Hans Jürgen. Und wenn er sich im Bache sah, kamen ihm noch ganz andere Gedanken, dem armen Hans Jürgen. Glatt war sein Gesicht nicht und munter seine Augen auch nicht; es lag darin ein Ausdruck, ich weiß nicht wie, aber die Leute sagten: das ist ein verdrossener Bursch, oder er ist schläfrig.
Wenn Hans Jürgen das Bild lange im Fließ sah, wurde das Gesicht allmählich ein anderes, und es tropfte etwas ins Wasser. Aber nur auf einen Augenblick, denn gleich darauf ward es ganz rot, und ärgerlich wischte er mit dem Ellenbogen über die Augen: »‘S ist gut, daß das keiner gesehen hat«, murmelte er und warf sich in die Brust. Aufgerichtet ging er, den Hals weit aus den Schultern, am Fließe auf und ab und dachte wieder: »Wenn ich auf einem gerüsteten Pferde säße, wir wollten doch sehen, ob ich nicht auch ein Ritter würde.« Aber wenn das laute Gelächter von drüben herschallte, war’s, als fuhr er wieder zusammen. Die andern spielten Plumpsack mit den nassen Tüchern, sie neckten, haschten und warfen sich, wie lustige Kinder tun, denen jede Arbeit zum Spiele wird. Wer allein ist, hascht und neckt nur mit seinen Grillen und bösen Gedanken. Nicht daß er stundaus, stundein bei dem Leder Schildwacht hätte stehen müssen und keinen Fußbreit fort gedurft, aber er gehörte doch nicht zu den anderen. Wäre er zu ihnen getreten, sie hätten ihn nicht fortgewiesen, aber er wäre immer an der Reihe gewesen beim Suchen und Haschen, und wenn die Knechte die großen Decken spannten und losten, wer in die Luft fliegen sollte, so wußte er, das Los hätte ihn getroffen. Er wußte auch, daß die anderen dachten, er sei muckisch, er halte nicht zu ihnen, weil er was für sich sein wollte.
»Und das will ich auch«, brach ein verstohlener Gedanke unwillkürlich aus seiner Brust, »laßt mich nur älter werden und größer«, und dabei stieß er den kurzen Jagdspieß so fest vor sich, daß er mit dem stumpfen Ende in dem Boden wurzelte. Es war ganz still geworden, die Abendluft wehte drüben durch die Elsenbrüche ihm recht erquicklich auf das heiße Gesicht. Von dem fernen Kloster Lehnin klang die Abendmette. Er schüttelte den Kopf: »Nein, ein Mönch will ich nicht werden. – Auch so einer nicht«, setzte er nach einer Weile hinzu, als er den Krämerwagen in das Lager einbiegen sah. Wie schon über den Gedanken unwillig, wandte er ihm rasch den Rücken. Der Wind, der zwischen den Hügeln sich fing, fuhr ihm entgegen, und er empfand einen heftigen Schlag ins Gesicht. Hans Jürgen hob zornrot den Arm – aber es war kein Lebendiger, der es sich erfrecht, auf ihn zu schlagen, kein Mensch, kein Arm, den er wiederschlagen konnte, es war das Stück Wäsche, davor er Schildwacht stand. Aufgeschwellt von der Luft, schwenkte es hin und her, und die willenlosen, nassen Beinriemen waren’s, die ihm um die Ohren peitschten. Es zuckte ihm durch die Finger, er war wieder hochrot, aber jetzt war es Scham wie Zorn, und schon hob er die Hand auf nach dem verdrießlichen, widerwärtigen Leder: »Mag der alte Herr Götze«, dachte oder kochte es in ihm, »auf dem bloßen Sattel reiten, ich will nicht länger Fahnenwache stehn vor seinen Büchsen!« Die schöne, feingegerbte Elenshaut, so sauber gewaschen, geklopft, gerieben und gebürstet, war in Gefahr, in den Sand geworfen zu werden, wenn nicht ein Schrei ihm ins Ohr geklungen hätte.
Ein durchdringender, feiner Schrei, kaum ausgestoßen und schon wieder verhallt. Hans Jürgen kannte die Stimme; im nächsten Augenblick war er auf dem Hügelrand, der dort die Aussicht auf das obere Fließ scharf abschnitt. Eine der kleinen Waschbänke hatte sich losgerissen, sie trieb in dem Wasser, und es war nicht ganz ohne Gefahr für das junge Mädchen, was ängstlich darauf stand, denn die Strömung war hier stark und trieb auf das Eck drüben los, wo sie leicht an den großen Steinen umschlagen konnte. Die Waschbank war selbst nur ein kleines, morsches Gefäß, welches unter seiner Last hin und her schwankte. Ohne den Gedanken an eine Gefahr wäre es ein hübsch anzuschauendes Bild gewesen. Das liebliche Mädchen im roten Mieder mit den aufgekrempelten Hemdsärmeln und den blonden Füßen, wie es, ein Stück feiner Wäsche in der Hand, mit Armen und Füßen das Gleichgewicht zu halten unbewußt bemüht war. Ihr ängstlicher Blick, der sich noch nicht von dem Boden, auf dem sie stand, forttraute, ihre halb geöffneten Lippen, die eine Reihe feiner Perlenzähne zeigten, ihr erstes Erbleichen, das jetzt schon einer Röte Platz gemacht, und dann wieder ein neuer Schreck, als sie auf den großen Granitblock schielte, auf den die Waschbank lostrieb. Sie war sichtlich im Zweifel, was zu tun. Sie steckte die goldene Dukatenkette, die allzu frei um ihren Hals spielte und beim Anstreifen an Gebüsch und Schilf eine gefährliche Schlinge werden konnte, mit der einen Hand in das Mieder und schien mit dem einen Arm im voraus zu prüfen, ob sie die Weide erreichen könne, die ihre Zweige von dem Steine über das Wasser streckte, um vor dem gefährlichen Anstoß sich zu schützen.
Aber die Schifferin erreichte weder die hilfreiche Weide, noch den gefürchteten Granitblock. Es rauschte im Wasser, und bald hatte ein kräftiger Arm die Waschbank gefaßt. »Du wirfst mich um« rief das Mädchen, denn vor der plötzlichen Berührung aus seiner ebenmäßigen Bewegung gekommen, schwankte das Gefäß.
»Dafür laß mich sorgen«, rief der Retter und hielt ihr den rechten Arm in die Höh, während er mit dem linken die Bank regierte. »Nun faß mich an, und dann ist’s gar nichts.«
Sie reichte ihm ihre zitternde Hand. Er watete etwa bis an die Brust im Wasser, und der Grund schien fest.
Aber die Bank mit ihrer schönen Last durch die Strömung nach dem anderen Ufer wieder zurückzuziehen, schien eine schwierige Aufgabe. Er strengte sich sichtlich an; er zitterte jetzt, während sie immer ruhiger wurde.
»Fürchte dich nicht, Eva«, sprach er, als er keuchend einen Augenblick anhielt.
»Was soll ich mich fürchten«, erwiderte sie, »du siehst ja, ich stehe fest. Ich brauche deine Hand nicht mehr.«
Er kämpfte und überwand. Er stieß die Bank ans Land. Das Schilf niedertretend, arbeitete er sich mit einem Fuß ans Ufer und wollte ihr den Arm reichen; aber mit einem leichten Satz war sie schon herübergesprungen. Die Bank schnellte weit zurück.
»Da wären wir ja«, sprach er. Aber der arme Hans Jürgen mußte gar zu possierliche Bewegungen machen, als er das Wasser von sich schüttelte, denn das junge Mädchen schien die Angst und Fährlichkeit ihrer Lage ganz zu vergessen, und statt zu danken, lachte sie aus vollem Halse:
»Wie ein Pudel, Hans Jürgen!« rief sie.
»Der Pudel springt auch ins Wasser«, murmelte er, und leiser setzte er hinzu: »Aber er holt nur, was man ihm befiehlt.«
»Nur nicht bös, Hans«, sprach das Mädchen. »Dank dir auch.«
Hans Jürgen schüttelte sich und murmelte etwas, was sie nicht verstand.
»Trockne dich, Hans, daß die anderen es nicht merken. Sonst lachen sie über dich und über mich auch.«
»Über mich, Eva? Was tut’s! Sie lachen ohnedem. Ich hab ‘nen tüchtigen Pelz.«
Eva Bredow sah sich um: »Ach, die Bank, die Bank! Hans, sie schwimmt fort. Dann merken sie’s. Die Bank wieder, Vetter Hans. Die muß wieder an ihre Stelle.«
Die Bank war schon ein gutes Stück weitergetrieben und schwamm drüben am Ufer hin; aber Hans Jürgen machte keine Anstalt, ihr nachzustürzen.
»Um dich, Eva, hab ich’s getan, und tät’s noch mal, wenn du mir auch nicht so viel danken wolltest; ja du möchtest mich auch noch mal auslachen; aber um das alte Stück Holz spring ich nicht rein.«
»Ein Brummbär bist du, aber kein gefälliger Vetter, Hans.«
»Hans Jürgen heiß ich«, sprach der Bursch verdrießlich. »Du hast ja andere Vettern, die heißen auch Hans. Ruf den Hans Jochem. Wenn du ihn bittest, schwimmt er wohl dem Brette nach.«
Ein böser Zug streifte um die Lippen des hübschen Kindes, ja es schien, als zerdrücke es mit seinen Samtwimpern ein Etwas, das sie sich schämte sehen zu lassen.
»Ich konnt’s von dir erwarten.«
»Hans Jürgen taugt zu nichts, hast’s ja oft genug von deiner Mutter gehört.«
»Wenn du nur anders wärst.«
»Bin wie ich bin. Mach dich nur auf die Beine, Eva, daß dich keiner bei mir sieht. Um die Waschbank brauchst du nicht angst zu sein. Die Waschbank plaudert nicht. Da kann der Strick gerissen sein, als du ans Ufer sprangst, und der Wind trieb sie fort. Keiner sah’s; da ist ja alles gut.«
»Alles ist nicht gut. Du zitterst, Hans Jürgen, du frierst.«
»Ich zittere nicht, ich friere auch nicht, das bilde dir nur ja nicht ein.«
»Hans Jürgen«, sprach das Mädchen mit sanftem Ton und streckte ihm ihre kleine Hand entgegen. »Du wirst zu niemand was davon sagen, das weiß ich –«
»Da hab ich wohl mehr zu tun. Und bis da hab ich’s auch vergessen.«
»Aber so gehe ich nicht von dir. Es ist nicht recht von dir –«
»Daß ich dir die Meise haschte und lebendig brachte, und den Käfig wollte ich dir von Rohr binden, du hättest den ganzen Winter durch Spaß gehabt, und vorher konntest du nicht genug sagen, wie du solche Meise liebtest, und als du sie hattest, ließest du sie fliegen; rein mir zum Possen. Und mit dem jungen Fuchs war’s auch so. Alles was ich tun mag und aufstellen, du tust, als wenn’s gar nichts wäre, und nur mir zum Schabernack. Und als du dich verspätet hattest drüben im Kloster, ach was Furcht hattest du vor dem Knecht Ruprecht, der mit langen Schritten hinter dir kam und die Fichten auseinanderbog, und aus jeder Wurzel schoß die Frau Harke auf. Und wenn’s in den Büschen lispelte, da drücktest du dich an mich und hast’s so gern geduldet, daß ich meinen Mantel um dich schlang, und du konntest die Augen zumachen. Da war ich dein lieber Hans Jürgen, und du streicheltest mich mit den Fingern auf die Backe, und was klopfte dein kleines Herz. Aber als der Wald lichter ward, da ward’s dir zu warm an meiner Seite, und als die Hunde bellten, da waren dir die Hunde lieber als Hans Jürgen, du hast sie geherzt, als wären es Bruder und Schwester. Über die Zugbrücke sprangst du mit ihnen um die Wette, als wäre Feuer hinter dir. Die Knechte hätten sie aufziehen mögen: ob ich draußen blieb, dich kümmerte es nicht.«
Man sah, es war ein verhaltener Unmut, der aus ihm sprach: was in ihm lange gekocht, brach, von einem Funken entzündet, mit einem Male heraus. Eva hätte kein Weib sein müssen, wenn nicht auch ihr Gefühl verletzt worden wäre und der bittere Angriff eine ebenso bittere Verteidigung vorgelockt hätte. Die hübschen Lippen kniffen sich zusammen, aber man sah auch, daß sie einen Kampf mit sich kämpfte, aus dem sie wenigstens zum Teil als Siegerin hervorging.
»Hans Jürgen, was hast du denn getan, das dir ein Recht gibt, so zu sprechen«, sagte sie nach einer Pause mit einer Stimme, aus der die Leidenschaftlichkeit, aber auch die Wärme fort war.
»Ich, ich habe gar nichts getan. Nichts tue ich, ich kann ja nichts tun.«
»Was du tatest, hätte jeder andere auch getan. Ich danke es dir. Aber der Martin, der Wenzel, auch der verdrießliche Ruprecht, die wären alle auch ins Wasser gesprungen. Was war denn für große Gefahr dabei; das Fließ ist nicht tief.«
»Und darum solchen unnützen Mund! Nicht wahr? Hätte ich nur mehr Wasser geschluckt, dann müßt’ ich das Maul halten.«
»Das ist böse Rede, Vetter.«
»Wär’ es Hans Jochem gewesen, der wäre gleich fortgelaufen, er hätte sich nicht geschüttelt, daß die Tropfen spritzten. Aber du hättest auch nicht lachen können wie über einen Pudel. Den Spaß habe ich dir doch gemacht.«
»Hans Jürgen, nun höre auf. Hans Jochem ist auch ein guter Junge, aber er hätte sich wohl erst bedacht, ob er sein neu Wams naß machen dürfe.«
»Meinst du das, Eva?«
Sie hielt ihm wieder die Hand hin: »Vetter, lauf ans Feuer und trockne dich, dann wirst du nicht so wirsch sprechen. Daß ich die Meise fliegen ließ, das war nicht recht von mir. Es überkam mich gerade so. Ich wollte es dir auch abbitten, aber ich hab’s nicht getan. Und damals, wie ich von der Muhme kam, da schämte ich mich nur, daß mich so gegrault hatte, und dann sprangen die Hunde mich an. Ich hab’s dir aber wohl im Herzen behalten, wie du mich durch den Wald führtest, der gar zu grauslich war, und so lieb zu mir sprachst, daß ich mich nicht fürchten sollte. Bis ich einschlief, hab ich zur Mutter Gottes gebetet – für dich auch, Hans Jürgen.«
»Hast du das! –« der Bursch sah finster vor sich hin. »Das ist hübsch von dir. Und weißt du, Eva, ich hab’s mir auch gedacht, daß du so tätest. Freilich, was die Mutter Gottes hört, das hört kein anderer Mensch.«
Eva Bredow senkte auch die Augen. Sie verstanden sich. Beide schwiegen. Es tut nicht gut, alles auszusprechen. Hans Jürgen hob zuerst wieder an:
»Nun geh nur schnell fort, daß sie dich nicht vermissen und nichts merken. Du kannst auch über mich lachen vor den andern, soviel du willst, ich will dir darum nicht bös sein und es nicht vergessen, was du mir hier gesagt hast. Aber es wird auch mal eine Zeit kommen, wo sie mich nicht hänseln sollen, wo sie mich nicht in den April schicken sollen und nicht hinstellen, vor den alten Büchsen Wache stehen. Und dann, und dann –«
»Hans, wo willst du hin?«
»Geh nur, ich komme nach.«
»Aber du hast mir noch nicht die Hand geschüttelt, daß du mir wieder gut bist.«
»Ach was, es könnt’s einer sehen.«
»Daß du weinst, Hans Jürgen, das schickt sich nicht.«
»Ich weine nicht«, sagte er barsch und wollte fort.
»Wohin?«
»Die Bank holen. Sie schwimmt zu weit. Geh du nur zu deinen Krausen und Tüchlein. Ich habe sie dir wieder hingebracht, eh’s einer merkt.«
Aber sie rief ihn mit einem solchen Ton zurück, daß er folgen mußte.