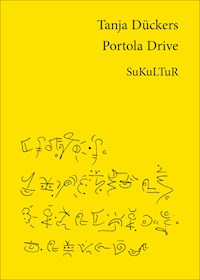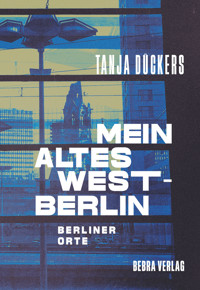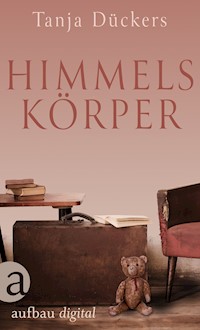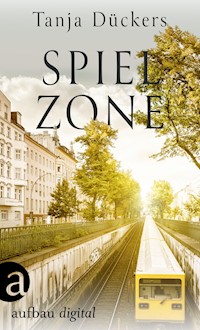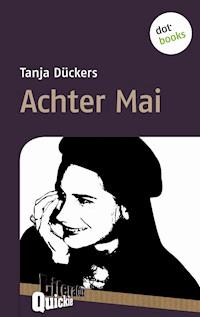10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lukas hat einen Nachschlüssel für die Wohnung seiner Ex-Freundin, die inzwischen mit Uwe, dem absoluten »Anti-Lukas«, zusammen ist. Wenn die beiden nicht zu Hause sind, schleicht sich Lukas ein und hinterläßt Spuren, um etwas Irritation in die Pärchenharmonie einzufädeln … Der alte Herr Hazatérés gesteht Frau Sieben, wie es dazu kam, daß er nach einer langen Ehe nun mit einem Mann zusammenlebt, und er braucht dabei keine Intimitäten und Sünden auszusparen, denn er weiß, daß Frau Sieben trotz ihres Gedächtnistrainings alles sofort vergißt … Die Geschichten um normale Nervtöter, leichtsinnige Kinder oder verwirrte Großmütter stecken voll liebevoller Bosheiten und akribischer Perfidien. Psychologisch raffiniert erzählt, fehlt es ihnen nicht an Traurigem, Groteskem und verblüffenden Wendungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Lukas hat einen Nachschlüssel für die Wohnung seiner Ex-Freundin, die inzwischen mit Uwe, dem absoluten »Anti-Lukas«, zusammen ist. Wenn die beiden nicht zu Hause sind, schleicht sich Lukas ein und hinterläßt Spuren, um etwas Irritation in die Pärchenharmonie einzufädeln …
Der alte Herr Hazatérés gesteht Frau Sieben, wie es dazu kam, daß er nach einer langen Ehe nun mit einem Mann zusammenlebt, und er braucht dabei keine Intimitäten und Sünden auszusparen, denn er weiß, daß Frau Sieben trotz ihres Gedächtnistrainings alles sofort vergißt …
Die Geschichten um normale Nervtöter, leichtsinnige Kinder oder verwirrte Großmütter stecken voll liebevoller Bosheiten und akribischer Perfidien. Psychologisch raffiniert erzählt, fehlt es ihnen nicht an Traurigem, Groteskem und verblüffenden Wendungen.
Über Tanja Dückers
Tanja Dückers wurde 1968 in Westberlin geboren. Sie studierte Nordamerikanistik, Germanistik und Kunstgeschichte. Neben Prosa und Lyrik schreibt sie Essays, Hörspiele und Theaterstücke. Sie erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, die sie u.a. nach Kalifornien, Pennsylvania, Gotland, Barcelona, Prag und Krakau führten. Sie lebt in Berlin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Tanja Dückers
Café Brazil
Erzählungen
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Lebenskästchen
Im Innern des Turms
Der Flamenco-Spieler
Rote Federn
Café Brazil
Die Suche nach Montserrat
I went mad like a machine
Henna-Hexen
Die Wollmütze
Nikita
Der Nacken
Der Stier
Marmorkuchen
Die Nacht
Maremagnum
Lux Aeterna
Osterfeuer
Veo
Dank
Impressum
Lebenskästchen
Ich bin das Ergebnis eines Mordes. Das ist kein schöner Anfang für eine Geschichte, nicht wahr? Es ist nicht so, daß ich sehr wild darauf bin, das hier zu schreiben. Der Untersuchungsrichter hat mir drei Blatt Papier hingelegt und gesagt: »Erinnern Sie sich mal ein bißchen … dann sehen wir weiter.«
Der Moment ist nicht ungünstig, um zu schreiben, denn Helge und Oliver spielen einigermaßen ruhig Schiffe versenken, und Tom schläft (schnarcht allerdings wie ein Walroß). In einer halben Stunde gibt es Abendessen, und ich bin noch beziehungsweise schon wieder im Schlafanzug – ich versuche, soviel wie möglich zu schlafen. Schlafen ist das billigste und ungefährlichste Vergnügen. Stimmt’s oder habe ich recht? Außerdem bin ich chronisch müde. Müde vom Reden, Denken, vom Hin- und Her-Laufen, das Muster meiner Schritte auf diesem Boden ein einziges sinnloses Zick-Zack, nein, auch das klingt noch zu zackig, eher ein Hick-Hack oder einfach die Spur eines Kreisels, der sich um sich selbst dreht und dreht. Was soll ich denn schreiben? »Kommen wir zur Sache!« sagt er immer, der Herr Allert, mein Untersuchungsrichter mit den abgestoßenen Manschettenknöpfen und dem Busfahrerbart.
Knut war ein Mörder und, wie Ihnen bekannt ist, verschossen in Sommersprossen. Eine schlechte Schlagerzeile wert. Ich erinnere mich besser an Knut als Sie: Er hatte ein rotangelaufenes Gesicht, dicke blaue Adern am Hals und Hände, die gar nicht zu einem Menschen zu gehören schienen, so seltsam, schwer wie Bananenstauden oder reife Trauben, baumelten sie an seinen Armen. Den kräftigen Oberkörper, mit Haaren, die aus dem Hemd quollen, trug er etwas zur Schau. Die eher dünnen Beine waren fast haarlos. Die Haut seines Gesichts war großporig und lederartig, am Hals dagegen überraschend weich, fast babyhaft; er hatte sogar ein leichtes Doppelkinn. Seine Stirn war von breiten Linien zerfurcht, die mich an die Redewendung »ein Brett vor dem Kopf haben« erinnerten. Er hatte längeres schwarzes krauses Haar, das ihm etwas Wildes verlieh. Sein Kopf war kastenförmig, sein breiter Mund asymmetrisch, ein Mundwinkel zeigte nach oben, einer nach unten, seine Nase war recht platt, mit einem Höcker wohl von einem Nasenbeinbruch, die sehr hohen Wangenknochen verliehen ihm etwas Exotisches, das im Kontrast stand zu den sehr blauen Kinderaugen, die einen in einer Mischung aus Dreistigkeit und Naivität anglotzten.
Ich habe ihn nur einmal in meinem Leben getroffen, aber ich habe ihn mir gründlich angeschaut.
Am 5. März 1997 gegen 17.00 Uhr habe ich Herrn Knut Leerdams Leben beendet. Auf einem Schrottplatz in Hamburg. Ich habe eine abgeschlagene Cola-Flasche in seinen Hals gerammt, ein verrostetes Stopschild von hinten zwischen seine Beine gestoßen, ein altes Fahrradgestell wiederholt auf seinen Kopf geschlagen, einen Lampenschirm über sein Gesicht gestülpt und durch die Öffnung Spucke auf ihn tropfen lassen, einen aufgeweichten Pappkarton mit Legosteinen über ihm ausgeschüttet, mit den Federn eines Kinder-Indianerkostüms auf ihn eingestochen, ein fünftausendteiliges Puzzle auf seinen Nabel regnen lassen und ein buntes Kaleidoskop rektal eingeführt sowie verfaultes Gemüse auf seinem Rücken zerrieben.
Ich habe ihn mir genau angeschaut, das schrieb ich schon, und ihn dann mit zwei ölgetränkten Tüchern zugedeckt und angezündet.
Zwei junge Leute, die Kunststudenten gewesen sein könnten, begegneten mir auf dem Weg zum Ausgang, beladen mit Zylindern, Zahnrädern und Eisenbahnschrauben, die sie auf die ein mal ein Meter große Waagschale legten und auswogen. Fürs Kassieren war ein kleiner weißhaariger Mann, der ununterbrochen Pistazien aß, zuständig.
Ich habe dann den Bus zurück nach Eimsbüttel genommen und im »Blue Moon« zwei Kirscheis mit Vanillesoße gegessen. Zu Hause habe ich mein Namensschild abgeschraubt, »Leif Gone« mit schwarzer Tinte auf die Rückseite des Schildes geschrieben und es wieder befestigt. Das ist mein Künstlername. Für das Kunstwerk meines Lebens, das mit einem Mord begann.
Was mich am meisten bedrückt, ist der Zustand meiner Mutter. Sie weint ununterbrochen, wenn sie hier ist, und bringt mir viel mit, Kuchen zum Beispiel. Aber ich merke ihre Zurückhaltung, ihren Abstand zu mir. Das Unverständnis. Sie sagt, daß ich verrückt bin, glaubt sie nicht.
Mehr als ein paar Fliegen und Frösche habe ich bis jetzt nicht um die Ecke gebracht. Die Vorstellung, ich hätte jemanden getötet, kommt selbst mir total absurd vor.
Es ist ganz und gar nicht langweilig im Gefängnis; das schreiben nur Leute, die nie einsaßen. Zu viele Eindrücke, zu wenig Zeit, sie zu verarbeiten, weil man ständig gezwungen wird, etwas zu tun: frühmorgens aufstehen, gleich unter die Dusche mit zehn anderen lauten Typen, anstatt den Tag gemächlich beginnen zu können, essen, Gymnastik in der Halle, schwachsinnige manuelle Arbeiten, Zellenkontrollen … ständig ist etwas los. Und immer wieder neue Häftlinge, neue Lebensgeschichten, Adrenalinstöße, nächtliches Stöhnen, Streitereien.
Mit Lawrence habe ich oft einfach nur auf dem Sofa gelegen, nachdem wir miteinander geschlafen haben, stundenlang Musik gehört, das war gerade unsere Wave-Zeit, und nichts gesagt. Liebe, Liebe machen, das sind Ausdrücke, die mir schon vollends fremd geworden sind in der langen Zeit, bevor ich beschloß, Knut kennenzulernen.
Herr Allert sagte mir, ich soll über den psychischen Zustand schreiben, in dem ich mich vor dem und am Tage des Mordes befunden habe.
Ich weiß, das ist keine sehr originelle Idee, aber ich hätte gerne eine Maschine, mit der man die Zeit anhalten und zurückspulen kann wie auf einer Videokassette. Ich würde gerne nachschauen, wann und wie Knut begann, sich für meine Familie zu interessieren, so sehr, daß er Enschede in den Niederlanden verließ, nach Hamburg zog und sich verschuldete, nur um eine Wohnung in unserer Nähe zu bekommen.
Ich bin ziemlich müde, das ewige Gegröle von Helge und Tom geht mir auf die Nerven. Sie erzählen sich den ganzen Tag Fäkalgeschichten und denken sich gerade Namen für verschiedene Kothaufenformationen aus: Da hätten wir den »Doppelwhopper«, den »Sputnik« und den »Mutterkuchen« – ob Helge und Tom irgendeine Vorstellung haben, wie ein Mutterkuchen aussieht? Für diese vulgären Lümmel ist das wohl ihr Pendant zu dem »Motherfucker« der Hip-Hop-Musik, die sie ununterbrochen hören. Helge und Tom scheinen sich von allen Dingen auf der Welt, für die man sich begeistern könnte, nur für eines zu interessieren: den Hintern anderer Menschen, der die beiden Dinge, die sie am meisten faszinieren, auf wundersame Weise miteinander verbindet: Sex und Scheiße. Daß die HipHopper noch nicht auf den »Fatherfucker« gekommen sind, erstaunt mich.
Der Untersuchungsrichter will, daß ich mich zu der Formulierung »Kunstwerk meines Lebens« äußere. Wohlan. Manche Leute leben einfach in den Tag hinein. In der Retrospektive sähe ihr Leben wie eine geschlungene, verknäulte Linie aus. Aber man kann auch so leben, daß man nachher ein eindeutig erkennbares Muster, einen Webteppich hat, in dem jeder kleine Ausschnitt die Struktur des Ganzen in sich trägt. Pars pro toto. Auf diese Struktur, die dem Leben Einheit und Sinn gibt, kommt es mir an. Eine Form, die sich gänzlich unterscheidet von der chaotischen Ansammlung zusammenhangloser Erlebnisse in den Biographien der meisten Menschen.
Ich habe versucht, dies in meiner Mappe »Die Lebenskästchen«, die ich an der Hochschule der Künste eingereicht habe, zu erklären, aber man konnte oder wollte mich nicht verstehen, denn ich erhielt einen Ablehnungsbescheid. Danach habe ich sechs Wochen deprimiert auf dem alten Sofa meiner Mutter herumgelungert. Bis ich beschloß, Archäologie zu studieren, und das mache ich seit zwei Semestern.
Das Lebenskunstwerk: Auch wenn ich jung sterben sollte, was ich nicht hoffe, aber man weiß ja nie, wünsche ich mir, daß mein Leben schon jetzt etwas Charakteristisches hatte, etwas, in dem mein »Ich« sichtbar wird. Keine Schulnoten, Sportpokale oder die Tatsache, daß meine Eltern mir drei Vornamen gegeben haben, nein, die Details meines Lebens, meine Gedanken und Sehnsüchte, die Art, wie ich Blumen gieße, oder das ausgeklügelte System, mir Dinge zu merken – all das soll für mein ganzes Leben sprechen, etwas über mich verraten. Falls doch mal irgendein Verrückter, ein Amokläufer, ein betrunkener Autofahrer oder ein weiterer Sommersprossenfetischist, der es nicht nur mit Kindern gut meint, die filigrane Struktur meines Lebens zu zerfetzen trachtet. Man weiß ja nie.
Ich habe mein Zimmer vor drei Jahren total umgeräumt, Schluß gemacht mit dem Jugendzimmer aus Ikea-Möbeln und Postern an der Wand, das sich in jedem Einfamilienhaus zwischen Stockholm und München hätte befinden können. Mein Zimmer ist jetzt ein Kabinett mit einer Sammlung von Kästchen und Dosen und Schachteln, in denen ich Steine, Glasperlen, Stoffstücke, rostige Nägel, alte Glühbirnen, Versteinerungen, Milchzähne, Miniaturgloben, Schnürsenkel, kleine Stücke von Postkarten, ausgeschnittene Buchstaben, Gedichtzeilen und dergleichen mehr, mit kleinen Datumsschildern versehen, aufbewahre. Jeder Gegenstand hat seine Bedeutung, jeder verlorengegangene Gegenstand würde ein Loch in meinem Leben, eine fallengelassene Masche, bedeuten. Wer jemals in meinem Zimmer Forschungen anstellen würde, könnte sich durch die Sedimente meines Lebens wie durch ein Tagebuch blättern und dort alles finden: meine Leidenschaften und Wutausbrüche, Kränkungen und Phasen des Rückzugs, meine geistigen Interessengebiete und die Intensität, mit der ich sie zu verschiedenen Zeiten verfolgt habe, meine Freundschaften, meine Ängste, meine Träume … für alles, was mir wichtig erschien, habe ich ein materielles Äquivalent gefunden.
Ich habe keine Farbe, keinen Stein, keine Schraube, keinen Bierdeckel, keine Muschel, keine Fahrradschläuche, keine Lampenschirme, keine Kugelschreiberminen, keine Indianerfedern, keine Straßenschilder für Mord. Der Webteppich meines Lebens fängt gleichsam in der Luft an, wurde absurd, bevor ich auch nur einen Faden legen konnte.
An meinem einundzwanzigsten Geburtstag, dem 5. März 1997, wollte ich ihn treffen, Knut, ihn mir von nahem besehen, ihn, der uns so lange von nahem gesehen hatte und soviel Unglück über unsere Familie gebracht hat. Wegen dem meine Mutter jahrelang einen Therapeuten aufsuchte und zweimal stationär behandelt werden mußte. Die Pillen, die auf ihrem Nachttischchen herumlagen, habe ich probiert, um zu wissen, was sie ihrem Körper zuführt. Zwei Tage lang fühlte mein Körper sich an, als hätte man ihn in eine Bleirüstung gesteckt, mein Kopf war wie aus Granit, und Gedanken hatte ich, wirr wie Ameisenstraßen und unwirklich wie Zuckerwatte.
Jetzt muß ich schon wieder aufhören zu schreiben, weil wir auf den Gang sollen, es soll heute ein medizinisches Checkup geben, wegen einem Tbc-Fall vor ein paar Tagen. Helge und Tom streiten sich über das Datum der Mondlandung. Helge meint, das wäre vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen, denn die Deutschen hätten den Mond als Raketenstützpunkt benutzt, um Rußland anzugreifen. Tom meint, er wüßte es besser, da er älter sei, und er sei sich sicher, daß dieses Ereignis in den frühen sechziger Jahren stattgefunden habe. Oliver ritzt wieder mit seinen Fingernägeln Buchstaben in die Metallstangen des Bettgestells. Dabei gibt es ein scheußliches, quietschendes Geräusch. Ich weiß, ohne hinüberzugehen, was er schreibt: O + M, M + O, O + M …
Wieder zurück. Genervt. Dieses ewige dumme Gequatsche. Auf der K-Treppe stand neben »Elvis«, unserem Lieblingswärter, eine Frau mit langen schwarzen Haaren und einer Handtasche, wie meine Oma sie tragen könnte. Ich konnte mit halbem Ohr mithören, daß sie Schriftstellerin ist und – das hat sie so nicht gesagt – hier mal herumschnüffeln will. Na denn viel Spaß beim Schreiben …
Ich habe seit drei Tagen nichts mehr geschrieben. Der Untersuchungsrichter hat mein Geschreibsel noch nicht kommentiert, aber ich finde langsam Gefallen daran. Wenn ich denn schon meine Kästchen und Schachteln schmerzlich vermissen muß, gezwungenermaßen meine Transformationsarbeit einstellen mußte.
Ich bin müde und verwirrt, sehne mich nach Ruhe und nach Gegenständen, die warm und still in der Hand liegen. Es macht mich krank, daß ich mein Lebenskunstwerk hier nicht fortsetzen kann, alles nimmt man mir weg, fast wünsche ich mir wieder diese Pillen, die ich damals probiert habe.
Seitdem ich hier bin, verstehe ich mein Leben nicht mehr, alles ist formlos und chaotisch, verworrene Geschichten überfluten mich täglich, schlechte Suppe, die laute Klospülung, Samenergüsse aus Körpern, die ich nicht sehe, da ich meine Augen dann fest zuhalte. Mein Lebenswebteppich produziert steuerlos wie eine entartete Zelle strukturlose Muster, Farbknäuel, häßlich und von blutiger Farbe. Es ist, als ob man den Teppich meines Körpers auf dem Strecktisch meines Lebens in alle Richtungen ziehen würde. Meine Mutter kann mir nicht mehr helfen, sie weint nur, und Vater schaut betreten auf den Boden und sagt fast nichts, wenn er hier ist. Und mein Zimmer, das Archiv meines Lebens, hat sich nicht mehr verändert seit dem Tag, an dem ich festgenommen wurde, zwei Tage nach meinem Geburtstag. Kein Zeichen, kein Indiz für all das, was mir seitdem widerfahren ist, keine Spuren mehr von mir, dort, in dem Mausoleum meines Lebens.
Der Anfang vom Ende:
Knut arbeitete auf einem Kirmesplatz in Enschede; er hob die kleinen Kinder auf die Sitze des Riesenrads. Er ging sehr fürsorglich und lieb mit ihnen um. »Niet bang zijn«, sagte er immer, fuhr ihnen kurz durchs Haar. Meine Schwester, ihr Name eine kobaltblaue Glasperle in meinem Zimmer, nahm bereitwillig Knuts große Hand, als sie in eine Gondel kletterte, er half ihr, das linke Bein über den bunten, mit Flokatistoff beklebten Rand der Gondeln zu heben. So genau weiß ich das eigentlich nicht, denn ich war nicht dabei, aber meine Mutter hat es mir so und nicht anders Hunderte von Malen erzählt. Es gibt sogar ein Foto von meiner Schwester, wie sie lachend in der Gondel sitzt, die gerade erst ein Viertel der Radhöhe erklommen hat.
Zwei Tage später half ihnen der gleiche Knut bei »Hema« in der Spielzeugabteilung, eine bunte Hängematte und ein großes Känguruh mit Brusttasche für meine Schwester auszusuchen. Meine Mutter konnte ihn nur mühsam davon abbringen, die Sachen in das Ferienhaus zu tragen.
Drei Monate später war Knut ihr Nachbar in Eimsbüttel. Er bot sich an, meine Schwester zur Schule zu bringen, abzuholen und ihr bei den Hausarbeiten zu helfen; nicht mal eine polizeiliche Verwarnung nahm ihm seinen Eifer. Das war alles vor meiner Geburt. Zu Zeiten, wo kein Gedanke an mich verschwendet wurde.
Knut legte weiterhin Spielzeug, Überraschungseier und selbstgepflückte Blumensträuße »für de kleine Prinsesin«, wie er in seinem Gemisch aus Niederländisch und Deutsch schrieb, vor unsere Tür. Manchmal ließ er sich wochenlang nicht blicken, doch dann tauchte er plötzlich, als würde er Schabernack mit meinen Eltern treiben, an irgendeinem Ort völlig unvermittelt auf: im Planetarium bei der Kindervorführung um 15.00 Uhr, bei einem Sonntagsausflug am See, einmal sogar im Garten meiner Großeltern im Sauerland. Meine Eltern waren seiner Versuche, Aufmerksamkeit zu erhaschen, irgendwann so überdrüssig, daß sie sie konsequent ignorierten. Auch meine Schwester ging stoisch ihren Schulweg, ob er da mit seiner Kindermundharmonika stand oder nicht.
Aber am Morgen des 3. März fand man meine Schwester, von siebzehn Messerstichen getötet, auf einem Schrottplatz schräg gegenüber ihrer Schule.
Knut hat nie ein Geständnis gemacht, aber einige Indizien sprachen dafür, daß er der Mörder gewesen ist. Passende Fußabdrücke auf dem matschigen Boden, ein Schulheft meiner Schwester in seiner Wohnung, verworrene Aussagen über seinen Tagesablauf am 2. und 3. März (ihr Todeszeitpunkt wurde auf den frühen Abend des 2. März gelegt, wo sie wie oft auf dem Spielplatz mit ihren Freundinnen Tischtennis spielte) und sein schuldbewußt wirkendes Betragen vor Gericht. Er wurde jedoch von einem Gerichtspsychiater für nicht zurechnungsfähig erklärt, da er unter einer endogenen Psychose litt (er erzählte von Stimmen, die ihm nachts Märchen vorlasen) und einen Intelligenzquotienten unterhalb der Debilitätsgrenze aufwies. Knut verbrachte die nächsten zwölf Jahre seines Lebens in einer psychiatrischen Klinik.
Meine Mutter war 41, als das alles geschah. Ironie des Schicksals: ein Jahr später, fast am Todestag meiner Schwester, wurde ich, das Ersatzkind, geboren. Mich gibt es nur, weil meine Schwester so früh gestorben ist. Meine Eltern – beide berufstätig und keine »Kinder-sind-das-Einzige-in-unseren-Leben-Eltern« – wollten nie zwei Kinder haben. Den Tod meiner Schwester zu betrauern, hieß für mich, mich selbst tot, ungeboren zu wünschen. Mein eigenes Leben zu genießen bedeutete, einem Mord in der eigenen Familie innerlich zuzustimmen. So schien es mir zumindest lange Zeit. Ein bißchen Abstand zu all dem bedeutete das Jahr, das ich als Austauschschüler bei einer amerikanischen Gastfamilie in Colorado verbrachte. Das war 1993. Dort verliebte ich mich in Lawrence, den Sohn meiner Gastfamilie, und kapierte, daß es möglich sein kann, meinen Körper zu genießen, ohne zu denken, hier, an meiner Statt könnte jetzt der Körper meiner Schwester liegen. Doch in Deutschland grübelte ich wieder über ihn nach, diesen Knut, und es beunruhigte mich, daß ich bis dahin so wenig in der Lage gewesen war, ihn zu begreifen und in mein Kabinett einzuordnen. Nicht um ihn und das, was er wohl getan hat, zu akzeptieren, sondern um die Bombe in meinem Kopf zu entschärfen und die mit ihm verbundenen Ereignisse genauso dingfest zu machen wie all die anderen Erlebnisse in meinen vielen Schachteln. Ich mußte ihn finden. Ich mußte wissen, wer er ist.
Er war zunächst in ein anderes Heim verlegt worden, wo die Insassen, nein, Patienten sagt man ja, freien Ausgang haben. Nach drei weiteren Jahren, also fünfzehn insgesamt, wurde der nunmehr Achtundvierzigjährige freigelassen. Er bekam eine kleine Wohnung in einem Viertel mit Sozialwohnungen bei Horn zugewiesen und arbeitete seitdem für wenig Geld als Putzkraft in einem Bürokomplex.
Ich hatte mir einen Trick ausgedacht und bekam ihn auch gleich beim ersten Anruf ans Telephon. Es war ein frostiger, windiger Februartag, als ich ihn anrief.
»Wer … is … da … hä?« machte Knut.
»Guten Tag, hier ist Leif Gone, Journalist für die Deutsche Welle. Wir bereiten ein Feature zu dem Thema: ›Die Niederländer und die Deutschen‹ vor, denn uns interessiert gerade in dieser politisch brisanten Zeit, wie die Niederländer über die Deutschen denken, wir möchten mit unserem Feature zum Dialog zwischen diesen beiden Nachbarländern beitragen. Deshalb, Herr Leerdam, wären wir Ihnen, als gebürtigem Niederländer, sehr dankbar, wenn wir ein Interview mit Ihnen durchführen könnten. Selbstverständlich erhalten Sie ein Honorar.«
Soviel Mühe hätte ich mir gar nicht machen müssen, denn er schien wirklich nicht mit großen Geistesgaben gesegnet zu sein und interessierte sich nur für das Honorar. Er war sofort bereit, sich mit mir zu treffen. Nicht mal die Örtlichkeit machte ihn stutzig: die Ecke, an der sich der Eingang zum Schrottplatz befindet, auf dem meine arme Schwester sterben mußte. Ich hatte befürchtet, daß er Verdacht schöpfen könnte, aber ich wollte keinen anderen Treffpunkt vorschlagen, da nur ein Stelldichein an diesem Platz den Zyklus des Schreckens und der inneren Qualen in meinem Leben zu Ende bringen würde. Nach dieser Begegnung würde ich in einen neuen Zyklus übergehen und schwarzen Samt über die vielen Kästchen und Schachteln, die mein Leben bisher hervorgebracht hat, legen und nur noch gelegentlich in ihnen stöbern. Dann würde die Befreiung beginnen, etwas, das die Farbe des Himmels über Colorado am heißesten Tag des Jahres hat.
Ich hatte mich also mit Knut Leerdam für 16.30 Uhr an besagter Straßenecke verabredet. Bislang hatte ich nur ein Foto von ihm gesehen, da war er zweiundzwanzig. Das Foto liegt bei meinen Eltern mit einigen Zeitungsausschnitten und Gerichtsunterlagen in einem schmutziggelben Ordner, an dessen Ende die erste Fotoserie von mir als Baby anfängt.
Ich war aufgeregt an diesem Tag, so aufgeregt, daß es sogar meinem Vater auffiel, der meinte, ich würde mich wie meine Schwester benehmen, damals zu Weihnachten, wenn sie vor dem Tannenbaum stand. Ich sagte meinen Eltern nicht, was ich vorhatte, sicher hätten sie versucht, mich von dem Treffen abzuhalten.
Um Viertel nach drei ging ich los, denn ich wollte auf dem Schrottplatz eine große Schere besorgen, und vielleicht würde ich ein paar andere Sachen finden, denn ich mußte die letzten zwei Wochen noch materialisieren, da gab’s einige Lücken. Ach, was für ein Wortspiel, nämlich eine Zahnlücke, ja im Ernst, ich bin nämlich in einer Kurve vom Fahrrad geflogen und habe mir einen halben Schneidezahn abgebrochen, dafür mußte mir noch etwas einfallen. Herr Allert, nerve ich Sie jetzt?
Ich wurde fündig und wog meine Sächelchen auf der riesigen Waage ab; der weißhaarige Mann, der wie ein Russe aus dem 19. Jahrhundert aussah, berechnete mir 13,50 Mark und legte das Rückgeld mit seinen roten furchigen Händen auf die stumpfe Waagschale. Ich ging, immer nervöser, zum Eingang des Schrottplatzes, die Schere unter meiner Jacke versteckt, denn damit wollte ich – ehe Knut sich versah – ein Stück von seiner Jacke oder seinem Hemd ausschneiden, ganz schnell, ein kleines Stück für meine besondere Schachtel, in das ich es dann zusammen mit einem Stück von dem Kleid, das meine Schwester an ihrem Todestag anhatte, legen würde, und diese Schachtel würde ich an ihren vorgesehenen Platz unter allen anderen Boxen und Schachteln legen, ganz zuunterst, und vom Gewicht der über ihr lagernden Schachteln und Kästchen würde ihr Pappdeckel langsam eingedrückt werden.
Es war Punkt halb fünf. Ich wartete. Zehn Minuten vergingen. Ich lief im Eingangsbereich des Schrottplatzes auf und ab. Schließlich öffnete ich den Filzkasten, den ich gerade erstanden hatte, und legte einige Werkzeuge, die ich auch gekauft hatte, hinein. Kein Knut. Ich war enttäuscht und verärgert. Mir fiel ein, daß er, falls er mir hätte absagen wollen, unter »Leif Gone« von der Auskunft keine Telephonnummer bekommen hätte. Wenn Knut überhaupt schlau genug war, an so etwas wie die Auskunft zu denken. Doch da kam eine kräftige, große Gestalt mit angegrautem, krausem Haar und platter Nase auf mich zu.
»Herr Gooone? Ich bin’s.«
Eine harmlos klingende, überraschend helle Stimme kam aus seinem schweren, gedrungenen Körper.
»Herr Leerdam, ich habe auf Sie gewartet, ich dachte schon, Sie kommen gar nicht mehr.«
»Tschuldigung … hab mich verfahren, falscher Bus, das is nämlich nich die Neun, sondern die Einhondertdreijunzwanzich, ich kenn mich hier nicht so aus, war noch nie in dieser Gegend … aber tut mir leid, daß Sie auf mich warten mußten … hab vielleicht was zur Entschädigung für Sie in meinem Anorak.«
Knuts dicke, kräftige Hand verschwand in seiner Manteltasche, und während ich noch über seine Sätze nachdachte, holte er einen kleinen Schlumpf, der auf einer Harfe spielt, hervor. »Der Musik-Schlumpf«, erläuterte er mir mit breitem Lächeln, »der macht Ihnen wieder gute Laune!«
Aber ich war verwirrt und nicht in der Lage, auf die fröhliche Kumpelschiene einzusteigen, ich starrte nur entsetzt und voller Ekel auf seine kräftigen roten Hände und dachte an die Bilder von meiner kleinen Schwester, die jetzt älter wäre als ich, und ein sehr sonderbares Gefühl, das ich nur von ganz früher kannte, überkam mich. Ich merkte, daß ich anfing zu zittern. Ich bewegte meine Lippen, erst lautlos, dann flüsterte ich: »Bring mich um.«
Ich wiederholte es mit flehender Stimme: »Bring mich um.«
Dann sagte ich in englisch ebenso schnell und leise in sein perplexes Gesicht: »If you need anything, it’s here.«
Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Lawrence hatte das gesagt und Kondome und Gleitcreme damit gemeint, und ich gab meinem befremdet guckenden Gegenüber jetzt den Filzkasten vom Schrottplatz. Knut öffnete den Kasten nicht einmal, er sah mich nur völlig bedeppert an, wie ein Tier, dem man Tricks beibringen will, die es nicht versteht. Dann runzelte er die Stirn. Ich zitterte und wartete auf seine Reaktion. Ich fixierte seine blauen, undurchdringlichen Kinderaugen. Er regte sich nicht. Er schien nachzudenken. Dann, plötzlich, begann er schallend zu lachen, er schlug sich auf die Schenkel, er grölte und hatte Tränen in den Augen.
»Ich kann dir einen Ort sagen, wo se dich wieda heile machen!« brachte er unter Lachen hervor. »Du … du krankes … doofes … Huhn!« kam es aus ihm heraus.
An diesem Punkt beginnt die große Leere in meinem Kopf. Ich haßte ihn plötzlich unbändig, wie er so dastand und mich auslachte, und ich griff wahllos nach irgendwelchen Gegenständen auf dem ersten der Müllberge neben uns und schlug auf ihn ein.
Aber ich will und kann darüber nicht weiter schreiben. Ich habe Kopfschmerzen. Ich bin müde. Ich will zurück zu meinen Kästchen.
Im Innern des Turms
Sie sitzt auf dem alten Buffet, ohne sich zu bewegen. Manchmal, wenn sie sich zurücklehnt, höre ich das feine Geräusch, wie der Stoff ihres T-Shirts an den blau-weißen Tellerrändern entlangstreicht. Sonst ist es still. Bis auf das Pochen in meinen Schläfen, meinen Handgelenken, den Kniekehlen. Gelegentlich ein Rascheln draußen im Gras, ein Klappern der Dachziegel, ein fernes Auto. Wenn Julia ihre Position verändert, ein Bein über das andere schlägt, blitzen ihre silbernen Sandalen auf, ein Blitzen, das mich zusammenzucken läßt. Vielleicht merkt sie das, sie schlägt die Beine über, noch einmal und noch einmal. Das Zucken der Forellen im Bach, die wir vorhin beobachtet haben, das Glitzern des Wassers, der Steine unter ihren unruhigen Sandalen. Um ihr linkes Fußgelenk (ich schreibe mit links; wenn ich nicht weiß, ob ich nach links oder rechts abbiegen soll, biege ich immer nach links ab, sagt sie) hängt ein türkisfarbenes Band, wie ein Geschenkband, aber aus Metall.
»Wollen wir uns ins Gras hinlegen oder den Turm erforschen, Less?«
Ich heiße Lester, Lester Schwarz, aber sie nennt mich einfach Less. Less White. Ich wußte nicht, daß Schwarz in Deutsch eine Farbe ist.
Julia beugt sich vor, das Fernglas baumelt an ihrer linken Schulter.
»Wenn die Treppen nicht zu morsch sind?«
Bei einem unserer seltsamen Ausflüge haben wir uns gestritten, in einer Heftigkeit, mit der ich mich selten gestritten habe, schon gar nicht mit jemandem, den ich kaum kenne. Jetzt erinnere ich mich an unsere erste Tour: Julia wollte eine Ruine bei Charleston, ein stillgelegtes Fabrikgebäude, besichtigen, um sich darin ein Moosbett anzulegen und dort ein Stück ihrer Lieblingstorte zu essen. Mein Job dabei war, ihr auf dem Weg dahin zu helfen, denn sie hat einen phänomenal schlechten Orientierungssinn, und außerdem sollte ich sie auf ihrem Moosbett, die Torte verspeisend, fotografieren.
»Ich sammle schöne Orte und kröne sie mit mir«, hat sie mir auf der Rückfahrt ins Ohr geflüstert. Ich sagte nicht, welche Vorstellungen ich hatte, wie man gemeinsam diese Orte krönen könnte. Sie hat mir ihre leicht gebräunte Hand aufs Bein gelegt, ich hatte Shorts an wegen der Hitze, und gesagt: »Nächstes Mal bringe ich auch dir ein Stück Kuchen mit!«
Das hielt ich für ein gutes Zeichen.
»Ich will auf den Turm!« ruft sie jetzt.
Das Porzellan hinter ihr klappert leise, blau-weiß bricht sich der Himmel über ihrem langen Haar, das mich an einen Wasserfall erinnert. Als ich ihr das sagte, meinte sie nur spöttisch: »Ihr Amerikaner seid alle so kitschig, wie gut, daß ich hier nicht ewig leben muß.«
Sie springt auf, Trägheit und Aktivität wechseln bei ihr unberechenbar, und läuft zielstrebig auf die große Wendeltreppe zu. Ich folge ihr in einigem Abstand. Ihre Sandalen funkeln vor mir auf der halbverfaulten Treppe. Wenn wir bis nach oben laufen wollen, müssen wir Hunderte dieser morschen Stufen nehmen.
»Julia?«
Sie reagiert nicht. Ich glaube, ich habe aus Versehen wieder »Dschulia« gesagt, dann antwortet sie nämlich einfach nicht.
»Bitte, hör mir zu!«
Sie dreht sich um, guckt genervt.
»Wirst du schon wieder feige?« ruft sie.
»Hör mal, ich möchte mir hier nicht das Genick brechen!«
»Oben ist es bestimmt herrlich!«
Sie wirft einen Blick auf ihren Leinenbeutel, in dem sie die Moospolster mitgenommen hat. Auf dem Rücken trägt sie in einem bunten Rucksack, den sie in Mexiko gekauft hat, den Kuchen und ihre Holunderbeersaftflasche. Sie hat sich jetzt ganz zu mir umgedreht, ihr Blick ist fest auf mich gerichtet.
»Was soll passieren, es wird schon nicht die ganze Treppe einbrechen!«
Mit ihrem harten deutschen Akzent bekommt jeder ihrer Sätze eine zusätzliche Schärfe. Ich wünschte manchmal, ich könnte auch so reden, aber die Worte gelangen weich und geschmeidig wie Gummi aus meinem Mund.
Bei jedem meiner Schritte, sie ist bestimmt schon einen Absatz weiter, taste ich vorher behutsam den Boden ab. Endlich bin ich in der ersten Etage. Julia hat erstaunlicherweise auf mich gewartet.
»Seltsam, wie man einen alten Wasserturm umgebaut hat!«
»Das sieht aus wie eine Funkzentrale mit den alten Kabeln hier.«
»Stell dir vor, du fällst in einen Wasserturm, und um dich nichts als Wasser und Mauern.«
»Das möchte ich mir lieber nicht vorstellen!« sage ich.
»Aber es wäre eine angenehme, ruhige Art zu sterben, ohne Leute um einen herum, die nerven, irgendwie erhaben.«
»Da möchte ich lieber auf einem Berg unter einem Baum sterben.«
»Eigentlich ist es schade, daß man nicht verschiedene Arten zu sterben ausprobieren kann, Angst ist so ’ne blöde, überflüssige Sache …«
Ob sie sich vorstellen könnte, ein Kamikaze-Flieger zu sein, frage ich sie, weil mir das immer unbegreiflich war. Doch, sagt sie, wenn man sich’s traut, wär’s die beste Art zu sterben überhaupt. Einfach nur ein Ziel, ein Gedanke, eine Überzeugung, keine Abwege, Abgründe. Sie klopft an die dicke Wand des Turms, winzige rote Tierchen laufen über den Stein.
»Ach, die Fenster hier sind ja schön!«
Im Zuge der Umfunktionierung des Turms hat man offenbar einige Fenster eingesetzt, deren Scheiben zum Teil fehlen oder kaputt sind. Die offenen Flügel stoßen durch den leichten Wind aneinander; das leise Geräusch erinnert mich an das sanfte Stühle-Zurechtrücken vor dem Abendessen früher in der Wohnung meiner Eltern – dieses leise, erwartungsfreudige Geräusch.
Julia betrachtet mich von einem der offenen Fenster aus. Dann beugt sie sich nach hinten, so daß ihre Haare im Wind wehen, und sagt: »Rapunzel mich!«
Sie sieht mich an.
»Rapunzel mich.«
Jetzt fängt sie an zu lachen. Sie amüsiert sich immer, wenn ich irgend etwas, das sie auf Deutsch sagt, nicht verstehe. Ich habe auch schon versucht, ihr einige Fallen zu stellen, aber ihr englischer Wortschatz ist leider ziemlich groß. Das Wort eben klang irgendwie unschön und aggressiv. Eine Sekunde muß ich an »rupture« denken. Aber das Flattern ihrer Haare war sanft.
Sie hüpft auf den nächsten Treppenabsatz zu und stürmt hoch. Ich beschließe, die Holzbohlen nicht zu genau anzusehen, um nicht in Panik zu geraten, da passiert es schon: Eine Stufe knirscht und zerbricht unter meinen Füßen, ich rutsche einen halben Meter tiefer.
»Less, was machst du für einen Mist, deine dämliche Angst hat dich schwer gemacht!«
Kalter Schweiß ist mir ausgebrochen. Auch wenn ich mir heute fest vorgenommen hatte, Julia beim Kuchenessen einfach zu küssen, werde ich ihr definitiv nicht nach oben folgen. Zum Glück weist mein Bein außer einigen blutigen Schrammen keine Verletzungen auf, und ich krieche auf allen vieren zurück auf die untere Ebene, egal wie lächerlich das aussieht. Ich möchte weder für einen Glauben noch für eine Regierung noch für einen anderen Menschen sterben.
Unter dem offenen Fenster, an dem eben noch Julia gestanden hat, sitze ich nun und lege den Kopf auf mein zerschundenes rechtes Knie. Der Wind fährt über meine verschwitzte Stirn, und das Klappern der Fensterflügel stimmt mich sehnsüchtig. Von oben dringt das leise, behende Klappern der Sandalen, das Blitzen, das ich jetzt nicht sehen kann, aber fast auf meiner Haut spüre. Wäre die Stufe ganz gesplittert, wäre ich ungefähr zehn Meter in die Tiefe gefallen, auf Stahlträger und Beton. Julia ist die entscheidenden Kilo leichter als ich, hoffentlich. Diesmal wird wohl niemand ihren Schmaus an einem schönen Ort dokumentieren. Schon höre ich ihre Schritte wieder nach unten eilen.