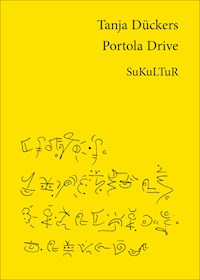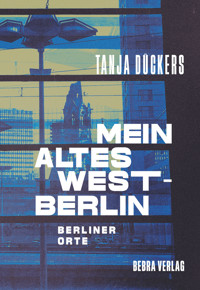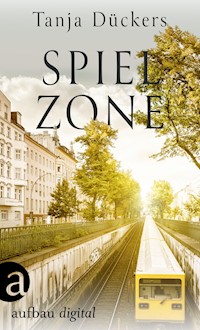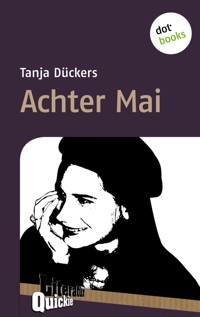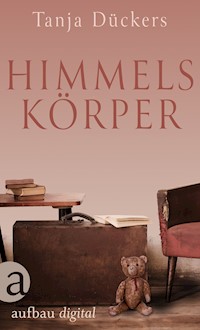
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Frauen, drei Generationen: Zwischen Berlin und Polen ist eine junge Frau einem Familiengeheimnis auf der Spur
»Es gibt so viel Ungeklärtes in unserer Familie, das mir plötzlich keine Ruhe mehr läßt. Als hätte eine Art Wettlauf mit der Zeit begonnen ... vielleicht ist es ein unbewußter Drang, zu wissen, in was für einen Zusammenhang, in was für ein Nest ich da mein Kind setze ...«
Freia, die junge Meteorologin aus Berlin, ahnt mehr und mehr, daß es in ihrer ach so normalen Familie nicht nur ein Geheimnis gibt, weswegen vertuscht, gelogen, verdrängt wird. Was immer Freia erfragt oder vermutet, alles scheint 1945 begonnen zu haben - an jenem bitterkalten Morgen im Krieg, als die Großmutter mit Freias Mutter, damals ein Mädchen von fünf Jahren, auf einem der letzten Schiffe aus Westpreußen über die Ostsee fliehen wollte. Freia, die jetzt selbst ein Kind erwartet, muß dieser Geschichte auf den Grund gehen, um sich von der Vergangenheit zu befreien ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Drei Frauen, drei Generationen: Zwischen Berlin und Polen ist eine junge Frau einem Familiengeheimnis auf der Spur
»Es gibt so viel Ungeklärtes in unserer Familie, das mir plötzlich keine Ruhe mehr läßt. Als hätte eine Art Wettlauf mit der Zeit begonnen … vielleicht ist es ein unbewußter Drang, zu wissen, in was für einen Zusammenhang, in was für ein Nest ich da mein Kind setze …«
Freia, die junge Meteorologin aus Berlin, ahnt mehr und mehr, daß es in ihrer ach so normalen Familie nicht nur ein Geheimnis gibt, weswegen vertuscht, gelogen, verdrängt wird. Was immer Freia erfragt oder vermutet, alles scheint 1945 begonnen zu haben – an jenem bitterkalten Morgen im Krieg, als die Großmutter mit Freias Mutter, damals ein Mädchen von fünf Jahren, auf einem der letzten Schiffe aus Westpreußen über die Ostsee fliehen wollte. Freia, die jetzt selbst ein Kind erwartet, muß dieser Geschichte auf den Grund gehen, um sich von der Vergangenheit zu befreien …
Über Tanja Dückers
Tanja Dückers wurde 1968 in Westberlin geboren. Sie studierte Nordamerikanistik, Germanistik und Kunstgeschichte. Neben Prosa und Lyrik schreibt sie Essays, Hörspiele und Theaterstücke. Sie erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, die sie u.a. nach Kalifornien, Pennsylvania, Gotland, Barcelona, Prag und Krakau führten. Sie lebt in Berlin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Tanja Dückers
Himmelskörper
Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
1: Bahnsteig, abends
2: Cirrus Inflatus
3: Blaue Stunde
4: Waldgeister
5: Die Insel
6: Cirrus Opacus
7: Verschwundene Zöpfe
8: Die Zwillinge
9: Der Krieg ist eine Fliege …
10: … eine Stadt aus Marzipan
11: Wieland
12: Und Beuys ist tot
13: Lakritz
14: Der Imker
15: Die rote Tür
16: Bernsteinketten
17: Wasserpfeife
18: Das leuchtende Schiff
19: Leere Kühlschränke, goldene Kästen
20: Nachtkammern
21: Honigglas
22: Cirrus Perlucidus
23: Aino
24: »Himmelskörper«
Danksagung
Impressum
»Geliebte Wega – rast uns mit fünfundsiebzigtausend Stundenkilometern entgegen, vielleicht platzt sie eines Tages in unser System hinein und kreist dann mit unserer Sonne rings um die gemeinsame Gravitationsmitte. Es wird wunderbar sein, zwei Sonnen zu sehen …«
Stanisław Ignacy Witkiewicz, »Das Geheimnis eines Septembermorgens«
»[…] die allgemeine Subordination ging so weit, daß ein Sonnenaufgang ohne Weckruf in diesem Staate keine Gültigkeit hatte.«
Stanisław Lem, »Die erste Reise«
»Der Sonnenuntergang ist schön, aber mein fester Wille, von Tag zu Tag härter geworden, sagt mir, daß es nun genug ist, daß man den Anblick nicht in die Länge ziehen darf, man sollte sich jetzt umdrehen und den Hügel hinabsteigen.«
Edward Stachura, »Ein lichter Aufenthalt am Fluß«
»Im besonnten Berghang klafft plötzlich eine kohlschwarze Höhle. Der Führer steckt Kerzen an. […] Warum wurde gerade dieser Ort zur Wiege des Himmelsgottes auserwählt? Hätte er nicht vielmehr auf einem Berggipfel geboren werden müssen oder in einem weiten, sonnenerfüllten Tal? Warum wurde sein Ursprung in die Tiefe einer Höhle verlegt?«
Zbigniew Herbert, »Versuch, die griechische Landschaft zu beschreiben«
»›Vielleicht beschert uns der liebe Gott noch irgendeinen Krieg‹, griff der Bauer seufzend ein anderes Thema auf und sah zum Himmel, mit der Reflexbewegung des Landwirts, der voraussehen möchte, was das Morgen bringt: Regen? Gutes Wetter?«
Józef Mackiewicz, »Requiem auf ein Land«
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
1: Bahnsteig, abends
2: Cirrus Inflatus
3: Blaue Stunde
4: Waldgeister
5: Die Insel
6: Cirrus Opacus
7: Verschwundene Zöpfe
8: Die Zwillinge
9: Der Krieg ist eine Fliege …
10: … eine Stadt aus Marzipan
11: Wieland
12: Und Beuys ist tot
13: Lakritz
14: Der Imker
15: Die rote Tür
16: Bernsteinketten
17: Wasserpfeife
18: Das leuchtende Schiff
19: Leere Kühlschränke, goldene Kästen
20: Nachtkammern
21: Honigglas
22: Cirrus Perlucidus
23: Aino
24: »Himmelskörper«
Danksagung
Impressum
1Bahnsteig, abends
Ich hatte das Foto nicht dabei. Unruhig durchwühlte ich meine Reisetasche, durchblätterte einen Notizblock, eine Zeitung, schlug meinen Paß auf, suchte zwischen Bahn-Card und Bibliotheksausweis, zwischen Thermoskanne und getrockneten Früchten das kleine Schwarzweißbild, das ich gestern aus dem Foto-Schuhkarton genommen und auf meinen Schreibtisch gelegt hatte. Ich biß mir vor Wut auf die Lippen. Als ich den Kopf hob, begegnete ich dem Blick eines stark geschminkten jungen Mädchens, der nicht Mitleid, sondern Verachtung ausdrückte. Schließlich schlug ich den weißen Ordner mit den vielen Klarsichtfolien wieder auf, einen Ordner, der mich seit Jahren weite Reisen unternehmen ließ.
»EINE BITTE UM WOLKENBILDER. – Die Internationale Meteorologische Konferenz hat beschlossen, bei ihrem nächsten Treffen, 1894 in Uppsala, einen farbigen Wolkenatlas zu veröffentlichen, um die typischen Wolkenformationen nach der Nomenklatur von Hildebrandsson und Abercromby darzustellen. Das mit der Durchführung betraute Komitee bittet um die Ausleihe von farbigen Zeichnungen oder Gemälden nach der Natur, damit die geeignetsten in dem Atlas repoduziert werden können. Solche Wolkenstudien können zur Beurteilung an das amerikanische Mitglied der Kommission geschickt werden, A. Lawrence Rotch, Blue Hill Observatory, Readville, Massachusetts. Sie werden den Verleihern in gutem Zustand zurückgegeben.«
Mit dieser 1892 im American Meteorological Journal erschienenen Anzeige – nur ein typisches Beispiel von vielen ähnlichen Aufrufen – wollte ich morgen meinen Vortrag beginnen. Ich sortierte meine Notizblätter, die lose im hinteren Teil des Ordners gelegen hatten, auf meinem Schoß. Der Treibhauseffekt, die Klimaerwärmung würden natürlich ein Thema auf dem Kongreß sein, auch die Frage, wie man ohne Mitarbeit der USA an einem wirksamen Abkommen zur Reduktion der Luftverschmutzung arbeiten könnte. Es wurden Beiträge aus London, Rom, Kioto, Sydney und Wellington erwartet, auf die ich sehr gespannt war, aber auch Referenten wie Dr. Tuben aus Wien, der über »Esoterik und Exosphäre« sprechen würde, interessierten mich, weil sie unkonventionelle Ansätze versprachen.
Ich selbst wollte einen historischen Überblick über die verschiedenen Wolken-Klassifikationsmodelle geben, um anschließend ein leidenschaftliches Plädoyer für einen neuen, umfassenderen Wolkenatlas mit internationaler Beteiligung zu halten.
»237 Kilometer pro Stunde« verriet die flackernde Anzeige. Ein kleines Kind neben mir weinte im Rhythmus des schaukelnden Zuges vor sich hin. Der Papierstapel auf meinem Schoß zitterte.
»Goethe glaubte, die Anziehungskraft der Erde und die Elastizität der Luft bewirke die Formung des atmosphärischen Wasserdampfs zu wolkenartigen Gebilden«, las ich meine in der Unruhe der letzten Wochen niedergeschriebenen Zeilen, »diese Ansicht gab er erst auf, als er 1815 eine Übersetzung von Luke Howards Abhandlung gelesen hatte. Mit Howards neu eingeführten Wolkentypen: Stratus, Kumulus, Zirrus und Nimbus betitelte er vier Gedichte – unter dem Obertitel ›Howards Ehrengedächtnis‹.«
Mein Doktorvater Dr. Remler würde wenig Verständnis für meinen poetischen Exkurs aufbringen. War das nicht schon immer so gewesen? Im Studium hatte ich zur verachteten Minderheit gehört, die Dr. Tubens ausufernden, Kunst- und Kulturgeschichte und selbst Parapsychologie berührenden Gastvorträgen gelauscht hatte.
Einen Moment schaute ich aus dem Fenster: Stratocumulus, Fractocumulus, gemischt mit Altocumulus Castellanus, turmförmigen Haufenwolken, darunter geziegelte Häuschen, Felder, ein Traktor, winzige Menschen, die auf den Boden anstatt in den Himmel guckten; kleine Regentropfen fingen an, schräg das Zugfenster zu streifen.
Peter im blauen Overall, im Garten, Kirschen über die Ohrmuscheln gehängt, lachend. Mäxchen mit Krücken am Bleichen See, vermutlich im Gespräch mit Silberlügenaalen, sehr nachdenklich. Jo auf einer Anhöhe stehend, mit bunter Daunenjacke, eine Kamera in der Hand. Paul auf Peters Arm, ihn mißtrauisch beäugend: Ich starrte auf die Fotos, die ich aus dem zerschlissenen Umschlag, den ich auf jeder Reise dabeihabe, gezogen hatte. Ein Foto jeder Person. Das genügte. Ich besaß keine Alben zu Hause.
Ich blickte noch einmal auf das Bild von Peter mit den Kirschen über den Ohren und mußte wieder daran denken, wie mein Vater früher taubengraue Briefe an »Gott« geschrieben und ins Meer geworfen hatte. »Papa, was hast du denn Gott geschrieben?« fragten Paul und ich. Peter antwortete nur: »Das bleibt mein Geheimnis.« Nach dem Abendessen stand er oft auf und verschwand. Erst im Morgengrauen kehrte er mit zerzausten Haaren und Blättern an den Ärmeln seines wetterfesten Anoraks zurück. Manchmal erzählte er uns, er habe im Wald mit Elfen gesprochen. Und dann malte Peter diese Elfen für uns. Paul und ich stritten oft, wer denn diese Zeichnungen jetzt in seinem Zimmer anstelle der langweiligen Tierposter aus der Apotheke aufhängen durfte. Meine Mutter lachte nur, wenn wir sie baten, etwas für uns zu zeichnen. »Das kann ich nicht«, sagte sie verlegen. Nicht einmal Silberlügenaale wollte sie malen, dabei gab es doch wirklich nichts Einfacheres. Man brauchte nur einen silbernen Edding dafür. Sie glaubte immer, etwas nicht zu können.
Der Regen wurde stärker, und bald waren die Häuschen, die Felder und die Traktoren nur noch rote, gelbe und grüne Flecken, begleitet von einem beständigen Prasseln und Trommeln. Pe-ter. Pe-ter. Pe-ter. Peter, der Kopfschmerzen hat, den eine Wespe gestochen hat, der am Strand auf eine Qualle getreten ist. Der am ersten Urlaubstag in Dänemark alle mit seiner schlechten Laune quälte, weil er keinen Zigarettenautomaten neben der Blockhütte fand. Der seine lustigen Geschichten schrieb, bis man vor Müdigkeit, und weil auch Lachen auf die Dauer anstrengend ist, nicht mehr konnte.
Weder Paul, der aus dem Stegreif Geschichten erfinden konnte, noch ich, das Mathe-As und Knobeltalent, und schon gar nicht meine Mutter, von der jeder glaubte, sie und ihre Frauenzeitschriften, ihren Kräutergarten und ihre Königsberger Klopse in- und auswendig zu kennen, standen im Mittelpunkt unserer Familie. Nein, es war immer Peter. Pe-ter. Die Regentropfen wiederholten seinen Namen mit geisterhaften nassen Zungen. Pe-ter. Pe-ter. Hatte schöne braune Augen, in denen der Schalk geschrieben stand, und Arme, die uns hoch in die Luft werfen konnten, als wir klein waren.
Breite Schlieren rannen die Scheiben entlang. Vom Fahrtwind wurde der rasche Weg der Wassertropfen nach unten gebremst, und sie liefen wie im Gleichschritt quer übers Fenster. Noch einmal versuchte ich, mich auf meine zum Unverständnis meiner Kollegen mit Füllfederhalter zu Papier gebrachten Sätze zu konzentrieren. Luftmassen, Haufenwolken, Kaltluftfronten schoben sich an mich heran. Doch bald wanderten sie weiter, die Gedanken, wie die eigensinnigen Regentropfen auf der Zugscheibe: Mein Vater, kein Held mehr, mit grauer Haut und fahrigen Bewegungen. Immer wieder versuchte er, vom Nikotin loszukommen, lief nachts in der Wohnung herum, fraß Schokolade. Und irgendwann rochen seine Lippen, seine Finger, seine Haare doch wieder nach Rauch. Paul und ich verstanden nicht, daß Peter irgend etwas nicht konnte. Etwas, das sich in nichts als Rauch auflöste, brachte ihn zum Weinen. Das Trinken dagegen hatte er sich abgewöhnt. Viele Jahre hatte Peter jeden Tag ein, zwei Flaschen Wein getrunken. Irgendwann hörte er damit von heute auf morgen auf und fing nie wieder an. Anfangs malte er sich noch jeden Abend mit Filzstiften, die er von uns Kindern borgte, eine Flasche Wein auf die Serviette neben dem Besteck, dann ließ er auch das. »Diese Glühstimmel sind teuflischer als eine Weinbrandflasche, mit der man jemanden erschlagen könnte«, sagte er einmal, bevor er durch die Hintertür in seine Praxis schlich.
Ich sah mein Spiegelbild in der Zugscheibe zittern und zerrinnen. Zwischen den platzenden Regentropfen suchte ich meine Augen. Die dunklen Augen und die dichten Wimpern, die ich von Peter geerbt hatte. Nicht nur das. Wie er stand auch ich gern im Mittelpunkt. Ich dachte an meine Liebhaber vor Christian: Sie waren geduldig an meiner Seite in Gummistiefeln am Strand entlanggestapft, während ich nur in den Himmel guckte und selten zu ihnen hinüber. Wenn es eine besondere Sternkonstellation gab, war ich nächtelang mit dem Fernrohr unterwegs. Bei den Männern konnte ich mir immer viel herausnehmen: Im Studienbereich Meteorologie lag der Frauenanteil bei 17 Prozent.
Ich versuchte wieder, einen Blick auf meine Unterlagen zu werfen, aber als ich anfing, die Überschrift als zitternden schwarzen Regenwurm zu sehen, spürte ich, daß Tränen in meine Augen getreten waren. Ich lehnte den Kopf ans Fenster und schaute in den Himmel, suchte ihn unwillkürlich nach Cirrus Perlucidus ab, dem durchsichtigen Cirrus, der einzigen Cirrus-Formation, die ich bisher nur von Beschreibungen aus verschiedenen Wolkenatlanten kannte und die ich seit Jahren überall auf der Welt suchte. Cirrus Perlucidus ist nämlich nicht zu verwechseln mit Cirrus Translucidus, dem durchscheinenden Cirrus, aber ihre Abgrenzung ist die Frage einer bisher niemals wissenschaftlich determinierten Nuance. Wann ist etwas durchscheinend, wann durchsichtig? Sonder- oder Begleitformen wie Arcus, eine Wolke mit Böenkragen, oder Virga, mit verdunstenden Fallstreifen, waren fotografisch dokumentiert worden, nur mit Cirrus Perlucidus wollte sich niemand recht beschäftigen. Selbst Luke Howard, mein Idol der Wolkenforschung aus dem 19. Jahrhundert, auf dessen Wolkenklassifikation noch alle gegenwärtigen Systeme Bezug nehmen, hat sich nicht mit der Unterscheidung dieser beiden Typen befaßt.
Die wenigen bisher in der Forschung erstellten Aufnahmen machten das Eigenartige, Fremde, Ungreifbare dieser Wolkensorte nicht deutlich, sie sah einfach nur aus wie eine schwache Ausprägung des gemeinen Cirrus Duplicatus oder gar des grätenförmigen Cirrus Vertebratus. Perlucidus war schließlich von geringem wissenschaftlichem Interesse, da er nicht an Unwetterbildung beteiligt sein konnte; aufgrund seiner hohen Sonnenlichtdurchlässigkeit hatte er auch keinen Einfluß auf die Landwirtschaft. Er war, in 13000 Meter Höhe, nichts als ein Hauch – nichts und niemand interessierte sich für diese Wolke, die vielleicht nicht einmal den Namen »Wolke« verdiente, so wenig war von ihr zu sehen –, manchmal mußte ich an die geisterhaften Körper der Quallen denken, die ich vor Jahren im Aquarium von Osaka bestaunt hatte.
Das Kind neben mir klopfte jetzt mit einer bunten Rassel auf meine Oberschenkel und lachte. Lautstark schimpfend bemühte sich seine Mutter, ihm das Spielzeug abzunehmen. Mit einem Blick auf meinen Bauch machte sie eine Bemerkung über das, was mir noch Übles bevorstünde. Dann rang sie ihrem Kind endlich die Rassel ab und schüttelte sie, während sie mich scharf ins Auge faßte, heftig wie eine Hexe. Ich senkte den Blick und holte, um beschäftigt zu wirken, noch einmal den Briefumschlag mit den Fotos aus meiner Reisetasche hervor. Beinahe wären mir die Bilder aus der Hand gefallen, so sehr schaukelte der Zug gerade. Und plötzlich rutschte in der nächsten Kurve aus meinem provisorisch angelegten Wolkenatlas das Bild von Renate heraus. Ich mußte es heute morgen sehr gedankenverloren eingesteckt haben. Mich überfiel unendliche Erleichterung.
Jahrelang hatte ich nur Bilder von Peter, Paul, Jo und Mäxchen mit mir herumgetragen. Erst Christian, dem ich in der Straßenbahn die Fotos gezeigt hatte, machte mich darauf aufmerksam, daß Renate fehlte; ich war peinlich berührt. Bei meinen Eltern hatte ich in vielen alten Alben geblättert und überlegt, welches Foto von Renate ich mit mir herumtragen wollte. Gestern wußte ich es plötzlich: Meine Mutter, so alt wie ich jetzt, ausnahmsweise nicht nur menschliche Haltevorrichtung für niedliche lockige Kleinkinder, sondern einmal nur sie selbst: Sie sitzt auf einer Schaukel, und ihre langen hellblonden Haare fliegen im Wind. Die Schaukel steht auf einer Art Anhöhe, ein Heer von dunklen Zwergtannen säumt den erdigen Platz, als wäre es ehrfürchtig vor meiner schaukelnden Mutter zurückgetreten. Renate lacht, aber ihr Blick ist nicht selbstgefällig auf die Kamera gerichtet. Sie schaut, so sieht es aus, in den Himmel, und der Wind bringt ihr Haar endlich einmal in Unordnung, läßt ihren Rock aufbauschen und ihre Lippen sich kräuseln. Es scheint, als sei das Foto geschossen worden, ohne daß sie es gemerkt hat, denn sonst hätte sie bestimmt ihren Rock zurechtgeschoben und das Haar aus dem Gesicht gestrichen. Der Himmel ist von unzähligen Cirrus Undulatus bevölkert, und die Kargheit der Landschaft steht im Kontrast zur Bewegtheit dieses wellenförmig aufgelockerten Himmels – und zum Schwung der Schaukel mit meiner Mutter.
Der Zug hielt in Wolfsburg, einige Minuten vergingen. Dicke Regentropfen trommelten gegen die Scheibe. Als ich mich nach meiner Mineralwasserflasche bückte, wurde mir übel. Ich lehnte mich zurück und versuchte, langsam und tief zu atmen. Mir stiegen wieder Tränen auf, das Foto vor meinen Augen verschwamm.
Der Gedanke, daß Renate meine Mutter ist, kam mir unwirklich vor. Mit dem Bild einer Mutter verband ich eine laute, herrische Person, von der man abhängig ist und gegen die man sich gleichzeitig auflehnt. Mutter: Das ist eine personifizierte Nabelschnur. Doch Renate war anders: Leise war sie, oft flüsterte sie ohne Grund. Sie war sehr schlank und hübsch mit ihrem feingeschnittenen slawischen Gesicht, den blonden langen Haaren und den blauen Augen, doch sie schminkte sich nie, zog sich möglichst unauffällig an, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ihre halbherzigen Versuche, mich für das Kochen zu interessieren, gab sie bald auf. Statt uns Kindern im Haushalt ein paar Pflichten zu übertragen, erledigte sie das meiste stillschweigend selbst. Mit der fatalen Folge, daß ich erst nach meinem Auszug, mit über Zwanzig, kochen lernte und mein Bruder bis heute kein Bett beziehen kann, ohne daß sich die Daunendecke in einer Ecke des Bettbezugs zusammenknüllt.
Wir Kinder hatten immer das Gefühl, ein wenig Angst um unsere Mutter haben zu müssen. Es war und blieb uns ein Rätsel, warum sie damals als Masseurin und Orthopädieassistentin so erfolgreich gewesen war. Man konnte sich kaum vorstellen, wie sie den Rücken eines Mannes derart durchkneten konnte, daß er aufschrie vor Schmerz. Aber sie konnte das. Wenn sie, wie so oft, mit geradem Rücken abends am Tisch saß und Peter sich neben ihr genußvoll auf dem Sofa fläzte, schien es mir, daß sie ihre Energien sehr viel sinnvoller einsetzte als er. Peter nahm jede Herausforderung an, die ihm das Leben bot, um dann allerdings über die Begleiterscheinungen seiner chronischen Überforderung wie Nervosität, Schlafmangel und das extreme Rauchen zu klagen. Manchmal kam es mir vor, daß meine Mutter aus der Betrachtung der Tannen vor unserem Fenster mehr Kraft schöpfte als mein Vater aus all seinen exzessiven Weinprobe-Abenden, Kneipennächten, spontanen Kinobesuchen oder Kurzreisen.
Doch meistens fand ich meine Mutter langweilig. Still, wie sie war, gab es keine Reibung, kaum Kontakt. Ich vertiefte mich in mein Studium, zog von zu Hause aus, nahm ein Stipendium in Island wahr, schrieb ihr gelegentlich nichtssagende Ansichtskarten. Manchmal deutete ich darauf an, daß ich von all den vielen aufregenden Dingen, die ich in Island erlebte, nach meiner Rückkehr ausführlich berichten würde, doch als ich wieder da war, schenkte ich Renate lediglich einen selbstgebastelten Kalender mit Geysir-Aufnahmen zum Geburtstag. Peter hingegen erzählte ich nächtelang von meinen Kommilitonen, unserem Projekt und der sagenhaften Natur.
Manchmal, wenn meine Mutter regungslos im Wohnzimmer vor ihren Strohblumen stand, übersah ich sie schlicht. Sie stand da vor der Fensterbank, und wenn sie nach zehn Minuten ein Wort sagte, ich lag längst mit einem Buch auf der Couch, fuhr ich zusammen. Meine Mutter hatte ein enormes Talent im Nicht-anwesend-Sein entwickelt. Mein Vater hingegen konnte gar nicht anders, als mit zerlesenen Zeitungen, zerknüllten Pfefferminzbonbontütchen und natürlich einer zum Schneiden dicken Luft Spuren zu hinterlassen.
Plötzlich fuhr der Zug langsamer und hielt mitten auf der Strecke an. Eine Minute verging, in der ich nur den Regen hörte. Dann raste weißrot wie ein verrückter Gedanke ein ICE an uns vorbei. Über uns rissen die Cumuluswolkenbänke auf, verteilten sich als feinfaserige Watte, und hinter ihnen leuchtete gedämpft die Sonne. Die letzten Irrläufer der Regentropfen streiften die Scheiben. Fest. Flüssig. Gasförmig … Mein Bruder und ich, wir waren flüssig. Ständig oszillierten wir zwischen Mutter und Vater, zwischen drinnen und draußen, der Stadt und dem Wald, mit- und gegeneinander, unruhig, jung, formlos. Paul oszillierte ganz besonders. Er hatte ein weicheres, unentschiedeneres Gesicht als Peter und lief oft stundenlang ziellos durch den Wald. Wenn er zwischen mir und Peter ging, streckte er eine Hand nach mir und eine nach Peter aus. Nie werde ich vergessen, wie er damals meine Kinderhand drückte, als Renate auf dem Pferd verschwand: Wir waren bei Onkel Kazimierz in Warschau gewesen und machten auf dem Rückweg halt bei einem Gestüt in Oberschlesien. Peter fachsimpelte mit allen möglichen Leuten, die halbwegs des Deutschen mächtig waren, über das, was er über Pferde wußte. Vermutlich hielten sie ihn für einen Tierarzt. Als er Paul auf ein Pony heben wollte, fing der an zu weinen, und ich versteckte mich schnell in einer Futterbaracke. Aus einem Spalt zwischen zwei Holzbohlen starrte ich hinaus. Auf einmal sah ich, wie meine Mutter sich auf ein großes weißes Pferd – kein Pony – setzte und jenseits der Einzäunung losgaloppierte. Sie trug einen roten Schal, der wie eine Fahne, ein stolzes Banner hinter ihr herflog, vom Wind aufgebläht und wieder zusammengestaucht. Mir verschlug es den Atem, ich stand hinter den Holzbohlen und konnte nichts tun außer zugucken, wie sie auf ihrem Schimmel zwischen den Birken verschwand. Ich weinte, als wäre sie für immer fortgeritten.
Bald darauf diskutierten die Leute aufgeregt in polnisch und deutsch, wo sie denn hingeritten sein könnte. Erst zwei Stunden später kam sie zurück. Mit vom Wind geröteten Wangen und flatterndem Schal. Sie beachtete Peter keine Sekunde, nur dem Pferdebesitzer drückte sie eine ordentliche Summe Złoty in die Hand. Mit keinem Wort äußerte sie sich zu dem Vorfall, weder damals noch irgendwann später. Als Peter ihr hilflos Vorwürfe machte, nickte sie wie ein Schulmädchen und fing an, Pauls Hemdkragen zurechtzurücken. Und jeder Ruck ging durch meinen Körper mit, denn Paul umklammerte meine Hand.
Die Abteiltür wurde aufgerissen, ein Schaffner mit gezwirbeltem Schnauzbart fragte nach in Wolfsburg Zugestiegenen.
Ich starrte hinaus in die Dämmerung. Ein leichter Bodennebel dampfte von den Feldern, als wären sie heiß wie Herdplatten. Und langsam wurde das ausglühende Rot vom Blau der Nacht verschluckt. Dieses besondere Blau, das für wenige Minuten unglaublich hell und durchdringend, wie Lapislazuli, wie der Sitz des versteckten Herzens des Himmels, leuchtete. Für einen Moment schoß mir die »blaue Stunde« und mein seltsames Gespräch vor einer Weile mit Renate durch den Kopf. Dann vergaß ich alles wieder.
Altocumulus verdichtete sich, eine stürmische, orangefarbene Glut inmitten eines violetten Ozeans aus Luft, nur um Minuten später dunkler als dieser zu werden. Würde diese geheimnisvolle Bühne, wie Dr. Tuben bisweilen den Himmel nannte, mir jemals einen Blick auf Cirrus Perlucidus gestatten? Oder würde ich die durchsichtige Wolke in 13000 Meter Höhe, die ich schon mit meinem ersten Wald-und-Wiesen-Feldstecher gesucht hatte, einfach nie erblicken können? Mir fiel wieder ein, daß Goethe an Caspar David Friedrich die Bitte herangetragen hatte, einen Satz Zeichnungen zu den von Howard klassifizierten Wolken anzufertigen. Doch Friedrich lehnte ab. Für ihn waren Wolken naturale Metaphern einer Grenzen und Gesetze überwindenden Freiheit – und die Vorstellung, sie auf eine Weise zu systematisieren, die er als aufgezwungene wissenschaftliche Ordnung betrachtete, erfüllte ihn mit großem Unbehagen.
Der Zug bremste ab, und ich sah die Buchstaben »Hannover« aus einem schwarzen zitternden Streifen heraus Konturen annehmen.
In zweieinhalb Stunden würde ich in Köln sein. Ich blickte auf den unspektakulären Bahnhof von Hannover und hoffte, daß der Zug bald abfuhr. Auf einmal zuckte ich zusammen. Da draußen lief meine Mutter!
Ich stand sofort auf, durchquerte das Abteil und trat an die Scheibe auf dem Gang. Das war sie, eine so perfekte Doppelgängerin konnte es doch gar nicht geben! Ich starrte auf den Bahnsteig. Es war zweifellos meine Mutter. In ihrem dunkelblauen langen Mantel, grauen Leinenhosen, mit einem geblümten Halstuch. Sie zog ihren kleinen Koffer auf Rollen hinter sich her. Siedend wurde mir der Zusammenhang bewußt: Noch am Vormittag hatte ich mit ihr telefoniert, dann hatte sie auflegen wollen, weil sie den Zug zu meiner Großmutter, deren Zustand sich verschlimmert hatte, seit mein Großvater gestorben war, erreichen mußte. Ich hatte nebenbei erwähnt, daß ich zu einem Kongreß fahren würde. Daß mein Zug nach Köln über Hannover fuhr und wir tatsächlich vorhatten, denselben Zug zu nehmen, war mir entgangen.
Die modernen ICE-Züge haben durchgehende Scheiben ohne Öffnungsmöglichkeit; ich überlegte, ob ich zur nächsten Tür hasten sollte. Neben mir standen eng gequetscht einige bepackte Mädchen und Jungen. Der Rucksack eines Hünen streifte mein Gesicht. Der Besitzer merkte es nicht einmal. Ich gab den Gedanken auf, meine Mutter zu überraschen, und starrte hinaus: Da lief sie, da – lief – sie.
Selten, wahrscheinlich noch nie seit dem Ausritt auf dem Gestüt in Oberschlesien, hatte ich Renates Anblick so in mir aufgesogen. Völlig unerwartet, wie sie hier auftauchte, nahm ich sie viel intensiver wahr. Gleichzeitig machte es mich verrückt, ihr nichts zurufen zu können, hinter der dicken Plexiglasscheibe des ICE gefangen zu sein. Wie oft hatte ich am Abendbrottisch neben ihr gesessen und nicht gewußt, worüber ich mich mit ihr unterhalten sollte. Wie oft habe ich sie beim Abwaschen allein gelassen, weil sie mich gelangweilt hatte und ich mir lieber von Peter auf dem Sofa etwas über Waldgeister erzählen ließ. Wenn sie jetzt doch wenigstens ein Handy gehabt hätte! Dann könnte ich sie mit dem Satz überraschen: Rate mal, wo ich bin?, und sie könnte schnurstracks an mein Fenster gelaufen kommen, und wir würden lachend, wenngleich tonlos, die Scheibe zwischen uns, voreinander stehen.
Sie ging zum Gleis auf der gegenüberliegenden Seite. Ihr Rücken war sehr gerade beim Gehen, ihr Schritt gemessen. Manchmal verfingen sich die Rädchen ihres Koffers in einer Bodenunebenheit, und er begann zu schlingern. Dann hielt meine Mutter inne und ging ganz langsam weiter. Jetzt wartete sie mit einem Grüppchen von Leuten vor einer Zugtür, ein Schaffner sprang heraus und ließ die Menschen einsteigen.
Ich war so erschüttert über unsere Unfähigkeit, unsere Reisepläne miteinander zu koordinieren, daß mir wieder Tränen aufstiegen. Hilflos schlug ich gegen die Scheibe. Da stand sie, meine Mutter, eine fremde Frau, ihre blonden Haare mit jener Haarspange zusammengehalten, die ich ihr letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt hatte, ein wenig ängstlich hielt sie ihr Gepäck fest. Ich lehnte meine Stirn erschöpft gegen die Scheibe.
Für einen Moment schoß mir ein furioser Hoffnungsschimmer durch den Kopf. Vielleicht fuhr Renate ja gar nicht zu ihrer Mutter …? Vielleicht hatte sie es deshalb versäumt, ihre Zugreise mit meiner abzustimmen. Diesen wilden Moment lang, in dem ich auf meinen linken Daumenknöchel biß, bis er weiß wurde, wünschte ich mir, daß sie eine geheimnisvolle Reise anträte, daß sie Rudolf heimlich treffen, daß er sie hier mit einem von seiner Nervosität und seiner Hast schon halb zerfledderten, doch farbenprächtigen Blumenstrauß vom Bahnhof abholen würde – doch auf Gleis 4 fuhr in fünf Minuten ein Regionalexpreß nach Minden ab, wo meine Großmutter lebte. Ich schloß die Augen und sah meine Mutter in einem weiten, vom Ostwind aufgeblähten Rock auf einer Schaukel – meine Mutter, die einmal als junge Frau die finnische Küste von Turku bis Kokkola abgefahren ist – die einzige Reise, die Peter und sie ohne Kinder unternommen hatten, in einem nicht enden wollenden Spätsommer. Seitdem wollte meine Mutter immer wieder mit uns allen dorthin, aber daraus wurde nie etwas. Peter und seine Wehwehchen, unsere Schularbeiten, das Haus, seine vielen Ecken, Winkel, Hängeböden und Kellerräume …
Allen ließ sie mit gesenktem Kopf den Vortritt: dem alten Mann mit dem flaschengrünen Hut, dem wild gestikulierenden Pärchen in identischen Anoraks, sie ließ auch den jungen Mann mit der umgedrehten Schirmmütze und das dünne Mädchen mit den weißblond gefärbten Haaren und den glitzernden Plateaustiefeln vor. Schließlich stieg sie ein: schnell, behende, mit einem Satz war sie drinnen.
Ich stand vor dem nicht zu öffnenden Fenster des ICE und versuchte, nicht zu weinen. Noch einmal stellte ich mir in einem trotzigen Aufbegehren gegen die Wirklichkeit vor, der Zug auf Gleis 4 würde nach Rom oder Paris fahren, wenn er schon keine Flügel anlegen und nach Kokkola fliegen konnte. Kokkola, das Städtchen an der finnischen Ostseeküste, in dessen Nähe Peter Renate auf der Schaukel vor den Zwergtannen fotografiert hatte, ohne daß sie es gemerkt zu haben schien.
Wir haben uns verpaßt, diese Tatsache war so unmittelbar und deutlich – als unsere Züge sich in verschiedene Richtungen in Bewegung setzten, mußte ich laut und falsch lachen.
2Cirrus Inflatus
Langsam traten unsere Gesichtszüge aus dem beschlagenen Spiegel hervor, als würden sie, wie auf den Gemälden des präsurrealistischen amerikanischen Malers Elihu Vedder, hinter einem Wolkenschleier zum Vorschein kommen. Über Vedder hatte ich bei Dr. Tuben einen Vortrag gehört; ich erinnerte mich an die Dias, die Tuben nach mühseligen Versuchen, den Diaprojektor in Gang zu setzen, endlich schräg und zitternd an die Wand warf. Verschwommene Mädchengesichter unter riesigen Hüten – Cumulonimbus –, die sich drohend und unheilverkündend über peitschenden Ozeanen erhoben. Auch steinerne Sphinxen in trostlosen Phantasie-Wüsten, vor denen Wanderer in abgeschabter Kleidung mit geneigtem Kopf lauschend knieten, entwarf dieser seltsame Maler schon vor hundert Jahren. Damals, als in fast allen herkömmlichen naturwissenschaftlichen Disziplinen eine zunehmende Rationalisierung, eine Objektivierung eintrat und völlig neue Forschungsgebiete aus der Taufe gehoben wurden, unterstützt von einer enorm anwachsenden Flut empirischer Daten, stellte Vedder den Menschen terrestrischen Urgewalten oder ihren Symbolen als schutzlos ausgeliefert gegenüber.
Erst sah man unsere Nasen, dann Pauls Kinn, meine Stirn, den leuchtenden Kragen seines hell- und dunkelgrün karierten Hemdes, meine kräftig gezeichneten Augenbrauen. Wir lächelten uns an, als würden wir uns gerade zum erstenmal sehen.
»Erinnerst du dich noch, wie wir früher überlegt haben, was in unseren Gesichtern die Leute dazu bringt, zu wissen, wer von uns das Mädchen und wer der Junge ist? Da waren wir vielleicht sieben.«
Ich blickte zu Paul. Er hatte jetzt kinnlange schwarzgefärbte Haare im Cleopatra-Schnitt, ich eine Glatze. Er trug silberne halbmondförmige Ohrringe arabischer Herkunft, ich hatte nicht einmal Ohrlöcher.
»Wir haben uns auf die Nase und vor allem auf das Kinn geeinigt«, rief er mir in Erinnerung und legte einen Arm um meine Schultern.
»Weißt du, daß ich schon zehn Pfund mehr wiege? Dabei bin ich erst im fünften Monat!«
»Ich wollte es ja nicht so direkt sagen, aber man sieht es schon ein wenig …« Paul zwickte mich in eine Wange. Ich pustete noch einmal kräftig in den Spiegel, um unsere Nasen im Dampf verschwinden und wiederkehren zu sehen. Dann nahm ich Pauls Hand, und wir gingen vom Bad in sein »Kabinett«, wie er es nannte. Die großen hohen Fenster klapperten uns geräuschvoll entgegen, die Zugluft wirbelte ein paar bunte Papierbögen auf. Ich legte sie mit einem Briefbeschwerer, einem runzligen Stein, in dem Paul eine Kröte zu sehen meinte, auf ein Tischchen. Dann trat ich an die Fensterbank und schaute hinaus. Mein Bruder wohnte am Rand eines kleinen Parks; tagsüber hörte man von unten Kinderstimmengewirr, ein auf- und abschwellendes, helles Geräusch, aus dem sich kein einziges Stimmchen hervorhob. Eine Windböe trieb mir ein paar winzige Tropfen ins Gesicht, ich starrte in den Himmel, spürte den steifen, frischen Wind aus Nordost. Mir ging durch den Kopf, wie Beaufort, der mit Luke Howard befreundet war und nach dem die Beaufort Sea nördlich von Alaska benannt wurde, die Windtypen klassifiziert hatte. Die Nachteile einer rein beschreibenden Terminologie zeigten sich auch bei den verschiedenen Wind-Klassifikationsmodellen, besonders im Falle von Stürmen auf See. Was das eine Jahrhundert für einen fürchterlichen Sturm hielt, war für das andere nicht mehr als ein kräftiger Wind. A Fine Breeze, A Small Gale, A Fresh Gale, A Top-Sail Gale, A Hard Gale of Wind, A Fret of Wind, A Storm, A Tempest – so nannte man Anfang des 19. Jahrhunderts die verschiedenen Windstärken. Schon Daniel Defoe hatte 1703 in seinem Bericht über einen Sturm den Mangel an Objektivierbarkeit dieser Ermessensbegriffe beklagt. Die Naturgewalten, befand Luke Howard hundert Jahre später, bedurften zuvörderst einer sprachlichen Kontrolle. Es war ein Zeitalter, in dem eine neue Sprache nachhaltig kulturell wirkte: »Galvanismus«, »Umwandlungswärme«, »Wahlverwandtschaften«, »stabiler Zustand«; neue Wörter kursierten schnell, der wissenschaftliche Diskurs begann die Alltagssprache zu infiltrieren. Wer konnte schon widerstehen, seine Rede mit Begriffen wie Magnetismus, Mesmerismus oder gar dem von Coleridge erfundenen Ausdruck »psychosomatisch« zu würzen? Bald entbrannte ein Streit darüber, ob lateinische oder englische Begriffe in den internationalen Zeitschriften verwendet werden sollten …
Paul konnte mir stundenlang zuhören. Während ich sprach, malte er. Nach unserem großen Zerwürfnis näherten wir uns einander langsam wieder, einfach indem ich am Fenster stand und erzählte, ohne ihn anzugucken. Von ihm hörte ich über Stunden nur das Eintunken seines Pinsels in den Wasserbecher und das Anrühren neuer Farbe. Manchmal hörte ich eine Eierschale knacken – Paul mischte seine Farben auf Ei-Basis – und roch den Staub der Trockenfarbe, der von seinen heftigen Rührbewegungen aufgewirbelt wurde. Lange Zeit habe ich Paul mehr gehört und gerochen, als mit ihm geredet.
Jetzt sah ich mit einem Blick über die Schulter, daß Paul gerade mit meiner Lieblingsfarbe, dem »6-Uhr-Winterblau«, Formen malte, die man mit viel Phantasie für Wirbel, Windhosen, Sturmböen, Hoch- und Tiefdruckgebiete auf einer Wetterkarte halten konnte. So war es immer: Ich schwadronierte vor mich hin, entwarf ganze Kapitel meiner Doktorarbeit vor Pauls riesigen Atelierfenstern, und er hörte zu und malte selbstvergessen vor sich hin.
Im übrigen hatte er eine recht seltsame Angewohnheit: Er signierte seine Bilder nur selten mit seinem Namen oder einem Kürzel, er betitelte sie auch nicht (oder nur gelegentlich – Paul war kein Mensch der Prinzipien; »ausnahmsweise« war eines seiner Lieblingsworte), statt dessen schrieb er auf jedes Bild, an unterschiedlichen Stellen, eine Gradzahl: 15 Grad, 27 Grad, 666 Grad, 1000 minus 1 Grad. Die auf den Bildern angegebene Gradzahl schien meist keineswegs kongruent mit der inhaltlich oder atmosphärisch vermittelten »Temperatur« des Bildes. Oft machte mich erst eine Minuszahl auf die versteckte Bösartigkeit eines Bildes oder ein überraschend hoher Wert auf so etwas wie subkutane, unter der Haut der Leinwand versteckte Leidenschaftlichkeit aufmerksam. All die Ordnung, die ich mit meinem noch spezifischeren Wolkenatlas in der Natur nachzuweisen versuchte, meine Grübeleien über sprachliche Finessen wie »wann ist etwas durchscheinend und wann durchsichtig?«, meine Suche nach etwas, das eigentlich nicht mehr Objekt und doch noch nicht ganz entmaterialisiert ist, meine Suche nach Cirrus Perlucidus, verwandelte sich in Pauls Gemälden wieder in ihren ursprünglichen, amorphen Zustand. Doch auf mir unbegreifliche Weise liebte ich Pauls Zerrüttung meiner Begriffe. Er hatte bereits ein beleibtes Monster, das höchstens ein Cumulus-Wesen hätte sein können, »Cirrus Inflatus« genannt …
Als das Rascheln und Streichen von Pauls Pinsel, das Umrühren von Wasser und Farbe lange Zeit nicht mehr zu hören gewesen war, wandte ich mich um. Paul starrte nachdenklich auf seine Leinwand, die auf der rechten Hälfte von verschiedenen kleinteiligen 6-Uhr-winterblauen Wesen bevölkert und auf der linken – diese Seite hatte er nicht weiß grundiert – bis auf eine verdrehte eichenblattbraune Spirale leer war. Dann spürte er, daß er beobachtet wurde, und hob den Blick.
»Ich habe Renate neulich an einem Ort gesehen, wo ich nicht mit ihr gerechnet hatte … auf dem Bahnhof von Hannover …«
Ich löste mich von meinem Fensterplatz und trat ins Zimmerinnere. Paul war vermutlich der einzige Maler auf diesem Planeten, der in seinem Atelier über türkische Teppiche lief. Die Wände waren mit Zeichnungen, Skizzen, ausgeschnittenen Schnipseln und Notizen übersät; eine ausrangierte Schulkarte mit den chemischen Elementen, die ich ihm einmal geschenkt hatte, hing an der Decke neben einem Sonnensystemmobile.
Pauls Sofa stand unter einem langen freskenhaften Ölgemälde mit dem Titel »Sonnenblumenurlaub – vermutlich 27 Grad«. Urlaub nahmen nicht gestreßte Zeitgenossen, sondern die Sonnenblumen selbst. Überall fielen sie, als einziges buntes Element auf dem erdfarbenen Gemälde, in Bars und Cafés ein, bummelten auf Boulevards, zogen in langen Kolonnen durch Vergnügungsviertel und tanzten im Regen. Der »Sonnenblumenurlaub« war schon fast zehn Jahre alt und eines seiner wenigen formal realistischen Gemälde.
Während Paul sich mit einem Taschentuch Farbe von den Händen wischte, erzählte ich ihm von meinem Nicht-Treffen mit Renate auf dem Weg zum Kölner Kongreß. Mittlerweile sprachen wir auch wieder über solche persönlichen Dinge.
Paul pustete etwas getrocknete blaue Farbe von seinem Handrücken.
»Dich beschäftigt Renate sehr in letzter Zeit?«
Ich zuckte die Schultern, nickte.
»Hat das damit zu tun?« Er schob eine seiner braunen, schlanken Hände vorsichtig auf meinen Bauch und tätschelte ihn.
»Vielleicht … es hat mich neugierig auf sie gemacht … seitdem ich die Nachricht verdaut habe, daß ich schwanger bin« – ich brach kurz ab und dachte an den Abend, an dem ich mit Christian, den ich noch nicht lange kannte, überlegte, was wir nun tun sollten, und an dem wir nach einigem Hin und Her zu dem Schluß kamen, daß der Gedanke, auf den »perfekten Zeitpunkt« für ein Kind zu warten, etwas Zwanghaftes und Unrealistisches hatte und wir uns lieber »überraschen« ließen –, »seitdem ich also weiß, daß ich selbst Mutter werde, muß ich sehr oft an Renate und auch an Jo denken. Es gibt so viel Ungeklärtes in unserer Familie, das mir plötzlich keine Ruhe mehr läßt. Als hätte mit meiner Schwangerschaft eine Art Wettlauf mit der Zeit begonnnen, in der ich noch offene Fragen beantworten kann … ich weiß auch nicht genau, woher meine Unruhe stammt … vielleicht ist es ein unbewußter Drang, zu wissen, in was für einen Zusammenhang, in was für ein Nest ich da mein Kind setze …«
Ich schloß die Augen und sah Renate vor mir. Ich sah auch Jo und meine Urgroßmutter, alle mit dicken Bäuchen. Plötzlich war ich Teil einer langen Kette, einer Verbindung, eines Konstrukts, das mir eigentlich immer suspekt gewesen war. Und mir ging durch den Kopf, daß ich schon allein dadurch aus dem Rahmen fiel, die einzige Frau in unserer Familie zu sein, die ein uneheliches Kind bekam – und studiert hatte. Und – das betraf zumindest meine Mutter und meine Großmutter – die nicht im Krieg geboren worden war. Sowohl Renate als auch Jo waren jeweils im ersten Kriegsjahr zur Welt gekommen.
Paul pustete jetzt etwas getrocknete Ei-Tempera von meinem Ärmel. Dann rückte er näher und murmelte:
»Weißt du noch, wie Renate damals auf dem Pferd weggeritten ist? Oder wie sie manchmal, ohne ein Wort zu sagen, sich in den Zug gesetzt und zu Onkel Kazimierz nach Polen gefahren ist?«
»Und all die Bücher, die sie verschlingt …«
Paul hatte aufgehört, mein kleines Bäuchlein zu streicheln. »Hast du manchmal Angst um sie?« fragte er unvermittelt.
Ich sah Paul lange an. Dann antwortete ich ausweichend:
»Mir ist nicht mehr jeden Morgen übel.«
Paul streichelte sofort meinen Bauch wieder. »Ein Glück …«
Wir schwiegen eine Weile.
»Hast du dich langsam mit dem Bauch angefreundet …«, sagte Paul. Es war keine Frage, sondern eine vorsichtige Feststellung. Ich legte wortlos meine Hand auf Pauls flachen Bauch.
»Geht’s dir gut mit Christian?« wollte mein Bruder nun noch wissen – eine für ihn ungewöhnlich direkte Frage.
»Bisher sehr gut. Aber laß uns über die Vergangenheit, nicht über die Zukunft reden. Das ist eine andere Geschichte. Ich hätte mir wirklich nie träumen lassen, daß ausgerechnet ich mal Mutter werde«, ich lachte und strich mir über die Glatze. Paul fuhr ehrfurchtsvoll über meine Kopfhaut.
»Deine BDM-Glatze«, murmelte er, und spielte auf eine Geschichte an, die er »Verschwundene Zöpfe« getauft hatte, und ich mußte grinsen: Ich trug schon seit vielen Jahren Glatze, zum nie verschmerzten Verdruß meiner Großmutter, die mir früher gern die Zöpfe geflochten und uns Fotos aus »der glücklichsten Zeit ihres Lebens« gezeigt hatte: sie, mit langen blonden Zöpfen wie ihre beiden jüngeren Schwestern, brav in Reih und Glied, nur die Kinderhände spielen am Rocksaum. Aber ich hatte mir eines Nachts einfach die Haare geschoren und meine langen Zöpfe ordentlich auf den Schreibtisch gelegt. Und meine Mutter, die nichts, aber auch wirklich gar nichts, wegwerfen konnte, nahm sie verstohlen an sich und hängte sie ins Schlafzimmer.
Als ich schließlich so alt war wie Jo in ihrer BDM-Zeit, nahmen Paul und ich zum zweitenmal in der Schule das NS-Regime durch und bedrängten die Erwachsenen einige Wochen lang aufgeregt mit unseren Fragen. Es war die Zeit, wo ich keine Lust mehr hatte, den Abwasch zu machen oder den Müll hinunterzutragen, irgend etwas zu tun, das nicht gerade meiner Laune entsprach. Ich schmierte »Null Future«, das mir damals wie eine originelle Mischung aus Null Bock und No Future erschien, an meine Zimmerwand. Es war die Zeit, in der Paul anfing, Yoga-Unterricht zu nehmen und zu malen. Es war nicht die glücklichste Zeit meines Lebens.
Paul und ich tranken den Rest des Abends Unmengen Grünen Tee mit Ingwer und Zitrone, seit langem Pauls Lieblingsgetränk. Später sprachen wir über Wieland und stellten uns wieder einmal die Frage, wo in aller Welt er sich wohl jetzt aufhalten könnte. Seit Jahren hatten wir nur gelegentlich Ansichtskarten von ihm bekommen … Marseille, Narvik, São Paulo, Katmandu … Wir entwarfen verwegene Hypothesen, ich zitierte Bücher und Romanhelden, sprach über Renate und Westpreußen, Peter und die Elfen, über den Bleichen See und unsere Mittelinsel, natürlich über jenen besonderen Abend mit meiner Mutter, an dem ich zum erstenmal von Rudolf erfuhr, der immerhin Pate für Pauls zweiten Namen gestanden haben mußte, und mein Bruder starrte auf seine Finger, an denen immer noch winzige Spuren blauer Ei-Tempera klebten.
3Blaue Stunde
Die »blaue Stunde« war eigentlich ein schlecht gewählter Name, denn er könnte den »blauen Dunst« nahelegen, dabei hat er viel eher mit der Redewendung »Ins Blaue reden« zu tun. Und mit der Uhrzeit, zu der sie begann: an einem lauen Herbsttag, als die Dämmerung mir die Haut fahl werden und die Adern auf Schläfen und Handrücken durchschimmern ließ. Meist nimmt man diese Zeit gar nicht wahr: Man sitzt in elektrisch beleuchteten Zimmern, man steht kurz vor Ladenschluß noch zwischen neonbeleuchteten Supermarktregalen oder hastet wieder nach Hause. Der Himmel ist keine nennenswerte Größe in einer Stadt, er ist so selbstverständlich wie die Kopfhaut und wird normalerweise nicht weiter beachtet.
Es war fünf nach sechs, und bei Christian machte niemand auf. Das irritierte mich, denn wir waren verabredet, und Christian ist ein zuverlässiger Mensch. Ich verordnete mir, bis halb sieben zu warten. Da Christian nicht kam – später erfuhr ich, daß er sich lediglich mit der Straßenbahn verfahren hatte –, überlegte ich, was ich tun sollte. Plötzlich kam mir die Idee, bei meinen Eltern vorbeizuschauen. Als ich mich schon auf dem Weg befand, fiel mir ein, daß mein Vater übers Wochenende zu einem Freund fahren wollte. Einen Moment lang zögerte ich, denn ohne meinen Vater versprach der Abend nicht halb so lustig zu werden.
Meine Mutter stand irritiert, fast ein wenig erschrocken, in der Tür. Aber dann bat sie mich herein und schien sich auf einmal doch zu freuen. Wir gingen in die Küche, wo sie sich gerade einen Salat machte. Ich setzte mich und schnippelte ein paar Tomaten, Gurken- und Käsewürfel dazu. Zum Essen zündete Renate eine Kerze an.
Ich weiß nicht, wie wir es schafften, binnen weniger Minuten von ein paar Bemerkungen über meine Arbeit mit dem Wolkenatlas und Peters Schlafstörungen auf ihre erste Zeit mit meinem Vater zu sprechen zu kommen. Waren es einige meiner lockeren, aber forschen Scherze, war es die Tatsache, daß gemeinsames Essen immer etwas Verbindendes hat, oder war es dieses unglaubliche Licht, das auf unsere Gesichter fiel und uns das Gefühl gab, in einer Art Auszeit, einer kurzen Pause vom Leben, sprechen zu können, so als könnten diese Zwitterstunden später ausgelöscht werden und konsequenzlos bleiben?
Meine Mutter erzählte, wie Peter einmal auf ihren Balkon im ersten Stock der düsteren Grevestraße geklettert war und wie sie ein andermal nachts, nur mit einem Bademantel bekleidet, klopfenden Herzens die Stufen hinuntergelaufen ist, um ihn heimlich in die elterliche Wohnung zu nehmen. Mein Vater war wohl damals ganz vernarrt in meine bildhübsche und schüchterne Mutter und hatte sich jeden erdenklichen Spaß ausgedacht, um ihre Aufmerksamkeit und Liebe zu gewinnen, selbst eine Schnitzeljagd quer durch die Stadt, bei der er am Ende mit einem Lebkuchenherzen unter einem Baum stand.
Während wir Zitroneneis zum Nachtisch aßen, auf das der Schatten unserer Kerze flackernd fiel, erzählte Renate auf einmal von einem sommersprossigen Jungen namens Rudolf, der bei Onkel Kurt in der Baumschule gearbeitet hatte. Sie hatten beide nie gewagt, mehr als ein paar flüchtige Sätze miteinander zu sprechen, aber einmal, als sie sich auf der Couch ausruhte, hatte er plötzlich vor ihr gekniet und sie geküßt …
Die Baumschule Hillig bestand schon seit drei Generationen. Es gab Gewächshäuser, schnurgerade Reihen fast identisch aussehender Bäumchen; alles schien seit langem seine Ordnung zu haben. Hier war Natur, aber sie war nicht gefährlich. So pendelte Renate zwischen der städtischen Wohnung ihrer Eltern – die mit viel zu vielen Möbeln und Erinnerungen vollgestopft war, in der ihr Vater in seinem aufgepolsterten Stuhl, sein rechtes Bein hochgelagert, Patiencen legte und ihre Mutter stundenlang nähte, ohne ein Wort zu sprechen – und dem Gelände ihres schon in frühen Jahren glatzköpfigen Onkels und ihrer praktischfürsorglichen Tante mit den kräftigen, orthopädische Griffe gewohnten Händen. Tante Lena, die zusammen mit Jo und der kleinen Renate vor »dem Russen« geflohen war und die nach Ansicht aller Familienmitglieder nach dem Krieg mit Onkel Kurt eine gute Partie gemacht hatte.
Kinder hatten sie allerdings nur eines, Tante Marion; auch Renate hatte keine Geschwister. Warum, fragte niemand.
Als Renate in die Untersekunda ging, diskutierten ihre Eltern, ob sie nicht vielleicht statt dem Abitur eine Ausbildung bei Tante Lena als Orthopädieassistentin anfangen sollte. Abi, diese Silben klangen wie ein Ticket in eine Welt jenseits der grünen Gummistiefel, mit denen Onkel Kurt durch die Gewächshäuser lief, jenseits der Heckenrosen und der fuchtelnden Schere in Tante Lenas weißbehandschuhten Händen, jenseits der Weihnachtssterne aus silbernem Kaugummipapier am Küchenfenster ihrer Eltern.
Renate wollte fort. Der Gedanke, monatelang Tante Lena dabei zuzuschauen, wie sie alten Männern wieder das Gehen beibrachte, zuzuhören, wie ihre im Krieg zerschossenen, im Krankenhaus zusammengeflickten Hüften nur so knirschten, ein Knirschen, das Renate für immer mit dem Anblick weißer, enger Flure in Verbindung bringen würde, stimmte sie unbehaglich. Nicht nur, daß auch ihr Vater lange bei Tante Lena aus- und eingegangen war, ihr Vater, der früher, als es sie noch nicht gab, so daß sie es folglich kaum glauben konnte, als Pfadfinder in fernen Ländern wie Norwegen oder Schweden Wanderungen unternommen hatte in einer geheimnisvoll klingenden Region, die er »jenseits der Baumgrenze« nannte, der jetzt einmal die Woche mit seinem Schwerbehindertenausweis ins städtische Schwimmbad ging, wo er sich mühsam mit seinem Stumpf und seinen Krücken durch die vielen mit Dampf beschlagenen Türen quälte.
Wenn Renate aus dem kleinen quadratischen Fenster – der Anbau für Lenas Orthopädie-Praxis war nach dem Krieg errichtet worden – hinausschauen würde, reichte ihr Blick nicht einmal bis zur Straße, wo bärtige Männer in schmutzigen Lastwagen vorbeirasten – Männer, vor denen Mutter und Tante Lena sie früher gewarnt hatten: Du darfst auf keinen Fall in so einen Wagen einsteigen, wenn er neben dir anhält, die wollen junge Mädchen mitnehmen. Das klang bis dahin noch nicht wirklich bedrohlich. Irgend etwas mußten Mutter und Tante Lena also verschweigen. Vielleicht fuhren die Männer ja mit den Mädchen in ein Land jenseits der Baumgrenze. Aber diese Männer, von denen sie als Kind angenommen hatte, daß sie Kopftücher wie Piraten trügen, würde sie nicht einmal sehen können, sondern nur, ein paar Handbreit entfernt vom Fenster, die dunstbeschlagenen Scheiben des niedrigen Gewächshauses, aus dem etwas verschwommen ihr Onkel winken würde.
Vielleicht hatte Renate damals gespürt, daß die Reihenfolge verkehrt war und sie erst einmal etwas über die Körper in Erfahrung bringen mußte, bevor sie zu ihrer Behandlung schreiten konnte. Ihr Körper, unter dessen Oberfläche ihre Brüste plötzlich wie unheilvolle Vulkane mit einem kleinen, roten, runzligen Krater hervorgeschoben wurden und der Haare in einer anderen Farbe als auf ihrem Kopf an allen möglichen und unmöglichen Stellen hervorbrachte. Natürlich würde Renate Anatomiebücher lesen und Tante Lenas dicken Fuß in einer Hand wiegen, um daran das »Überbein« zu studieren, aber sie würde nicht wissen, wie sich die Haut eines Menschens anfühlt, der eine Berührung erhält, die nicht ärztlich verordnet ist – abgesehen von den ritualhaften Gute-Nacht-Küssen, die sie mit ihren Eltern austauschte, und dem freundschaftlichen Klaps, den Tante Lena ihr manchmal gab. Sie würde noch nie einen gesunden Körper berührt haben, bevor verspannte, steife Nacken, schlecht zusammengewachsene Brüche, Sehnenrisse, Bandscheibenvorfälle und die Kriegsknirschhüften unter ihren Händen liegen würden.
Aber Renate war nicht gut in der Schule, und ihre Eltern wollten ihr die Demütigung ersparen, die Untersekunda wiederholen zu müssen. Sie strengte sich zum erstenmal in ihrem Leben richtig an und wurde versetzt. Johanna, ihre Mutter, gab Renates Vater einen flachen Klaps auf den Hinterkopf, als der etwas von »Wozu braucht ein Mädchen denn das Abitur?« murmelte, und Renate durfte die Oberstufe besuchen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, daß sie gleich nach dem Abitur die Orthopädie-Ausbildung absolvieren würde, damit sie nicht noch obendrein, wie ihr Vater meinte, auf die hirnverbrannte Idee käme, ein Studium anzufangen.
Ein Grund dafür, weshalb Renate froh war, die Ausbildung aufschieben zu können, weshalb sie nicht öfter als nötig bei Onkel Kurt und Tante Lena sein wollte, war die Geschichte ein paar Monate zuvor im Winter, als sie befürchtet hatte, schwanger zu sein.
Sie hatte sich damals nach dem Mittagessen, es gab, was es immer dienstags bei den Hilligs gab: Pellkartoffeln, Königsberger Klopse und Schwarzwurzeln, im Wohnzimmer auf die Couch gelegt und ein bißchen gedöst. Plötzlich wachte sie von einer Bewegung auf. Rudolf, er war genauso alt wie sie, fünfzehn, hatte rote, kurze Haare und überall in seinem Jungengesicht Sommersprossen, hockte vor ihrer Couch. Er lächelte verlegen. »Ich wollte dich nicht wecken«, murmelte er, schaute zu Boden und dann doch wieder sie an. Renate musterte ihn erstaunt. Plötzlich schob er seinen Kopf vor und gab ihr einen Kuß auf den Mund. Dann lief er nach draußen, wo Onkel Kurt schon auf ihn wartete. Renate schmeckte noch seinen Speichel auf ihren Lippen, im nächsten Moment sah sie Tante Lena, die auf dem Flur mit einer weißen Handschuhhand, an der noch Massage-Öl glänzte, eine Fliege erfolgreich verscheuchte. Renate hatte keine Zeit mehr, über die Berührung, den Geschmack, das Geräusch, das ihre und Rudolfs Lippen bei ihrer raschen Kollision verursacht hatten, nachzudenken, da stand Tante Lena schon vor ihr.
»Renate, du brauchst nicht zu weinen«, sagte sie, dabei weinte Renate gar nicht, »diesen Burschen werde ich gleich zur Rede stellen und ihm eine Lektion erteilen.« Sie legte Renate für einen Moment eine Hand auf den Kopf, als wollte sie ihn wieder zurechtrücken, etwas Böses, Unheimliches mit dieser Geste austreiben – eine Gegenberührung zu der, die eben stattgefunden hatte. Es war kein Streicheln, kein Über-die-Haare-Streichen, Tante Lena legte nur einmal ihre große, schwere Hand auf Renates Kopf. So kam zu dem Geschmack von Rudolfs Lippen der Geruch von Massageöl in ihrem Haar hinzu, und beides verschmolz in ihrer Erinnerung.
Nachts zu Hause allein in ihrem Bett, dachte Renate nach über das, was ihre Mutter einmal vage über den Austausch von Körperflüssigkeiten und das Kriegen von dicken Bäuchen und kleinen Kindern gemurmelt hatte, während sich im Spülbecken das schmutzige Abwasser und das frische aus dem Hahn mischten und ein weißer geiler Schaumrand sich auf allen Tellern und Tassen aufblähte und wieder in sich zusammenfiel. Renate, verwirrt von all den Gerüchen und Geschmäckern an ihrem Körper, bekam auf einmal große Angst …
Renate hatte drei lange Wochen Angst. Auch noch Angst, als ihre Brüste sich vergrößerten, wie immer vor der Menstruation, und sie gereizt und unruhig wurde. Dann, endlich, als sie ihre Tage bekam, legte sich die Furcht, schwanger zu sein.