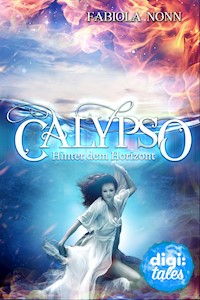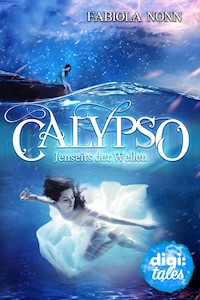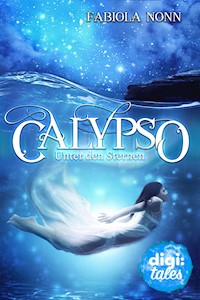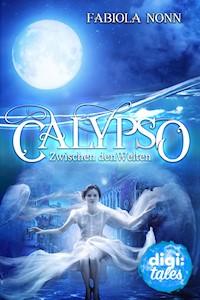
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Calypso
- Sprache: Deutsch
***Auftakt der mythischen Unterwasser-Saga des Sommers!*** Nachdem das Ökosystem auf weiten Teilen der Erdoberfläche kollabierte, suchten die Menschen unter Wasser Zuflucht. Noemi lebt mit ihrer Familie in einer der größten submarinen Städte: Calypso - benannt nach der Meeresgöttin und Herrscherin über das sagenumwobene Volk der Ondine. Seit sie denken kann, fühlt Noemi sich von der geheimnisvollen Tiefsee angezogen und versucht die Mythen des Meeres zu ergründen. Als sich dabei jedoch immer wieder tragische Unfälle ereignen, die schließlich sogar die Existenz der Stadt bedrohen, zieht Noemi die einzig mögliche Konsequenz und ergreift die Flucht. Auf sich allein gestellt begibt sie sich auf eine gefährliche Reise, die sie nicht nur ihrer wahren Herkunft, sondern auch ihrer großen Liebe näherbringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
.
.
Roman
Digitale Originalausgabe
.
digi:tales
Ein Imprint der Arena Verlag GmbH
Digitale Originalausgabe
© Arena Verlag GmbH, Würzburg 2017
Covergestaltung: Sarah Buhr
Alle Rechte vorbehalten
E-Book-Herstellung: KCS GmbH, Stelle | www.schriftsetzerei.de
ISBN: 978-3-401-84019-2
www.arena-verlag.de
www.arena-digitales.de
Folge uns!
www.facebook.com/digitalesarena
www.instagram.com/arena_verlag
www.twitter.com/arenaverlag
www.pinterest.com/arenaverlag
.
Für meine Familie … Und für alle, die ihrer wahren Bestimmung auf der Spur sind.
Es ist unser eigenes Licht, das wir fürchten,
nicht unsere Dunkelheit.
Wir fragen uns: »Wer bin ich eigentlich, dass ich wundervoll, begnadet und großartig sein darf?«
Aber wer bist du denn, es nicht zu sein?
Du bist ein Kind Gottes.
Dich selbst klein zu halten, dient nicht dieser Welt.
Es ist nichts Erleuchtendes daran, sich so klein zu machen, dass andere sich in deiner Nähe nicht verunsichert fühlen. Wir alle sind dazu bestimmt, zu leuchten – wie es die Kinder tun. Und dieses Licht ist nicht nur in einigen von uns. Es ist in jedem von uns.
Frei übersetzt aus einer Rede von Nelson Mandela
#01
– Lagerfeuergeschichten –
Rote Lichtsignale erleuchten meinen Heimweg. Die Straßen sind erfüllt vom Heulen der Sirenen, das in meinen Ohren widerhallt. Es ist der schrille Gesang einer Stadt in Aufruhr: Calypso.
Ich passiere gerade die Schleusentore von Ebene VII, als meine Jackentasche vibriert. Besser gesagt, das TabCom in meiner Jackentasche. Das Gerät ist alt, und das Netz überlastet – wie so oft. Seitdem all unsere Ressourcen in die Instandhaltung der Kuppel fließen, ist der technische Fortschritt hier unten fast zum Erliegen gekommen. Anstelle eines Anrufs empfange ich nur die Mailbox-Nachricht meiner Mutter: Noemi! Wo steckst du? Auf Ebene VII gab es einen Wassereinbruch, komm schnell nach Hause! So schnell du kannst. Hörst du? Und bitte melde dich, sobald du diese Nachricht erhalten hast.
Ich werde schon nicht ertrinken. Ebene VII ist nichts anderes als ein zwei Meter breiter Steg, der wie ein Rundgang knapp unter dem höchsten Punkt der Kuppel verläuft. Heute ist die Aussicht besonders spektakulär, wenn auch nicht in positivem Sinne: Im Dach der Kuppel hat sich ein Riss gebildet. Ein kleiner Wasserfall ergießt sich über die botanischen Plattformen, vorbei an den anderen Ringebenen, bis er auf den Widerstand der geschlossenen Ebene III trifft. Dort unten kämpft die Garde in einer Wolke aus feinem, salzigem Nebel darum, einen Durchbruch zu verhindern. Ein zweiter Trupp ist bereits auf dem Weg nach oben. Gut so, denn der Schaden an der Kuppel muss schnellstmöglich behoben werden. Und ich bin gespannt, wie lange es dieses Mal dauern wird.
In letzter Zeit passiert so etwas häufiger. Dann wird in sämtlichen Stadtteilen von Calypso über nichts anderes mehr gesprochen, und das Alltagsleben gerät für ein paar Tage komplett aus den Fugen. Als der letzte Wassereinbruch bei uns am Esstisch diskutiert wurde, habe ich meinen Eltern erklärt, dass sich das Meer nur den Raum zurückholt, aus dem wir es verdrängt haben. So entsetzt wie an diesem Abend haben sie mich in siebzehn Jahren noch nie angesehen. Aber ich verstehe nun mal nicht, wie man sein gesamtes Leben lang die Augen vor dem Offensichtlichen verschließen kann: Es ist nur eine von Menschen entworfene und gebaute Membran, die uns von den kalten, dunklen Wogen des Ozeans trennt. Wir leben in einer transparenten Eierschale. Zweihundert Meter tief unter dem Meeresspiegel.
Ich lasse mein gebrauchtes, anthrazitfarbenes TabCom in meine Sporttasche fallen und bleibe stehen, um meinen Pferdeschwanz neu zu binden. Hätte ich meinem kleinen Bruder Beek nicht versprochen, eine Insel mit ihm zu bauen, würde ich den ganzen Tag hier oben verbringen.
Ich lasse den Anblick ein letztes Mal auf mich wirken. Wie eine Mahnung an mich selbst, nicht zu vergessen, wie zerbrechlich die Welt ist, in der wir leben. Dann schlage ich den Weg über die große Treppe ein, die am Zentralgarten entlangführt. In einer Nische am untersten Treppenabschnitt liegt der Zugang zum Apartment meiner Familie. Neben dem Briefkasten gibt eine Kennziffer unseren Bezirk, die Straße und Hausnummer des Apartments an. Ohne diese Ziffer wäre die Wohnung äußerlich kaum von den anderen zu unterscheiden: Ein weißer Kubus mit großer Fensterfront. Zuletzt renoviert vor etwa dreißig Jahren. Während ich meine Tasche noch nach dem Hausschlüssel durchwühle, reißt meine Mutter schon die Tür auf.
»Noemi! Da bist du ja. Hast du meine Nachricht nicht bekommen?«
»Gerade eben erst. Das Netz war überlastet«, erwidere ich und hebe rechtfertigend die Hände. Zum Glück stürmt Beek mir entgegen, bevor meine Mutter weitere Fragen stellen kann.
»Wurde die Kuppel schon repariert?«, fragt er mich, neugierig wie immer.
»Die Garde gibt ihr Bestes. Wir müssen uns keine Sorgen machen.«
Beek sieht zufrieden aus. »Ich werde auch der Garde beitreten, wenn ich sechzehn bin. Dann kann ich euch beschützen, wenn Papa auf Mission ist.«
Beek ist gerade elf geworden, diese Pläne haben also noch etwas Zeit. Die Anspannung meiner Mutter ist trotzdem für uns beide spürbar. Unser Vater arbeitet für die Marine, wo er sich in den letzten Jahren unverzichtbar gemacht hat. Dass es zu Hause auch noch Menschen gibt, die ihn brauchen könnten, vergisst er leider manchmal. Er fehlt mir, genau wie Beek. Mein kleiner Bruder weiß nicht, dass unsere Mutter ihn jedes Mal mit Vorwürfen überhäuft, sobald er die Wohnung betritt. Und die Folge davon ist natürlich, dass Papa sich noch seltener hier blicken lässt.
Trotzdem weiß ich, dass unser Vater uns liebt. Kurz nachdem er zum zweiten Offizier seiner Flotte ernannt wurde, hat er uns sogar mit auf sein Schiff genommen, um uns alles zu zeigen. Beek und ich waren beide vollkommen begeistert von dieser Welt, die so ganz anders ist als das, was wir kennen. Ich werfe meiner Mutter einen Blick von der Seite zu. Sie betrachtet Beek mit einem stolzen Lächeln, obwohl ich ihr ansehe, dass sie den Vorschlag ihres Sohnes, der Garde beizutreten, alles andere als beruhigend findet.
»So jemanden wie dich können sie bestimmt gut gebrauchen«, ermutige ich Beek und lasse mich von ihm in sein Zimmer schleppen. Er hat bereits Decken und Kissen aus dem gesamten Apartment zusammengetragen. Seit ich denken kann, hat er es geliebt, Inseln zu bauen. Obwohl er inzwischen häufig betont, zu alt für unsere Insel zu sein, scheint er diese Tatsache gelegentlich zu vergessen – so wie heute.
Der Klang der Sirenen ist inzwischen verebbt. Beek zieht die Vorhänge zu. Dann lehnt er sich mit dem Rücken an die Topfpalme und knipst eine Taschenlampe an, die ab sofort »Lagerfeuer« genannt wird. Einen Augenblick sitzen wir schweigend in der Dunkelheit.
»Sind wir gestrandet?«, frage ich vorsichtig. Mein kleiner Bruder läuft zur Höchstform auf und nickt beklommen.
»Möglicherweise werden wir bis zu unserem Tod hier festsitzen«, flüstert er.
Ich unterdrücke ein Schmunzeln und erwidere mit dem Ernst, der unserer aussichtslosen Lage entspricht: »Und was machen wir so lange?«
»Du könntest mir die Geschichte von der verlorenen Welt erzählen.«
»Hm. Die Geschichte von der verlorenen Welt. Ob ich mich daran noch erinnere? Mal sehen«, murmle ich und tue so, als würde ich Beeks hoffnungsvollen Blick nicht bemerken. Ich weiß gar nicht, wie oft ich ihm diese Geschichte schon erzählen musste.
»Alles begann damit, dass der Prinz des vereinten Kontinents Europa am Strand einer Azoreninsel spazieren ging. Wo genau das war, weiß man heute nicht mehr.« Beek nickt schnell. Sein Blick hängt an meinen Lippen und ich fahre fort: »Als die Abenddämmerung hereinbrach, erreichte der junge Prinz eine Bucht. Er setzte sich, um den Sonnenuntergang zu betrachten. Da erschien ihm die Meeresgöttin Calypso, die Herrscherin über das Volk der Ondine. Ihr Körper glänzte wie eine Perle im Licht der untergehenden Sonne, und ihre saphirblauen Augen funkelten geheimnisvoll. Sie war wunderschön. Doch die Worte, die sie sprach, waren grausam: Nehmt euch in Acht vor dem Zorn der Erde. Denn sie hat euer maßloses und selbstsüchtiges Leben lange genug erduldet – nun ist die Zeit der Abrechnung gekommen. Die vier Elemente, die ihr unterworfen habt, werden gegen euch aufbegehren. In den Flammen werdet ihr alles verlieren, was euch teuer ist, und die Asche eurer Liebsten wird den Himmel schwarz färben. Da erschrak der Prinz. In großer Eile kehrte er zum Festland zurück und suchte seinen Vater, den König des vereinten Kontinents, auf, um ihm von seiner Begegnung mit der Meeresgöttin zu berichten. Doch der König wollte nicht auf seinen Sohn hören. Er nannte ihn einen Narren, befand ihn seiner Nachfolge nicht würdig und verbannte den jungen Prinzen aus seinem Reich.
Und so kam es, wie Calypso vorhergesagt hatte: Das Erdreich öffnete sich und verschlang große Teile des Kontinents. Der Meeresspiegel sank um einige Meter ab. Jeder Fleck im Königreich, der nicht von gewaltigen Erdbeben erschüttert wurde, ging in Flammen auf. Der Rauch war so dicht, dass die Vögel vom Himmel fielen. Feuer überzog das Land und verschonte weder Hügel noch Täler.«
»Was geschah mit dem verstoßenen Prinzen?«, fragt Beek, obwohl er die Geschichte in- und auswendig kennt. Ich fahre mit seiner Lieblingspassage fort:
»Der Prinz war zurück auf die Insel geflohen, um Calypso zu berichten, was zwischen ihm und dem Regenten vorgefallen war. Weil er ihr geglaubt hatte, verzieh die Meeresgöttin dem Prinzen und schenkte ihm einen Teil ihres eigenen Reichs. Zehn seiner engsten Freunde und Berater halfen dem Prinzen dabei, eine Stadt zu erbauen, in der sie fortan leben konnten.«
»Und als Zeichen seiner Liebe und Dankbarkeit nannte er diese Stadt Calypso,« endet Beek mit einem versunkenen Lächeln. »Das waren unsere Vorfahren, nicht wahr?«
»So sagt es die Legende.«
»Calypso muss den Prinzen sehr gemocht haben«, schwärmt Beek. Er kuschelt sich in sein Kissen und wartet darauf, dass ich weitererzähle …
»Ja, sie mochte ihn wirklich sehr. Obwohl ihre Herkunft es nicht erlaubte, verliebten sich die beiden ineinander. Es dauerte nicht lange, bis das Volk der Ondine erfuhr, dass Calypso das Kind eines Menschen erwartete. Die Meeresgötter tobten vor Zorn. Sie beschworen eine gewaltige Strömung herauf, die den Prinzen erfasste und auf den Grund des Meeres schleuderte. Wenn Calypso versuchen würde, dem Prinzen zu helfen, würde das Volk der Ondine sie verstoßen. Das wusste Calypso. Doch ihre Verzweiflung war so groß, dass sie beschloss, dem menschlichen Prinzen in die endlose Finsternis der Tiefsee zu folgen. Niemand weiß, was genau mit ihnen geschehen ist. Die Ondine glauben, dass Calypso bei der Geburt ihrer Tochter starb. In den Schatten der Verdammnis überlebte dieses Kind, genährt vom unsterblichen Hass seiner Mutter auf die Menschen und das Volk der Ondine. Man sagt, das Kind wache im Verborgenen darüber, dass sich das Schicksal nicht wiederholt. Sein Ruf hallt noch immer zwischen den Welten, hörbar für all jene, die sich zu weit von ihrem eigenen Volk entfernen.«
»Das Kind der Meeresgöttin hat dieselbe schöne Stimme wie alle Töchter vom Volk der Ondine«, ergänzt Beek meine Erzählung. Ich nicke und spreche mit geheimnisvoller Stimme weiter:
»Doch wer dem Klang seiner Stimme erliegt, der folgt dem Schattenkind in die Verdammnis und ist verloren.«
Einen Augenblick lang starren wir in das Licht unseres Lagerfeuers.
»Glaubst du, es gibt sie wirklich?«
»Die Ondine?« Ich sehe Beek erstaunt an. »Na klar gibt es sie. Sonst wäre Calypso doch nie gebaut worden.«
Beek schaut mich mit großen Augen an, dann lächelt er und nickt zufrieden. Dass meine Mutter in der Tür steht, bemerke ich erst jetzt. Sie wirkt besorgt.
»Noemi, kommst du mal?«
Beek lässt mich nicht ohne Protest gehen – er würde natürlich gerne noch mehr Lagerfeuergeschichten hören. Doch es hilft nichts, meiner Mutter scheint es ernst zu sein. Kaum ist die Tür zu Beeks Zimmer hinter mir zugefallen, verschränkt sie die Arme vor der Brust.
»Eigentlich bin ich raufgekommen, um Beek ins Bett zu bringen. Ich habe nur zufällig gehört, was für Geschichten du ihm da erzählst«, sagt sie und runzelt vorwurfsvoll die Stirn.
»Die Sage von der Ondine? Die hat Papa mir doch früher auch erzählt«, erwidere ich schulterzuckend. Warum habe ich überhaupt das Gefühl, mich verteidigen zu müssen? »Beek hört sie genauso gerne wie ich damals. Nur deshalb habe ich sie ihm erzählt.«
»Das mag ja sein. Trotzdem ist es nur eine Sage und er soll nicht an so einen Unsinn glauben.« Noch bevor ich etwas erwidern kann, lässt sie die Schultern sinken und fährt mit leiser Stimme fort: »Ich mache mir Sorgen, Noemi. Dein Interesse für diese Tiefseegeschichten … das ist nicht normal. Du hast schon wieder drei neue Bücher über Meeresbiologie bestellt.«
»Mom?«, lache ich. Ist das tatsächlich ihr einziges Problem? Dass ich zu viele Bücher lese? »Wir sprechen von Meeresbiologie. Nicht von Okkultismus. Die Eltern meiner Freunde wären froh, wenn ihre siebzehnjährigen Töchter solche Bücher lesen würden.«
»Welche Freunde denn, Noemi?«
Autsch. Das hat gesessen. »Richtig, mit mir redet ja keiner mehr«, erwidere ich und muss meine Stimme kontrollieren, um nicht laut zu werden, »seit ich für Überschwemmungen und Rohrbrüche im Schulgebäude verantwortlich gemacht werde. Mal im Ernst …« Ich schüttle fassungslos den Kopf. »Ist dir klar, wie absurd das ist?« Als könnte ich mit der Kraft meiner Gedanken ein Wasserrohr zum Platzen bringen.
»Ich glaube dir ja, dass es keine Absicht war, Noemi. Aber das ist eine ernste Angelegenheit«, flüstert meine Mutter eindringlich. Und ich dachte, sie hätte mich verstanden. Von wegen. Abwehrend hebe ich die Hände. Dieses Gespräch wird nirgendwo hinführen. Wir hatten das alles schon einmal, und ich habe nicht den Eindruck, dass sie mir wirklich zugehört hat.
»Manchmal habe ich das Gefühl, dass du mich anders behandelst, weil …« Ich stocke. Es gibt keine passenden Worte für das, was ich sagen will. Die Tatsache, dass ich, anders als Beek, nicht das leibliche Kind meiner Mutter bin, hat nie eine Rolle in unserer Beziehung gespielt.
»Das ist nicht wahr, Noemi. Und das weißt du«, versichert sie mir. Doch sie bleibt distanziert, verunsichert auf eine Art und Weise, die ich nicht deuten kann.
»Es ist spät und ich bin müde«, murmle ich resigniert. »Gute Nacht.«
»Schlaf gut«, sagt sie. Ich weiß genau, dass es ein Versöhnungsangebot ist, doch ich kann ihr einfach nicht mehr in die Augen sehen. Deshalb schließe ich schnell die Zimmertür, ohne mich noch einmal umzudrehen, bevor ich mich auf mein Bett fallen lasse.
Ein merkwürdig düsterer, unbewohnter Traum begleitet mich durch die Nacht, bis in den Morgen hinein. Als ich aufstehe, fühle ich mich wie erschlagen. Ich schleppe mich vom Bett bis zum Schrank und wähle mit Bedacht ein schlichtes Outfit für den bevorstehenden Schultag aus. Soweit das noch möglich ist, will ich mich wohlfühlen – jetzt, wo sich die Geschichte über das geplatzte Rohr verbreitet wie eine ansteckende Krankheit. Wenn ich mich so normal wie möglich verhalte, wird hoffentlich bald niemand mehr Grund dazu haben, hinter meinem Rücken zu tuscheln. Schließlich habe ich nichts zu verbergen.
Tatsächlich gelingt es mir, optimistisch zu bleiben. Den Weg zur Schule lege ich noch voller Entschlossenheit zurück, dem Tag eine Chance zu geben. Ich interpretiere den zuckenden Mundwinkel meiner Tischnachbarin als Lächeln und wünsche Mila einen guten Morgen, während sie desinteressiert die Textmarker in ihrem Mäppchen nach Farben sortiert.
Gerade beginne ich mich zu entspannen, da ruft Marek aus der letzten Reihe nach vorne: »Bloud, du hast Blumendienst.«
Verdammt.
»Ach, wirklich?«, erkundige ich mich, während ich zum Dienstplan laufe, um selbst einen Blick darauf zu werfen. Ich bin mir fast sicher, dass in der betreffenden Spalte gestern noch ein anderer Name stand.
»Keine Sorge, viel kannst du da nicht falsch machen«, bemerkt Mila, und streicht gedankenverloren über ein verdorrtes Veilchen. Sie meint es nicht böse, das weiß ich. Aber damit ist sie leider eine Ausnahme.
»Solange du nicht wieder alles unter Wasser setzt«, kichert jemand in der letzten Reihe. Es kostet mich einige Kraft, meinem Entschluss treu zu bleiben und den Kommentar einfach zu überhören. Ich ignoriere meine feuchten Hände, als ich die Gießkanne unter dem Wasserhahn platziere. Was soll schon schiefgehen?
»Achtung! Alle in Deckung«, scherzt jemand. Ich beschließe, die Sache einfach hinter mich zu bringen. Doch bevor ich den Hahn auch nur berühren kann, beginnt das Wasser schon zu sprudeln. Ein Strahl, so dick wie das Rohr selbst schießt in das Becken. Ich weiche zurück, kann der gewaltigen Ladung Spritzwasser aber nicht mehr ausweichen.
»Sehr witzig!«, entfährt es mir. Wer auch immer das war, ist zu weit gegangen. »Leute, was soll das? Ernsthaft, wollt ihr mich eigentlich …?« Als ich in die Gesichter der anderen sehe, verschlägt es mir die Sprache. Denn niemand sieht so aus, als würde er das hier lustig finden. Kein einziger. Sie alle sind genauso fassungslos wie ich. Niemand steht auf. Alle starren wie gebannt auf das Becken.
»Was ist denn hier los?«, ruft der junge Lehrer, als er von einer Flutwelle begrüßt wird. Ich suche nach einer sinnvollen Antwort. Doch die Worte sind weg. Da ist nur noch Wasser, das sich viel zu schnell im Becken sammelt, über den Rand quillt und in alle Richtungen spritzt. Ich spüre den nassen, kalten Stoff auf meiner Brust – und darunter mein Herz, das immer schneller schlägt. Meine Hände zittern unkontrolliert, während Wasser in meine Schuhe sickert. Ein Schauer kriecht mir den Rücken hinauf, und irgendwo flüstert eine Stimme meinen Namen.
Noemi, flüstert sie. Du bist ich, und ich bin du.
Hektisch sehe ich mich um. Doch es war ganz sicher niemand hier im Raum, der gesprochen hat. Ich versuche ruhig zu atmen, meine Gedanken zu ordnen. Es ist nur Wasser, sage ich mir. Doch da ist noch immer diese Stimme. Sie lauert im Hintergrund. Sie scheint es besser zu wissen. Und ich weiß es auch: Irgendwas stimmt hier nicht. Ich schiebe mich an unserem hilflos aussehenden Lehrer vorbei durch die Tür. Sollen die anderen denken, was sie wollen. Ich will einfach nur weg von hier. Weg von allem. Ich will damit nichts zu tun haben. Sie können mich nicht einfach dafür verantwortlich machen. Oder etwa doch?
#02
– Unerwartete Strömung –
Ich wandle durch die Straßen der Kuppelstadt, getrieben von dem Gefühl, dass sich das wahre Leben in einer Parallelwelt abspielt. Unter meinen Füßen spüre ich den kalten Glasboden der Einkaufspassage, durch den man auf das alte Stadtzentrum hinabsehen kann. Die Schaufenster auf Ebene II sind dunkel und leer. In der Ferne höre ich den Brunnen auf dem Poseidonplatz. Aus den Amphoren, die der in Marmor geschlagene Meeresgott auf seinen Schultern trägt, strömt unbeirrt Wasser. Begleitet von diesem entfernten Rauschen und in der Hoffnung, jemanden zu treffen, schleiche ich weiter die Passage entlang. Es muss doch irgendjemand hier sein. Einer meiner Freunde, meine Eltern oder Beek, wenigstens jemand von der Nachtwache. Aber hier ist nichts und niemand – außer der Stille, die sich in meinen Kopf frisst und mir zu verstehen gibt, dass ich nicht hierhergehöre.
Je stärker ich mich gegen diesen Gedanken wehre, desto einsamer fühle ich mich. Ich lasse mich gegen eines der Schaufenster sinken. Das kühle Glas auf meiner Haut lässt mich frösteln. Und erst jetzt wird mir klar, dass die Schaufenster gar nicht leer sind. Anstelle der Verkaufsräume erkenne ich dunkles, grünliches Wasser hinter den Scheiben. Sie sehen aus wie große Aquarien, eins an das andere gereiht. Wenn ich genau hinsehe, erkenne ich Schatten, die sich durch das Wasser bewegen. Ohne den Blick abzuwenden, entferne ich mich von den Schaufensterscheiben und bleibe in der Mitte der Passage sitzen. Als ich meinen Blick auf die Glasplatten unter mir richte, ist auch dahinter nur noch Wasser zu sehen. Ich erkenne die überfluteten Ruinen des Stadtzentrums. Während ich sie betrachte, schwillt das Rauschen des Brunnens in meinen Ohren zu einem Tosen an. Immer wieder verdichten sich die Schatten zu einer Gestalt, die durch das Wasser schießt. Ihre Bewegung ist geschmeidig und unglaublich schnell. Ich glaube, eine Schwanzflosse zu erkennen, und habe doch das Gefühl, dass es sich nicht um ein Tier handelt. Während ich noch fieberhaft nach einer Erklärung dafür suche, verwandelt sich das Tosen in ein Dröhnen. Unter meinen Händen erzittert der kalte Glasboden. Dann platzt mit einem dumpfen Knall hinter mir die erste Schaufensterscheibe. Ich fahre herum und sehe, dass Wasser in den Gang strömt. Eine weitere Scheibe explodiert. Die Glassplitter werden vom Druck der kalten Fluten nach innen geschleudert. Ich schütze mein Gesicht mit Armen und Händen. Unzählige kleine Splitter hinterlassen Schnitte auf meiner Haut. Ich weiß, dass ich weglaufen sollte. Doch etwas hält mich zurück: Das Bewusstsein, dass ich mich nicht gegen die Macht dieses Elements wehren kann. Es will mich an sich reißen. Es ist stärker als ich. Und ich weiß, dass ich ihm nicht entkommen werde.
Mit aufgerissenen Augen starre ich an die Zimmerdecke, die nicht aufhören will, sich zu drehen. Mein Herz hämmert wild gegen den Brustkorb, als hätte ich tatsächlich in dieser Passage gesessen. Das Shirt, in dem ich geschlafen habe, ist so nass, als hätten mich die Wellen zurück in dieses Bett gespült. Aber es ist nur kalter Schweiß. Ich gehe ins Badezimmer, wo ich ein paar gierige Züge aus dem Hahn trinke und mir das Gesicht wasche. Auf dem Rückweg entdecke ich Licht im Arbeitszimmer meines Vaters. Mein Herz macht einen kleinen Sprung, doch als ich einen Blick durch den Türspalt werfe, entdecke ich nur meinen kleinen Bruder. Beek liegt auf dem Bauch vor der alten Holzkommode und scheint mit irgendetwas beschäftigt zu sein. Mir entwischt ein lautloser Seufzer. Einen kurzen Moment zögere ich, doch ich bin einfach zu neugierig. Beeks Lippen formen ein stummes »Oh«, als er mich entdeckt und sich hastig aufrappelt.
»Was machst du?«, frage ich und knie mich neben ihn auf den Boden, wo Fotografien auf Hochglanzpapier und eine neue Packung Buntstifte verteilt liegen. Beek hat sein Schulheft benutzt, um das Foto abzumalen.
»Ich dachte, Mama will die Bilder irgendwann wegwerfen. Wenn Papa nicht wiederkommt.«
»Deshalb hast du sie abgemalt? Das ist richtig gut geworden«, flüstere ich und nehme behutsam das Schulheft in die Hand. Das Foto ist bei unserem letzten Familienausflug entstanden. Das war vor zwei Jahren, als Beek seine erste Schultasche bekommen hat. Stolz schultert er seinen selbst ausgesuchten Schatz. Papa steht hinter uns und lächelt in die Kamera. »Aber die Fotos wird niemand wegwerfen, keine Sorge. Wie kommst du überhaupt auf so was?«, frage ich vorsichtig.
»Mama hat zu Papa gesagt, dass sie ihn nie mehr sehen will. Letztes Mal in der Küche. Ich habe es gehört.« Er sortiert die Buntstifte zurück in die Packung und fragt: »Glaubst du, dass er zurückkommt?«
Ich zögere, weil ich nicht weiß, wie ich Beek erklären soll, dass Papa sich für ein Leben weit weg von uns entschieden hat. So weit entfernt wie nur möglich.
»Kannst du deshalb nicht schlafen?«, frage ich, anstatt zu antworten. Mein kleiner Bruder zuckt mit den Schultern und legt die Fotos sorgfältig in ihren Karton zurück. Ich nehme seine Hand und er lässt sich ohne Widerspruch in sein Zimmer bringen.
»Der Prinz hat doch auch zu Calypso zurückgefunden, oder nicht?«
»Ich weiß es nicht, Beek. In der Sage wird darüber nichts erzählt«, flüstere ich und beiße mir im nächsten Moment auf die Zungenspitze. Das war bestimmt nicht die Antwort, die er hören wollte. »Aber weißt du«, besinne ich mich schnell, »ich bin mir sicher, dass er so lange gesucht hat, bis er sie wiedergefunden hat.« Ich überrede mich selbst zu einem hoffnungsvollen Lächeln und ziehe Beek auf die Beine, um ihn zurück in sein Zimmer zu schieben. Er macht sich absichtlich schwer und ich lasse mich auf ein kurzes Gerangel ein. Damit entlocke ich ihm tatsächlich ein kleines Lächeln.
»So, und jetzt sollten wir beide schlafen!«, stelle ich fest. Beek zieht eine Grimasse, legt sich aber trotzdem hin. Bevor ich aus dem Zimmer schleichen und das Licht löschen kann, blinzelt er noch einmal.
»Emi? Können wir morgen zu den Docks gehen?« Ich halte unwillkürlich die Luft an. Natürlich erkenne ich die Hoffnung, die sich hinter dieser Bitte verbirgt – wie könnte ich ihm diesen Wunsch abschlagen?
»Klar, machen wir«, erwidere ich. »Nach der Schule, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, okay? Und jetzt schlaf gut!« Beek nickt, zieht sich die Decke über den Kopf, und mit einem Lächeln lösche ich das Licht.
Ich war schon lange nicht mehr bei den Docks. Hier unten starten und landen Tiefseeboote im Auftrag der Industrie, der Marine und der Wissenschaft. Der Anleger der Andromeda, das Schiff meines Vaters und das größte Kriegsschiff Calypsos, ist seit ihrem Auslaufen vor zwölf Tagen leer. Manchmal haben wir in der Schule darüber gescherzt, gegen welchen imaginären Feind die Marine von Calypso da draußen wohl kämpft. Ich schätze, die Regierung will das Schiff einfach auf Bereitschaft sehen.
Kaum haben wir den Neptunsteg erreicht, steuert Beek auf den Kiosk bei den Anlegern zu. Er ist verrückt nach den Brauselutschern in Form von U-Booten und Tiefseeungeheuern. Ich nehme ein paar davon für ihn mit und hole mir selbst eine heiße Schokolade. Dann gehen wir auf den Anleger hinaus. Beek ist begeistert von den Frachtern, die ganz vorne im Hafen liegen. Diese Stahlkanister sind so geschunden und unförmig, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass sie wie Steine versinken, sobald sie die Schleusentore verlassen. Tatsächlich beliefern sie aber die Produktionsstätten außerhalb der Stadt. Dabei handelt es sich teilweise um ausgelagerte Fabrikhallen der Protena Industries Corporation, die in Calypso keinen Platz mehr gefunden haben. Aber ich habe auch von submarinen Treibhäusern gehört, in denen Getreide oder Obst gezüchtet wird. Künstlich klimatisierte Kuppeln, die mit intensiverem Licht ausgestattet sind, als wir Menschen es zum Überleben benötigen. In regelmäßigen Abständen bringen die Stahlkanister ihre Ernte nach Calypso, aber sie transportieren auch verletzte Arbeiter oder nehmen neue mit. Manchmal bringen sie auch nur hölzerne Kisten zurück, deren Form und Größe ohne Zweifel auf ihren Inhalt schließen lassen.
Gleich hinter den Frachtern liegen die Forschungsboote. Sie sind filigraner und besser ausgestattet. Von außen erkennt man Messgeräte, Spezialausrüstung und leichte Waffen. Beek ist schon ein Stück vorausgelaufen. Er scheint eines der größeren Forschungsschiffe entdeckt zu haben, das gerade einer Auslaufkontrolle unterzogen wird. Das gesamte Schiff liegt außerhalb der Membran, hinter einer mannshohen Schleuse, durch die das U-Boot an den Landungssteg mit der Nummer 32 gekoppelt ist. Für sperrige Fracht gibt es einen separaten Schacht, der Anleger und Frachtraum direkt verbindet. Ein Mitglied der Crew schlendert gerade den Steg hinunter und wird prompt von Beek aufgehalten. Ich bleibe in einiger Entfernung stehen, um das Gespräch der beiden nicht zu stören.
»Wie viel wiegt euer Schiff?«, will Beek wissen.
»Das kommt darauf an, ob es beladen ist oder nicht«, erklärt ihm der junge Kerl mit hellen Haaren und dunkler Lederjacke. Er scheint kaum älter zu sein als ich. Aber seine muskulöse Statur und die raue Art, die er ausstrahlt, lassen ihn erwachsener wirken.
»Und, was habt ihr geladen?«, löchert Beek weiter.
»Wir müssen Waffen und Messinstrumente mitnehmen, wenn wir auf Exkursion gehen, weißt du. Aber auch einen großen Vorrat an Lebensmitteln.«
»Dann müsst ihr einen ziemlich großen Kühlschrank haben«, schlussfolgert Beek.
»Das kannst du aber glauben.«
»Wie groß ist euer Kühlschrank?«
»Na ja …« Er ist nicht der Erste, der von Beeks Neugier überrumpelt wird. Und ich mache mir jedes Mal einen Spaß daraus, das Spektakel zu beobachten.
»So groß wie ein Klassenzimmer?«, fragt Beek. Jetzt kann auch ich mir das Lachen nicht mehr verkneifen.
»Ja, ungefähr so groß wie ein Klassenzimmer«, erwidert sein Gesprächspartner und sieht zu mir herüber. »Gehört die Kichererbse zu dir?« Beek folgt seinem Blick.
»Das ist meine Schwester«, erklärt er und kommt auf mich zu. »Aber wir müssen jetzt weiter.«
Ich tausche einen amüsierten Blick mit dem Besatzungsmitglied. »Na dann, einen schönen Tag noch«, ruft er uns nach, und ich lasse mich wortlos von meinem kleinen Bruder weiterziehen. Nicht ohne noch einen Blick zurückzuwerfen.
Es ist ein wirklich schöner Tag. Der vibrierende Puls der Verkehrsadern liegt in der Luft, und die Ventilatoren lassen eine leichte Brise erahnen. So ähnlich stelle ich mir den Wind über dem Meer vor. In einem meiner Bücher habe ich gelesen, dass dieser Wind so stark sein kann, dass er sogar die Pflanzen in Bewegung versetzt oder ganze Bäume entwurzelt. Ich sehe hinauf zu den prächtigen botanischen Inseln, deren Blütenpracht sich über die Ränder der großen blauen Glastöpfe hinaus ergießt. Diese Blüten sind der Grund, weshalb wir noch atmen. Sie wurden nach dem Vorbild der Pflanzen an der Oberfläche gezüchtet, um das ausgeatmete Kohlendioxid aus der Luft zu filtern. Die Aerorchideen benutzen eine abgewandelte Form der Photosynthese, die auf das Licht hier unten angepasst ist. Echtes Sonnenlicht zu imitieren, ist unmöglich. Das mussten die Erbauer dieser Stadt schon vor vielen Jahrhunderten feststellen. Das neue Lichtsurrogat wird erst seit dreißig Jahren benutzt. Es vermindert die natürliche Lebenserwartung nur noch um wenige Jahre und liefert wichtige Stoffe, die der Körper beispielsweise zur Herstellung bestimmter Vitamine braucht. In den Laboren von Calypso wird noch immer fieberhaft geforscht. Ich habe gelesen, dass die Ingenieure momentan an der Umsetzung einer neuen Konstruktion arbeiten. Die Idee ist ganz einfach: Ein zweihundert Meter langes Glasrohr soll das Sonnenlicht von der Oberfläche direkt in die Kuppel leiten. An dem Material wird noch gearbeitet. Die größte Herausforderung besteht wohl in der Befestigung an der Oberfläche, denn Calypso liegt fast zwei Kilometer von der Küste entfernt, und über uns befindet sich das offene Meer.
»Emi?« Beek rüttelt an meinem Arm und reißt mich aus meinen Gedanken. »Ich geh die Boote anschauen, okay?« Er schwenkt den Brauselutscher in Richtung der Anleger und ich nicke geistesabwesend.
»Na klar. Mach das.«
Ich lasse mich auf eine Bank fallen und ziehe die Knie an die Brust. Das ausgediente Rettungsboot, das von der Garde gespendet wurde, scheint ihn heute nicht zu interessieren. Weil man in das restaurierte Wrack hineinklettern kann, ist es eine Hauptattraktion für viele Kinder, die am Wochenende mit ihren Eltern herkommen. Wahrscheinlich fühlt er sich auch dafür inzwischen zu alt. Während Beek hinüber zu den Anlegern schlendert, lehne ich mich zurück und schließe noch einmal die Augen. Nach diesem unangenehmen Traum tut mir die Ruhe hier draußen gut. Die meisten Schiffe sind schon gestern oder heute Morgen ausgelaufen. Ab und zu schlendern Arbeiter mit dampfenden Kaffeebechern über den Platz. Ich lausche dem entfernten Geräusch des Verkehrs und der Ventilatoren und denke an die Schule. Wie soll das nur weitergehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Zwischenfall mit dem Waschbecken keine Konsequenzen haben wird. Dabei weiß ich doch selbst nicht, was los ist. Seufzend lege ich den Kopf in den Nacken und blinzle gegen das Licht der grellen Kuppelscheinwerfer an, die auf uns herabstrahlen. Für einen kurzen Moment vergesse ich alles um mich herum. Sogar Beek. Irgendwo im Hafenbecken heult ein Motor auf und holt mich zurück in die Wirklichkeit. Ich öffne die Augen und sehe mich intuitiv nach Beek um. Doch als ich einen Blick hinüber zu den Anlegern werfe, kann ich ihn nirgends entdecken.
Reflexartig stehe ich auf. Ich laufe hinüber zu dem restaurierten Wrack und stecke den Kopf in den metallischen Hohlraum. »Beek?«, rufe ich. Die einzige Antwort entstammt dem dröhnenden Motor eines Schnellbootes draußen im Hafen. Was ist denn heute nur los? Das Geräusch hallt im ausgenommenen Bauch des Wracks wider, vertreibt die Müdigkeit aus meinen Knochen und verwandelt sie in ein angespanntes Kribbeln. Ich hoffe, Beek hält das hier nicht für ein Spiel. »Du versteckst dich doch nicht, oder? Komm bitte raus. Das ist nicht lustig.«
Keine Reaktion. Schon wieder heult draußen der Motor auf. Im Hohlraum des restaurierten Wracks schwillt das Geräusch zu einem unerträglichen Dröhnen an. Ich presse beide Hände auf die Ohren und ziehe meinen Kopf zurück ins Freie. Genervt halte ich nach der aufdringlichen Geräuschquelle Ausschau. Von meinem Vater weiß ich, dass innerhalb des Hafens Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten. Doch das scheint den Fahrer dieses Schmuckstücks nicht zu interessieren. Eine Bugwelle vor sich herschiebend prescht das elegante weiße Jetboot an freien und besetzten Anlegern vorbei. Die vertäuten Schiffe schwanken gefährlich – genau wie ich, als ich den Jungen erkenne, der sich an die Reling klammert. Beek! Ich traue meinen Augen kaum. Was hat er sich nur wieder gedacht? Ob er Spaß oder Angst hat, kann ich von hier aus unmöglich erkennen. Aber was ich deutlich erkenne ist, dass er keine Rettungsweste trägt. Eine Mischung aus Wut und Entsetzen explodiert in meinem Inneren. In meinen Ohren hallt noch die Warnung meiner Mutter nach: »Haltet euch vom Hafenbecken fern. Das ist kein Spielplatz, hast du gehört?« Wenn ihm irgendetwas zustößt, wird sie mir das nie verzeihen. Und ich auch nicht.
Als die Yacht eine scharfe Wende macht, muss ich mich an die Außenwand des Wracks klammern. Ich habe das Gefühl, gleich den Boden unter den Füßen zu verlieren. Mit seiner halsbrecherischen Wende verursacht das Boot eine Welle, die bis auf den Anleger schwappt und den halben Platz überschwemmt. Beek geht bei dem waghalsigen Manöver fast über Bord – verdammt! Wer steuert dieses Ding? Und wo ist die Garde, wenn man sie braucht? Ich schnappe nach Luft, will etwas schreien, doch der Motor ist wesentlich lauter als meine Stimme. Ich laufe los. Da beschleunigt das Boot schon wieder und prescht zu einer neuen Runde davon. Ich habe keine Chance, Beek oder den Fahrer auf mich aufmerksam zu machen – oder sie vor der Welle zu warnen, die sich entgegen aller Naturgesetze plötzlich hinter dem Boot auftürmt und in Richtung der Anleger rollt. In meinem Kopf herrscht chaotisches Rauschen. Alles geht viel zu schnell. Es sieht beinahe so aus, als wollte die Welle das Boot zurück an Land schieben. Als hätte es beschlossen, meinem heimlichen Wunsch zu folgen und für mich zu handeln, während ich hilflos hier stehe. Das einzige Problem ist die Größe dieser Welle. Sie überragt das Boot, das erneut zur Wende ansetzt, trifft dessen Flanke und bringt es zum kentern, noch ehe ich begreifen kann, was da passiert. Panisch schnappe ich nach Luft.
Beek!
Er muss über Bord gespült worden sein. Ich kann den Blick nicht abwenden, als die Wand aus Wasser auf die Anleger zubraust. In der Hoffnung, Beek irgendwo im Wasser zu entdecken, klammere ich mich an einen Poller und bereite mich auf den Zusammenstoß mit der Welle vor. Wie konnte ich mir auch nur für den Bruchteil einer Sekunde lang einbilden, diese Formation aus Wasser könnte eine Verbündete sein? Ich hoffe inständig, nichts damit zu tun zu haben. Denn das würde bedeuten, dass ich gerade die nächste Katastrophe heraufbeschworen habe. Das gesamte Dock bebt, als die Welle auf die Anleger trifft. Im Stillen stoße ich die schlimmsten Flüche aus, die mir einfallen, und schicke ein schnelles Gebet hinterher. Doch mir ist klar, dass ein Wunder geschehen müsste, um Beek zu retten. Die Macht des Wassers ist gewaltig – was habe ich nur getan?
Mit voller Wucht spült die Welle über mich hinweg. Ich klammere mich an den Poller und kann mich nur mit Mühe halten. Als ich wieder Luft bekomme, sind meine Klamotten völlig durchnässt. Der Anleger ist überflutet.
Das Wasser schießt in Sturzbächen auf die Hafenbecken zu. Es spült Taue und Eimer mit sich. Und dann sehe ich ihn.
»Oh mein Gott, Beek!«, rufe ich verzweifelt. Er klammert sich an das Ruder einer vertäuten Yacht. Doch die Strömung ist viel zu stark, er hat keine Chance.
»Emi«, wimmert er. »Ich kann nicht …«
»Halt dich einfach fest!«, ermutige ich ihn und wate los. »So fest du kannst. Ich bin gleich bei dir!«
Doch das Wasser steht mir bis zu den Knöcheln. Und je näher ich dem Hafenbecken komme, umso stärker wird die Strömung.
Ich muss aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. In einiger Entfernung nehme ich das Heulen der Sirenen wahr. Die Garde rückt aus. Sie werden bald hier sein. Aber werden sie es rechtzeitig schaffen? Mir entwischt ein Aufschrei, als Beeks kleine Hände von dem rutschigen Griff des Ruders abgleiten.
»Beek! Benutz deine Beine! Klammer dich fest, ich bin gleich da!«, rufe ich ihm zu. Aber die Wahrheit ist, dass ich kaum vorwärtskomme. Die Strömung ist so stark, dass ich bei jedem Schritt um mein Gleichgewicht kämpfen muss. Ich bin nur zwei Meter von meinem kleinen Bruder entfernt, als er den Halt verliert. Sein kleiner Körper wird über den Steg geschwemmt wie ein Stück Treibholz und rutscht über die Kante des Hafenbeckens. Im letzten Moment klammert er sich an einem der Taue fest. Ich kämpfe mich auf Händen und Knien weiter durch die Strömung. An den rauen Steinplatten schürfe ich mir die Haut auf, aber das ist mir egal. Endlich rücken die Boote der Garde an.
Als ich mich aufrichte, um Hilfe heranzuwinken, rammt eine treibende Kiste meine Kniekehle. Ich schreie auf. Der Schmerz frisst sich in meine Wade und es fühlt sich an, als würde meine gesamte Energie in diesen einen Muskel hineingezogen. Als ich mich zwinge, den Blick wieder nach vorne zu richten, entdecke ich jemanden auf dem überfluteten Anleger. Sein helles Haar und die Lederjacke habe ich heute schon einmal gesehen. Ist das nicht der junge Mann, mit dem Beek gesprochen hat? Was hat er vor? Zielstrebig kämpft er sich an den Punkt vor, wo mein Bruder in das aufgewühlte Hafenbecken gespült wurde. Ich versuche, hinterherzuwaten, bin aber viel zu langsam und verrenke mir beinahe den Hals, um zu sehen, was passiert. Tatsächlich scheint dieser Kerl etwas zu fassen zu bekommen. Es vergehen weitere Sekunden, die sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Dann endlich zieht er meinen Bruder auf den Anleger und hält ihn fest im Arm, während er sich mit der freien Hand an einem Poller abstützt.
Langsam zieht die Welle sich zurück. Sie hinterlässt nichts außer einen Film aus schäumender Gischt auf dem Anleger und rasende Panik in meinem Inneren. Ein Sanitäter hilft mir auf die Beine, während andere Helfer über den Steg laufen und alles einsammeln, was vom Wasser mitgerissen wurde. Kanister, Taue, nasse Stoffteile. Ich erkläre mindestens dreimal, dass ich okay bin und zu meinem kleinen Bruder muss, der zitternd auf dem Steg sitzt. Klatschnass. Lebendig. Hustend, aber ansonsten wohlauf. Beek befreit sich sofort aus seiner wärmenden Decke, als er mich sieht.
»Emi, geht es dir gut?« Ich schließe ihn in meine Arme. Er ist kalt und nass. So wie ich. Aber er lebt!
»Ob es mir gut geht? Ja«, stammle ich fassungslos und bemerke in dem Augenblick, dass Beeks Retter neben uns steht. »Wenn du nicht gewesen wärst«, beginne ich und stelle fest, dass mir die Worte fehlen. In meinem Kopf herrscht noch immer Chaos, aber viel gibt es ohnehin nicht zu sagen. »Vielen Dank!« Unter seiner durchnässten Lederjacke, die er sich über die Schulter geworfen hat, gleicht sein Oberkörper tatsächlich dem eines Rettungsschwimmers. Wie es aussieht, hatten wir Glück. »Wenn ich den Irren erwische, dem dieses verdammte Jetboot gehört«, schimpfe ich drauf los. Und weil unser Rettungsschwimmer auf einmal so still geworden ist, fahre ich fort: »Wie kann man nur so unverantwortlich sein? Hast du zufällig gesehen, wer das war?«
Die tropfende Lederjacke auf der Schulter, tauscht mein Gegenüber einen stummen Blick mit Beek. Was ist denn jetzt los? Mir dämmert viel zu langsam, weshalb mein kleiner Bruder nicht sofort antwortet. »Nicht euer Ernst? Das ist dein Boot?« Ich unterdrücke den Impuls, dem Kerl vor mir eine Ohrfeige zu verpassen. »Weißt du, wie alt Beek ist? Bist du vielleicht auf die Idee gekommen, mich zu fragen, bevor du ihn einfach mit auf eine Spritztour nimmst?« Ich verschränke die Arme vor der Brust und wende mich wieder an Beek.
»Warum – wärst du selbst gerne mitgekommen?«, kontert mein Gegenüber. Auch noch frech genug, mir in dieser Situation mit blöden Sprüchen zu kommen. Nicht zu fassen! Ich stoße ein überraschtes Lachen aus. Aber nicht, weil ich diese Situation auch nur im Entferntesten komisch finde.
»Den Kommentar hättest du dir sparen können. Du Idiot hättest meinen kleinen Bruder fast umgebracht!«
»Kannst du dich mal entscheiden? Gerade hast du dich noch bei mir bedankt.« Ich hole schon Luft, um zu fragen, was er sich eigentlich einbildet, aber der aufgeblasene Kerl ist schneller. »Es war diese Welle, die uns fast umgebracht hätte«, korrigiert er mich. »Woher auch immer die kam. So etwas ist eigentlich nicht möglich.«
Ich kann nicht einmal dagegenhalten. Denn ich weiß er hat recht: Es ist unmöglich. Der Hafen von Calypso ist vollkommen abgeschottet von den Meeresströmungen außerhalb der Kuppel. Es gibt keine Wasserbewegung in diesem Becken. Normalerweise.
Ein schrecklicher Gedanke bahnt sich seinen Weg in mein Bewusstsein. Ich weigere mich, ihm nachzugeben. Nein. Ich hatte nichts mit dieser Welle zu tun. Ganz sicher nicht. Genauso wenig wie mit dem Rohrbruch oder dem Waschbecken. Es muss eine andere Erklärung für das alles geben.
»Na, hab ich dich sprachlos gemacht?«
»Du kannst den Rand halten und froh sein, wenn ich dich nicht anzeige«, erwidere ich knapp. In Zukunft werde ich wohl besser aufpassen müssen, mit wem Beek ins Gespräch kommt.
»Na dann, euch auch noch einen schönen Tag«, lautet die Antwort. Vollkommen unbeeindruckt. Wie dreist kann man bitte sein?
Ich antworte mit einem bösen Blick und murmle: »Kann ja nur besser werden.« Während unser vermeintlicher Retter mit einem Sanitäter spricht, konzentriere ich mich wieder ganz auf Beek. Am liebsten würde ich ihn einfach nach Hause bringen, die ganze Angelegenheit meiner Mutter beichten und hoffen, dass sie mich nicht zu lebenslänglichem Hausarrest verdonnert. Aber als wäre nicht alles schon kompliziert genug, bestehen sie darauf, Beek ins Krankenhaus zu bringen. Ich widerspreche nicht. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, war meine Schuld. Ich kann nicht verantworten, dass womöglich eine Verletzung übersehen wird, nur weil ich die Sache möglichst schnell und unauffällig regeln will. Bevor wir mit den Sanitätern aufbrechen, muss ich Beek versprechen, dass ich ihn nach der Untersuchung gleich nach Hause bringe. Er hasst es, an fremden Orten zu übernachten.