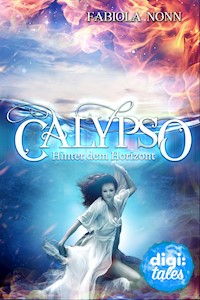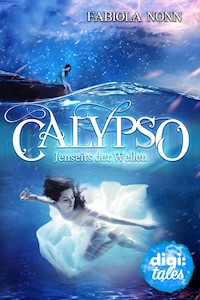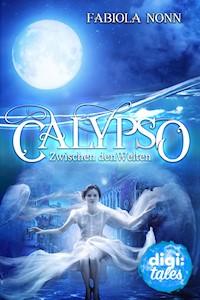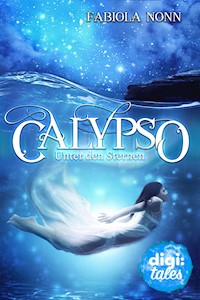
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Calypso
- Sprache: Deutsch
***Tauch ab - Teil 2 der magischen Unterwasser-Saga*** Erst vor kurzem hat Noemi erfahren, dass sie dem in Vergessenheit geratenen Volk der Ondine angehört. Trotzdem beschließt sie, bei den Menschen zu bleiben, als diese aus Calypso vertrieben und dazu gezwungen werden, ihre Heimatstadt unter dem Meer aufzugeben. Das Leben an Land stellt Noemi und ihre Freunde jedoch vor neue Herausforderungen: Nicht nur das unberechenbare Klima ist eine Bedrohung für die unerfahrenen Siedler. Auch die nahegelegene Ruinenstadt Celonia hütet ein gefährliches Geheimnis. Und während Noemi gleichzeitig um ihre Liebe zu Jonaz und das Überleben an Land kämpfen muss, trifft sie unerwartet auf neue Verbündete.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
digi:tales
Ein Imprint der Arena Verlag GmbH
Digitale Originalausgabe
© Arena Verlag GmbH, Würzburg 2017
Covergestaltung: Sarah Buhr
Alle Rechte vorbehalten
E-Book-Herstellung: KCS GmbH, Stelle | www.schriftsetzerei.de
ISBN: 978-3-401-84020-8
www.arena-verlag.de
www.arena-digitales.de
Folge uns!
www.facebook.com/digitalesarena
www.instagram.com/arena_digitales
www.twitter.com/arenaverlag
www.pinterest.com/arenaverlag
Für Nina … und für alle, die zu neuen Ufern aufbrechen.
»Ich hätte mit 16 gern gewusst, dass das Einzige, was zwischen uns und dem Leben steht, die eigene Angst ist, und dass man sie nicht füttern darf, indem man ihr nachgibt. Ich hätte gern gewusst, dass es keine Veränderung gibt, ohne dass man dafür mit Angst bezahlen muss, und wie wunderbar glücklich und frei es macht, Dinge zu tun, vor denen man sich fürchtet.« Cornelia Funke
Inhalt
#1 – Das Seifenblasental
#2 – Keine Ausnahmen
#3 – Eine besondere Gabe
#4 – Leuchtfeuer aus einer anderen Welt
#5 – Gefährliche Brandung
#6 – Knappes Entkommen
#7 – Das Feuer der Freiheit
#8 – Schmerzhafte Wahrheit
#9 – Lumina
#10 – Eine neue Herausforderung
# 11 – Dem Untergang geweiht
– Epilog –
#1 – Das Seifenblasental
»Ist das Ihr Ernst, General Bloud?« Mein Vater erwidert nichts. Schweigend und mit verschränkten Armen sitzt er da, während die Diskussion sich immer weiter zuspitzt. »Wir müssen unseren Fokus auf die Gewinnung der Rohstoffe setzen, wenn wir diese Siedlung retten wollen!« Seit Stunden geht das nun schon. »Nur so können wir wachsen! Das muss Ihnen doch einleuchten«, beendet der Vorsitzende der konservativen Partei seinen Vortrag.
»Wachstum kann nur da stattfinden, wo ein solider Nährboden vorhanden ist«, entgegnet mein Vater mit seiner ruhigen und kräftigen Stimme. Er stützt sich auf die Unterarme, und das hölzerne Pult knarrt unter seinem Gewicht. Das Holz ist so neu wie die Kuppel über unseren Köpfen. Wie fast alles hier in der Siedlung. »Und wenn die Bevölkerung keine Grundversorgung erhält«, fügt mein Vater hinzu, »wer fördert dann Ihre Rohstoffe, General Tosca? Möchten Sie das vielleicht selbst in die Hand nehmen?«
Dieser peinliche Denkfehler treibt dem sonst so standfesten General das Blut in den Kopf. Der Gedanke, dass jemand dreist genug ist, seinem Vorschlag zu widersprechen, und damit auch noch recht haben könnte, scheint ihm gar nicht zu gefallen. Was Tosca meinem Vater an Lebensjahren unterlegen ist, scheint er durch seine Motivation wieder wettmachen zu wollen. In Kombination mit seiner fehlenden Erfahrung führt das leider oft zu Diskussionen, die uns Zeit und Nerven rauben. Und die Tatsache, dass dieser junge General in hohem Maße von sich selbst überzeugt ist, macht es auch nicht besser. Ich seufze und ignoriere meinen knurrenden Magen. Selbst der Regierungskreis ist mit unserer Situation überfordert. Nichts ist mehr so wie noch vor wenigen Wochen. Keinem von uns fällt es leicht, das zu akzeptieren. Doch letzten Endes wird uns kaum etwas anderes übrig bleiben.
»Vergessen Sie Calypso«, fährt mein Vater fort. »Die Spielregeln haben sich geändert.«
»Darum geht es gar nicht«, verteidigt sich Tosca vehement. Er bekleidet dieses Amt erst seit wenigen Wochen, schlägt dafür – oder vielleicht gerade deswegen – aber schon einen recht harschen Ton an. »Wir werden nicht von unserem Kurs abweichen. Die Kalkulation verschiedener Szenarien hat ergeben, dass unsere Gemeinschaft gerade vom Fokus auf die Ressourcen profitiert. Erst der Bau einer neuen Kuppel über der Siedlung wird unser Überleben an Land sicherstellen.«
Seine Parteigenossen nicken im Gleichtakt. Frustriert stütze ich mein Kinn in die Hand und lasse den Blick hinauf zum transparenten Dach der Senatskuppel schweifen. Diese Konservativen. Sie sind immer einer Meinung. Und sie hören niemandem außer sich selbst gerne beim Reden zu. Geschlossen an einem Strang zu ziehen – das macht sie so stark. In unseren Reihen hingegen wird diese Besprechung wieder für endlose Diskussionen sorgen. Ich betrachte all die nachdenklich dreinblickenden Gesichter um mich herum und frage mich, was ich eigentlich hier mache. Seit ich die Verhandlungen zwischen Menschen und Ondine erzwungen und damit einen drohenden Krieg verhindert habe, scheint mein Vater große Hoffnung in meine politische Karriere zu setzen. In seinen Augen bringt das jede Menge Vorteile mit sich: Ansehen und ein gesichertes Auskommen zum Beispiel. Trügerische Sicherheit nenne ich das. Denn seit wir unsere alte Heimat Calypso hinter uns gelassen haben, ist rein gar nichts mehr sicher. Und auch der Regierungskreis trägt herzlich wenig dazu bei, dass sich daran etwas ändert. Es ist wirklich kaum auszuhalten. Hier wird den ganzen Tag geredet, beraten, abgestimmt. Und trotzdem dreht sich alles nur im Kreis. Es werden Kompromisse geschlossen und Entscheidungen erzwungen, mit denen am Ende niemand zufrieden ist. Ich weiß nicht, wie mein Vater das aushält. Er wirkt in letzter Zeit so abgespannt und erschöpft. Sein Haar hat einen verdächtigen Grauton angenommen, was meiner Mutter natürlich sofort aufgefallen ist. Aber er macht trotzdem weiter, schlägt sich Tage und Nächte um die Ohren, um eine Lösung zu finden. Er ist kaum daheim, genau wie früher. Mir entwischt ein Seufzer. Auch daran hat sich nichts geändert.
Die Zeiger der großen Uhr rücken auf die volle Stunde vor. Sie haben dieses Relikt aus dem alten Regierungskreis in Calypso gerettet. Keine Ahnung wie, denn das Ziffernblatt ist riesengroß und schwer. Allein der Stundenzeiger überragt einen ausgewachsenen Mann schon um ein paar Köpfe. Kaum hallt ihr vertrauter, archaischer Gong durch die ansonsten eher karge Senatskuppel, stehe ich schon mit geschulterter Tasche neben meinem Platz.
»Ich glaube, den Rest bekommt ihr auch ohne mich hin«, flüstere ich gerade so laut, dass nur mein Vater es hören kann. Die anderen Senatsmitglieder sind ohnehin viel zu beschäftigt, um mich zu bemerken. Selten habe ich mich so fehl am Platz gefühlt. Auf Papas kritischen Blick antworte ich mit meinem charmantesten Lächeln. Ich weiß genau, dass er keine Diskussion mit mir anfangen wird. Nicht hier, vor allen anderen. Die Quittung bekomme ich frühestens heute Abend, zuhause. Mir bleibt also noch der halbe Tag, um nützlicheren Dingen nachzugehen – wie beispielsweise dem Plündern. Wenn ich Glück habe, erwische ich noch den Anschluss an meine Gruppe. Ich stürme aus dem Saal und gebe den Sicherungscode für das Flexigment ein. Die dreieckigen Segel aus Sicherheitsglas wurden inzwischen an der Außenhülle jeder Kuppel angebracht. Ein hydraulisches System zieht die Segel nach oben und senkt sie nach kurzer Zeit wieder, sodass die Eingangsbereiche der Kuppeln perfekt abgedichtet werden.
Unsere Mechaniker haben Wochen gebraucht, um einen Bruchteil der Stromversorgung wiederherzustellen, die in Calypso zur Verfügung stand. Aber es hat sich gelohnt, denn unsere Kuppeln sind dadurch nicht nur sicherer geworden: Jedes einzelne Flexigment erinnert an das große Schleusentor von Calypso – den ersten Ort, an dem diese Technik zum Einsatz kam. Sie stehen symbolisch für unseren Stolz, und die Hoffnung, eines Tages wieder die hoch entwickelte Zivilisation zu sein, die wir einst waren. Dass die Mechanik bei größeren Kuppeln etwas schwerfälliger läuft, ist ein kleiner Nachteil, der sich leicht umgehen lässt. Wenn mir, so wie heute, wieder einmal die Geduld fehlt, warte ich nicht, bis die grüne LED mir erlaubt, das gesicherte Tor zu passieren. Ich schlüpfe einfach unter dem Segel durch, sobald der Spalt breit genug ist. Normalerweise klappt das auch. Nur heute stolpere ich über ein unvorhersehbares Hindernis, das auf den Stufen unmittelbar hinter dem Durchgang lauert. Ich versuche auszuweichen und falle dabei fast die Stufen hinab. Bevor ich reagieren kann, springt das Hindernis auf, umschließt meine Taille fest mit beiden Händen – und mit einem Ruck stehe ich wieder auf den Beinen. Eine Mischung aus Überraschung und Besorgnis spiegelt sich in den goldbraunen Augen meines Gegenübers. Ich bin mir ziemlich sicher, ihn noch nie zuvor gesehen zu haben.
»Was war das denn?«, wollen die Bernsteinaugen wissen und funkeln mich neugierig an. »Alles klar bei dir?«
»Ich glaube schon«, erwidere ich und mache einen Schritt zurück. »Und selbst? Warum lungerst du hier vor der Kuppel herum, wie ein …« Anstatt weiterzusprechen beiße ich mir auf die Zunge. Vielleicht sollte ich den Unbekannten nicht gleich beleidigen. Immerhin hat er mich gerade vor einem ziemlich heftigen Sturz bewahrt. Der Fremde scheint mir die unglückliche Wortwahl nicht übel zu nehmen. Im Gegenteil. Meine Bemerkung sorgt für eine nachdenkliche Bewegung seiner dunklen Augenbrauen, die von einem charmanten Lächeln abgelöst wird. Auf einmal wird mir warm, obwohl der allmorgendliche Dunst noch immer über der Siedlung hängt. Die Sonne habe ich heute noch nicht gesehen, aber das Zifferblatt im Regierungskreis hat mir verraten, dass es schon fast Mittag ist. Wenn ich den Anschluss an meine Gruppe nicht verpassen will, sollte ich mich jetzt wirklich auf den Weg machen. »Also, eigentlich habe ich das nicht so … tut mir leid«, sage ich und versuche mich kurz zu fassen. »Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass jemand hier sitzt.«
Er verschränkt die Arme vor der Brust. Sein Shirt sitzt nicht nur ziemlich gut – mir fällt sofort auf, dass es kaum getragen ist. Mein drei Monate alter, blassblau gestreifter Lieblingspullover, dessen Saum sich am Hals bereits aufdröselt, wirkt im Vergleich dazu schäbig. Ungetragene Klamotten gibt es in dieser Siedlung nicht mehr. Wie kommt man da an Kleidung, die nicht nur neu sondern auch noch fast maßgeschneidert wirkt? Mein Blick verweilt einen Moment zu lang auf seinen durchtrainierten Oberarmen, bevor mich eine leise Stimme daran erinnert, dass ich so etwas wie einen Freund habe. Verdammt. Auch wenn wir den offiziellen Status unserer Beziehung noch nicht benannt haben – wenn Jonaz andere Mädchen so anstarren würde, fände ich das mit Sicherheit nicht lustig.
»Wie heißt du?«, erkundige ich mich, weil ich diese Frage für unverfänglich halte. »Ich habe dich hier noch nie gesehen.«
»Wow, kennst du etwa jeden einzelnen Menschen in dieser Siedlung?«, kontert der Unbekannte, immer noch schmunzelnd. »Beeindruckend.«
»Natürlich kenne ich nicht jeden einzelnen Menschen in dieser Siedlung«, antworte ich rasch und versuche nicht rot zu werden. Was natürlich prompt das Gegenteil bewirkt, ich spüre förmlich, wie mir das Blut in den Kopf schießt. Das war’s dann wohl mit der Unverfänglichkeit. Was soll ich sagen? Dass ich mich an einen Kerl wie ihn ganz bestimmt erinnern würde, wenn wir uns schon einmal begegnet wären? Ich schätze, es ist Zeit zu gehen. Doch der Fremde streckt mir seine Hand entgegen.
»Mein Name ist Nicon.«
Ich erwidere den Handschlag. »Ein Spitzname?«, rate ich ins Blaue hinein.
»Genau, kurz für Nicarion«, erklärt er und verzieht das Gesicht zu einem gequälten Lächeln. »Normal fanden meine Eltern langweilig.« Ich muss lachen.
»Ja, meine auch. Ich heiße Noemi.«
»Na, immerhin haben sie Geschmack.«
»Danke«, erwidere ich lachend. Die nächste Frage liegt mir schon auf der Zunge. Natürlich interessiert mich, was er hier macht und woher er kommt. Aber wenn ich mich nicht beeile, ziehen die anderen ohne mich los. Schweren Herzens verabschiede ich mich. »Nicon, ich muss weiter. Aber wir sehen uns. Würde mich jedenfalls freuen.«
»Und mich erst«, erwidert er grinsend. »Bis dann, Noemi.«
»Bis dann.« Diese kleine Bemerkung macht es leichter, den Blick von ihm abzuwenden. Früher oder später werden wir uns wieder über den Weg laufen. Die Siedlung ist nicht groß genug, um sich langfristig aus den Augen zu verlieren. Trotzdem bleiben meine Zweifel. Arbeitet dieser Nicon etwa für die Schwarzplünderer? Obwohl diese Gruppe einer nicht ganz legalen Tätigkeit nachgeht, weiß jeder, womit sie ihren Lebensunterhalt bestreitet: Entgegen der vertraglichen Regelung plündern sie die stillgelegten Produktionsstätten von Calypso. Und insgeheim sind wir alle froh darüber. Es gibt nur wenige die furchtlos genug sind, sich über die strengen Auflagen der Ondine hinwegzusetzen. Ihre heimlichen Streifzüge in die Tiefe fördern nach und nach an die Oberfläche, was wir bei der Flucht zurücklassen mussten. Und diese Güter sind begehrt. Ob Nahrung, Kleidung, Medikamente, oder Werkzeug, Bücher und Haushaltsgegenstände. In Calypso gibt es noch so vieles von dem, was hier oben dringend gebraucht wird. Und solange wir keine Fabriken und Maschinen in Betrieb nehmen können, werden wir nicht in der Lage sein, diese Güter selbst herzustellen. Das ist ein echtes Problem.
Obwohl ich mir einbilde, Nicons Blick noch im Nacken zu spüren, widerstehe ich dem Impuls mich umzudrehen und schlage stattdessen den Weg in eine Seitengasse ein. Sie führt mich weiter weg vom Platz der Senatskuppel. Ich streife gedankenverloren durch die Siedlung. Vorbei an den notdürftig reparierten Kuppeln. Wie traurige Denkmäler säumen sie die Seitenstraße, erinnern an den letzten Sturm. Bei einigen hat sich das Flexigment auf halber Höhe verkeilt. Es hängt starr und schief im Eingang, der stattdessen mit Brettern oder einem Stück abgerissener Plane verdeckt ist. Alles wirkt so schäbig und zerbrechlich. Mir wird schwer ums Herz, wenn ich nur daran denke, dass einige dieser Konstruktionen dem nächsten Unwetter vermutlich nicht standhalten werden. Genau zwei Wochen haben sie unbeschadet überstanden – bevor der erste große Sturm kam und die aufwändige Vorbereitung der wenigen Felder zunichtemachte, die wir bepflanzen wollten. Dieses Unwetter kostete uns nicht nur Kraft und Nerven, sondern auch einen Großteil unserer medizinischen Ressourcen und drei Menschenleben. Die Kriminalität stieg weiter an und auf dem Schiffsfriedhof entstanden neben neuen Arbeitsplätzen zwei große Trakte für die Unterbringung von Gefangenen. Tag und Nacht reißen die zum Gemeinschaftsdienst verurteilten Zwangsarbeiter dort gemeinsam mit vielen Freiwilligen die Schrauben, Kupferdrähte und Metallplatten aus den Wracks. Trotzdem reicht das Material kaum für die Reparatur der bestehenden Kuppeln. Und dabei müssten eigentlich dringend weitere Unterkünfte gebaut werden. Insbesondere für junge Familien und ältere Menschen.
Ich erreiche den Rand der Siedlung und bleibe stehen, um einen juckenden Mückenstich an meiner Ferse zu kratzen. Insgesamt habe ich sicher ein gutes Dutzend davon – verteilt über den ganzen Körper.
»Guten Morgen!«, tönt es da hinter mir. Ich richte mich ein bisschen zu rasch auf, und mir wird schwindelig. Mit zusammengekniffenen Augen erkenne ich meinen Bruder Ashek.
»Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen«, stellt er belustigt fest. Ich erwidere nichts. Stattdessen fällt mein Blick auf die gespaltene Kokosnuss in seiner Hand. Sofort läuft mir das Wasser im Mund zusammen.
»Wo hast du die denn gefunden?«, erkundige ich mich hoffnungsvoll. Am Strand gibt es nur vereinzelt Palmen, die Früchte tragen. Die starken Unwetter beschädigen insbesondere kleine Pflanzen und erschweren ihr Wachstum. Man muss also Glück haben – und gut klettern können. Denn eine Kokosnuss gehört demjenigen, der sie zuerst in die Finger bekommt. So lautet die Regel für alle wilden Pflanzen und Tiere an Land.
»Na, woher habe ich die wohl?«, zieht Ashek mich auf, reicht mir aber ohne zu zögern eine der beiden Hälften. »Ich war heute Morgen am Strand.«
»So macht man das als großer Bruder, dachte ich.«
»Ja, vollkommen richtig«, pflichte ich ihm bei, obwohl wir gar nicht genau wissen, ob er nun mein großer Bruder ist, oder ich seine große Schwester bin. Ashek und ich sind Zwillinge, aber was die Körpergröße angeht, liegt er definitiv vorne – leider hatte unsere Mutter nie Gelegenheit dazu, uns mehr über die Details unserer Geburt zu verraten.
Nachdem ich die Reste der frischen Kokosnuss verspeist habe, lasse ich die leere Schale fallen, und wir gehen weiter: Vorbei am Schiffsfriedhof, wo schwelende Ölfackeln den Himmel mit einem grauen Schleier überziehen. Das Wasser in der Bucht ist so schmutzig wie die Luft, die über den Decks flimmert. Der trostlose Anblick erinnert mich immer wieder an unsere Heimatstadt Calypso, an das sichere Leben unter der Kuppel, tief im Meer. Nie hätte ich gedacht, dass mir die künstlich angelegten Gärten und das geordnete System der Straßenebenen eines Tages fehlen würden. Jetzt existiert diese Welt nicht mehr. Nichts von all dem, was wir für selbstverständlich gehalten haben. Und ich zwinge mich, in den aufsteigenden Rauch über den Wracks zu starren – damit ich diesen Fehler nie wieder mache. Nie wieder werde ich irgendetwas für selbstverständlich halten.
Von Ash erfahre ich, dass der Treffpunkt auf später verschoben wurde. Er war heute Morgen schon einmal hier, und offenbar war ich nicht die einzige, die gefehlt hat. Unser Teamleiter hat entschieden, die Mission nicht unter einer Besetzung von fünf Mann durchzuführen. Es scheint also um etwas Größeres zu gehen. Ich bin gespannt. Ausnahmsweise sind wir die ersten am Treffpunkt. Wir schlendern gemütlich über die schwankenden Bretter der Hängebrücke – unserer einzigen direkten Verbindung mit dem anderen Ufer des Fjords. Ich atme tief durch, während mein Blick den Unebenheiten der Strömung folgt. Einige hundert Meter weiter, wo er ins Meer mündet, kräuselt sich das Wasser im Licht der Sonne. Knapp zwei Monate ist es her, dass wir uns hier an Land gerettet haben, nachdem die Menschen von den Ondine gezwungen wurden, Calypso zu verlassen. Es gibt nur wenige, die den Strand schon vor der großen Flucht kannten. Mein Bruder Ash und ich gehören diesem nicht ganz freiwilligen Kreis an. Mit zusammengekniffenen Augen lasse ich meinen Blick den Strand hinabwandern. Ausgehend vom Fjord windet sich der breite Sandstreifen am alten Schiffsfriedhof vorbei und formt in einem perfekten Bogen den Rand einer Bucht, hinter der sich die grün bewaldeten Berge erheben. Von hier aus ist das Riff nicht zu sehen, auf das man stößt, wenn man dem Strand weiter in Richtung Westen folgt. Am zweiten Tag unserer Ankunft haben wir Erkundungstrupps gebildet, die dem Fluss aufwärts folgten und das kleine Tal im Schutz der Berge fanden. Ein paar Tage später wurden bereits die ersten Kuppeln hier erbaut. Und weil der Baustoff aus Calypso im Licht der Sonne schimmerte, nannten wir diesen Ort liebevoll das Seifenblasental. Alles musste schnell gehen. Der Abgleich mit alten Karten verriet uns, dass der Fluss bereits einen Namen hatte, genau wie die Stadt auf der anderen Seite. Und kurz darauf wurde die erste Einsatzgruppe unter dem Kommando von Canter Zevion ins Leben gerufen, die sich zunächst nur dem Bau der Brücke widmete. Damals ahnte noch keiner von uns, was wir auf der anderen Seite finden würden.
Ashek und ich erreichen das andere Ufer und lassen uns auf einem Bruchstück der gigantischen Statue nieder, die über viele Generationen früherer Siedler gewacht haben muss, bevor sie zerstört wurde. Rekonstruktionszeichnungen haben gezeigt, dass es eine weibliche Figur mit ausholendem Dreizack war, die vor mehreren Jahrhunderten hier oben in Stein gemeißelt wurde. Ob sie eine Göttin war, eine Heldin oder Heilige – das weiß heute keiner mehr. Ebenso wenig, ob sie durch eines der zahlreichen Unwetter zerstört wurde, oder von Menschenhand. Nur ihr massiver Sockel ist erhalten geblieben. Teile davon haben wir verwendet, um das Fundament unserer Brücke zu beschweren. Von hier oben kann man das scheinbar endlose Trümmerfeld von Celonia überblicken: Verwitterter Zement, die brüchigen Fassaden alter Wohnblöcke, schuttbedeckte Straßen. Täglich durchstreifen wir das Labyrinth der Geisterstadt. Auf der Karte, die uns ihren Namen verraten hat, waren auch alte Industriegebiete und Fabrikhallen eingezeichnet, in deren Trümmern verborgene Schätze schlummern: Werkzeug, Waffen und konservierte Nahrungsmittel ergänzen das Angebot der Schwarzplünderer, das eines Tages erschöpft sein wird. Natürlich wird unsere Ausbeute auf die gesamte Siedlung verteilt. Mehr können wir im Moment nicht tun.
Ein leichtes Schwingen der Stahlseile verrät, dass jemand die andere Seite der Brücke betreten hat. Durch den letzten, verblassenden Dunst des Morgens klingen die Stimmen unserer Kameraden zu uns herüber. Wir arbeiten nun schon seit einigen Wochen zusammen. Anders als die meisten Arbeitgeber achtet Zevion darauf, seine Leute beisammenzuhalten. Es gibt zwar weder Arbeitsverträge noch Festgehalt, aber wenigstens haben wir einen fairen Teamleiter. Und das weiß jedes einzelne Mitglied der Crew zu schätzen. Niemand kann es sich noch leisten, große Versprechungen für den nächsten Tag zu machen, auch Zevion nicht. Die ganze Siedlung ist auf der Suche nach einem lohnenden Job. Am liebsten auch noch einen, der sicher ist. Die Tätigkeit der Plünderer zählt nicht in diese Kategorie. Doch im Gegensatz zu den schwarzen Plünderungen ist unsere Arbeit vom Regierungskreis autorisiert. Wir riskieren nicht, von den Ondine erwischt und für einen Verstoß gegen das Friedensabkommen eingebuchtet zu werden. Immer wieder haben Mitglieder aus Zevions Team zwischenzeitlich ihr Glück bei den Schwarzplünderern versucht. Die Jungs kamen schnell wieder zurück, sobald sie erkannten, wie viel sie damit aufs Spiel setzen. Leichtfertig vergibt unser Einsatzleiter, Canter Zevion, keine zweite Chance. Doch er hat ein gutes Gespür dafür, wer sie zu nutzen weiß und wer nicht. Inzwischen gehört sein ernstes Gesicht tatsächlich zu den Dingen, auf die ich mich bei der Arbeit am meisten freue.
So auch heute. Als er nach einigen weiteren Minuten am Treffpunkt ankommt, begrüßt Zevion uns mit einem Schlag auf die Schulter und überreicht uns wortlos die Ausrüstungen. Auch die anderen trudeln jetzt nach und nach ein. Nachdem alle acht Mann versorgt sind, nickt er zufrieden in die Runde und verkündet:
»Wenn das heute gut läuft, gebe ich eine Runde Wurzelsud aus!«
Ich tausche einen überraschten Blick mit meinem Bruder. Bei allem Respekt, den ich ihm entgegenbringe: Optimismus zählt normalerweise nicht zu den Eigenschaften, die unseren Einsatzleiter auszeichnen.
»Die Historiker haben einen weiteren Teil der Karte rekonstruiert. Und ratet, was sie gefunden haben: Ein altes Fabrikgelände der Protena Industries Corporation.« Auf unsere fragenden Gesichter reagiert er mit einer wegwerfenden Handbewegung. »Das erkläre ich euch unterwegs. Wir haben einen langen Weg vor uns. Also, los!«
Das Labyrinth der Geisterstadt empfängt uns mit seinen verwitterten Betonmauern. Efeuranken überwuchern den brüchigen Stein und aus jedem Riss in der asphaltierten Straße zwängt sich ein Büschel wilder Pflanzen. Ein heulender Windstoß fegt durch die Ruinen der hohen Gebäude, die teilweise erstaunlich gut erhalten, teilweise ausgebrannt oder in sich zusammengestürzt sind. Ich bekomme eine Gänsehaut. Diese Gegend ist so unwirklich, so trostlos. Und zugleich von anrührender Schönheit. Es ist der Nachhall einer belebten Welt, der in dieser Stille mitschwingt und mich erschaudern lässt. Wenn ich die Augen schließe, höre ich brummende Motoren und die Schritte vieler tausend Menschen. Kinder zeigen staunend auf Schaufenster. Eine Zeitung wird vom Wind erfasst und in die Luft getragen.
Doch wenn ich die Augen öffne, sind da nur ein paar trockene Blätter, die vom Boden aufgewirbelt werden. Von der belebten Stadt ist nicht viel übrig geblieben – außer dem Wind. Und den leeren Straßen. Obwohl schon so manche Plünderer berichtet haben, sie hätten Menschen gesehen, die in den hohen, unerreichbaren Fensternischen saßen oder ganz plötzlich um die nächste Ecke verschwanden. Die einen schieben es auf die Hitze hier draußen, die einem durchaus zu Kopf steigen kann. Die anderen auf die unheimliche Atmosphäre, die man besser nicht zu nah an sich heranlassen sollte. Was mit all den Menschen geschah, die damals in Celonia lebten, weiß heute niemand mehr. Womöglich haben einige es nach Calypso geschafft – die Stadt der Hoffnung, die von den Siedlern damals in weiser Voraussicht erbaut worden war. Als das Meer schließlich über seine Schwelle trat und schwere Erdbeben das Land erschütterten, müssen sich viele Überlebende von ihrer Welt verlassen und verraten gefühlt haben. Anders kann ich mir nicht erklären, weshalb wir nie wieder einen Gedanken an die Besiedelung der Oberfläche verschwendet haben. Das Festland blieb uns als lebensfeindliches Terrain in Erinnerung – als trostloser Ort, der vergessen werden wollte. Die Regierung von Calypso stabilisierte ihre Machtstrukturen, indem sie vor dem unberechenbaren Klima, extremen Temperaturschwankungen, Flutkatastrophen und vor Wasserknappheit an Land warnte. Und so lebten wir jahrhundertelang unter dem Meer, in dem Glauben, die Oberfläche unseres Planeten sei eine unbewohnbare Wüste.
»Protena Industries wurde nicht erst im Laufe der Ära Calypso zu unserem größten Lebensmittelhersteller. Der Konzern existierte schon früher«, erklärt Zevion und reißt mich damit aus meinen Gedanken. »Nach dem Untergang von Celonia betrieb Protena noch zwei Dutzend weitere Produktionsstätten unter Wasser – bis die verfluchten Ondine uns alles genommen haben«, fügt er verbittert hinzu. »Wahrscheinlich fressen sie dort unten jetzt unsere Proteine.«
»Ich fürchte, das haben sie gar nicht nötig«, seufze ich. Zevion ist nicht der einzige, der Groll gegen die Ondine hegt. Fast alle geben dem maritimen Volk die Schuld an unserem Elend. Ich sehe das ein bisschen anders. Nicht etwa, weil mein Bruder in ihrer Stadt, Nalanee, aufgewachsen ist. Oder weil ich selbst zur Hälfte eine Ondine bin. Nein – aber ich finde nun mal, dass die Menschen mindestens genauso viele Fehler gemacht haben wie das maritime Volk. Hätten wir ihren Lebensraum nicht mit dem Abwasser unserer Stadt vergiftet, und hätte Captain Jenszen nicht gewaltsam versucht, ihnen ein politisch sowie wirtschaftlich sensibles Geheimnis zu entreißen, dann hätten sie uns vielleicht in Ruhe gelassen. Nicht nur vielleicht. Ich bin mir sicher, das hätten sie. Aber natürlich will das hier niemand hören.
»Wenigstens die Produktionshallen und Maschinen von Protena hätten sie uns lassen können«, knurrt Zevion jetzt. Ich kann seine Wut verstehen. Auch wenn ich den getrockneten Fisch, die Nüsse und Wurzeln an Land zu schätzen gelernt habe – sie allein liefern uns nicht genug Energie um den täglichen Überlebenskampf hier draußen zu bestehen. Und Zevion ist noch nicht fertig. Ohne stehen zu bleiben, dreht er sich zu uns um. »Ich kann euch beide gut leiden, das wisst ihr. Aber dass diese Fischgesichter uns zwingen, verschimmelte Reste aus den Ruinen dieser Stadt zu kratzen, das geht zu weit. Wir können von Glück reden, dass wir wenigstens die Wiederaufbereitungstechnologie aus den Produktionsstätten unter Wasser retten konnten, bevor sie uns vertrieben haben.«
Ja zum Glück hat diese einzigartige Technologie überlebt. Es ist Asheks Stimme, die ich in meinem Kopf höre. Klar und deutlich. Auch der ironische Unterton entgeht mir nicht. Ich kann seine Gedanken hören. Und er meine. So war es schon immer. Seit wir einander zum ersten Mal begegnet sind.
Nicht auszudenken, was ohne sie los wäre, fährt er ärgerlich fort. Die Menschen würden womöglich auf die Idee kommen Tiere zu jagen. Oder Fische zu fangen.
Ich seufze und konzentriere mich auf den Weg vor mir, um meinen Bruder nicht anzusehen, während ich antworte: Ash, die Menschen haben jahrhundertelang unter der Kuppel von Calypso gelebt und vergessen, wie man auf die Jagd geht. Außerdem besitzen wir kaum brauchbare Waffen. Mit der Protena-Technologie sind sie besser dran als ohne sie. Glaub mir.
Schweigend gehen wir weiter. Das Echo unserer Schritte hallt von den nackten Betonwänden wider. Selbst am hellen Tag klingt das etwas unheimlich. Auf der grünen Kreuzung machen wir Halt, um Wasser zu trinken und die ersten Riegel aufzuteilen. Ihren Namen erhielt die grüne Kreuzung, weil sie inmitten der grauen Betonwüste an eine fruchtbare Oase erinnert: Im Umkreis einiger hundert Meter ist sie der einzige Fleck mit zwei hoch gewachsenen alten Bäumen und Gras, das fast bis zu den Knien reicht. Der Wind streift durch die blassgrünen Halme und die knorrigen Äste strecken sich tapfer dem Himmel entgegen. Die Sonne steht inzwischen hoch über uns. Erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht, während man einen Fuß vor den anderen setzt – ein weiterer Vorzug dieser Arbeit. Das Beste ist jedoch, dass wir Mahlzeiten gestellt bekommen. Eine Tagesration Proteine für jeden und nach Feierabend noch mal vier Riegel, das ist unser Lohn. Dafür wird von uns erwartet, dass wir in den Trümmern von Celonia die letzten verwertbaren Nahrungskonserven ausbuddeln. Die alten Proteine werden in der Siedlung wiederaufbereitet und mit den letzten Riegeln aus Calypso gestreckt. Bis jetzt hat diese Strategie unsere Kolonie am Leben erhalten. Und wenn wir heute erfolgreich sind, werden wir keinen Gedanken mehr an den Hunger verschwenden müssen. Wenigstens für die nächsten paar Tage. Ich seufze, trenne den markierten Falz meiner ersten Ration auf und schnuppere vorsichtig. Es könnte Haselnuss sein, oder Schokolade. An der Modifikation unterschiedlicher Geschmacksrichtungen muss bei der Wiederaufbereitung noch dringend gearbeitet werden. In Calypso waren wir auf diese Riegel nur angewiesen, wenn es zu einem größeren Ausfall in den Produktionsstätten kam. Jetzt zählt alles, was wir aus unserer alten Heimat mitgebracht haben, zu den erschöpfbaren Ressourcen und wird streng rationiert. Wenn unsere Vorräte aufgebraucht sind, müssen wir uns hier oben selbst versorgen können. Auch deshalb hängt unser Überleben von der Wiederaufbereitung der Reste ab, die in den Kellern der Ruinen erhalten geblieben sind.
Eine angenehme Brise weht mir die verschwitzten Strähnen aus der Stirn. Ich streiche mir durchs Haar und schließe einen Moment lang die Augen. Zuerst nehme ich die kribbelnden Punkte auf meinen geschlossenen Lidern kaum wahr. Aber dann werden sie rasch größer, wachsen zu blauen Funken heran und tanzen wie ein Schwarm wilder Hummeln über meine Netzhaut. Was ist das? Ich versuche sie wegzublinzeln – vergeblich. Die hellblauen Lichtpunkte bleiben, selbst als ich die Augen wieder öffne.
Das passiert mir in letzter Zeit häufiger. Anfangs habe ich es noch auf meinen Kreislauf geschoben. Mir eingeredet, ich hätte zu wenig gegessen oder geschlafen. Erzählt habe ich niemandem davon. Meine Eltern würden sich nur Sorgen machen, das weiß ich genau. Und Zevion würde mich womöglich als arbeitsunfähig einstufen. Das kann ich mir gerade so überhaupt nicht leisten. Ich kneife die Augen zusammen und versuche, mich auf einen Punkt zwischen den verwitterten Fassaden zu konzentrieren: Da ist ein besonders großes Loch in der Wand eines halb zerfallenen Wohnblocks. Und noch etwas: Schatten. Ich erkenne verschwommene Schatten, die sich schließlich zu klaren Umrissen verdichten. Die blauen Funken schwirren umher, spielen vollkommen verrückt, und deuten dann wieder Konturen an, die an menschliche Körper erinnern. Es wirkt fast ein bisschen so, als würden sie hinter den Wänden lauern - hinter Mauern aus Beton, die scheinbar auf einmal transparent geworden sind. Aber wie kann das sein? Sofort denke ich an die Geschichten der anderen Plünderer. Denn die Beschreibung stimmt überraschend genau mit dem überein, was ich zu sehen glaube: Menschen. In den Ruinen. Hat es mich jetzt auch erwischt? Werde ich verrückt?
Alles klar bei dir? Asheks Stimme holt mich schlagartig in die Realität zurück.
Ich glaube schon, erwidere ich so ehrlich wie möglich, ohne seine Besorgnis zu wecken. Er würde es sofort spüren, wenn ich ihn belüge. Zum Glück bleibt keine Zeit für weitere Fragen. Zevion ist aus dem Schatten des knorrigen Baumes getreten und wartet mit verschränkten Armen, während wir unsere Taschen schultern. Ich versuche, die blauen Funken, die Schattengestalten und die transparenten Wände aus meinem Kopf zu verbannen. Dann schultere ich meine Tasche. Noch ist sie federleicht, doch wenn wir heute Abend den Rückweg antreten, werden die Riemen in unsere Schultern schneiden – das schmerzhafte und zugleich triumphierende Gefühl eines erfolgreichen Raubzugs.
Wir erreichen die Lagerhalle erst gegen Nachmittag. Sie liegt tief im Herzen der Stadt. Tiefer als jedes andere unserer bisherigen Ziele, weil wir es nie nötig hatten, so weit vorzudringen. Doch die Zeiten ändern sich schneller als uns lieb ist. Von Staub bedeckt unterscheidet sich die Fassade der Fabrik kaum vom Rest der verlassenen Stadt. Der Rettung alter Karten verdanken wir das Wissen um potenzielle Nahrungsquellen. Und ausnahmsweise rechne ich dem Regierungskreis diese Leistung hoch an. Denn hätte deren früherer Vorstand die Geheimhaltung dieser Dokumente nicht aufgehoben und die alten Karten aus der Bibliothek in Calypso retten lassen, würden wir heute wohl kaum vor den gewaltigen Toren der Protena Industries Corporation stehen. Auf den ersten Blick habe ich sie gar nicht wahrgenommen: Die beiden Tore, die wie zerschmetterte Flügel eines überirdischen Wesens unter dem verkrusteten Staub und Schutt hervorragen. Unzerstörbar. Und doch gefallen. Manchmal kann ich nicht anders – ich empfinde eine dumpfe Traurigkeit bei dem Gedanken an dieses längst vergangene Imperium, über das wir viel zu wenig wissen.
Hinter dem Industriegebiet ragt ein Damm hoch in den Himmel auf. Er ist alt und brüchig, doch seine Größe wirkt noch immer furchteinflößend. Hätte Zevion sich nicht selbst vergewissert, dass der See dahinter bis auf den Grund ausgetrocknet ist, würden wir jetzt nicht hier stehen – im Schatten der alles überragenden Mauer. Wie viele Jahrhunderte lang hat sie den Menschen hier oben wohl gedient, bevor sie Zuflucht in Calypso suchen mussten? Die alten Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass der See über dem Damm bereits kein Wasser mehr führte, als die Menschen Celonia verließen. Dass dieser Damm die gesamte Ära Calypso überdauert hat, grenzt jedenfalls an ein Wunder.
Wir steigen über die gefallenen Torflügel hinweg und betreten das Fabrikgelände. Ein kaum noch erkennbares Bahngleis führt direkt auf die Halle zu. Davor steht ein aufgebrochener Waggon, von Löwenzahn und Unkraut überwuchert. Er ist viel größer als die Container, die im Hafen von Calypso auf Schienen transportiert wurden. Während zwei von uns sein Innenleben erkunden, suchen Zevion und Ashek nach einem Mechanismus, der die schweren Tore der Fabrikhalle öffnet. Unsere bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass ein Großteil der Mechanik hier oben die Zeit nicht überdauert hat. Insbesondere, wenn sie Wind und Wetter ausgesetzt war – wie dieses Gelände. Mit verschränkten Armen betrachte ich die über uns aufragende Hallenwand. Die Fassade ist mit einer dicken Schicht aus Rost und Staub überzogen. Wir packen alle mit an, ziehen und rütteln an der Stelle, wo wir das Schloss vermuten. Ich bin froh um meine Handschuhe, die zuverlässig vor Rost und scharfen Kanten schützen. Aber richtig zupacken kann ich damit leider nicht. Es ist aussichtlos. Auch mit Hammer und Zange kommen wir nicht weiter. Obwohl das Material spröde ist, hält es unserem gesamten Werkzeugsortiment stand. Es bewegt sich rein gar nichts. Stöhnend trete ich einen Schritt zurück, wische mir den Schweiß von der Stirn und sehe mich um.
»Es muss doch noch eine andere Möglichkeit geben, da reinzukommen«, spricht Ash wieder einmal meine Gedanken aus – wobei wir in diesem Moment vermutlich alle das gleiche denken.
»Über das Dach vielleicht?«, schlägt jemand vor.
»Wenn du mir sagst, wie wir da raufkommen«, entgegnet Zevion und entfacht damit eine kleine Diskussion, die ich mir lieber nicht anhören möchte. Nicht schon wieder. Stattdessen gehe ich ein paar Schritte um das Gebäude herum und entdecke zwischen wild wucherndem Löwenzahn und verbeulten, leeren Kanistern aus Plastik ein weiteres Tor. Als ich mich nähere, dringt aus dem dunklen Spalt ein kühler Lufthauch. Ich erschaudere und gehe intuitiv wieder ein paar Schritte auf Abstand, bevor ich den anderen zurufe:
»Leute, kommt mal her!«
Tatsächlich unterbrechen sie ihre Diskussion, um sich meine Entdeckung anzusehen. Einen Moment lang herrscht Stille – nur der Wind heult durch das Tor, als würde die alte Fabrikhalle tief einatmen. Dann räuspert sich Zevion.
»Gut gemacht, Bloud.« Er nickt anerkennend, doch es ist Ashek, der spontan die Führung übernimmt. Niemand erhebt Einspruch. Das Licht seiner Taschenlampe flackert auf und wir greifen nach unserem eigenen Licht, bevor wir Ashek in die Dunkelheit folgen. Es ist erstaunlich kühl. Durch die zersprungenen Scheiben in der Decke dringt etwas Licht herein, doch es ist zu wenig für unsere Augen, die bis eben noch der sengenden Mittagssonne ausgeliefert waren. Nach und nach gewöhnen wir uns an das Dämmerlicht. Die Taschenlampe kommt nur zum Einsatz, wenn wir uns durch besonders dunkle, schmale Passagen zwängen müssen. Wir folgen Zevion durch das Gewirr an Maschinenblöcken und Fließbändern bis zu den Lagerhallen. Niemand sagt ein Wort. Schritte hallen von den nackten Wänden wider, das Zwitschern eines Vogels dringt durch das beschädigte Dach. In den einfallenden Lichtstrahlen tanzen Staubflocken und sofort breitet sich ein merkwürdiges Gefühl in meinem Brustkorb aus.
Ashek?, frage ich flüsternd in den Raum hinein.
Doch es ist nicht mein Bruder, der antwortet. Zevion kommt ihm mit rauer Stimme zuvor: »Was zum …« Er macht ein paar hastige Schritte in die leere Halle hinein.
»Sind wir hier richtig?«, flüstert Ash. Er lässt den Strahl seiner Taschenlampe durch den Raum gleiten. Und da sehe ich es auch. Einen endlos erscheinenden Moment lang herrscht vollkommene Stille. Wortlos starren wir in den zitternden Lichtkegel an der Hallenwand. Dort prangt in blutrotem, feucht schimmerndem Ton ein riesiges Symbol. Es kann kaum älter als ein paar Stunden sein, denn die Farbe ist noch nicht getrocknet. Ich erkenne ein viergeteiltes Wappen, das ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen habe. Die anderen wohl auch nicht, wie es scheint.
»Jemand ist uns zuvorgekommen«, murmelt Zevion und sieht sich hastig um. Ich weiß genau, was er denkt: Dieser jemand könnte noch hier sein. Das alte Fabrikgelände ist der perfekte Ort für eine Falle. Wir stehen wie angewurzelt da und lauschen in die Stille hinein. Doch außer dem unbeirrt zwitschernden Vogel ist nichts zu hören. Ich trete vor die beschmierte Wand, um die einzelnen Segmente des Wappens genauer zu betrachten. Wer auch immer für dieses Werk verantwortlich ist, hatte entweder nicht viel Zeit, oder keine Lust, sich Mühe zu geben. Ich erkenne einen Kreis in der Mitte des Wappens. Das Symbol darüber könnte eine Krone darstellen. Oder einen Dreizack. Die Details sind nur schwer zu erkennen. Den aufdringlich schweren Geruch von Ölfarbe nehme ich umso deutlicher wahr. Und als ich die Wand mit dem Finger berühre, bestätigt sich mein Verdacht:
»Die Farbe ist noch frisch«, flüstere ich und drehe mich um. Die anderen haben das Licht ihrer Taschenlampen auf den Boden gerichtet, wo im Staub dutzende Fußabdrücke zu erkennen sind. Klar und deutlich, sicher noch keinen Tag alt. Und ganz bestimmt nicht nur von unseren eigenen Leuten. So viele Mitglieder zählt Zevions Team gar nicht. Auf einmal fühlt es sich unheimlich an, so abseits der Gruppe in der Dunkelheit herumzustehen. Intuitiv suche ich die Nähe meines Bruders. Ash streift meinen Arm, wie um sich meiner Nähe zu vergewissern. Trotzdem breitet sich das Unbehagen weiter in mir aus. Schaudernd erinnere ich mich an die Erzählungen der anderen Plünderer – denen niemand glauben wollte …
»Was machen wir jetzt?«, murmelt jemand in die Stille hinein. Ratlos sehen wir einander an. Und je länger wir schweigen, umso bewusster wird uns allen, dass wir gar nichts machen können. Außer mit leeren Händen zurückzukehren.
Wir werden Hoffnungen zerstören. Für den Hunger in der Siedlung verantwortlich gemacht werden. Wir werden die Versager sein, die den einfachsten Auftrag nicht erledigen können. Und als wäre das alles nicht schon genug, werden wir die Überbringer einer erschütternden Nachricht sein, die unsere Zukunft an Land verändern wird. Dieser Teil wird ihnen am wenigsten gefallen, fürchte ich. Und trotzdem muss die ganze Siedlung es erfahren: Wir sind nicht allein hier oben.
#2 – Keine Ausnahmen
Auf dem Rückweg herrscht angespanntes Schweigen. Unsere Schritte knirschen leise auf dem sandbedeckten Asphalt. Wir behalten jede Fassade und jede Kreuzung genau im Blick. Dieses Wappen war ganz offensichtlich eine Warnung. Und die Tatsache, dass seine Anhänger uns nicht schon in der Fabrikhalle aufgelauert haben – wo wir unbewaffnet mit dem Rücken zur Wand standen – beruhigt mich auch nicht wirklich.
Kaum haben wir die Treppe am Stadtrand von Celonia erreicht, stößt die APEC II zu uns. Casim Makash, der Anführer der zweiten autorisierten Plünderungseinheit Celonia – kurz APEC – ist ein guter Freund von Zevion. Er ist bekannt für seine wilde Entschlossenheit und eine unerschütterliche Ruhe, von der heute leider nicht viel zu spüren ist. Seine Gesten und hektisch geflüsterten Worte verraten mir alles, was ich wissen muss. Ashek und ich tauschen einen beunruhigten Blick und setzen unseren Weg schweigend fort. Nichts wie raus aus dieser Geisterstadt.
»Unheimlich ist das«, murmelt ein junges Mädchen aus der APEC II. Ich kenne sie nicht, aber sie versucht offenbar, mit uns Schritt zu halten. Ihre Freunde sind einige Stufen zurückgefallen, aber ihre skeptischen Blicke entgehen mir nicht. »Ihr habt das Wappen also auch gesehen?«