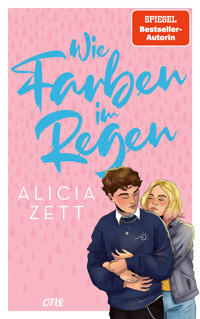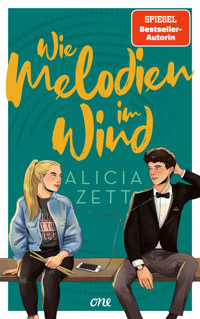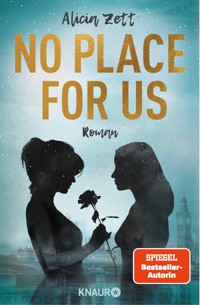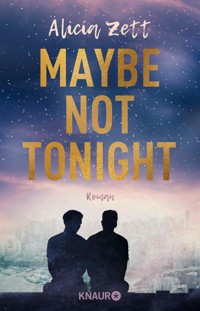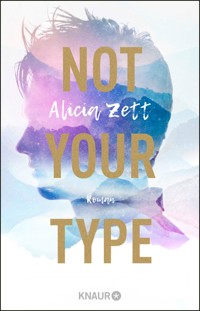9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wenn es einen Ort gibt, an dem die 17-jährige Malin ganz sie selbst sein kann, dann ist es Camp Rainbow. Wie jedes Jahr fiebert sie den Ferien in den bayerischen Alpen entgegen: Drei Wochen voller Natur, Freiheit - und hoffentlich ganz viel Herzklopfen. Denn obwohl Malin im queeren Sommercamp eine Menge toller Menschen kennt, ist sie bisher noch ungeküsst. Das soll sich nun ändern! Kurzerhand erstellt sie mit ihren beiden besten Freund:innen eine Want-to-kiss-List, und wenig später beginnt es zwischen ihr und dem Camp-Schwarm Juan zu kribbeln. Doch Malin hat nicht mit Nora gerechnet, dem Mädchen, das alle von sich stößt - und das sie eigentlich niemals auf ihre Liste setzen wollte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumHinweisWidmungPlaylistMalin Guck-in-die-LuftEine wichtige RechercheDas Kuss-DilemmaIm DoppelpackFinally SeventeenHeimkehrWillkommen in Camp RainbowCamp-GeburtstagLilly ShuDie KusslisteCamp-AlltagRudern für Anfänger*innenFlynn RosenbaumDer erste KussHow to flirten?Zwei auf einen StreichMädelsabendDas erste DateBetörender DuftCrushMiss UnverbindlichBacke, Backe KuchenKindheitserinnerungenDie vergessene FreundinEin Tag im ParadiesVerpuffte VorfreudeDie Leichtigkeit in PersonAuf WanderschaftIn der HöhleKrebs ohne PanzerDer versetzte SchauspielerBasti, der LiebesguruDate mit der PfadfinderinParty TimeFriendship BreakupSchreckliche Freund*innenDu und ichÜber uns der HimmelSo viel mehrIs it casual now?Dear Evan HansenHeimwärtsEpilogDanksagungINHALTSINFORMATIONÜber dieses Buch
Wenn es einen Ort gibt, an dem die 17-jährige Malin ganz sie selbst sein kann, dann ist es Camp Rainbow. Wie jedes Jahr fiebert sie den Ferien in den bayerischen Alpen entgegen: Drei Wochen voller Natur, Freiheit – und hoffentlich ganz viel Herzklopfen. Denn obwohl Malin im queeren Sommercamp eine Menge toller Menschen kennt, ist sie bisher noch ungeküsst. Das soll sich nun ändern! Kurzerhand erstellt sie mit ihren beiden besten Freund:innen eine Want-to-kiss-List, und wenig später beginnt es zwischen ihr und dem Camp-Schwarm Juan zu kribbeln. Doch Malin hat nicht mit Nora gerechnet, dem Mädchen, das alle von sich stößt – und das sie eigentlich niemals auf ihre Liste setzen wollte …
Über die Autorin
Alicia Zett wurde 1996 geboren, hat Film studiert und arbeitet derzeit bei einem lokalen Fernsehsender. Wenn sie nicht gerade auf ihren Social Media Kanälen (aliciazett) über queere Bücher, Filme und Serien spricht, verbringt sie ihre Tage am liebsten mit langen Spaziergängen in der Natur, dem Erstellen von Buchplaylisten oder stundenlangen Gesprächen mit ihren Freund*innen. Alicia schreibt Bücher, die sie selbst in ihrer Jugend gebraucht hätte. Nun nutzt sie ihre Geschichten, um zu zeigen, dass Liebe in allen Formen und Farben existiert.
A L I C I AZ E T T
Über mir der Himmel
Band 1
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Langenbuch & Weiß Literaturagentur.
Copyright © 2025 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Textredaktion: Silvana Schmidt
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de
Illustration: © Mi Ha, Guter Punkt, München
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-7440-6
one-verlag.de
luebbe.de
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Dazu findet ihr genauere Angaben auf S. 464.
ACHTUNG: Diese enthalten Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer Team vom ONE-Verlag
Für alle, die das Gefühl haben,zu viel,zu queer,zu laut zu sein.Ihr seid genau richtig.
PLAYLIST
Good Bi – Beth McCarthy
Mess It Up – Gracie Abrams
Feel My Feelings – girli
I Won’t Cry – Layne Elizabeth
I Can Do It With a Broken Heart – Taylor Swift
Gravity – Pale Waves
Turbulence – Emma Charles
Running Out of Places to Go – Riley Whisler
Anybody – BIZZY
Waving Through A Window – Ben Platt, Original Broadway Cast of Dear Evan Hansen
Dial Drunk – Noah Kahan
this is me trying – Taylor Swift
In It Together – Joshua Howard, Marielle Kraft
Officially Mine – Maude Latour
So viel schöner – SOPHIA
Peppermint Sky – Abi Carter
Silk Chiffon – MUNA, Phoebe Bridgers
June – becks
TIME OF YOUR LIFE – KAYKO
Die komplette Buchplaylist findet ihr auf Spotify unter: »Camp Rainbow – Der Soundtrack zum Buch«
MALIN GUCK-IN-DIE-LUFT
Von meinem Zimmer aus kann ich die Sterne nicht sehen.
Schuld daran sei die Lichtverschmutzung, erklärte mir Papa, als ich alt genug war, ihn danach zu fragen.
»Papa, wieso ist der Himmel so dunkel?«, wollte ich von ihm wissen.
»Weil München zu hell ist, mein Schatz«, erwiderte er.
»Denkst du, die Sterne sind traurig, weil wir sie hier unten nicht sehen können?«
Darüber musste er lange nachdenken. Mama hätte mich besänftigt. Mir gesagt, dass Sterne gar keine Gefühle haben. Dass die meisten Lichter, die wir hier unten heute sehen, bereits vor vielen Hundert Jahren erloschen sind. Aber Papa kannte mich besser. Er verstand meinen Schmerz und meine Sorge, weil er ebenfalls viel und intensiv fühlte.
»Weißt du was? Wir zwei werden dafür sorgen, dass die Sterne sich gesehen fühlen, ja? Wir werden jeden Abend in den Himmel blicken und nach ihnen Ausschau halten. Und wenn es die Wolken gut mit uns meinen, werden wir ein paar von ihnen entdecken. Und dann sagen wir ihnen, wie lieb wir sie haben, okay?«
Ich nickte. Noch war ich zu klein, um mein Fenster zu öffnen und auf den Sims zu klettern, aber von nun an schob ich meinen kleinen Schemel jeden Abend unter das Fenster und blickte vor dem Schlafengehen in den Himmel. Wenn Papa von der Arbeit nach Hause kam, setzte er sich zu mir.
Es wurde zu unserem Ritual, gemeinsam in den Himmel zu blicken und uns über große Themen zu unterhalten. Nichtssagende Konversation gab es mit Papa nicht. Mit ihm ging es immer in die Tiefe, und ich wünschte, Gespräche würden auch mit den anderen Menschen in meinem Leben so verlaufen. Mit Lila zum Beispiel. Aber meine Zwillingsschwester schien eine vollkommen andere Sprache zu sprechen.
Kurz nach Omas Tod verriet Papa mir, dass er glaubte, wir Menschen würden zu Sternen, wenn wir diese Welt einmal verlassen.
»Deine Oma ist irgendwo dort oben und leuchtet auf uns herab. Ist das nicht ein schöner Gedanke?«, fragte er mich, als wir uns von der reizüberflutenden Beerdigungsfeier davongeschlichen hatten, um stattdessen am Kinderzimmerfenster zu sitzen.
»Wir können ihr Licht nicht sehen«, sagte ich untröstlich.
»Aber wir wissen, dass es da ist.«
Nach diesem Gespräch flehte ich meine Mutter an, mit mir in die Buchhandlung zu gehen. Dort bat ich sie, mir alle Bücher über den Himmel zu kaufen.
Sie würde sagen, dass ich zu dieser Zeit besessen vom Himmel war.
Meine Therapeutin nannte mir einige Jahre später ein anderes Wort, nachdem sie mir die ADHS-Diagnose gestellt hatte.
Hyperfokus. So bezeichnet man den Zustand starker, ausdauernder Konzentration. Während solcher Phasen nahm ich oft nichts anderes um mich herum mehr wahr. Es ist keine Superkraft, wie es so oft online heißt. Nein, das ist einfach meine Art zu denken. Sie ist nicht besser oder schlechter als die von anderen Menschen. Sie existiert einfach, und ich habe gelernt, sie für mich zu nutzen.
Auf meinen Himmel-Hyperfokus folgten viele weitere. Dinosaurier, Flugzeuge, die Ungerechtigkeit in der Welt, Taylor Swift, das Schmelzen der Polarkappen, jede Serie mit queeren Figuren und natürlich: die Astrologie. Aber während mich alle anderen Themen nur für wenige Wochen in ihren Bann zogen, blieb meine Faszination für den Himmel bestehen.
Mit sechs Jahren flehte ich meine Eltern an, mir ein Teleskop zu kaufen. Damals verstand ich noch nicht, dass das kein kleines Geschenk war. Geld war für mich eine unvorstellbare Größe. Etwas, das meine Eltern zur Genüge besaßen. Immerhin bezahlten sie alles mit einer kleinen silbernen Karte. Ein wahres Wunderwerkzeug, wie ich fand.
Statt eines Teleskops schenkten sie mir ein Fernglas. Was, wenn ich ehrlich bin, das enttäuschendste Geschenk meines jungen Lebens war. Es fühlte sich an, als hätte ich mir ein Fahrrad gewünscht und stattdessen einen Sattel bekommen.
Papa kam am Abend meines Geburtstages zu mir und setzte sich neben mich. In seinen Händen: ein zweites Fernglas.
Nach der anfänglichen Enttäuschung begann ich das Fernglas lieb zu gewinnen. Immerhin konnte ich so andere Menschen aus meinem Zimmerfenster beobachten. Und die Wolken am Himmel waren auch etwas näher.
Auch viele Jahre später noch saß ich abends am geöffneten Fenster und versuchte, in dem dunklen Blau etwas zu erkennen, das nicht von den Lichtern der Stadt verschluckt wurde.
Meine Zwillingsschwester Lila fragte immer öfter, was wir da machten. Wieso ich Abend für Abend zusammen mit Papa in ein Meer aus Schwarz starrte. Er reichte ihr sein Fernglas, damit sie auch hindurchschauen konnte, doch das lange Sitzen wurde ihr schnell langweilig. Insgeheim war ich froh darüber.
Als Lila und ich elf Jahre alt waren, ließen sich unsere Eltern scheiden. Sie sagten, sie würden sich im Guten trennen. Deshalb begriff ich nicht, wieso sie nicht zusammenblieben. Wenn sie sich doch noch mochten, wieso musste Papa dann ausziehen?
Mama sagte, sie hätten sich auseinandergelebt. Dabei schliefen sie jede Nacht im selben Bett. Ich verstand es nicht.
Doch Papa zog in eine Wohnung am anderen Ende der Stadt, und Lila und ich verbrachten nur noch jedes zweite Wochenende bei ihm.
Papa hatte mir versprochen, dennoch jeden Abend in den Himmel zu sehen, und wir verabredeten uns für eine gemeinsame Uhrzeit. Damals besaß ich noch kein Handy, aber er schickte Mama jeden Abend ein Bild. Das musste sie mir zeigen, darauf beharrte ich.
»Schatz, ich finde es toll, dass du und Papa dieses Ritual habt, aber willst du nicht lieber mit ihm telefonieren? Sieh mal, mein Handy besteht nur noch aus den immer gleichen grauen Bildern. Die Handykameras sind nicht gut genug, um Sterne einzufangen.«
Sie verstand nicht, worum es eigentlich ging.
Papa schickte mir weiterhin Bilder, und ich saß jeden Abend am Fenster.
Bis zu dem Tag, an dem er kein Bild schickte. Erst glaubte ich, er habe es vergessen. Ich ging alle fünf Minuten zu Mama und fragte, ob nun ein Bild gekommen sei.
»Er musste sicher länger arbeiten oder schläft schon, Schatz. Morgen schickt er dir bestimmt eins.«
Doch Papas nächstes Bild kam erst drei Tage später. Er erzählte mir, er habe jemanden kennengelernt und stundenlang mit ihr geredet. Er entschuldigte sich lang und breit bei mir, doch das Gefühl blieb. Er hatte mich vergessen.
Papas Bilder kamen immer seltener. Diese neue Frau in seinem Leben nahm alles ein.
Lila und ich lernten sie ein halbes Jahr später kennen. Sie hieß Veronica und hatte bereits zwei Kinder. Zwei Söhne, die viel jünger waren als Lila und ich.
Veronica kam eigentlich aus Berlin und war nur wegen ihres Ex-Mannes nach München gezogen. Sie wollte zurück in ihre Heimatstadt, doch Papa versprach Lila und mir, dass er in München bleiben würde.
»Ich bin doch euer Papa.«
Die Wochenenden bei ihm waren laut, weil Veronicas Söhne immerzu durch die Wohnung rannten und die drei Zimmer zu klein für uns alle waren. Zudem gab es nur ein Fenster, von dem aus man den Himmel richtig sehen konnte, und das lag in Papas und ihrem Schlafzimmer, in das wir nicht gehen durften.
»Ein bisschen Privatsphäre müsst ihr uns schon lassen«, meinte Veronica.
Lila kam ganz gut mit ihr klar. Die beiden gingen shoppen oder ins Kino. Veronica schwärmte davon, dass sie sich immer eine Tochter gewünscht habe. Nur passte ich wohl nicht in dieses Bild.
Zwei Jahre ging das so, und dann besuchte Papa uns in unserem alten Haus. Erst sprach er mit Mama, dann mit Lila. Als Letztes kam er zu mir.
Wir saßen an meinem Fenster, und er nahm meine Hand.
»Ich liebe sie sehr, mein Schatz, aber sie ist hier in München so unglücklich. Sie vermisst ihre Familie, ihre Geschwister. Kannst du das verstehen?«
»Aber wir sind deine Familie. Und wir sind hier.«
Sein Blick sank hinab auf seine Hände.
»Es tut mir leid. Ich werde mit ihr und den Jungs nach Berlin ziehen. Aber du und Lila könnt mich in den Ferien besuchen kommen. Und ich verspreche dir, dass ich auch immer in den Himmel schauen und nach den Sternen sehen werde, okay?«
Er hatte mir in den letzten zwei Jahren nur zehn Bilder vom Himmel geschickt. Ich glaubte nicht mehr daran.
»Okay«, sagte ich.
Papa zog nach Berlin, Mama lernte Holger kennen. Einen netten Mann, der Bestatter war und der sie glücklich machte. Er verstand nichts von Sternen.
Ich zog mich immer mehr zurück. Saß stundenlang am Fenster, presste mir die metallene Fassung so fest in die Haut, dass sie rote Ränder hinterließ. Aber ich hörte nicht damit auf.
Mama und Holger machten sich Sorgen. Sogar Lila versuchte mit mir zu sprechen. Aber ich blockte ab. Ließ niemanden an mich heran.
Papa war nicht gestorben. Aber es fühlte sich so an.
Ich zeichnete Sternbilder in mein Notizbuch, las jedes meiner Astrologiebücher erneut. Versuchte, so viel Wissen in mich aufzusaugen, wie nur möglich. Denn wenn ich das tat, hatte ich das Gefühl, Papa wieder nahe zu sein.
Kurz nach Papas Umzug kam Lila in mein Zimmer. In letzter Zeit hatte sie mein Fernglas immer argwöhnischer gemustert, doch nun stellte sie sich neben mich.
»Darf ich auch mal?«, fragte sie.
»Was?«
»Darf ich auch mal durchschauen? Ich will wissen, was da so Besonderes ist.«
»Du hast doch schon mal durchgeschaut. Da fandest du es langweilig.«
»Na und? Vielleicht verstehe ich es jetzt.«
»Lass mich, ich darf den Winkel jetzt nicht verändern. In zehn Minuten geht die Sonne unter.«
»Komm schon, Malin. Nur fünf Minuten.«
»Nein, verschwinde einfach.«
»Ich vermisse ihn auch, weißt du?« Lilas Stimme klang hart. So als sei sie sauer, weil ich trauerte.
»Er ist auch mein Papa!«
Lila hatte schon damals alles. Mama, Holger, selbst Veronica liebte sie. Sie hatte einen Haufen Freundinnen, war gut in der Schule, und bei Familienfeiern sprachen alle mit ihr. Papa und ich verstanden uns. Wir waren die zwei Menschen in der Ecke, die sich über Ebbe und Flut unterhielten. Über Mondphasen und die Weite des Ozeans. Das konnte sie mir nicht auch noch nehmen.
Doch genau das tat sie. Schnappte mir das Fernglas aus der Hand und hielt es sich vor die Augen.
»Gib es zurück!«, schrie ich und riss an ihren Armen.
»Lass mich, ich will das auch sehen!«, erwiderte sie.
Es endete in einem Gerangel aus Haaren und Spucke. Wer glaubt, nur Brüder prügelten sich, der hat noch nie zwei Schwestern erlebt, die aufs Erbittertste das haben wollen, was die andere besitzt.
Ich riss erneut an Lilas Arm, das Fernglas flog aus ihrer Hand, segelte durchs Zimmer, durch das geöffnete Fenster und zerschellte weit unten im gepflasterten Innenhof.
Lila und ich hatten uns von klein auf schon immer viel gestritten, aber an diesem Tag zerstörte sie weitaus mehr als ein Fernglas.
Vier Jahre sind seit diesem Vorfall vergangen.
Papa lebt noch immer in Berlin, und ich sehe ihn kaum noch. Einmal hörte ich Mama zu Holger sagen, dass sie es nicht fassen könne. »Er hat sich da ein schönes neues Leben aufgebaut und die Mädchen hier einfach vergessen.«
Zu Hause in meinem Zimmer kann ich noch immer keine Sterne sehen, aber wenn ich in den Himmel blicke, stelle ich mir manchmal vor, dass Papa wieder neben mir sitzt. Dass ich elf Jahre alt bin und die Welt noch in Ordnung ist.
Wäre er tot, dann könnte ich den Leuten leichter erklären, wieso ich ihn vermisse. Aber so sagen alle immer: Du siehst ihn doch bald wieder, du kannst ihn doch jederzeit anrufen.
Ich kann nicht erklären, wie es sich anfühlt. Einen Vater zu haben, der nicht mehr anwesend ist.
Und obwohl ich das Camp unheimlich liebe, werde ich auch dort unweigerlich an ihn erinnert, sobald ich in das Meer aus Sternen blicke, das man am Himmel sehen kann.
EINE WICHTIGE RECHERCHE
Manchmal beobachte ich die Menschen um mich herum und frage mich, wieso es für sie so leicht ist. Das Leben. Die Liebe.
Es fühlt sich an, als hätten sie alle einen Leitfaden gelesen, den ich nie erhalten habe.
Als läge ihr Hyperfokus auf exakt drei Themen: Küsse, Sex und Jungs. Zumindest was die Mädchen in meiner Stufe angeht. Jungs denken nicht an Jungs und Mädchen nicht an Mädchen. Und das, obwohl die Statistik etwas anderes verspricht. Laut dieser müsste jede zehnte Person an meiner Schule queer sein. Ich weiß nur von Lila und mir. Und dann ist da noch diese eine aus der Abschlussklasse, die jeden auf den Gängen mit einem Todesblick begrüßt. Was auch der Grund ist, warum ich nicht gerade scharf darauf bin, Kontakt zu ihr aufzunehmen.
Während die Hälfte meines Jahrgangs also nur noch über diese drei Themen spricht, fühle ich mich an den Rand gedrängt. Den Rand für die Ungeküssten, Unreifen.
Es ist wieder so wie damals auf den Familienfeiern. Nur, dass Papa nicht mehr hier ist, um sich mit mir ans Fenster zu setzen. Und hier bin ich nun. Fast siebzehn Jahre alt und immer noch ungeküsst.
Dieser verdammte erste Kuss verfolgt mich schon seit Jahren. In jedem Buch, das ich lese, jedem Film, den ich sehe, geht es um nichts anderes.
In meinem Kopf höre ich die Stimme meiner Oma, die sich darüber aufregt, dass jungen Mädchen eingetrichtert wird, dass es nur ein Ziel im Leben gibt: eine stabile Partnerschaft einzugehen. Dicht gefolgt vom Muttersein, versteht sich.
Meine Mutter bezeichnet sich selbst als Feministin und führte mit Oma immer lautstarke Debatten darüber, dass sie gerne Mutter sei und sie niemand dazu gezwungen habe. Ich verfolgte diese Diskussionen gerne. Ich glaube ja, dass an beiden Meinungen etwas dran ist. Eine Beziehung kann etwas Schönes sein. Mutterschaft kann etwas Schönes sein. Das sehe ich bei Mama und Holger. Sie kuscheln auf der Couch. Lassen Lila und mich am Wochenende öfter mal allein, um einen Date-Tag einzulegen, unterstützen sich bei ihren Jobs und sitzen abends mit uns am Esstisch und fragen uns, wie unser Tag war. Aber eine Beziehung kann auch in die Brüche gehen. So wie die zwischen Mama und Papa. Oder Omas erste Ehe, die ihr mehr oder weniger aufgedrängt wurde. Erst mit Mitte dreißig lernte sie meinen Opa kennen und lieben. Sie sagte einmal zu mir: »Wenn du dich selbst verstecken musst, damit dich ein anderer Mensch liebt, dann ist das keine Liebe, mein Schatz. Es ist ein gottverdammter Käfig.«
Ich bin also auf der Suche nach einem Menschen, der mich liebt, so, wie ich bin. Und ich bin ehrlich: Es könnte keine schwierigere Aufgabe geben. Ich war schon oft kurz davor, einfach die erstbeste Person zu nehmen, die mir über den Weg lief. Aber dann musste ich wieder an Oma denken und an das Strahlen in ihren Augen, wenn sie von Opa sprach.
»Ich wünsche dir genauso eine Liebe, mein Schatz. Gib dich niemals mit weniger zufrieden. Das habe ich die Hälfte meines Lebens getan.«
Alle in meiner Stufe hatten bereits ihren ersten Kuss, und sie werden auch nicht müde, weiter rumzuknutschen. Sie tun es ständig.
Jetzt gerade in diesem Moment zum Beispiel beobachte ich zwei Personen aus meinem Jahrgang, die hinter der Eiche auf dem Schulhof übereinander herfallen.
Was ich nur sehen kann, weil ich, wie so oft, an der Sporthallenwand lehne. Dem Ort, von dem aus man einen perfekten Blick auf das ganze Gelände hat und doch von niemand anderem wahrgenommen wird. Fast fühlt es sich an, als würde ich auf meinem Stuhl am Fenster sitzen und in den Himmel blicken. Nur dass ich nicht nach Sternen suche, sondern nach einer Antwort auf die Frage: Wie funktionieren zwischenmenschliche Beziehungen?
Neben mir an einem in die Jahre gekommenen Holztisch sitzen Tom, Gulia und Serafina. Uns verbindet, dass wir alle lieber etwas abseits der lauten Masse sitzen. Lieber den Überblick über das große Ganze behalten.
Tom und Giulia nutzen die Pausen, um zu rauchen und sich über ihre Eltern aufzuregen. Serafina zeichnet an einem ihrer Mangas und ich … ich beobachte.
Eine meiner liebsten Beschäftigungen.
Beginnen wir also mit meinem imaginären Protokoll.
Objekte der Beobachtung: Lasse Londström und Viviane Haberts.
Alter: siebzehn.
Beziehungsstatus: waren in der zehnten bereits zusammen, haben sich auf der Klassenfahrt getrennt und sind beide gerade single. Haben aber offenbar immer noch Lust, miteinander rumzuknutschen.
Lasse schiebt seine Hand unter Vivianes Schultasche, sie drückt ihn gegen den Baumstamm, an dem die beiden lehnen.
Kusstechnik: Zunge. Sehr viel Zunge. Mehr ist von hier aus nicht zu sehen.
Ich recke meinen Kopf zur Seite, um einen besseren Blickwinkel zu erhaschen. Ah, sie lösen sich voneinander.
Viviane kichert, Lasse leckt sich über die Lippen. Beide haben gerötete Wangen, und Vivianes glänzendes Haar ist zerzaust. Sie murmelt etwas an seinem Hals, das ich nicht verstehen kann. Er streicht ihr eine Strähne aus dem Gesicht und küsst sie erneut.
Kurz darauf lösen sie sich voneinander, und Viviane sieht in meine Richtung. Mist. Schnell senke ich den Blick auf den Gedichtband in meinen Händen. Eine Schmuckausgabe von Emily Dickinsons Werken. Wenn doch nur ihre Gedichte mir die Antwort darauf liefern würden, wie ich auch so etwas erleben kann.
Ich bin nicht stolz darauf, meine Mitschüler*innen zu beobachten. Es erscheint mir viel eher wie der letzte Ausweg. Der letzte, verzweifelte Versuch zu verstehen, was ich falsch mache. Wieso es bei mir einfach nicht funktionieren will.
Tom, Giulia und Serafina habe ich schon öfter um Tipps gebeten. Aber Tom und Giulia halten nicht viel von Beziehungen im Allgemeinen, und Serafina lebt sowieso in ihrer ganz eigenen Welt. In ihren Mangas fallen die Figuren reihenweise übereinander her, aber auf dem Schulflur kann sie kaum jemandem in die Augen blicken.
»Denkt ihr, Lasse und Vivi kommen wieder zusammen?«, frage ich sie dennoch.
»Wen interessiert’s?«, meint Tom sofort und bläst einen Kreis in die Luft. Die Kunst der Rauchkringel hat er im letzten Halbjahr perfektioniert. Eigentlich dürfen wir auf dem Schulhof nicht rauchen, aber diese Regel ist ziemlich hinfällig, weil gut die Hälfte des Lehrkörpers ebenfalls heimlich hinter der Sporthalle raucht. Manchmal stellen sie sich sogar zu uns. Ich rauche nicht, ertrage den Gestank aber, um in den Pausen nicht allein zu sein.
Außerdem mag ich Tom und Giulia. Sie interessiert es nicht, wenn ich mit Regenbogensocken in die Schule komme, und sie haben noch nie seltsam reagiert, wenn ich über ein Mädchen sprach, das ich gut fand. Es ist nicht so, dass sie selbst queer wären, aber ich glaube, ihnen ist so ziemlich alles egal, und das ist eine willkommene Abwechslung.
»Leute, ich brauche einen Nachnamen für meine Figur. Er ist achtundzwanzig und der neue Geschichtslehrer an der Schule«, meldet sich Serafina zu Wort.
»Bruce Springsteen«, schlägt Tom feixend vor.
»Kristof«, kommt es von Giulia. Damit spielt sie auf den neuen Lehrer an unserer Schule an.
Serafina schüttelt vehement den Kopf.
»Wie wäre es mit Mr. Lim?«, schlage ich vor. Immerhin weiß ich, dass ihr Manga in Seoul spielt.
Das scheint ihr zu gefallen, denn kurz darauf beugt sie sich wieder über ihren Zeichenblock.
Die Schulglocke erklingt, und das Scharren von Hunderten Füßen bewegt sich Richtung Klassenräume.
»Na dann. Bis in sechs Wochen.« Tom drückt seine Zigarette im sandigen Schulboden aus und steckt sie in das kleine Metalldöschen, das er immer bei sich trägt.
»Man sieht sich.« Auch Giulia erhebt sich, verstaut ihre Hausarbeit in ihrer ausgeleierten Ledertasche und winkt uns zu, ehe sie Tom folgt. Die beiden gehen in dieselbe Klasse, obwohl sie zwei Jahre jünger ist. Wenn Tom sie aufziehen möchte, nennt er sie Wunderkind. Das hasst sie.
Serafina verabschiedet sich nicht, dafür ist sie zu sehr in ihre Zeichnung vertieft, aber das ist okay.
»Schöne Ferien«, wünsche ich ihr, und nun sieht sie doch auf und lächelt vorsichtig.
»Wünsche ich dir auch.« Dann geht sie, immer noch mit Blick auf ihren Notizblock, Richtung Kunsttrakt.
Ich sollte mich ebenfalls langsam auf den Weg machen, doch ich genieße jede Sekunde, die ich nicht mit meiner Klasse verbringen muss. Deshalb binde ich meine Doc Martens neu, streiche mir die Haare hinters Ohr und warte, bis die letzte Person im Gebäude verschwunden ist. Erst dann erhebe ich mich.
Die Sonne spiegelt sich in den vielen Fenstern des Luisengymnasiums. Ich kneife die Augen zusammen, während ich über die Schwelle trete. Innerlich wappne ich mich für das, was nun folgen wird.
Nur noch vier Stunden bis zum Beginn der Sommerferien.
»Malin, möchtest du nichts zu unserer Diskussion beitragen?« Herr Steinmaiers buschige Augenbrauen haben sich in den letzten Monaten immer weiter angenähert. Nun trennt sie nur noch eine hauchdünne Linie davon, zusammenzuwachsen.
»Was für eine Diskussion?«, frage ich so höflich wie möglich.
Meine Zwillingsschwester Lila in der Reihe vor mir verkrampft sich. Sie ahnt bestimmt, was gleich folgen wird, und ich weiß, wie sehr sie es hasst, wenn ich mich mit unseren Lehrkräften anlege. Aber es ist nicht meine Schuld, dass diese Schule extrem rückständig ist.
Herr Steinmaier sieht genervt aus. »Das Diskussionsthema der heutigen Stunde.« Er zeigt auf die Tafel. »Wir sprechen nun schon seit zwanzig Minuten darüber.«
Manchmal frage ich mich, wieso Herr Steinmaier PoWi-Lehrer geworden ist. Ich glaube, er würde viel lieber in der Politik arbeiten, statt mit Teenies darüber zu sprechen, wie viele Sitze der Bundestag hat. In welcher Partei er wohl wäre?
Herrn Steinmaiers Hand pocht dreimal gegen die Tafel. Er hätte auch einfach darauf zeigen können, aber scheinbar denkt er, auf sie einzuhämmern hätte einen größeren Einfluss auf mich.
Als hätte ich die ekelhafte Überschrift nicht bereits seit Beginn der Stunde angestarrt.
Das Recht auf Abtreibung – Pro und Kontra
Aber gut, er wollte, dass ich mich beteilige, also tue ich ihm den Gefallen.
»Ich sehe hier keinen Grund für eine Diskussion. Über die Rechte von Gebärenden diskutiere ich nicht.« Mal davon abgesehen, dass ich die letzten zwanzig Minuten dabei zuhören musste, wie genau das geschah. Nicht einmal das Verfassen meines nächsten Gedichts konnte mich davon ablenken.
»Du weigerst dich also, mitzuarbeiten?«
Lila dreht sich zu mir um. »Lass es, Malin«, zischt sie.
Manchmal wünschte ich, ich wäre so wie meine Schwester. Ihr scheint es nichts auszumachen. Sie bleibt einfach ruhig sitzen, während alles in mir brodelt.
»Reproduktive Rechte sind nicht verhandelbar, und sie gehören in keine Pro-und-Kontra-Debatte. Und vor allem betrifft diese wichtige Entscheidung hauptsächlich die Personen, die auch schwanger werden können, was, wenn ich mich nicht täusche, auf einige in dieser Klasse nicht zutrifft.«
Herrn Steinmaiers Wangen werden lila. Rot sind sie immer, aber wenn sie diesen Lilaton annehmen, sollte man sich in Acht nehmen.
Die Schulglocke rettet mich. Um mich herum werden Stühle gerückt, Taschen gepackt, und ein lautes Stimmengewirr bewegt sich Richtung Ausgang.
Ich beeile mich, den anderen zu folgen, weil ich keine Lust auf ein Einzelgespräch mit Herrn Steinmaier habe.
»Musste das sein?« Lila ist neben mir aufgetaucht. Ihre blonden Haare sind wie immer perfekt frisiert, die Nägel in einem Rosaton lackiert, und selbst ihre Schultasche glänzt wie neu. Meine dagegen ist voller Flecken, und das Band reißt an einer Stelle schon ein, dabei haben wir sie beide erst letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen.
Wir sind eineiige Zwillinge, aber seit der Grundschule geben wir uns größte Mühe, dass das niemand bemerkt.
»Musste was sein? Ich sage wenigstens meine Meinung, wenn es drauf ankommt.«
Lila rollt mit den Augen. Ich hasse es, wenn sie das macht. Weil sie selbst bei dieser Geste perfekt aussieht. Wie all die jungen Frauen in Netflix-Serien.
»Was auch immer. Sag Mama, ich gehe noch mit zu Vivi und Romina. Abendessen könnt ihr ohne mich.«
»Viel Spaß. Sag Vivi liebe Grüße von mir.«
Lila kneift die Augen zusammen. »Wieso sollte ich das tun?«
»Egal. Vergiss es. Schönen Abend euch.« Meine Stimme trieft vor Sarkasmus.
»Danke. Den werden wir haben.«
Mit diesen Worten dreht sie sich um, rauscht an mir vorbei und beeilt sich, zu ihren Freundinnen zu laufen.
Wie gesagt: Manchmal wünschte ich, ich wäre wie meine Schwester. Sie hat Freundinnen, zu denen sie nach der Schule gehen kann. Ich verbringe meine Freizeit mit dem Schreiben von politischen und emotionalen Texten, dem Betrachten und Fotografieren des Himmels, dem Erstellen von Playlists für jede Lebenslage und damit, mich in Tagträumen von meinem aktuellen Crush zu verlieren. Ganz normale Hobbys also.
Giulia, Tom und Serafina sind angenehme Gesellschaft, und wir schreiben auch mal in unserem Gruppenchat, der sich Breakfast Club nennt – sehr kreativ, ich weiß –, aber richtig befreundet sind wir nicht.
Dann gibt es da noch die Menschen vom Poetry Slam, die ich wirklich gernhabe, die aber alle bereits fertig mit der Schule sind. Ich sehe sie einmal in der Woche, was eine willkommene Abwechslung ist, aber für sie bin ich das Küken. Nicht dass sie mich so nennen würden, aber in ihrer Gegenwart fühle ich mich noch unreifer als hier in der Schule.
Und dann wären da natürlich meine Freund*innen aus dem Camp. Allen voran Flo und Basti. Wir schreiben meist über Discord, facetimen auch ab und zu, und wenn es unser Taschengeld und der Schulstress zulassen, besuchen wir uns ein paar Mal im Jahr. Aber es ist nicht genug. Sie sind viel zu weit entfernt. Papa würde sagen, wir blicken in denselben Himmel, aber mittlerweile bin ich alt genug, um zu wissen, dass ich mehr brauche als das.
Lila ist in einer der beliebten Schulcliquen. Sie wird eigentlich von allen gemocht, ist Schulsprecherin, schreibt gute Noten, lernt bereits für das Abitur, obwohl das erst in zwei Jahren ansteht, und plant ihr Au-pair-Jahr danach.
Ich … bin froh, dass ich dieses Jahr geschafft habe. Meine Noten sind okay, also in Sport, Kunst und Deutsch natürlich. In den anderen Fächern sind sie eher ausreichend bis mangelhaft. Aber hey, all die interessanten Menschen hatten eine schwierige Schulzeit. Wenn man danach geht, muss ich nur noch zwei Jahre durchhalten, ehe ich richtig berühmt werde.
Außerdem ist es nicht so leicht, sich auf den Schulstoff zu konzentrieren, wenn man unglücklich verliebt ist. Und das bin ich ständig.
Es macht etwas mit dir, wenn deine Gefühle nie erwidert werden. Also wirklich, jedes einzelne Mal. Natürlich traue ich mich auch deshalb immer seltener, sie zu kommunizieren. Lilly zum Beispiel weiß nicht, dass ich seit drei Jahren für sie schwärme. Ich sehe sie übermorgen im Camp wieder und habe keinen blassen Schimmer, wie ich mich dann verhalten soll. Sie ist nicht mein erster Crush, aber der längste. Einer, der jeden Sommer aufs Neue entfacht wird. Und Lilly würde wirklich perfekt zu mir passen. Wir lieben beide Literatur, interessieren uns für klassische Musik, und sie hat noch nie darüber gelacht, wenn ich wieder einmal stehen bleiben musste, um den Himmel zu betrachten.
Und doch bringe ich es nicht über mich, sie nach einem Date zu fragen. Das wird jetzt unser viertes Campjahr zusammen, und ich bin genauso planlos wie in den Sommern zuvor.
Was sicher auch daran liegt, dass ich morgen siebzehn Jahre alt werde und noch keinerlei romantische Interaktion mit einem menschlichen Individuum hatte. Diesen einen Tag im Kindergarten einmal ausgenommen, als Justus Hagenberg seine schlabbrigen Lippen auf meine presste, weil er wissen wollte, wieso seine Eltern das immerzu machten. Damals fanden wir es beide ekelerregend und erklärten unsere Eltern zu seltsamen Wesen.
Mein einziger Trost bei dieser ganzen Sache ist: Lila geht es genauso. Zumindest habe ich mitbekommen, wie sie mit Vivi darüber sprach, dass sie noch niemanden geküsst hat. Ich habe sie nicht belauscht, aber ihre Zimmertür stand offen. Ich hätte direkt weitergehen können, aber als das Wort »Kuss« fiel, bin ich quasi zur Salzsäule erstarrt.
Was mir dort vor ihrer Zimmertür klar wurde, war: Sie erzählt mir so gut wie nichts mehr aus ihrem Leben.
Dabei verbindet uns nicht nur der Druck des ersten Kusses, nein, wir sind auch beide queer. Aber, anders als ich, hat Lila sich in der Schule nicht geoutet und redet eigentlich nie darüber.
Früher teilten wir viel miteinander. Vor dem Fernglas-Streit gab es viele gute Phasen. Tage, an denen wir friedlich miteinander spielten und uns zum Lachen brachten. Wir liebten beide alles, was mit Weihnachten zu tun hatte, und blieben ewig auf, um das Christkind auf frischer Tat zu ertappen.
Doch je älter wir wurden, desto mehr schloss Lila mich aus ihrem Leben aus. Mit Papas Umzug nach Berlin entfernten auch wir uns immer weiter voneinander. Weil sie das Mama-Kind war und ich das Papa-Kind, dessen Vater nicht mehr mit im Haus lebte.
Ich konnte spüren, wie die Verbindung zwischen mir und Lila schwächer wurde. Genauso wie bei Papa. Das scheint wohl mein Schicksal zu sein: die Menschen zu verlieren, die mir wichtig sind. Das Band wird dünner und dünner, und je mehr ich mich daran festklammere, desto poröser wird der Stoff.
DAS KUSS-DILEMMA
Als Zwilling wirst du immer wieder gefragt: Wer von euch beiden kam zuerst zur Welt?
Lila hat mir drei Minuten und achtzehn Sekunden voraus. Das ist nicht viel, könnte man meinen. Aber es zieht sich durch unser ganzes Leben. Sie konnte zuerst laufen. Hat als Erste Mama und Papa gesagt. Im Kindergarten schaffte sie es vor mir, ihren Namen zu schreiben, und selbst bei der Einschulung wurde sie zuerst aufgerufen, weil sie in die 1a kam und ich in die 1b.
Lila lernte zuerst schwimmen und gewann den Buchstabierwettbewerb. Sie wird von unseren Verwandten immer als Erste begrüßt. Das mag daran liegen, dass sie zuerst auf sie zugeht und ich mich davor drücke, an die schwitzige Brust unserer Großtante gedrückt zu werden, aber dennoch: Sie sagen immer »Hallo Lila. Oh, Malin, du bist auch da. Schön.«
Der erste Kuss soll also mir gehören. Das ist etwas, das ich vor ihr erreichen kann. Ich weiß, dass man so etwas nicht planen und sich keinen Druck machen sollte. Dabei machen das fast alle.
Ich habe die letzten Jahre damit verbracht, alle Menschen in meinem Umfeld zu beobachten. Vor allem die Gleichaltrigen. In der Sportumkleide kichern sie und malen sich bereits aus, wen sie auf der Party am Wochenende küssen werden. Sie planen, wie es sich anfühlen wird, wie sie den perfekten Moment abpassen, was für einen kussechten Lippenstift sie tragen und so weiter.
Planung scheint hier also zu helfen. Und Recherche. Beides habe ich in den letzten Jahren perfektioniert. Ich habe jeden Liebesfilm und jede Serie gesehen, in der sich zwei Menschen küssen, und dann bin ich zu den lebenden Objekten übergegangen. Den Schulpärchen, die ich auf dem Pausenhof oder in den Fluren gut beobachten konnte. Sollten wir eine Klausur darüber schreiben, wie der perfekte erste Kuss abläuft, ich bekäme eine 1+.
Die Theorie habe ich also mehr als genug abgedeckt. Fehlt nur noch die Praxis.
Und es ist nicht so, als hätte ich keine Auswahl. Ich bin bi und verknalle mich ständig. Es gäbe also genug Personen, die sich zum Küssen anbieten würden, vorausgesetzt, sie würden meine Gefühle erwidern. Doch an diesem Punkt scheitert es jedes Mal aufs Neue.
Mit zwölf bin ich in die Pubertät gekommen, all die Verliebtheiten davor zähle ich mal nicht, aber seit meinem zwölften Geburtstag war ich in sage und schreibe sechs Menschen verliebt. Und ich meine damit keine Tagschwärmereien, sondern das volle Programm: Appetitlosigkeit, Hitzewallungen, Schlafstörungen, obsessive Gedanken und so weiter. Das war jedes Mal verdammt anstrengend! Aber keiner meiner Crushes wollte mich.
Okay, nur vieren davon habe ich meine Gefühle überhaupt gestanden, aber die anderen beiden waren entweder sowieso vergeben oder nicht an Frauen interessiert. So viel also zu der tollen Aussage, bisexuelle Personen hätten solch ein Glück im Dating. Wenn du dich in deine heterosexuelle Freundin verknallst, bringt dir das trotzdem nichts.
Also ja, es gab viele Personen in meinem Leben, denen ich nah sein wollte. Manchen habe ich meine Gefühle ganz romantisch in einem Brief gestanden, einer habe ich es sogar persönlich gesagt – über meinen Mut bin ich immer noch überrascht –, doch all das hat nichts gebracht.
Also habe ich es aufgegeben, hier in meiner Heimatstadt eine Person zu finden, die zu mir passen könnte.
Wer sich an solchen Diskussionen beteiligt, wie wir sie eben in PoWi hatten, kann mir ohnehin gestohlen bleiben.
Aber ich werde siebzehn. Das zählt schon nicht mehr als Spätzünderin, das ist ein echtes Problem. In der Sportumkleide reden sie nicht mehr von ihren ersten Küssen, jetzt geht es darum, wer bereits Sex hatte, wie gut es war, und all das. Also wirklich: Ich fühle mich, als stände ich am Rand einer Autobahn, während alle anderen an mir vorbeirasen.
Dabei mangelt es mir nicht an Interesse. Ich will das alles! Nicht nur die Küsse, auch den Sex.
Wenn ich nachts allein im Bett liege und mich berühre, stelle ich mir vor, wie es mit einem anderen Menschen sein könnte. Es fühlt sich schön an, meinen eigenen Körper zu erkunden. Dennoch schäme ich mich anschließend dafür, weil in der Schule kein anderes Mädchen darüber spricht. Aber Selbstbefriedigung ist das eine, Sex das andere.
Wer sagt einem, was guten Sex ausmacht? Das ist etwas, das ich nicht recherchieren kann. Pornos einmal ausgenommen, aber ich weiß, dass die beim besten Willen nicht die Realität abbilden.
Es ist wie mit dem Himmel. Ich weiß, irgendwo da oben sind die Antworten, aber hier unten kann ich sie nicht sehen.
Dass ich nicht der einzige Mensch bin, der mit siebzehn noch ungeküsst ist, ist mir klar. Erst letztens habe ich auf YouTube ein Video über einen Fünfundzwanzigjährigen gesehen, der diese Erfahrung ebenfalls noch nicht gemacht hat, und darunter haben viele Menschen kommentiert, denen es auch so ging.
Online habe ich also das Gefühl, nicht allein zu sein. Sobald ich das Handy zur Seite lege oder den Laptop schließe, werde ich aber mit der Realität konfrontiert: Alle sind weiter als ich. Und ich kann nichts gegen diesen inneren Druck tun. Er wächst und wächst, egal, wie oft ich mir einrede, dass ich doch Zeit habe, dass schon irgendwann die richtige Person kommen wird …
Immerhin bin ich beim Thema »richtige Person« etwas weitergekommen. Mittlerweile weiß ich: Ich möchte von meinem Gegenüber verstanden werden. Die erste Person, die ich küsse, soll auch queer sein. Lilly wäre also perfekt. Sie ist pansexuell und besucht ebenfalls jeden Sommer das Camp. Wobei ich nicht weiß, ob sie dieses Jahr wieder dort sein wird. Letztes Jahr ist sie achtzehn geworden, für eine Teilnehmerin ist sie also mittlerweile zu alt. Ich habe allerdings die Hoffnung, dass sie als Betreuerin zurückkommt, denn das war immer ihr Plan. Eigentlich sind romantische Beziehungen zwischen Betreuungspersonen und Campteilnehmenden verboten, aber sie ist nur eineinhalb Jahre älter als ich. Das wird schon nicht zum Problem werden. Zumindest rede ich mir das ein.
Wenn ich übermorgen das Camp betrete und sie da ist, werde ich endlich über meinen Schatten springen und ihr meine Gefühle gestehen. Ich kann und will nicht länger warten.
Kommen wir also zu dem Ort, an dem ich nicht nur die Sterne sehen kann, sondern auch meinen ersten Kuss erleben werde: Camp Rainbow. Das queere Sommercamp, das ich dieses Jahr bereits zum vierten Mal besuche. Der Name sagt eigentlich schon alles. Queere Teenies zwischen zwölf und achtzehn Jahren. Drei Wochen. Ein Camp.
Während ich an meinem Fenster sitze, meinen Kater Peanut kraule, der sich auf meinem Schoß zusammengerollt hat, und in den violetten Abendhimmel sehe, denke ich daran, wie abwertend Lila immer über das Camp spricht. Sie macht kein Geheimnis daraus, wie grässlich sie die Vorstellung findet, ein Camp zu besuchen, in dem man keinen Handyempfang hat und sich sein Essen selbst zubereiten muss. Sie verbringt die Ferien lieber mit ihren Freundinnen. Mir ist das ganz recht, denn im Camp kennt niemand Lila. Dort ist sie nicht die Nummer eins.
Das Taubenpärchen, das in der Dachrinne unseres Nachbarhauses lebt, zieht Kreise über meinem Kopf. Die beiden Vögel landen auf dem Laternenmast und schmiegen die gefiederten Köpfe aneinander.
Peanut entdeckt die zwei, springt von meinem Schoß und stellt sich mit den Vorderpfoten auf das Fensterbrett, um die Tauben besser beobachten zu können. Sein Fell hat die Farbe von gerösteten Erdnüssen, weswegen Lila und ich ihn damals Peanut getauft haben. Einer der seltenen Fälle, in denen wir einer Meinung waren.
Vor knapp drei Jahren hatte ich einen kleinen Hyperfokus auf Tauben, daher weiß ich, dass sie, zumindest in den meisten Fällen, monogam leben. Nur wenn eine von beiden stirbt, suchen sie sich eine neue Partnertaube. Sie ziehen die Jungtiere gemeinsam groß und leben, bei passenden Bedingungen, für immer am selben Nistort. Dieses Taubenpaar lebt dort schon seit ich denken kann. Ich habe sie mehrere Jungtiere aufziehen sehen und bin nach wie vor fasziniert von diesem kleinen Kosmos, der sich direkt vor meinem Fenster abspielt.
Ob da draußen auch irgendwo meine Taube wartet? Ist es zu viel verlangt, dass ich mir das Gleiche wünsche, das auch diese Vögel haben? Oder sind das veraltete Wünsche, die alles andere als feministisch sind? Ich weiß doch überhaupt nicht, ob ich monogam leben möchte und … Okay, das führt nun wirklich zu weit.
Im Haus gegenüber öffnet sich die Tür, und Herr Greinert betritt die Straße. Ich winke ihm zu und frage mich, wann er wohl zuletzt eine Beziehung geführt hat und ob er monogam lebt oder nicht.
Dann schweifen meine Gedanken ab, und mir fällt ein, dass ich vergessen habe, meinen Föhn in den Koffer zu packen, also erledige ich das, ehe ich es wieder vergessen kann, und hake den Punkt auf meiner Packliste ab.
Gerade als ich auf meine Countdown-App blicke, die mir verrät, dass es nur noch 40 Stunden bis zum Campbeginn sind, ruft Flo mich an.
»Hi«, sage ich erfreut. »Ich dachte, du wärst schon im Camp und hättest keinen Empfang.«
»Ich hab Mum angefleht, mich mit zum Supermarkt zu nehmen. Hier habe ich nicht nur zwei Balken, es gibt auch gratis WLAN.« Ich höre Flos Grinsen durch das Handy hindurch.
»Ich kann nicht glauben, dass wir uns übermorgen endlich wiedersehen!«, rufe ich etwas zu laut ins Telefon, doch ich kann meine Freude nicht zurückhalten.
»Geht mir genauso. Und es wird noch besser: Meine Mums gehen morgen mit mir zum Spiel der Eintracht gegen FC Bayern. Ich werde Nicole Anyomi live sehen!« Sie kreischt auf, und ich grinse.
Mit Fußball konnte ich noch nie sonderlich viel anfangen, aber Flo weiß alles darüber. Mich interessiert nur der Gossip. Wer mit wem zusammen ist und so, aber sie steckt richtig tief drin in der Materie, verfolgt jedes Spiel und hat auch schon einige Spielerinnen live getroffen.
»Aber deshalb ruf ich nicht an«, fährt Flo fort. »Ich wollte fragen, ob du mitbekommen hast, dass sich unser Traumpaar getrennt hat.«
»Wer?«
»Nora und Denise.«
»Was?« Damit hatte ich nicht gerechnet.
»Ich hab es vorhin auf Insta gesehen. Eigentlich wollten die beiden auch zum Spiel kommen, du weißt doch, Nora ist ein Riesen-Bayern-Fan, aber jetzt hat Denise gepostet, dass sie ihre Karte verkauft. Und Nora hat alle Bilder mit ihr gelöscht.«
»Oh shit. Wenn das mal nicht das Gesprächsthema im Camp wird.«
»Wusste ich doch, dass dich diese Info interessiert.« Flo lacht. »Ich muss auflegen, wir schreiben morgen, ja? Schlaf gut, du Fast-Geburtstagskind.«
»Danke, viel Erfolg noch beim Einkauf.«
Wir legen auf, und sofort öffne ich Instagram. Sosehr ich es mag, im Camp keinen Internetempfang zu haben: Natürlich verbringe auch ich viel zu viel Zeit mit Social Media.
Wo sonst kann man so viel über zwischenmenschliche Beziehungen recherchieren?
Ich klicke auf Noras Profil und sehe, dass die Bilder von ihr und Denise tatsächlich gelöscht wurden. Es ist seltsam, weil wir beide im Camp bisher nicht viel miteinander zu tun hatten. Die zwei Male, in denen sie mich aus brenzligen Situationen retten musste, einmal ausgenommen. Und dennoch hatte ich das Gefühl, Nora zu kennen. Das schönste Mädchen des Camps, die toughe Pfadfinderin, die mit der sportlichen Blondine zusammen war. Die beiden wurden im Camp als absolutes Powercouple bezeichnet. Beide im Ruderteam, beide ehrgeizig und attraktiv.
Sie sind letzten Sommer während des Camps zusammengekommen, und von außen betrachtet wirkte es wie die perfekte Liebesgeschichte. Ich habe sie mehr als einmal beobachtet, wenn sie zusammen über den See ruderten oder sich im Wasser küssten, und mir vorgestellt, wie es wäre, solch eine Beziehung zu haben.
Noras Profil wirkt nun ziemlich leer. Da sind nur ein paar Naturaufnahmen, ihr Kopf von hinten, wie sie auf einen See hinausblickt, und eine Kreidezeichnung von einem Regenbogen auf Asphalt.
Mir passiert es oft, dass ich mich zu sehr in die Probleme anderer Menschen hineinsteigere. Ihre Emotionen werden zu meinen und überrollen mich.
Ich stelle mir vor, wie Nora allein in ihrem Zimmer sitzt und um die Beziehung weint. Dabei weiß ich doch gar nicht, wer sich von wem getrennt hat. Denise jedenfalls war mir schon immer recht unsympathisch. Als ich letztes Jahr mit ihr in der Kreativ-AG war und ein Sternbild zeichnete, meinte sie, das sei ja wohl das langweiligste Motiv, das man wählen könnte.
Ich klicke auf Noras Profilbild, um es mir größer anzeigen zu lassen. Sie grinst frech in die Kamera und trägt ihre Pfadfinderinnenkluft.
Ob ich ihr schreiben und nachfragen soll, wie es ihr geht?
Aber wir kennen uns kaum, das wäre seltsam. Nein, ich sollte mich auf meine eigenen Probleme konzentrieren. Und darauf, dass ich übermorgen Lilly wiedertreffen werde. Nora und Denise waren vielleicht nicht das Traumpaar, für das sie alle gehalten haben, aber Lilly passt in jeglicher Hinsicht perfekt zu mir. Oma wäre stolz auf mich.
IM DOPPELPACK
Die Menschen stellen es sich immer toll vor, ein Zwilling zu sein. Sie denken, da ist diese andere Person, die dir so ähnlich ist, die immer für dich da ist, die dich blind versteht.
Lila und ich könnten nicht unterschiedlicher sein.
Dass wir eineiige Zwillinge sind, sieht man äußerlich, ja. Wir haben beide Mamas blondes Haar und Papas blaue Augen geerbt, wir haben die gleiche Nase, dieselben »Bumms«-Lippen, wie Kevin in der Siebten sie damals genannt hat, die gleichen schmalen Finger, und selbst die Muttermale auf unserer Schulter sind identisch. Aber das ist das, was andere von außen sehen. Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Obwohl ich es versucht habe. Während Lila ihren perfekt frisierten blonden Bob seit Jahren trägt, erstrahlen meine kinnlangen Haare alle paar Monate in einer anderen Farbe. Gerade lasse ich das Mintgrün und Rosa rauswachsen.
Kommen wir also zu den Dingen, die mich von Lila unterscheiden, was so ziemlich alles andere wäre. Papa hat uns einmal mit zwei Süßigkeiten verglichen, was erstaunlicherweise sehr gut gepasst hat. Er meinte, Lila sei wie weiße und rosa Marshmallows. Süß, leicht, nicht zu aufdringlich, die meisten lieben sie. Ich hingegen sei After Eight. Altklug, bitter, sarkastisch. Ich schmecke nicht jedem.
Als Mama mitbekam, was Papa uns da erzählte, nahm sie uns beiseite und versicherte uns, dass wir beide toll seien auf unsere ganz eigene Art und Weise. Aber sind wir ehrlich: Papa hatte recht.
Ich bin After Eight. In meinem Schrank gibt es mehr schwarze Klamotten als in Holgers, und er ist Bestatter. Meinen Humor verstehen die wenigsten Gleichaltrigen, und Erwachsene überfordere ich oft mit meinen Gedankensprüngen. Lila hingegen wird von allen geliebt.
Würde man uns für eine Netflix-Serie casten, wäre Lila Edith und ich Wednesday.
Sie war schon früher das süße kleine Mädchen, das mit Puppen spielte, während ich im Schlamm gegen unsichtbare Bösewichte kämpfte. Sie hatte es leicht, weil sie mit ihrer Art und ihren Hobbys in die typische »Mädchen«-Schublade passte. Ich hingegen habe Schubladen schon immer gehasst.
Meine Fantasie war damals grenzenlos. Ich stellte mir vor, ich sei eine intergalaktische Superheldin, die die Menschheit retten müsse. So was eben. Im Kindergarten fand ich mit diesen Geschichten noch schnell Freund*innen. Ich spielte mit den anderen Kindern, wir bastelten uns Superheld*innen-Kostüme und kämpften gegeneinander. In der Grundschule wurde ich jedoch seltsam angesehen, als ich am ersten Tag mit meinem schwarzen Umhang den Klassensaal betrat und mich als Mal, die Dunkelkriegerin, vorstellte.
Man kann sich vorstellen: Ich hatte nicht den besten Start ins Schulleben.
Lila hingegen hatte schon nach der ersten Woche eine riesige Gruppe an Mädchen, mit denen sie abhängen konnte. Sie kamen zu uns nach Hause, flochten sich die Haare, spielten mit ihren Pferdeschleichtieren und probierten heimlich Mamas Schminke aus.
Unsere Eltern versuchten zwar, die Kluft zwischen uns zu überbrücken, indem sie Lila baten, mich mitspielen zu lassen, doch dadurch machten sie es nur noch schlimmer. Lila wollte mich nicht dabeihaben, weil sie Angst hatte, ich würde ihre Freundinnen vergraulen, und ich wollte nicht dabei sein, weil ich Zöpfen und Pferden nichts abgewinnen konnte.
Nach der Trennung unserer Eltern wurde es nicht besser, und als wir dann in die Pubertät kamen, stritten wir uns fast täglich. Bisher hatten wir unsere Geburtstage immer zusammen gefeiert. Mit der Verwandtschaft und einigen Freund*innen. Doch unseren dreizehnten Geburtstag wollte Lila anders feiern.
»Ich werde eine Teenagerin. Malin wird alles ruinieren, bitte, bitte zwingt mich nicht, mit ihr zu feiern.« Sie wussten nicht, dass ich sie hören konnte. Unsere Eltern und Lila dachten, ich sei oben in meinem Zimmer.
Papa war extra vorbeigekommen, um bei der Planung zu helfen. Damals lebte er noch in München und feierte mit uns gemeinsam.
»Vielleicht sind sie langsam wirklich alt genug für zwei getrennte Partys«, warf Papa ein.
»Aber wen laden wir denn dann für Malin ein?«, meinte meine Mutter bestürzt.
»Ich kann nichts dafür, dass sie keine Freunde hat!«, beschwerte Lila sich und drückte auf die Tränendrüse. »Sie ist einfach komisch.«
»Schatz, das stimmt nicht.«
»Niemand mag sie«, meinte sie mit Nachdruck. »Wenn sie mit uns feiert, kommen meine Freundinnen nicht, das weiß ich.« Sie schniefte.
»Wie wäre es, wenn wir erst mit den Verwandten feiern und ich dich und deine Freundinnen später in die Bowlinghalle fahre?«, schlug Papa vor.
»Das wäre toll, danke, Daddy.«
In diesem Moment hasste ich meine Schwester. Ich hasste sie, weil sie immer bekam, was sie wollte. Weil sie genau wusste, was sie sagen musste, und so selbst an unserem Geburtstag mehr Zeit mit Papa verbringen würde. Dabei gab es davon doch ohnehin viel zu wenig. Alle hielten sie für dieses süße, liebe Mädchen, doch ich wusste es besser. Sie war kein Marshmallow, sie war klebriges Karamell, das sich an deinen Zähnen festsetzt und Karies verursacht.
Aber vielleicht hasste ich sie auch, weil ein Teil von mir ihr glaubte. Ich hatte keine Freund*innen. Ich war seltsam, und wenn selbst Papa vorschlug, dass wir getrennt feiern sollten, vielleicht dachte er das dann auch? Aber ich wusste nicht, wie ich mich ändern sollte.
Und dann verliebte ich mich, und die Welt stand Kopf. Denn eins hatte ich mit Lilas Freundinnen sehr wohl gemeinsam: Ich fand Jungs süß. Auch wenn ich das niemals zugegeben hätte. Ich war Mal, die Dunkelkriegerin. Ich glaubte nicht an sowas wie Liebe oder Romantik.
Und doch konnte ich nicht leugnen, dass JJ der süßeste Junge der Schule war. Mit seinen hellbraunen Locken, seinen schnellen Fingern an der Gitarre und diesem Schlafzimmerblick, mit dem er alle Mädchen – und vielleicht ja auch manche Jungs – in seinem Umfeld an den Rand eines Wachkomas brachte. In gewisser Weise war er auch ein Superheld mit Superkräften, und das faszinierte mich. Aber ich hatte Wichtigeres zu tun, als mich mit Jungs zu beschäftigen, und ich wollte auf keinen Fall etwas mit Lila gemein haben.
Vielleicht meldete ich mich deshalb freiwillig, um der neuen Schülerin die Schule zu zeigen, die in der Siebten zu uns gewechselt war. Es war ein seltsames Jahr. Lila und ich hatten in den Sommerferien beide unsere Periode bekommen. Sie eine Woche vor mir, wofür ich sie insgeheim auch hasste.
Mit der Periode begannen unsere Brüste zu wachsen. Etwas, das ich seltsam und faszinierend zugleich fand. Mein Körper formierte sich. Ich verglich mich mit einem Pokémon, das die nächste Entwicklungsstufe erreicht hatte. Aus Malin, dem Mädchen, wurde Malin, die junge Frau.
Nach diesen ereignisreichen Sommerferien traf ich in der Aula auf Sophia, und mein Körper reagierte so heftig auf sie, dass ich erst glaubte, ich sei krank. Denn nachdem ich ihr die Schule gezeigt hatte, konnte ich eine Woche lang nichts essen. Ich schlief schlecht, hatte Hitzewallungen und konnte nicht aufhören, an sie zu denken.
Als ich Mama berichtete, ich hätte Angst, mir eine Sommergrippe eingefangen zu haben, lächelte sie nur.
Sophia mochte mich. Vielleicht, weil sie nicht die letzten Jahre gelernt hatte, mich seltsam zu finden. Sie schaute Science-Fiction-Filme, las Comics und fuhr Skateboard. Ich verliebte mich so schnell in sie, dass es sich anfühlte, als wäre ich im Sturzflug ohne Rettungsschirm.
Damals wusste ich jedoch nicht, wie ich diese Gefühle deuten sollte. Das verstand ich erst ein halbes Jahr später: Sophia kam nach den Weihnachtsferien zurück und knutschte mit JJ draußen bei den Fahrradständern. Ich weiß noch, wie ich mir vorstellte, dass ihre Zungen bei der Kälte aneinander festfrieren. Vielleicht war das der Grund, wieso sie sich minutenlang nicht voneinander lösten.
Mama ließ mich eine Woche krank spielen. Ich verkroch mich in meinem Bett. Lila verstand nicht, was los war. So kannte sie mich nicht, und für ihre Verhältnisse war sie sogar nett zu mir. Sie brachte mir Kakao und fragte, was los sei. Doch ich schrie sie an und befahl ihr, mein Zimmer zu verlassen. Als ob ich mit ihr über meine Gefühle sprechen würde. Gefühle waren sowieso etwas für Sterbliche. Ich war eine Dunkelkriegerin.
Doch in den nächsten Wochen musste ich mir eingestehen: Ich war keine Kriegerin mehr. Ich war eine Teenagerin mit einem gebrochenen Herz.
»Ich denke, ich bin bi«, sagte ich an einem Wochenende im Frühling erst zu Papa am Telefon, dann zu Mama und Holger, die gerade auf der Couch die Nachrichten schauten.
Ich wusste, dass ich Jungs interessant fand, und ich hatte auf jeden Fall Gefühle für ein Mädchen gehabt. Damit war die Sachlage für mich klar.
Papa, Mama und auch Holger reagierten superentspannt. Papa lächelte mir über meinen Handybildschirm entgegen. »Danke, dass du mir das erzählt hast. Ich muss jetzt die Jungs vom Handball abholen, aber wir sprechen später noch mal, ja?« Ich nickte, was sollte ich auch sonst tun?
Mama und Holger nahmen mich in den Arm und sagten mir, dass sie mich liebten. Und Lila? Lila sah mich nicht an, sondern presste die Lippen zusammen.
Damals verstand ich sie nicht. Ich wusste nicht, was ich getan hatte. Ich war ihr zuvorgekommen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Nur zähle ich das nicht wirklich dazu. Immerhin ist es keine Errungenschaft, sich zu outen. Das ist ganz einfach, wer ich bin.
Lila hatte ihr Coming-out mit fünfzehn. Sie weinte, und Mama und Holger hielten sie in den Armen. Ich weiß nicht, wieso es für sie so eine schlimme Sache war. Durch mein Coming-out wusste sie doch bereits, dass die beiden gut reagieren würden.
Sie stellte es so dar, als sei Queerness etwas Schreckliches. Etwas Unnormales. Ich liebte es, queer zu sein. Weil es dazu geführt hatte, dass ich endlich Menschen in meinem Leben hatte, die mich verstanden. Kurz nach meinem Coming-out hatte ich online von dem Sommercamp gelesen und meine Eltern gefragt, ob ich dorthin gehen dürfe, und schon nach meinem ersten Jahr dort wollte ich am liebsten nie wieder woanders hin.
»Möchtest du Malin diesen Sommer ins Camp begleiten?«, schlug Mama nach Lilas Coming-out vor.
»Das ist eine tolle Idee. Malin, du hast doch immer sehr viel Spaß dort, oder?«, fragte Holger.
Ich nickte. »Es ist der beste Ort der Welt.«
»Ich will nicht in dieses beschissene Camp!«, brachte Lila hervor und löste sich aus Mamas und Holgers Armen. »Ich muss nicht herumrennen und jedem meine Sexualität unter die Nase reiben. Ich wollte es euch sagen, aber sonst geht das niemanden etwas an.« Sie wischte sich über die Augen, schaffte es dabei irgendwie, nicht ihr Make-up zu verschmieren, und strich sich die Haare aus der Stirn.
»Ich werde jetzt schlafen gehen.«
»Okay, Schatz. Aber du kannst jederzeit mit uns reden, das weißt du, oder?«, sagte Mama.
»Und wenn du dir das mit dem Camp doch anders überlegst …«, begann Holger.
»Werde ich nicht. Das ist etwas, das Malin gefällt. Also werde ich es dort sowieso hassen.«
Tja, unsere Fronten waren verhärtet. Und ich glaube, in diesem Moment verstanden selbst Mama und Holger, dass Lila und ich zwar mit demselben Chromosomensatz ausgestattet, aber abseits davon zwei vollkommen unterschiedliche Wesen sind.
Ich sah meiner Schwester nach und verstand nicht, wieso sie so aufgebracht war. Sie wusste nicht, was sie verpasste. Und ganz ehrlich: Ich war froh, dass sie mich nicht ins Camp begleiten wollte. Ich wollte mein zweites Jahr dort mit meinen Freund*innen verbringen. Da würde sie nur stören.
Aber ein anderer Teil in mir, einer, den ich nur sehr selten an die Oberfläche ließ, hatte auch Mitleid mit Lila. Egal wie man es drehte und wendete: Sie war meine Schwester. Und sie so aufgelöst zu sehen, gefiel mir nicht. Aber ich war fünfzehn und hatte die letzten Jahre damit zugebracht, wütend und eifersüchtig zugleich auf sie zu sein. Wenn sie in der Vergangenheit nur ein wenig netter zu mir gewesen wäre, wer weiß, vielleicht hätte ich dann an diesem Abend an ihrer Zimmertür geklopft. Doch das tat ich nicht. Und wenn ich ehrlich bin, dann habe ich deswegen immer noch ein schlechtes Gewissen. Denn in dem folgenden Jahr distanzierte Lila sich noch mehr von mir. Sie sprach in der Schule immer nur über Jungs und lachte über die blödesten Witze. Gleichzeitig wurde sie zur Mittelstufensprecherin gewählt, und ihre Beliebtheit stieg ins Unermessliche.
Und hier sind wir nun. Mein viertes Jahr im Camp steht kurz bevor, ich habe dort tolle Freund*innen gefunden, aber in der Schule hat sich kaum etwas verändert, und meine eigene Schwester will nichts mit mir zu tun haben.
Wir sind zwei queere Teenagerinnen, die all die Fragen des Erwachsenwerdens, der eigenen Sexualität und des Lebens zusammen bewältigen könnten.
In einem High-School-Film würde es auch sicher genauso ablaufen. Aber das hier ist die Realität. Die, in der After Eight und Marshmallows niemals zusammen auf einem Snackteller serviert werden würden.
FINALLY SEVENTEEN
Noch 24 Stunden, bis ich endlich im Camp ankomme. Noch ein letzter Tag unter einem Dach mit Lila. Andere Menschen freuen sich auf ihren Geburtstag, ich wünsche mir, dass er einfach nur vorbeigeht. Denn feiern werde ich erst im Camp, das habe ich mit Flo und Basti bereits besprochen. Wir wohnen alle so weit auseinander, dass wir es abseits des Camps nur sehr selten schaffen, uns zu treffen. Dank Facetime sehen wir uns zum Glück trotzdem regelmäßig.
Die beiden können mich heute allerdings auch nicht ablenken, denn Flo ist gerade mit ihren Müttern im Stadion und Basti ist mit seinen Brüdern im Europapark. Trotzdem haben sie an meinem Geburtstag an mich gedacht. Heute früh habe ich von beiden ein kitschiges Video zugeschickt bekommen, in dem sie unsere schönsten Momente und peinlichen Bilder mit Musik unterlegt haben. Gerade sitze ich auf dem Klo und sehe es mir zum gefühlt siebten Mal an, als Lila hart gegen die Tür pocht.
»Wie lange planst du noch, da drin zu bleiben?«
»Wenn es nach mir ginge, bis morgen früh um neun, wenn ich endlich ins Camp fahren darf!«, rufe ich zurück und stelle mir vor, wie ihr Gesicht vor der Tür rot anläuft.
»Ich muss meine Haare föhnen, Vivi und die anderen kommen schon in einer halben Stunde!«
»Tja, dann werden sie dich wohl mit nassen Haaren ertragen müssen. Was für eine schreckliche Vorstellung.«
»Malin, komm jetzt sofort da raus!«
Wieder hämmert sie gegen die Tür. »Du benimmst dich, als wärst du zwölf!«
Ach wunderbar, sie zieht die Alterskarte. Nur weil sie mir drei Minuten und achtzehn Sekunden voraushat, ist sie der Meinung, dass sie die ältere, weisere und reifere von uns ist.
Ich höre Mamas Hausschlappen auf der Treppe, und kurze Zeit später klopft sie sanft gegen das Holz.
»Schatz, meinst du nicht, ihr könnt eure Schwesternfehde heute einmal beilegen? Es ist doch immerhin euer Geburtstag.«
Ich starre auf das Handy in meiner Hand. Auf Bastis grinsendes Gesicht und Flos strahlende Augen. Ich atme tief durch, lege das Handy zur Seite, ziehe meine Unterhose hoch, spüle und trete an den Wasserhahn. Noch vierundzwanzig Stunden, dann bin ich hier weg.
»Na endlich!« Lila rauscht an mir vorbei ins freie Bad und zieht die blumige Duftwolke ihres Parfums hinter sich her. Der Geruch erinnert mich daran, wie ich einmal aus Versehen ihr Shampoo verwendet habe – okay, es war kein Versehen, ich wollte wissen, ob das Versprechen von seidigem Glanz wirklich der Wahrheit entspricht – und wie sie ausgerastet ist, als sie es bemerkte.
Ich ziehe mich in mein Zimmer zurück und starre auf den fertig gepackten Koffer, der dort bereits seit Tagen auf mich wartet. Als unsere Eltern beschlossen, dass wir beide unsere eigenen Zimmer bekommen sollten, waren wir sieben. Doch damit es keine Benachteiligung gab, haben sie beide Zimmer exakt gleich eingerichtet. Dennoch ist Lilas Zimmer einen Quadratmeter größer – ich habe nachgemessen –, und sie hat Zugang zum Balkon. Dafür habe ich einen wunderschönen Erker, von dem aus ich in unseren Garten und vor allem in den Himmel darüber sehen kann. Ich möchte mein Zimmer also auf keinen Fall mit ihrem tauschen.
Die exakt gleichen Möbel haben wir auch nach und nach ausgetauscht. Lilas Zimmer könnte einem cremeweißen Einrichtungskatalog von