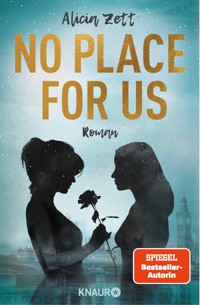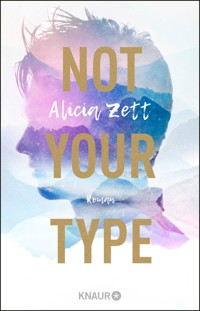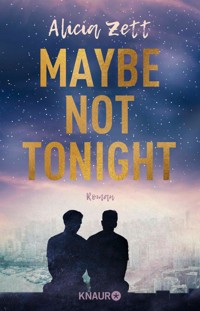
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Love is Queer
- Sprache: Deutsch
Leben heißt loslassen – und deinem Herzen folgen: Mutig, ehrlich und wunderbar romantisch erzählt der New Adult Liebesroman »Maybe Not Tonight« der SPIEGEL-Bestseller-Autorin Alicia Zett von zwei jungen Männern, einem traumhaften Sommer in Kanada und dem Mut, den es braucht, sein Leben so zu genießen, wie es ist. Für den 19-Jährigen Luke fühlt sich die Zeit als Au pair in Vancouver an wie ein Traum: Jahrelang hat er sich nur darauf konzentriert, seinen Geschwistern den toten Vater zu ersetzen – jetzt, viele tausend Kilometer von Zuhause entfernt, scheint plötzlich alles möglich. Bei einem Theaterprojekt findet Luke schnell neue Freunde und lernt auch den Studenten Jackson kennen, der ihm zeigen könnte, was es bedeutet, wirklich lebendig zu sein. Doch Luke hat keine Ahnung, wie er mit seiner neuen Freiheit umgehen soll. Und in wenigen Monaten wird er in einem Flugzeug zurück nach Deutschland sitzen. Es wäre äußerst unklug, sich auf Jackson einzulassen - oder? Mit viel Gefühl und Einfühlungsvermögen schreibt SPIEGEL-Bestseller-Autorin Alicia Zett, die selbst in der LGBTQ+-Community aktiv ist, über die Liebe zwischen zwei jungen Männern, denen es das Leben bislang nicht leicht gemacht hat - und die es trotzdem bis zum letzten Tag genießen wollen. Die Liebesromane aus Alicia Zetts New-Adult-Reihe »Love is Queer« im Überblick: - »Not Your Type« - »Maybe Not Tonight« - »No Place for Us«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Alicia Zett
Maybe Not Tonight
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Leben heißt loslassen – und deinem Herzen folgen:
Mutig, ehrlich und wunderbar romantisch erzählt der New Adult Liebesroman »Maybe Not Tonight« von zwei jungen Männern, einem traumhaften Sommer in Kanada und dem Mut, den es braucht, sein Leben so zu genießen, wie es ist.
Für den 19-Jährigen Luke fühlt sich die Zeit als Au pair in Vancouver an wie ein Traum: Jahrelang hat er sich nur darauf konzentriert, seinen Geschwistern den toten Vater zu ersetzen – jetzt, viele tausend Kilometer von Zuhause entfernt, scheint plötzlich alles möglich. Bei einem Theaterprojekt findet Luke schnell neue Freunde und lernt auch den Studenten Jackson kennen, der ihm zeigen könnte, was es bedeutet, wirklich lebendig zu sein. Doch Luke hat keine Ahnung, wie er mit seiner neuen Freiheit umgehen soll. Und in wenigen Monaten wird er in einem Flugzeug zurück nach Deutschland sitzen. Es wäre äußerst unklug, sich auf Jackson einzulassen - oder?
Mit viel Gefühl und Einfühlungsvermögen schreibt Alicia Zett, die selbst in der LGBTQ+-Community aktiv ist, über die Liebe zwischen zwei jungen Männern, denen es das Leben bislang nicht leicht gemacht hat - und die es trotzdem bis zum letzten Tag genießen wollen.
Die Liebesromane aus Alicia Zetts New-Adult-Reihe »Love is Queer« im Überblick:
»Not Your Type«
»Maybe Not Tonight«
»No Place for Us« (erscheint im Herbst 2021)
Inhaltsübersicht
Widmung
Playlist zum Roman
Luke
Luke
Luke
Luke
Jackson
Luke
Luke
Jackson
Luke
Luke
Luke
Luke
Luke
Jackson
Luke
Luke
Luke
Luke
Jackson
Luke
Luke
Jackson
Luke
Jackson
Luke
Luke
Luke
Luke
Luke
Luke
Jackson
Luke
Luke
Jackson
Luke
Jackson
Luke
Luke
Luke
Jackson
Luke
Luke
Luke
Luke
Jackson
Luke
Jackson
Luke
Luke
Luke
Luke
Jackson
Luke
Luke
Luke
Jackson
Luke
Jackson
Luke
Luke
Jackson
Luke
Luke
Luke
Luke
Jackson
Luke
Luke
Luke
Luke
Danksagung
Für all die wundervollen Menschen, die meine grauen Tage mit Farbe füllen.
Playlist zum Roman
Tennessee Line – Daughtry
You Let Me Walk Alone – Michael Schulte
Rollercoaster – Bleachers
Animal – Neon Trees
Come Home – The Peoples Thieves
Make Believe – The Faim
Missing Home – flora cash
Say I Am – Gavin DeGraw
Let’s Go To The Mall – Robin Sparkles
Perfectly Wrong – Shawn Mendes
WILD – Troye Sivan
Poetry – Wrabel
See You When I See You – Handsome Ghost
You’re Still The One – The Maine
Die komplette Playlist findet ihr auf Spotify unter:
Maybe Not Tonight Official Book Playlist
Hmpf, hmpf. Ich sitze auf den klebrigen Küchenfliesen, während Bounty neben mir ihr Futter inhaliert, als hätten wir sie eine Woche lang hungern lassen.
»Schling doch nicht so.«
Natürlich reagiert sie nicht. Zermalmt nur stetig weiter den nassen Hühnchen-Lachs-Mix. Ich seufze und wende mich wieder dem Ofen zu. Der Timer zeigt noch sieben Minuten an. Langsam beginnt der Käse zu schmelzen. Erst glänzt er nur leicht, dann wird er weich, fließt über den knusprigen Rand und bedeckt Stück für Stück die Tomatensauce. Mein Magen rumort.
»Komm schon!«, knurre ich den Ofen an. Bounty neben mir leckt sich die Pfoten und mustert mich.
»Was ist? Du sitzt auch immer stundenlang vor der Waschmaschine.«
Bounty maunzt und streift mit aufgestelltem Schwanz an mir vorbei. Es sieht fast so aus, als lache sie über mich.
»Wieso sprichst du mit der Katze?«
Ich zucke zusammen. Paul lehnt im Türrahmen und grinst mich an.
»Weil sie die Einzige in dieser Familie ist, die mich versteht«, antworte ich theatralisch, und Paul lacht.
»Jaa genau. Sie wird dich sicher nicht vermissen.«
»Ach ja? Dabei bin ich doch ihr treuer Dosenöffner.«
Paul setzt sich neben mich auf den Boden. Obwohl er seit seinem Geburtstag im Frühling ein ganzes Stück gewachsen ist, reicht er mir nur knapp bis zur Schulter.
»Was machst du da eigentlich?« Pauls Blick ruht nun ebenfalls auf dem Ofen. Seine Haare könnten mal wieder einen neuen Schnitt vertragen, sie fallen ihm ständig in die Augen. Aber ich habe vergessen, einen Friseurtermin auszumachen, und er traut sich immer noch nicht, selbst dort anzurufen.
»Ich warte, dass dieses Prachtexemplar endlich fertig wird.«
»Du bist komisch. Ich deck schon mal den Tisch.« Paul steht auf und wischt sich den Staub von der Hose. Gestern habe ich Sascha gebeten, wenigstens im Erdgeschoss zu saugen. So viel dazu.
Endlich piept der Timer, und ich stehe auf, um die Pizza aus dem Ofen zu holen.
Hinter mir höre ich Geschirr klirren, als Paul Teller und Gläser aufeinanderstapelt.
»Paul, nein. Trag sie einzeln, okay?«
»So geht’s aber schneller.«
»Nein, so geht nur wieder ein Glas kaputt. Das wäre dann das vierte diesen Monat.«
Paul schmollt, stellt dann aber doch die Gläser zurück und trägt nur die Teller zum runden Esstisch.
Ich schneide die Pizza auf dem Blech in sechzehn kleine Stücke. Das sind vier für jeden von uns. Dann laufe ich in den Flur und blicke nach oben in den ersten Stock.
Früher kam mir die geschwungene Holztreppe so edel vor, mit ihrer glänzenden Holzmaserung. Mittlerweile ist der Handlauf an einigen Stellen angelaufen, und man sieht den Stufen deutlich an, wie viele Füße schon darübergelaufen sind. Das Holz ist mit der Zeit spröde und dunkel geworden. Wie fast alles in diesem Haus hat es seine besten Zeiten längst hinter sich. Trotzdem mag ich die Treppe. Ich weiß genau, welche Stufe knarzt, finde den Handlauf auch mitten in der Nacht, wenn ich mal wieder betrunken in mein Zimmer schleichen muss, und wenn man sich die Stufen von unten einmal genauer ansieht, kann man die kleinen Buntstiftstriche erkennen, die Lou, Paul, Sascha und auch ich dort mit den Jahren hinterlassen haben. Ich fühlte mich cool, als ich damals meinen Namen auf das Holz kritzelte. Ma schimpfte danach zwar mit uns, ließ die Namen aber stehen. Heute sind sie ebenfalls verblasst, doch wenn man darüberstreicht, kann man noch spüren, an welchen Stellen der Stift in die Maserung eingedrungen ist.
»Kommt essen!«, rufe ich nach oben, um durch Saschas Kopfhörer und Lous Zimmertür zu dringen. Keine Reaktion.
»Es gibt Pizza!«, schreie ich noch lauter.
Knall. Eine Zimmertür wird lautstark geöffnet. Lou rennt aus ihrem Zimmer, flitzt mit ihren kleinen Rutschsocken über die Treppe und sitzt schneller am Tisch, als ich blinzeln kann. Sascha kommt nun ebenfalls die Treppe runtergeschlurft und hat sogar die Kopfhörer abgenommen. Seine braunen Haare stehen nun in alle Richtungen ab, fast wie bei einem Igel. Bis auf Lou haben wir alle Mas braunes Haar geerbt, das sich nicht bändigen lässt, egal, wie viel Gel wir reinklatschen. Nur Lous Haare leuchten rot, wenn die Sonne darauf fällt. Ein Stück von Papa, das sie mit sich trägt.
Als ich in die Küche komme, sitzen bereits alle auf ihren Plätzen und schaufeln sich Pizza in die Münder. Ich habe es aufgegeben, ihnen Manieren beizubringen.
»Lasst mir auch was übrig, okay?«
Lou kichert und nimmt sich schnell noch ein Stück.
Da nicht mehr genug saubere Teller vorhanden sind, hole ich mir eine Serviette aus dem Schrank und drapiere mein Stück auf dem hässlichen Weihnachtsmotiv. Dabei haben wir August. Aber alles ist besser als die Penis-Servietten, die meine beste Freundin Charlie mir letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt hat.
»Guten Appetit«, rufe ich feierlich in die Runde, bevor ich mich ebenfalls über die Pizza hermache. Meinen eigenen Hefeteig habe ich über die Jahre hinweg perfektioniert.
»Schmeckt geil!«, lobt Paul mich und reckt einen Daumen in die Höhe. Seit er in die Mittelstufe geht, ist alles »geil« oder »nice« oder, wenn er etwas gar nicht leiden kann, »wack«. Ich bin nur fünf Jahre älter als er und fühle mich trotzdem so, als würde er eine vollkommen andere Sprache sprechen. Ich bete, dass es bei Lou noch lange dauert, bis sie in die Pubertät kommt.
Sascha neben mir öffnet sich einen Energydrink, nimmt einen großen Schluck und rülpst laut.
»Ihhh«, kreischt Lou.
»Echt jetzt, Sascha?« Ich sehe ihn vorwurfsvoll an, doch Sascha stopft sich nur den letzten Rest Teig in den Mund und steht auf. »Sorry, muss weiterzocken.« Und er verschwindet aus der Küche.
Paul sieht ihm nach. Etwas Seltsames liegt in seinem Blick.
»Wieso kann er nicht gehen?«
»Paul!«
»Ich mein ja nur. Er macht uns bestimmt keine Pizza …«, murmelt er und schiebt ein einsames Maiskorn auf dem Teller hin und her.
»Er zwingt dich aber auch nicht, den Tisch abzuräumen.«
Pauls Gesicht hellt sich auf.
»Deswegen freu dich, dass du diese tolle Aufgabe heute noch einmal erledigen darfst!«
Das Grinsen verschwindet innerhalb einer Nanosekunde.
»Sadist.«
»Wie bitte?«
»Ich mach’s gleich …«
Während ich versuche, Lous Hände von Tomatensauce zu befreien, erzählt sie mir von ihrer neuen Klassenlehrerin. Sie kam vor ein paar Wochen in die zweite und ist jetzt schon hin und weg. Keine Ahnung wieso, aber sie liebt ihre Klassenlehrerin sehr. Vielleicht ist sie deshalb mit so wenigen Gleichaltrigen befreundet.
»Hast du die Hausaufgaben fertig, Mücke?«
»Fast. Das eine Blatt ist zu schwer …«
»Ich seh’s mir gleich mal an, okay?«
Sie nickt erfreut und verschwindet wieder nach oben. Die Hände immer noch mit Resten der Tomatensauce bekleckert.
Ich wische den Tisch sauber, spüle das Blech und sauge dann doch noch den Boden. So kann ich die Küche einfach nicht hinterlassen.
Als ich endlich nach oben zu Lou ins Zimmer komme, sitzt sie vor ihrem Playmobil-Bauernhof und schreit laut auf das Schleich-Pferd ein. Ihre Wangen sind schon ganz gerötet, und einzelne Strähnen haben sich aus ihrem Zopf gelöst.
»Lou, alles okay?«, frage ich vorsichtig und setze mich neben sie.
»Nein, Betty kriegt ihr erstes Fohlen, aber es will einfach nicht raus«, flüstert sie mir leise zu. Dann dreht sie sich wieder zu Schleich-Pferd Betty und schreit: »Pressen, jaa pressen!!!«
»Okay, Mücke, du schaust definitiv zu viele YouTube-Videos.«
Zwei Stunden später schließe ich endlich meine Zimmertür hinter mir. Nachdem ich Lou bei den Hausaufgaben geholfen habe, hat sie darauf bestanden, Bettys Fohlen ins Bett zu bringen. Das dauerte erstaunlich lange, weil es immer wieder aufgewacht ist und nach seiner Mama geschrien hat, doch als das Kleine endlich schlief, konnte ich Lou dazu überreden, sich die Zähne zu putzen und ebenfalls schlafen zu gehen. Ich war schon fast draußen, da drehte sie sich noch einmal zu mir. »Ich glaub, ich nenn das Fohlen Luke. Dann bist du immer bei mir.«
Ich habe schnell die Tür geschlossen, damit sie mich nicht weinen sieht.
Jetzt ist es ruhig im Haus, und ich habe das Gefühl, einen riesigen Fehler zu begehen. Ich kann hier nicht weg. Ich kann sie nicht allein lassen. Wenn ich nur daran denke, bildet sich ein Kloß in meinem Hals. Wie kam ich jemals darauf, dass das gut gehen würde?
Gleichzeitig freue ich mich schon seit Monaten auf diese Chance. Ach fuck.
Ich trete gegen den offenen Koffer, der vor meinem Bett steht, und prelle mir den kleinen Zeh. Lautlos fluchend hüpfe ich durchs Zimmer.
Als der Schmerz immer dumpfer wird, fällt mein Blick auf den Bücherstapel neben meinem Bett. Ein Reiseführer liegt ganz obenauf. Kanada – erleben Sie Ihren Traum steht dort. Kitschiger ging es auch nicht. Aber Charlie hat ihn mir geschenkt, also muss ich ihn wohl oder übel mitnehmen.
Ich dusche, ziehe mich um und lege mich schon um kurz nach zehn ins Bett. Sonst bin ich immer bis Mitternacht auf, aber vielleicht hilft es ja, vor dem Flug morgen etwas Schlaf zu tanken. Ich schließe die Augen und lasse mich langsam tiefer in die Matratze sinken.
Eine Minute später bin ich wieder hellwach. Ich höre, wie sich der Schlüssel im Haustürschloss dreht. Sie ist zu Hause. In Gedanken folge ich ihren Schritten. Sie hängt die Jacke, die immer nach einer Mischung aus ranzigem Fett und Desinfektionsmittel riecht, über einen Küchenstuhl, lässt den Schlüssel in die kleine Schale fallen, die wir extra dafür auf den Tisch gestellt haben, weil sie ihn sonst immer verliert. Dann zieht sie die Schuhe aus, läuft zurück zur Tür und stellt sie neben unsere. Als Nächstes gießt sie sich ein großes Glas Wasser ein, schaut im Kühlschrank nach Essensresten, findet die zwei Stücke Pizza, die Lou übrig gelassen hat, und setzt sich damit auf die Couch. Dort schaltet sie dann entweder eine Trash-TV-Sendung an oder schaut weiter ihre Netflix-Serie.
Irgendwann tauscht sie Wasser gegen Wein, und in einer Stunde wird sie eindösen, mitten in der Nacht auf der Couch erwachen und nach oben ins Bett kriechen.
Ob sie heute stattdessen bei mir vorbeischaut? Weil ich morgen früh nicht mehr da sein werde? Tatsächlich höre ich Schritte auf der Treppe. Sie kommt wirklich. Ich setze mich auf und streiche mir die Haare glatt.
Doch statt nach rechts, biegt sie nach links ab und verschwindet im Bad. Der Wasserhahn wird aufgedreht, und ich rolle mich wieder zur Wand. Fahre mit den Fingern über die ausgegraute Raufasertapete. Die Badezimmertür wird geöffnet. Schritte auf der Treppe. Sie kommt nicht zu mir. Und ich weiß, wieso. Sie hasst Abschiede genauso sehr wie ich.
Im Halbdunkel sehe ich mich im Raum um und versuche, mir jedes kleinste Detail einzuprägen. Seit zwölf Jahren lebe ich schon in diesem Zimmer. Die Tapete habe ich damals noch mit Papa gestrichen. Eine Wand dunkelblau, weil ich den Sternenhimmel ganz nah bei mir haben wollte. Die anderen weiß. Damit die Sonne auch schön reflektiert wird. Papa hat immer auf das Licht geachtet. Er war Malermeister, Hobbyschreiner und generell ein begabter Handwerker. Bei unserem Hausbau haben er und seine Kumpel so gut wie alles selbst gemacht. Das große Fenster in meinem Zimmer zeigt nach Osten.
»Damit die Sonne dich jeden Morgen wecken kann und du nie zu spät zur Schule kommst.« Sein Lachen klingt hohl und meilenweit entfernt in meinem Kopf, doch die Farbe, die ständig an seinen Händen klebte, rieche ich auch heute noch.
Jetzt ist der Rollladen fast ganz nach unten gefahren. Morgen wird mich keine Sonne wecken, nur der Handywecker.
Das Bett knarzt, als ich nach der Wasserflasche neben meinem Bett greife. Mein Handy blinkt, also nehme ich es erneut in die Hand, trinke einen Schluck und tippe mit der freien Hand auf die neue Nachricht. Sie ist von Charlie:
Es ist so scheiße, dass wir morgen nicht mit zum Terminal können . Aber ich hoffe, die kleine Abschiedsparty gestern hat dir gefallen .
Ich denke an den riesigen Eisbecher, den sie mir in unserem Lieblingscafé spendiert haben, und an die vielen kleinen Geschenke, die sie mir überreicht haben. Den Umschlag mit den Fotos dürfe ich erst in Kanada öffnen, hat Charlie mich angewiesen.
Ist vielleicht besser so, sonst würde das in einer reinen Heulorgie enden .
Noch während ich die Antwort tippe, spüre ich einen Kloß im Hals. Ich lasse nicht nur meine Familie zurück, sondern auch meine beste Freundin. Ich weiß nicht, wie ich das überstehen soll.
Charlie und ich kennen uns seit der siebten Klasse. Und seitdem haben wir kaum einen Tag getrennt voneinander verbracht. Gut, in der Schule saßen wir sowieso meistens nebeneinander, doch auch jetzt, nach dem Abi, treffen wir uns regelmäßig. Und das, obwohl sie und Viky immer noch in dieser nervigen Verliebtheitsphase sind. Auch wenn ich es Charlie von Herzen gönne, ich werde sie so sehr vermissen. Dabei war sie es, die mich schlussendlich zu diesem Abenteuer überredet hat. Sie hat angeboten, vorbeizuschauen und zu helfen, wenn sie kann. Wären sie und meine Großeltern nicht, die ebenfalls angeboten haben, nachmittags zu kochen und Lou bei den Hausaufgaben zu helfen, könnte ich morgen niemals in diesen Flieger steigen.
Eine Stunde lang rolle ich mich im Bett hin und her, dann gebe ich es auf, knipse das Nachtlicht an und schreibe Charlie:
Oh, wieso finde ich keine Ruh?? Wälze mich nur immerzu.
Okay, wenn du reimst, ist es besonders schlimm! Hör was von Daughtry! . Das wird schon .
Ich muss grinsen. Wieder einmal weiß Charlie, wie man mich aufheitern kann. Meine großen Kopfhörer liegen direkt neben mir auf dem Nachttisch, damit ich sie morgen auch ja nicht vergesse. Ich ziehe sie mir über den Kopf, lasse mich zurück ins Kissen fallen und drücke auf das erste Lied in meiner Kanada-Playlist. Tennessee Line von Daughtry. Der Leadsänger singt davon, seinem Herzen ins Unbekannte zu folgen. Die Heimat zu verlassen. Sich einfach treiben zu lassen.
Ich schließe die Augen und versuche, mir meine Gastfamilie vorzustellen. Gastfamilie, das klingt komisch. Immerhin bin ich mit ihnen verwandt. Nur kann ich mich kaum noch an sie erinnern. John ist der Bruder meines Vaters. Das letzte Mal habe ich ihn und seine Frau Meredith vor acht Jahren bei Papas Beerdigung gesehen. Vor ein paar Wochen habe ich zwar mit Meredith und Ava, meiner Cousine, geskypt, aber John und mein Cousin Alex waren außer Haus. Meredith wirkte auf mich sehr warmherzig, und Ava plapperte ununterbrochen darüber, wie sehr sie sich auf den Deutschunterricht freue.
Was John und Alex angeht, so waren sie nur dunkle Schemen in meinen Erinnerungen, bis Meredith mir ein Familienfoto geschickt hat, das alle vier zusammen zeigt.
Erneut entsperre ich mein Handy und klicke auf das Bild. Es öffnet sich und zeigt mir eine, zumindest teilweise, in die Kamera grinsende Familie. Mein Onkel John sieht so aus, als wäre er zu diesem Foto gezwungen worden, während Alex einen übergroßen Hoodie trägt und die Kapuze tief ins Gesicht gezogen hat. Ich erkenne nicht viel von ihm, lediglich ein paar rötliche Locken, die unter der Kapuze hervorlugen. Er ist zwei Köpfe kleiner als sein Vater und wirkt recht schmächtig. Während John und Alex offensichtlich zu diesem Foto gezwungen wurden, haben Meredith und Ava ihr Kameralächeln perfektioniert. Ava, die auf dem Schoß ihrer Mutter sitzt, strahlt direkt in die Kamera und wirft ihre zwei geflochtenen Zöpfe durch die Luft. Meredith hat mahagonirote Locken, Lachfältchen und trägt einen dunkelgrünen Pullover, auf den das typische Kanada-Symbol gedruckt ist: ein weißes Zuckerahornblatt. Aber wenn ich ehrlich bin, interessieren mich die drei nicht wirklich.
Es ist John, den ich mir in den letzten Wochen immer wieder ganz genau angesehen habe. Mein Vater starb, als ich elf Jahre alt war. Ich erinnere mich noch an ihn, aber ohne die vielen Fotos, die Ma ständig von uns gemacht hat, hätte ich vermutlich irgendwann vergessen, wie er aussah.
Mein Onkel John ist groß, hat grau meliertes Haar, das ihm in leichten Wellen über die Ohren fällt, und trägt ein braunes Hemd. Sein Blick wirkt nicht streng, sondern ruhig und zurückhaltend. Ich weiß, dass mein Vater der Jüngere von beiden war. Sein Haar war genauso widerspenstig wie meins, und seine blauen Augen konnten einen so durchdringend mustern, dass man nicht anders konnte, als ihm die Wahrheit zu sagen. Johns Augenfarbe kann ich nicht erkennen, aber wenn ich ihn mit den Fotos meines Vaters vergleiche, sieht er ihm verblüffend ähnlich. Er ist quasi die reifere, besonnenere Variante. Er ist bestimmt nicht der Typ, der spontan beschließt, mit seinen Kumpels auf ein Rockfestival zu fahren. Er sieht nicht so aus, als wüsste er, wie man ein Motorrad fährt. Das ist vermutlich der Grund, wieso John noch lebt und mein Vater nicht.
Bitterkeit steigt in mir auf, und ich muss mehrmals schlucken, um den Geschmack aus meinem Mund zu vertreiben. Ich nehme zwei große Schlucke Wasser und lege das Handy zurück auf den Nachttisch. Ich sollte jetzt endlich schlafen. Aber ich kann nicht.
Meine Verwandten werden mich in zwanzig Stunden am Flughafen abholen. Wie verhalte ich mich dann? Wird es komisch sein oder ganz ungezwungen? Ich habe keine Ahnung.
Ma hat mir erzählt, dass Alex dieses Jahr in die Highschool kommt. Innerlich bin ich zusammengezuckt. Papa hat nie mitbekommen, wie ich aufs Gymnasium gekommen bin. Dabei hatte er mir immer versprochen, mich am ersten Tag auf seinem Motorrad zur Schule zu fahren.
Meinen ersten Schultag habe ich nicht miterlebt. Statt mit den anderen Kindern der Begrüßungsrede der Direktorin zu lauschen, stand ich mit meinen schwarzen Schuhen im durchweichten Gras und starrte auf den Sarg, der in die Erde hinabgelassen wurde.
In den Tagen nach Papas Tod fühlte ich mich leer. Meine Welt war auseinandergebrochen. Da war nichts Helles mehr, nur noch Dunkelheit und Stille.
Ich versuchte zu funktionieren. Essen, schlafen, Hausarbeiten erledigen. Doch es ging nicht. Der Schmerz war zu mächtig. Es fühlte sich an, als lägen ganze Felsblöcke auf meiner Brust. Ich bekam schlecht Luft, blendete die Stimmen meiner besorgten Verwandten aus und zog mich in mich selbst zurück. Sieben Tage lang existierte ich nicht mehr. Dann brach Ma in der Küche zusammen, und ich musste irgendwie zurückkommen. Irgendwie versuchen, unsere Familie zu retten.
Ma blieb fast eine Woche im Krankenhaus. Ich besuchte sie fast jeden Tag nach der Schule, doch sie starrte immer nur aus dem Fenster. Ohne die Hilfe von Oma und Opa hätten wir in diesen Tagen nicht einmal ein warmes Abendessen bekommen.
Ich weiß nicht, wie wir weitermachten. Vermutlich so wie all die anderen Menschen, die einen so großen Verlust erlitten haben. Irgendwie. Schritt für Schritt.
Jetzt reiß dich mal zusammen, Luke, ermahne ich mich selbst. Hör auf, dich selbst so runterzuziehen. Morgen Nachmittag bist du in Kanada, du wirst dort studieren und deinen Cousin und deine Cousine treffen. Du wirst auf Partys gehen und Spaß haben, und darauf solltest du dich verdammt noch mal freuen! Ja, ist ja schon gut.
Als die letzten Töne des Liedes erklingen, lächle ich vorsichtig. Ich ziehe mir die Kopfhörer von den Ohren und lege sie neben mich auf den Nachttisch. Dann drehe ich mich zur Wand und schließe die Augen.
Schlaf ein, Luke. Schlaf ein.
Durch das geöffnete Fenster dringt die abgekühlte Sommerluft und kitzelt meine Wangen. Morgen früh werde ich nach Kanada fliegen. Ich kontrolliere meine Atmung. Sinke tiefer in die Matratze, doch der Schlaf kommt auch jetzt nicht.
Es passiert wirklich, ich werde nach Vancouver fliegen. Angst und Vorfreude rasen prickelnd durch meinen Körper.
Dieses Gefühl hält mich die ganze Nacht über wach.
Und du meldest dich, sobald du gut angekommen bist?« Ma steht vor mir im Hausflur, in der einen Hand meinen Seesack, an die andere klammert sich Lou. Ich blicke nach unten auf meine zerschlissenen Sneaker und die weißen Beine, die viel zu wenig Sonnenlicht abbekommen haben. Ich frage mich, ob es eine gute Idee war, die kurze Hose anzuziehen. Im Flugzeug werde ich sicher frieren.
»Ja, mach ich«, meine Stimme klingt seltsam brüchig, und ich räuspere mich. »Ich melde mich, sobald ich in Vancouver gelandet bin. Mach dir keine Sorgen.«
»Spar dir das. Seiner Mutter zu sagen, sie solle sich keine Sorgen machen, funktioniert nicht.«
Ich lächle leicht, und sie lächelt zurück.
»Du schickst doch diese geile Schokolade, die es nur in Amerika gibt, oder?«, Paul sieht mich flehentlich an.
»Natürlich. Wenn du auch kanadische Schokolade akzeptierst.«
Paul zuckt mit den Schultern. »Solang sie gut schmeckt.«
»Ich versteh immer noch nicht, wieso er geht«, Lou sieht zwischen Ma und mir hin und her.
»Dein Bruder hat sein Abitur und möchte endlich einmal etwas von der weiten Welt sehen.«
»Aber wieso nimmt er uns nicht mit?« Sie macht sich los und läuft zu mir. »Wieso kann ich nicht mitkommen?« Sie beißt sich weinerlich auf die Lippe, und ich schlucke. Dann knie ich mich auf den Boden, um auf Augenhöhe mit ihr sprechen zu können.
»Weil du dich um das kleine Fohlen kümmern musst, verstehst du? Ohne dich hätte es sicher schreckliche Angst alleine in deinem Zimmer.«
Ich sehe ihr fest in die Augen. Sie schaut zurück zu Ma, dann wandert ihr Blick zu Paul, der ihr die Zunge rausstreckt, und schließlich zu Sascha, der im Türrahmen lehnt und auf seinem Handy herumtippt. Mit ihm habe ich schon geredet. Jetzt, wenn ich weg bin, muss er sich um sie kümmern. Er wird sechzehn, kann also arbeiten und ein bisschen nebenher verdienen. Ma hat mir verboten, weiterhin Geld zu schicken. Sie meint, ich soll das, was ich in Kanada verdiene, für mich ausgeben. Aber ich weiß schon jetzt, dass ich mich nicht daran halten werde. Und ich denke, sie weiß das auch.
»Los, ab mit euch jetzt, ihr müsst zur Schule.« Ich blicke zu Paul, der Lous Ranzen schon in der Hand hält. »Euer Bus kommt in zehn Minuten, verpasst ihn nicht wieder, ja?« Paul wirft mir einen unsicheren Blick zu, überwindet sich dann und schlingt seine Arme um mich. Seine Umarmung fühlt sich fester an als sonst. Vielleicht hätte ich auch mit ihm reden sollen. Aber er ist erst dreizehn. Er sollte sich um all das noch keine Sorgen machen müssen. Lou weint mittlerweile und wischt sich immer wieder mit ihrer Stoffjacke übers Gesicht.
»Ich will nicht, dass du gehst«, schnieft sie schließlich, und ich muss mich stark zusammenreißen, nicht auch loszuheulen.
»Ich komme ganz bald wieder, Mücke«, meine ich dann und nehme sie schließlich in den Arm. Dann vollführe ich unser tägliches Ritual. Ich schiebe meine Arme unter die ihren, hebe sie in die Luft und wirble sie einmal um mich herum. Ich sehe, wie sie die Arme ausbreitet und aus dem Schniefen ein erfreutes Quieken wird.
Als ich sie schließlich auf dem Boden absetze, sehe ich den traurigen Blick meiner Mutter. Paul nimmt Lou bei der Hand und verschwindet mit ihr aus der Tür. Sascha knetet unbeholfen die Hände und tritt dann doch zu mir. Er umarmt mich schnell und unsicher, dann zieht er sich wieder zurück.
»Ciao, Mann«, sagt er und winkt, als er schon fast auf der Straße ist.
Als die Tür ins Schloss fällt, legt sich Stille über die Wohnung. Nur das Ticken der Küchenuhr und das leise Poltern der Waschmaschine sind zu hören.
»Sie werden dich alle sehr vermissen …«, bricht Ma schließlich das Schweigen.
»Ich sie auch«, murmle ich und spiele unsicher an meiner Uhr herum.
»Du wirst mir auch fehlen, weißt du?«, ihre Stimme klingt gefasst, aber ich weiß, dass sie sich nur so lange zusammenreißt, wie ich hier vor ihr stehe. Sobald ich gehe, wird sie zusammenbrechen.
»Pass auf sie auf, okay? Sascha soll beim Getränkemarkt jobben, da verdient er ganz gut und kann gleichzeitig seine Muskeln trainieren, ohne ein teures Fitnessstudio zu bezahlen.« Einer ihrer Mundwinkel hebt sich leicht. »Paul kann gut auf Lou aufpassen, aber nicht die ganze Zeit. Du musst auch für sie da sein, verstehst du?«
»Ich weiß.«
»Du kannst nicht nach Hause kommen und müde ins Bett fallen. Sie braucht dich.«
»Schatz, ich weiß. Ich habe mit Michael gesprochen, er hat meine Stunden schon gekürzt. Ab nächster Woche arbeite ich nur noch halbtags.« Das hat sie mir schon vor einem Monat erzählt. Ich hoffe wirklich, ihr Chef hält sich an die Vereinbarung. Sollte er das nicht, will Opa einspringen und den Lousitter spielen. Ich habe alles genau mit ihm besprochen. Wüsste ich nicht, dass er innerhalb von fünf Minuten zur Stelle ist, würde ich nicht gehen. Das könnte ich einfach nicht.
»Du schreibst mir?«
»So oft ich kann.«
Und dann tritt sie vor und schließt mich in ihre Arme. Ich atme ihr Shampoo ein und erlaube mir, mich drei Sekunden fallen zu lassen. Ich will diese Reise. Ich wollte noch nie etwas so sehr. Doch ich lasse meine Familie zurück. Meine Geschwister, für die ich die letzten acht Jahre verantwortlich war. Ich lasse meine Mutter zurück, die schon zu oft überfordert zusammengebrochen ist. Die Schuldgefühle sorgen dafür, dass ich kaum atmen kann.
Aber wenn ich jetzt nicht gehe, werde ich das ewig bereuen. Ich bin bereits am Campus eingeschrieben, habe alle Studienkosten und den Hinflug bezahlt. Und mein Onkel und seine Frau verlassen sich auf mich. Immerhin möchten sie, dass jemand ihrer Tochter Deutsch beibringt. Wenn ich nicht gehe, werden sie nach einem richtigen Au-pair suchen. Dann brauchen sie mich nicht mehr.
Ma lässt mich los, schiebt mich dann eine Armlänge von sich fort und betrachtet mich. »Du hast so viel von ihm, weißt du?«
Ich scharre mit den Füßen auf dem Boden und wende den Blick ab. Weiß nicht, was ich darauf erwidern soll. Wortlos reicht sie mir meinen Seesack. Ich schultere ihn, nehme den Koffer in die andere Hand und öffne die Tür.
»Bis bald, Ma.«
Ich sehe sie wieder an. Ihre Augen wirken jetzt wie kleine, graue Seen. Ich weiß, dass sie mich zum Flughafen gebracht hätte, aber ihre Schicht beginnt gleich. Ich will nicht, dass sie wegen mir zu spät kommt. »Er wäre stolz auf dich, wenn er dich so sehen könnte. Er hat sich immer gewünscht, dass du seine Heimat kennenlernst.«
Was soll man darauf erwidern? Ich sehe sie nur an, hebe dann die Hand zum Abschied und trete hinaus.
Als sich die Holztür hinter mir schließt, atme ich langsam aus und richte meinen Blick auf die Straße vor mir. Es riecht nach warmem Regen und Abgasen. So frühmorgens ist es hier in der kleinen Seitenstraße noch ruhig. Herr Breuer von nebenan gießt die Tomatenpflanzen in seinem kleinen Vorgarten, und Frau Shiraz lässt sich von ihrem Hund förmlich aus der Tür ziehen. Ich muss lachen, als ich sehe, wie sehr Lotta sich auf die Gassirunde freut.
Ich sehe die Straße hinab, versuche, mir das Bild einzuprägen, das ich einen Großteil meines Lebens täglich gesehen habe, wenn ich aus der Tür getreten bin. Ein Haus reiht sich an das nächste. Die Vorgärten sind klein und teilweise verwildert. Früher haben wir mit den Nachbarskindern auf der Straße mit Kreide gemalt und sind mit unseren Rollern über den rissigen Asphalt gebrettert. Heute sind die meisten weggezogen, zum Studieren in die Stadt oder in ein schöneres Viertel.
Ich schüttle den Kopf, um die Traurigkeit zu vertreiben, die sich in mir auszubreiten droht, und sehe dann auf meine Uhr.
Der Bus zum Flughafen geht in vier Minuten, ich muss mich beeilen. Also schiebe ich den Koffer über den nassen Asphalt und zwinge mich, nicht noch einmal zurückzublicken.
Fünfzehn Stunden später rollt das Flugzeug auf die kanadische Landebahn. Meine Beine fühlen sich taub an, und ich habe das dringende Bedürfnis, meine Zähne zu putzen und am besten direkt unter eine kalte Dusche zu springen.
Ich fühle mich heiß und kribblig, will endlich raus aus diesem Flugzeug. Gleichzeitig würde ich am liebsten sitzen bleiben und direkt wieder zurück nach Hause fliegen. Ich weiß nicht, ob es die Aufregung ist oder doch eher Angst, aber etwas schlägt mir schwer auf den Magen, und ich trinke schnell noch einen großen Schluck Wasser, während sich die restlichen Reisenden neben mir bereits erheben und nach ihrem Gepäck greifen.
Kurze Zeit später trete ich aus der Flugzeugtür. Ich freue mich, der abgestandenen Luft in der Kabine zu entkommen – das erste Mal kanadische Luft. Sie ist angenehm warm. Wow, ich bin tatsächlich hier.
Als der Passagier hinter mir unsanft seinen Koffer gegen meine Beine schlägt, beeile ich mich, die Metalltreppe nach unten zu laufen.
Ich hole meinen Koffer vom Gepäckband und führe eine kurze Katzenwäsche auf der Flughafentoilette durch. Schließlich will ich meiner Gastfamilie nicht als stinkender Iltis gegenübertreten.
Die Rollen des Koffers schlingern über den polierten Boden, während ich versuche, mich zu orientieren. Wieso gibt es hier nur so viele Schilder? Und wieso ist es überall so hell? Ich blinzle nach oben zu der Anzeigetafel, kann jedoch bei all dem Geblinke kaum etwas erkennen.
Also gehe ich meiner bewährten Strategie nach: einfach den anderen Reisenden folgen.
Nach weiteren fünf Minuten und einer Passkontrolle gelange ich endlich in die Empfangshalle. Dort, zwischen vielen anderen Menschen, stehen Meredith, John und Ava und halten ein Schild mit meinem Namen in die Höhe. Sie haben Lukas darauf geschrieben. Dahinter ist eine krakelige Deutschlandflagge gemalt. Bestimmt von Ava. Alle drei strahlen mir entgegen. Langsam laufe ich auf sie zu und versuche dabei, nicht über meinen Koffer zu stolpern. So frühmorgens sind meine Koordinationsfähigkeiten noch nicht die besten. Wobei, halt. Wir haben nicht Morgen, es ist gleich zwei Uhr mittags! Herzlich willkommen, Jetlag.
Als ich schließlich vor ihnen stehe, versuche ich, mir meine Müdigkeit nicht anmerken zu lassen, und überlege fieberhaft, wie ich sie begrüßen kann. »Hey«, sage ich schließlich und bin mir unsicher, wen ich dabei ansehen soll.
»Hallo, Lukas, es ist so schön, dich endlich wiederzusehen und nicht nur Whatsapp-Bilder von deiner Mutter geschickt zu bekommen!« Meredith tritt an meinem Koffer vorbei und zieht mich in eine enge Umarmung. In Gedanken übersetze ich noch, was sie gerade zu mir gesagt hat. Mein Englisch ist gut, immerhin hat mein Vater dafür gesorgt, dass wir zweisprachig aufwachsen, aber ich bin zu aufgeregt, um klar denken zu können. Vermutlich verhasple ich mich, sobald ich den ersten richtigen Satz spreche.
Ich fühle mich unwohl in Merediths Armen, weil ich trotz Katzenwäsche sicher nicht nach Rosen dufte und dringend meine Haare waschen sollte.
Kaum hat Meredith mich losgelassen, springt Ava auf mich zu wie ein kleiner, quirliger Flummi.
Sie reicht mir nur bis zum Ellbogen und streckt mir die Hand entgegen. »Hallo, Cousin. Coole Socken.« Sie zeigt auf mein blau-weiß geringeltes Paar. Ich hebe eine Augenbraue und versuche, mir meine Verwirrung nicht zu deutlich anmerken zu lassen.
»Ava liebt Socken. Sie hat wahrscheinlich mehr als der Rest der Familie zusammen«, meldet sich schließlich John zu Wort. Seine Stimme ist ruhig und warm, und ich zucke zusammen, als er mich an der Schulter berührt. »Schön, dich hier bei uns zu haben.« Er sieht mich durchdringend an. Ich weiß, was er gerade denkt. Denn ich denke dasselbe: Er sieht Papa noch viel ähnlicher, als ich dachte. Doch schlimmer ist seine Stimme. Ich habe meinen Vater seit acht Jahren nicht mehr sprechen gehört, und doch weiß ich, dass er fast genauso klang. Ich erschaudere.
Johns Augen finden meine. Braun, nicht blau. Gut, wenigstens ein wesentlicher Unterschied. Mir fällt auf, dass ich immer noch nichts gesagt habe, deswegen räuspere ich mich schnell: »Hallo, Onkel John, schön dich wiederzusehen.«
»O nein, Lukas. Du musst nicht so förmlich sein. Wir sind doch Familie.« Meredith tritt zu uns und hakt sich bei ihrem Mann unter. »Alex lässt sich übrigens entschuldigen. Er ist … krank.«
»Oh, das ist …«
»Seine typische Teenagerkrankheit. Er steht am Wochenende nicht vor zwei auf. Ich habe ihm gesagt, dass er für dich eine Ausnahme machen soll, aber du weißt sicher noch, wie störrisch du in diesem Alter warst.« Ich muss grinsen. O ja, das weiß ich.
»Also dann, wollen wir?« Meredith zieht John schon mit sich. Erleichtert, dass diese erste Begegnung so gut verlaufen ist, greife ich nach meinem Koffer und folge Meredith, John und Ava, die bereits den Ausgang ansteuern. Wir treten durch die Tür, und sonnige Wärme umfängt mich.
Hallo, neue Heimat für die nächsten acht Monate.
Im Auto ist es dank Klimaanlage so kalt, dass ich mir am liebsten einen warmen Pulli überziehen würde.
Ich starre ununterbrochen aus dem Fenster und versuche, jedes kleine Detail dieser Stadt aufzunehmen und dabei an etwas Warmes zu denken. Eine Wüste vielleicht. Es ist überwältigend. Ich bin große Gebäude gewöhnt, die gibt es in Frankfurt schließlich auch, aber das ist kein Vergleich zu Vancouver. Auf den Straßen quetschen sich riesige Jeeps und gelbe Taxis aneinander. Es sind nicht die typischen gelben New Yorker Taxis. Diese hier sind rundlicher und höher, irgendwie gemütlicher. Außerdem verpassen sie der grauen Umgebung einen tollen Farbtupfer.
Als wir auf eine Brücke mit meterhohen Metallstreben fahren, wird der Verkehr zäher, und wir kommen nur noch stockend voran.
Meredith holt eine große Bäckereitüte hervor, in der sich Bagel und Croissants befinden. Mein Magen rumort bei diesem Anblick, und sie grinst nur.
»Wir wollten es dir nicht zumuten, direkt nach der Ankunft irgendwo essen zu gehen, aber bevor du uns verhungerst, habe ich lieber mal etwas vorbereitet.«
Sie nimmt sich einen Bagel, bricht ihn in zwei Hälften, reicht John die eine und gibt dann die Tüte nach hinten durch. Der Geruch der frischen Croissants breitet sich im Wagen aus und lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal etwas gegessen habe, aber mein Magen schreit förmlich nach Kohlenhydraten.
»Willst du auch was?«, frage ich Ava noch und warte, bis sie sich einen Bagel genommen hat, dann beiße ich in das knusprige Croissant und kann mir ein seliges Stöhnen gerade so verkneifen. Eventuell war ich ein klein wenig ausgehungert.
Kauend schaue ich wieder aus dem Fenster. Das Wasser unter der Brücke blendet mich. Die Sonnenstrahlen lassen es in den unterschiedlichsten Farben glitzern. Langsam nimmt der Verkehr wieder Fahrt auf, und zehn Minuten später fahren wir wieder von der Brücke.
Ich komme gar nicht hinterher, alles zu fotografieren. Die besten Fotos schicke ich direkt Charlie und meiner Ma. Beiden habe ich Nachrichten geschrieben, dass ich gut angekommen bin und mich später melden werde. Charlies Handy ist noch aus, sie schläft natürlich noch. Meine Mutter hingegen hat direkt geantwortet. Wahrscheinlich saß sie die ganze Zeit nervös vor ihrem Handy.
Ava erzählt mir von ihrem besten Freund Tori, mit dem sie vor den Sommerferien in Werken ein eigenes kleines Baumhaus gebaut hat.
»Das ist mein absolutes Lieblingsfach! Der Lehrer ist so toll, und wir dürfen sogar Materialien vom Schulhof benutzen. Tori hat ein verlassenes Vogelnest auf der Wiese gefunden, und das ist jetzt unser Dach. Das musst du dir unbedingt mal anschauen. Wir kriegen sicher eine Eins.«
»Das klingt wirklich toll. So ein Fach hatte ich leider nie in der Schule.«
»Was war denn dein Lieblingsfach?«, fragt Ava direkt hinterher.
»Hmm, das ist schwer. Früher mochte ich Kunst sehr gerne, da durften wir sogar Musik hören.« Ava formt ein lautloses »Ohhh« mit dem Mund. »Aber eigentlich war mein Lieblingsfach Deutsch. Und der Theaterkurs natürlich. Da haben wir jedes Jahr richtig tolle Stücke aufgeführt.«
»Also bist du Schauspieler?«, fragt Ava begeistert, und ich muss grinsen, als ich sehe, wie ihre Wangen leicht rosig werden und sie aufgeregt auf dem Sitz hin und her wippt. Sie erinnert mich an Lou, obwohl sie zwei Jahre älter und um einiges gesprächiger ist.
»Nein, das noch nicht. Aber in der Zehnten war ich die Zweitbesetzung für den Romeo.« Ich erwähne nicht, dass ich sehr viel lieber Julia gespielt hätte, um meinen heißen Mitschüler küssen zu können, der Romeo spielte. Kurz projiziert mein Kopf mir das Bild von Chris auf die Netzhaut, und ich zwinge mich, nicht zu sehr an seine blonden Haare und den Schwung seiner Lippen zu denken. Damit habe ich schon viel zu viele Schulstunden verbracht.
»Also, ich mag lieber Musicals. Ich will unbedingt mal die Eiskönigin spielen. Mama kann mir dann ein Kostüm nähen. Oder Alex, der kann das auch sehr gut, auch wenn er oft böse zu mir ist.« Die letzten Sätze hat sie nur noch geflüstert, und ich muss grinsen. »Das klingt doch nach einem tollen Plan. Vielleicht darf ich ja auch eine Rolle in deinem Stück spielen?« Ava denkt lange darüber nach, bis sie mir schließlich ihren Entschluss mitteilt: »Aber nur eine kleine!«
Nach einiger Zeit werden die Straßen schmaler, die Häuser niedriger und dafür die Vorgärten grüner.
Meredith lehnt sich zu uns nach hinten. »Gleich sind wir da. Ich bin gespannt, was du zu unserem Haus sagst!«
»Ich zeig dir dein Zimmer!« Avas Wangen glühen vor Vorfreude.
John fährt eine Auffahrt hinauf, und ich erkenne links und rechts Grünflächen mit runden Büschen, einen wunderschönen Ahornbaum mit hellroten Blättern und mehrere angelegte Blumenbeete. Man sieht sofort, dass hier ein Gärtner am Werk war.
John hält vor dem Garagentor in der Einfahrt und zieht den Zündschlüssel. Aus dem Autofenster erkenne ich die helle Fassade des Hauses vor mir. Es ist bestimmt doppelt so groß wie unser Haus in Deutschland. Johns Firma für Landschaftsbau scheint gut zu laufen, und auch Merediths Ärztinnengehalt erkennt man in der teuren Außengestaltung und den riesigen Fensterfronten.
Es fühlt sich seltsam an, dass dieses Haus in den nächsten Monaten mein Zuhause sein soll.
»So, da wären wir«, meint John, und ehe ich es wirklich realisieren kann, hat Ava sich abgeschnallt und zieht mich an ihrer Hand aus dem Auto.
Ava ist für ihre neun Jahre ziemlich schnell. Sie rast durch die Wohnung wie ein Düsenjet. Weil ich versuche, ihr so gut es geht zu folgen, nehme ich kaum die Zimmer um mich herum wahr. Ich erkenne hellgrau gestrichene Wände, Holzfußboden, einen Kamin mit aufgeschichteten Holzscheiten, hellbeige Sofas und eine riesige Kücheninsel, die sich hinter dem großen Wohnzimmer erstreckt. Die Wohnung sieht aus, als wäre sie aus einem Pinterest-Einrichtungsfeed. Nur wärmer. Und mit mehr Bildern. Keine Fotos, sondern wirklich gemalte Bilder.
Ava berichtet mir stolz, dass Meredith die gemalt hat. »Hierfür hat sie sogar einen Preis gewonnen«, meint sie und deutet auf ein Bild direkt über dem Kamin. Auf weißem Untergrund sehen mir vier Augenpaare entgegen, die untereinander auf die Leinwand gemalt wurden.
Braun, grün-grau, grün und wieder braun. »Das sind meine!«, ruft sie stolz, zeigt auf das unterste Paar und eilt dann direkt weiter.
Doch ich bleibe noch kurz stehen. Meredith hat nicht nur die Augenpaare ihrer Familie perfekt eingefangen, sondern jedem Paar auch einen eigenen Charakter verliehen. Ihre und Avas haben diesen freudigen, spritzigen Glanz. Beide haben hellgraue Sprenkel in der Iris, die zu leuchten scheinen. Johns Augen sind dunkelbraun, doch ein Hauch Orange liegt in dem Rand um die Iris, so als würde ein warmes Kaminfeuer um sie herumzüngeln. Seine Augen sind kleiner und weniger weit geöffnet, doch die Lachfältchen sorgen dafür, dass man direkt mitlächeln muss, wenn man das Bild betrachtet. Alex’ Augen hingegen schimmern in einem dunklen, traurigen Grün. Seine Wimpern sind hell, aber lang, und er hat vereinzelte Sommersprossen, die sich um die Augen sammeln, wie kleine Farbspritzer. Unter dem Bild steht einfach nur Family, und ich schlucke schwer, als ich mir vorstelle, dass so ein Bild auch bei uns zu Hause hängen könnte. Nur, dass ein Augenpaar davon schon lange nicht mehr sehen kann.
»Wo bleibst du denn, ich muss dir mein Zimmer zeigen!« Ava zieht an meiner Hand, und ich bin dankbar, den Gedanken im Erdgeschoss zurücklassen zu können.
Wir laufen die helle Holztreppe nach oben, und Ava zeigt kurz auf zwei Türen. »Das da ist das Kinderbad, das ist für mich, Alex und dich. Und das da ist Alex’ Zimmer, aber geh nicht rein, wenn er da ist. Das hasst er.« Sie verdreht die Augen und zieht mich dann weiter. »Das da ist mein Zimmer!« Sie öffnet schwungvoll die Tür, und ich befinde mich in einem Dschungel. Oder zumindest in einem Gewächshaus. Bis auf eine hellbraune Wand sind alle grün. Die Wand zu meiner Linken ist mit wunderschönen und sehr echt aussehenden Palmen bemalt, die bis kurz unter die Decke reichen. Der Boden ist aus dunklem Holz, doch ich bin fast verwundert, als ich spüre, wie fest er ist. Für einen kurzen Moment hatte ich wirklich mit weicher Erde gerechnet.
Ava ist schon weiter in den Raum hineingelaufen und präsentiert mir nun ihr Hochbett. »Tori, Mum und ich haben das gemacht.« Mit »das« meint sie wohl die vielen grünen Schlingpflanzen, die sich um die Leitersprossen des Hochbettes ranken. Das helle Holz kann man darunter fast gar nicht mehr ausmachen. »Sie sind aber nicht echt. Mama meint, dass so viele Pflanzen mir meinen Sauerstoff wegatmen würden.« Sie geht weiter in den Raum hinein. »Jedenfalls glauben immer alle, dass sie echt sind. Ist das nicht cool? Ich habe meinen eigenen Wald.«
Ich grinse sie an und recke meinen Daumen in die Höhe. »Wirklich beeindruckend.«
»Ah, hier seid ihr.« John steht hinter mir im Türrahmen, meinen Koffer hat er hinter sich hergezogen. »Dachte, den könntest du gebrauchen.«
»Danke.«
»Hast du Lukas schon sein Zimmer gezeigt, Kleines?«
»Ich bin nicht klein! Und ich will ihm erst noch mein Nest zeigen.« Sie stützt die Hände in die Seiten und reckt den Kopf nach oben. Ich kann nicht umhin, ihre Selbstsicherheit zu bewundern. Auch wenn sie ihrem Vater nur knapp bis zum Bauchnabel reicht.
»Das kannst du auch nachher noch machen. Lukas hat eine lange Reise hinter sich. Er will sich sicher etwas ausruhen.« Dankbar sehe ich John an. Gerade würde ich alles dafür geben, frisch geduscht ins Bett zu fallen und die nächsten vierundzwanzig Stunden zu schlafen. Vermutlich sieht man mir diesen Gedanken an, denn Ava gibt nach.
»Na gut …«, grummelt sie und läuft an uns vorbei.
»Das ist deins. Direkt neben meinem.« Sie deutet auf die letzte Tür im Gang, und prickelnde Vorfreude schießt durch meinen Körper. Gleich werde ich das Zimmer sehen, in dem ich die nächsten acht Monate wohnen werde.
John stellt meinen Koffer neben mir ab und entschuldigt sich dann, dass er eben einen neuen Auftrag in der Arbeit reinbekommen habe und leider schnell noch einmal ins Büro müsse.
»Habt einen schönen Tag ihr beiden. Wir sehen uns beim Abendessen.« Und dann verschwindet er.
Ava schiebt mich zur Tür. »Los, geh schon rein!«
Mein Zimmer ist etwas kleiner als Avas. Der Boden ist genauso hell wie das Holz im Flur, und die Wände sind weiß gestrichen. Nur eine ist hellgrau. Das Bett – mein Bett – ist schön breit und mit einer blauen Bettdecke mit weißen Punkten bezogen. Sie sieht so wunderbar weich aus, dass ich einfach auf sie zugehen muss und darüberstreiche.
»Gefällt’s dir?«, fragt Ava aufgeregt. Ich sehe zu ihr und lasse meinen Blick dann weiter durch den Raum streifen. Ein Kleiderschrank mit Spiegeltüren, ein Schreibtisch, der direkt vor dem Fenster steht, und ein kleiner Nachttisch. Es ist nicht so pompös wie der Rest des Hauses. Aber genau das gefällt mir.
»Es ist wundervoll.«
Ava strahlt. »Die Bettwäsche hab ich ausgesucht. Ich dachte, Blau magst du.« Sie sieht mich unsicher an, so als wäre meine nächste Antwort ausschlaggebend dafür, ob ich hierbleibe oder direkt wieder ausziehe.
»Ich mag sie«, sage ich schnell und setze mich aufs Bett, um meine Worte zu unterstreichen.
Ava jauchzt auf und lässt sich ebenfalls auf das Bett fallen. Die Matratze sinkt leicht ein, aber nicht zu viel. Hier werde ich gut schlafen können.
Über dem Kopfende ist ein kleines Regal angebracht, das mich auf eine Idee bringt. Schnell stehe ich wieder auf und ziehe meinen Koffer hinter mir her ins Zimmer. Ava sitzt immer noch auf dem Bett und beobachtet mich interessiert.
Ich öffne den Koffer und schmeiße so lange Klamotten und Krimskrams heraus, bis ich schließlich an die Tasche ganz unten komme. Meine Lieblingsbücher haben die Reise zum Glück gut überstanden, lediglich eins ist ein bisschen eingedellt. Ich hole sie heraus, stelle mich vorsichtig aufs Bett und drapiere sie nebeneinander auf dem Holzbrett. Harry Potter, Band eins, eher aus nostalgischen Gründen, und Band drei, weil es der beste ist. Dann Call Me By Your Name, weil ich Elio und Oliver nicht zu Hause lassen konnte, genauso wie Simon aus Nur drei Worte und Aristoteles und Dante. Das Blau der beiden letzten Bücher passt perfekt zu der Bettwäsche, und ich begutachte mein Werk zufrieden.
»Harry Potter kenne ich, worum geht’s in den anderen?« Ava hat sich neben mich gestellt, ohne dass ich es bemerkt habe.
»Das hier«, sage ich und deute auf den Einband von Nur drei Worte, »heißt hier bei euch Love, Simon.«
»Cool, wir haben den Film im Kino gesehen. Es war toll, ich hab meine eigene Popcorntüte bekommen.« Sie lächelt, offenbar in Erinnerungen schwelgend.
Ich frage mich, ob das der richtige Moment ist, mich bei ihr zu outen. Ihre Eltern wissen es natürlich schon. Ma meinte, so etwas sollte man vorher schon ansprechen, wenn man längere Zeit bei Leuten lebt. Und vermutlich hatte sie recht. Trotzdem finde ich es immer noch blöd, meine sexuelle Orientierung zu nennen, so als wäre es ein Charaktermerkmal.
»Ähm, Ava? Wie fandest du es denn, dass Simon sich in einen Jungen verliebt hat?«
Ava sieht mich fragend von unten an. »Wie soll ich das finden?«
Darauf habe ich erst mal keine richtige Antwort. Aber Ava redet auch schon weiter. »Ich fand es okay. Aber sie hätten sich echt nicht küssen müssen. Das machen Mum und Dad auch immer, und das ist peinlich.« Ich grinse. Dann haut ihre nächste Frage mich um. »Hast du denn schon mal einen Jungen geküsst?«
Und ich antworte, ohne lange zu überlegen: »Ja, sogar schon mehrere.«
»Und wie war das so?«, fragt sie direkt vollauf interessiert. Scheinbar hat sie vergessen, dass sie Küsse eigentlich peinlich findet.
»Immer unterschiedlich. Mal schön, mal lustig, mal traurig.«
»Das klingt aufregend. Weißt du, ich würde Tori ja nie küssen, aber Sarah, meine andere beste Freundin, meint dauernd, dass er mich küssen will. Ist es komisch, wenn ich das nicht will?«
Mittlerweile sitzen wir nebeneinander auf dem Bett, und ich kann es nicht fassen, dass ich an meinem ersten Tag hier solch ein Gespräch führe. »Nein, das ist überhaupt nicht komisch. Du solltest nur die Menschen küssen, die du auch küssen möchtest.«
»Das macht Sinn.« Und mit diesen Worten springt sie auf und läuft zum Fenster.
»Tori lebt in dem Haus dort. Wir wohnen fast nebeneinander.«
Ich folge Ava zum Fenster und schaue ebenfalls auf die Straße. Mit ihrem kleinen Zeigefinger deutet sie den Gehsteig hinunter auf die andere Seite. Ich sehe einen Jungen im Garten mit seinem Vater Baseball spielen. Sie lachen und scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Bei mir sorgen solche Szenen immer nur dafür, dass sich mein Magen zusammenzieht. Ich bin nicht eifersüchtig, doch trotzdem beneide ich diesen Jungen. Ob Papa früher auch Baseball im Garten gespielt hat?
»Oh, und das da ist Jack. Ich mag ihn nicht, aber Mum sagt, dass ich nett zu ihm sein soll. Er hat mit seinem Motorrad unsere Schneckenfarm platt gefahren. Mum sagt, dass er das nicht gesehen hat, aber wer übersieht denn Schnecken?« Ava dreht sich demonstrativ weg vom Fenster, doch ich beobachte den Typen, der mit seinem aufgemotzten Motorrad gerade die Einfahrt des Hauses gegenüber von uns hochfährt. Durch eine Musikbox an seinem Gürtel dröhnt laute Technomusik bis durch mein Fenster. Nicht die Art von Musik, die in meinen Playlists landen würde.
Er stellt das Motorrad direkt neben einem silbernen Jeep ab und zieht sich den Helm vom Kopf.
Braune, lockige Haare, durchtrainierter Körper. Na wunderbar. Der Typ – Jack – hängt den Helm an den Lenker, streckt sich und zieht dann die Motorradjacke aus. Darunter trägt er nur ein weißes Shirt, das ihm am Körper klebt, dort, wo er unter der Jacke geschwitzt hat. Ich ahne das Schlimmste und will mich gerade wegdrehen, da zieht er sich das Shirt einfach über den Kopf und fächelt sich damit Luft zu. Schnell trete ich einen Schritt vom Fenster zurück und fixiere einen weißen Punkt auf der Bettwäsche. Verdammte Scheiße, der Typ sieht aus wie ein Hollister-Model.
»Jaa, er scheint wirklich schrecklich zu sein.«
»Sag ich ja!« Und mit diesen Worten verschwindet Ava aus meinem Zimmer, und ich bin allein. Versuche, meinen Puls zu kontrollieren, und traue mich kaum, noch einmal aus dem Fenster zu sehen. Natürlich reicht meine Selbstbeherrschung dafür nicht aus. Doch die Einfahrt ist leer. Jack muss im Haus verschwunden sein. Nur der Helm hängt noch am Lenker und schwingt leicht im Sommerwind.
Ich laufe zur Tür und schließe sie. Dann lasse ich mich aufs Bett fallen und starre an die Decke. Was war das gerade? Natürlich war mir klar, dass ich hier in Kanada auf andere männliche Wesen treffen würde. Möglicherweise auch recht gut aussehende. Aber das … Nur mir kann es passieren, direkt gegenüber von Charles Meltons jüngerem Bruder zu wohnen! In Gedanken verfasse ich schon eine Nachricht an Charlie, bis mir klar wird, was ich ihr und mir versprochen habe: Verliebe dich ja nicht in einen Kanadier! Und direkt ploppt die imaginäre Liste auf, die ich mir exakt für solch einen Fall angelegt habe.
In acht Monaten geht es zurück nach Frankfurt, und ich bin definitiv kein Typ für Fernbeziehungen. Das hat das Desaster in der Zehnten gezeigt, als ich drei Monate mit einem Typen aus dem Frankreichurlaub geschrieben habe und er ständig Telefonsex wollte! Im Ernst, einmal hat er bei mir zu Hause angerufen, und Paul ist drangegangen. Danach war er tagelang verstört.
Ich habe hier wirklich genug andere Aufgaben: das Studium, der Deutschunterricht mit Ava, die Hausarbeiten, die ich Meredith und John abnehmen will, und Freundschaften sollte ich vielleicht auch knüpfen.
Ich habe es endlich geschafft, Chris aus meinem Kopf zu verbannen, und das, obwohl er auf der Abiparty unter Alkoholeinfluss ziemlich offensichtlich mit mir geflirtet hat! Ich habe ihm widerstanden und bin endlich frei, das will ich genießen.
Ich habe es Charlie versprochen. Sie hatte die ganze Zeit Angst, dass ich mich in Kanada verliebe und dann vielleicht nicht zurückkomme. Als ob ich das jemals bringen würde. Meine Familie braucht mich. Aber Charlie hat außer Viky niemanden, also sollte ich mich auch für sie zusammenreißen.
Nein, geheimnisvoller, sexy Nachbar, aus uns wird leider nichts. Mal davon abgesehen, dass du sehr wahrscheinlich sowieso hetero bist. Ich ziehe die Gardine vors Fenster, um ihn auch wirklich aus meinen Gedanken zu verscheuchen, und wende mich stattdessen meinem Koffer zu. Ich muss mich ablenken.
Ich ziehe eine kleine Tüte aus dem Koffer hervor. Darin sind die Fotos, die Charlie mir bei unserem letzten Treffen vor der Abreise in die Hand gedrückt hat, damit ich etwas habe, das mich an zu Hause erinnert.
Da sind wir beide auf dem Abiball. Wir strahlen in die Kamera, während Paul und Sascha im Hintergrund stehen und in ihren schwarzen Anzügen einfach so erwachsen aussehen. Das nächste Bild zeigt sie, Mia und mich, wie wir unter unserem Baum auf dem Schulhof sitzen. Mia und Charlie reden nicht mehr miteinander, seit Charlie sich geoutet hat. Sie waren jahrelang beste Freundinnen. Bis Charlie sich in sie verliebt hat. Ich denke, Mia hat es gemerkt, trotzdem ist das kein Grund, seine beste Freundin einfach so fallen zu lassen. Ich schreibe noch ab und zu mit ihr, aber es ist nicht mehr dasselbe. Das Bild behalte ich trotzdem. Es ist schön, sich an die Schulzeit zu erinnern. Das nächste Bild zeigt Sascha, Paul, Lou und mich vor dem Weihnachtsbaum. Ma zwingt uns jedes Jahr zu diesem Foto, damit sie es allen Verwandten schicken kann. Genauso gezwungen lächeln wir alle auch in die Kamera, während Lous Blick schon ganz begierig auf dem kleinen Stapel Geschenke ruht, der sich im rechten Bildrand befindet. Ich streiche über ihr kleines Gesicht und lege das Bild dann schnell weg. Ich habe mir fest vorgenommen, an meinem ersten Tag hier nicht in Heimweh zu versinken.
Da ich nicht weiß, ob ich etwas an die Wand pinnen darf, stelle ich die Bilder auch erst einmal auf das Regalbrett, das mittlerweile schon recht voll wirkt. Dann sammle ich meine Klamotten vom Fußboden auf. Während ich sie in den Schrank stopfe und ein Katzenhaar von meinem schwarzen Pulli zupfe, fällt mir auf, dass ich in den nächsten Monaten ausnahmsweise einmal nicht mit von Katzenhaaren übersäter Kleidung herumrennen werde. Irgendwie gehören die kleinen weißen Härchen schon zu meinem Outfit mit dazu. Bounty fehlt mir schon jetzt so sehr. Ich habe Paul beauftragt, mir so viele Fotos und Videos von ihr zu schicken wie möglich. Hoffentlich hält er sich daran.
Ich stopfe das letzte T-Shirt zu den anderen Sachen und schaffe es gerade noch so, die Türen zu schließen.
Bügeln wird sowieso überbewertet. Ein paar Falten geben meinen Klamotten erst ihren Charakter.
Die restlichen Sachen wie Kulturbeutel, Collegeblock, Ladegerät und meine Kamera, lege ich auf den Schreibtisch.
Nun ist der Koffer leer, und der Raum um mich herum fühlt sich ein bisschen mehr nach mir an. Auch wenn die Wände immer noch viel zu kahl sind. Vielleicht kann ich mir in der Stadt ja ein Troye-Sivan-Poster besorgen. Zu Hause wache ich jeden Tag auf und sehe zuerst sein Gesicht. Was soll ich sagen: Es gibt schlimmere Anblicke.
Mittlerweile ist es halb vier. Ich lasse mich auf mein neues Bett fallen und sinke wieder in die duftende Bettwäsche. Schlechte Idee. Sobald ich auf diesem wunderbar weichen Stoff liege, übermannt mich die Müdigkeit. Ich denke gerade noch, dass ich ganz vergessen habe, meine Haare zu waschen, da schlafe ich auch schon ein.
Die Stadt unter mir schläft noch. Kaum ein Auto ist auf den Straßen, nur in manchen Häusern brennt Licht. Ich drücke auf den Auslöser und halte den Moment fest. Nebelschwaden hängen in der feuchten Luft. Es ist kurz vor sechs, und Vancouver erwacht vor meinen Augen.
Das erste Licht des Tages wirft Schatten auf die geraden Linien vor mir. Stein auf Stein, Betonklotz auf Betonklotz reihen sich aneinander. Vancouvers Hochhäuser sind eine Baukunst für sich. Manche Menschen beschweren sich über die immer neuen Baupläne, über die nie verschwindenden Kräne, die nie endenden Sanierungsarbeiten. Ich finde sie wunderschön.
Es gibt keinen Stillstand. Nur Verbesserung. Jeden Tag sieht die Stadt ein bisschen anders aus. Was ist schlecht daran?
Sie wandelt sich, bleibt im Kern aber doch die gleiche. Ich wohne seit zweiundzwanzig Jahren in dieser Stadt, genauer gesagt seit meiner Geburt, ich kenne die meisten Straßennamen auswendig und jedes Hochhaus beim Namen. In der Schule haben die anderen nicht verstanden, was so spannend an all den Zahlen und Fakten ist. Es sind eben Gebäude mit vielen Fenstern. Für mich waren sie mehr als das. Das sind sie auch heute noch.
Unter mir leuchtet eine Polizeisirene auf. Ich verfolge sie von der Cambie Street bis zum Queen Elizabeth Park. Dort hält der Wagen an. Ich sehe die Polizeistreife kaum, die aus dem Auto steigenden Uniformierten verlieren schnell mein Interesse.
Hier oben sind sie unwichtig. Was zählt, sind Formen, Linien und Bausubstanz. Ich sitze hier in 138 Metern Höhe auf einem Konstrukt aus Stahlbetonträgern. Westlich von mir schaukelt die Kranspitze leicht im Wind. In gut einer Stunde wird er in Betrieb genommen, dann muss ich von hier verschwunden sein. Aber noch ist es ruhig.
Ich stehe auf und laufe über den Kies, den sie hier oben verteilt haben. Das Dach ist ebenerdig, nur ein hüfthoher Zaun am Rand soll den Kies davon abhalten, in die Tiefe zu stürzen. Dass Menschen hier heraufkommen, damit rechnet dort unten niemand. Ich laufe zur Ostkante und beobachte das Wasser, das sich am Horizont entlangschlängelt. Das Licht der ersten Sonnenstrahlen spiegelt sich darin. In einer Woche werde ich wieder dort unten über den Campus laufen. So wie schon die letzten drei Jahre meines Lebens.
Immer das Gleiche. Immer geordnet. Immer sicher.
Ich kicke mit dem Fuß auf den Boden, wirble dabei ein paar Kiesel auf und lache innerlich bei dem Gedanken, was meine Eltern sagen würden, wenn sie wüssten, wo ich mich gerade befinde. Vielleicht schieße ich genau deswegen noch ein Foto.
Mein Gesicht ist kaum zu erkennen, man sieht nur den lachenden Mund und meinen Hals, dahinter Vancouver im ersten Licht des neuen Tages. Bevor ich das Bild poste, weiß ich, dass es viral gehen wird. Die Leute lieben es, wenn sie ein Stückchen von mir sehen. Seit Monaten rätseln sie, wer sich hinter Vancroofer97 verbirgt. Sie werden es nie erfahren. Ab und zu bekommen sie einen Silhouetten-Shot. Wenn ich dran gedacht habe, das Stativ mitzunehmen. Sonst sehen sie nur meine Beine. Meine Füße auf jedem Hochhaus der Stadt. Meine Schuhe über den Dächern Vancouvers. Und sie lieben es. Ich weiß nicht, wieso.
Ehrlich gesagt war es auch nie mein Plan, das alles zu posten. Vor sechs Jahren habe ich den Account erstellt und einfach das hochgeladen, was ich vor mir sah. Eine Straße, einen kaputten Range Rover, die Nachbarskatze beim Mittagsschlaf. Irgendwann fing ich an, den Himmel zu fotografieren. Weil es das Einzige war, das an manchen Tagen gut aussah. Weil der Himmel wandelbar ist und einem jeden Tag ein neues Gesicht zeigt. Das gefiel den Leuten.