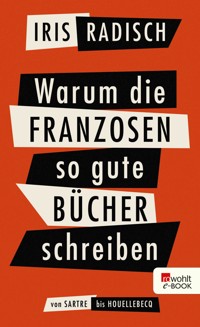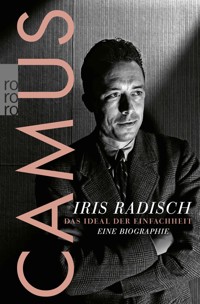
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Unterm Strich – Camus, wie ihn kaum jemand kennt Ein Mann, der zum Mörder wird, weil ihn die Sonne blendet – bis heute ist Der Fremde eine der berühmtesten literarischen Figuren der Welt. Albert Camus, sein Schöpfer, ist der Philosoph des Absurden, in das der Mensch hineingestellt ist, der Denker der Revolte, die den Menschen ausmacht – und immer der Anwalt der Einfachheit, die dem Algerienfranzosen das Grundgegebene unter der Sonne und zugleich das am stärksten Gefährdete war. «Aktueller denn je», lautet der Befund von Iris Radisch, einer der führenden deutschsprachigen Literaturkritikerinnen, die uns aus Anlass seines 100. Geburtstages auf eine faszinierende Reise mitnimmt: von Belcourt, dem ärmlichen Viertel Algiers, in dem Camus mit einer stummen Mutter aufwächst, in das graue Paris, das unter deutscher Besatzung die Moral der jungen Existenzialisten herausfordert. Vom konkurrierenden Großbürger Sartre als «algerischer Gassenjunge» abgetan, ist Camus, der erklärte Antifaschist, Antikommunist und Europäer, selbst ein Fremder – und hellsichtiger als alle. Emphatisch vermittelt uns Iris Radisch diesen von karger mittelmeerischer Landschaft geprägten Mann in allen seinen Lebenskämpfen, als Liebhaber der Frauen und eines Denkens, das sich engagiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Iris Radisch
Camus. Das Ideal der Einfachheit
Das Ideal der Einfachheit
Eine Biographie
Über dieses Buch
Unterm Strich – Camus, wie ihn kaum jemand kennt
Ein Mann, der zum Mörder wird, weil ihn die Sonne blendet – bis heute ist Der Fremde eine der berühmtesten literarischen Figuren der Welt. Albert Camus, sein Schöpfer, ist der Philosoph des Absurden, in das der Mensch hineingestellt ist, der Denker der Revolte, die den Menschen ausmacht – und immer der Anwalt der Einfachheit, die dem Algerienfranzosen das Grundgegebene unter der Sonne und zugleich das am stärksten Gefährdete war.
«Aktueller denn je», lautet der Befund von Iris Radisch, einer der führenden deutschsprachigen Literaturkritikerinnen, die uns aus Anlass seines 100. Geburtstages auf eine faszinierende Reise mitnimmt: von Belcourt, dem ärmlichen Viertel Algiers, in dem Camus mit einer stummen Mutter aufwächst, in das graue Paris, das unter deutscher Besatzung die Moral der jungen Existenzialisten herausfordert. Vom konkurrierenden Großbürger Sartre als «algerischer Gassenjunge» abgetan, ist Camus, der erklärte Antifaschist, Antikommunist und Europäer, selbst ein Fremder – und hellsichtiger als alle.
Emphatisch vermittelt uns Iris Radisch diesen von karger mittelmeerischer Landschaft geprägten Mann in allen seinen Lebenskämpfen, als Liebhaber der Frauen und eines Denkens, das sich engagiert.
«Iris Radisch beherrscht die große und seltene Kunst, ihren Gegenstand angemessen, genau und differenziert darzustellen und zu bewerten, und ihre Sprache zeichnet sich durch eine kreative Wortwahl, durch Originalität und Witz aus.»
Klaus Harpprecht
«Eloquent, schlagfertig und ohne jede ideologiebelastete Besserwisserei.»
Süddeutsche Zeitung
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2013
Copyright © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Redaktion Barbara Hoffmeister
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München
Umschlagfoto Beaton/Vogue; © Condé Nast
ISBN 978-3-644-03451-8
Anmerkung: Die Seitenzahlen im Bildnachweis beziehen sich auf die Seitenzahlen der Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Motto
1. Kapitel Die Mutter
Am Anfang war das Schweigen
Unterm Ochsenziemer – eine Kindheit im 20. Jahrhundert
Das Hohe Lied des französischen Schulsystems
«Voilà. Sie ist tot …»
2. Kapitel Der Sommer
Sonnenanbeter
Der Lungenkranke
Gides Früchte der Erde
Noces – die Hochzeit des Lichts
Unterm höchsten Sonnenstand
3. Kapitel Der Schmerz
Man muss sich Sisyphos als Dandy vorstellen
Ein Mann heiratet sich nach oben. Und wird Kommunist
Der glückliche Tod
Hauptstadt der Schmerzen
4. Kapitel Das Meer
Die Lehren des Meisters
Die neue Mittelmeerkultur
Die Mittelmeerphilosophen Plotin und Augustinus
Ein Abschied von sich selbst
5. Kapitel Das Elend
Lokalreporter
Eine Reise zu den Berbern
Das Lob der Armut
Der Soir républicain
Ein Fegefeuer der Vergangenheit
Ein Massenmörder auf dem Theater – Caligula
6. Kapitel Die Welt
Ein Algerier in Paris
Der Fremde
Der Einmarsch
Die Heirat
Der absurde Mensch – Mythos des Sisyphos
Lebe tief und heftig
Sisyphos in Auschwitz
7. Kapitel Die Ehre
Die Polarnacht von Paris
Eine «Hölle» des Wartens in Oran
Ein Erfolg von deutschen Gnaden
Von der Gleichgültigkeit zur Revolte – der Mensch im Widerstand
In der Pariser Bohème
Briefe an einen deutschen Freund
Das Missverständnis
Die Befreiung
8. Kapitel Die Menschen
Bester Freund wider Willen – Pascal Pia
Combat
Ein deutsches Zwischenspiel
Sartre (I). Der freundliche Feind
Eine amerikanische Liebschaft
Die Pest
Ein neues Zeitalter
Der Bruder – René Char
Der Mensch in der Revolte
Nemesis oder Gegen ein deutsches Europa
Sartre (II). Eine öffentliche Hinrichtung
9. Kapitel Die Erde
Heimkehr nach Tipasa
Die Traurigkeit, recht zu behalten
Die algerische Tragödie
Himmel und Hölle
Der Fall
Der Preis
10. Kapitel Die Wüste
Der Traum vom Buch der Einfachheit
Die Ehebrecherin
Das nomadische Denken
Das letzte Jahr
Der erste Mensch
René Char und das Nachleben der Sonne
Und Schluss
Epilog
Auf der Terrasse von Lourmarin
Im Klavierzimmer in Paris
Weiterführende Literatur
Zeittafel
Register
Bildnachweis
Leseprobe: Die letzten Dinge
Die letzten Dinge
JULIEN GREEN – «Altern ist Sünde.»
«Antwort auf die Frage nach meinen zehn bevorzugten Wörtern: ‹Die Welt, der Schmerz, die Erde, die Mutter, die Menschen, die Wüste, die Ehre, das Elend, der Sommer, das Meer.›»
Albert Camus im Sommer 1951
1. KapitelDie Mutter
Ort und Zeit: Mondovi 1913. Rue de Lyon, Algier, 1914 bis 1931.
Am Anfang war das Schweigen
Ein klappriger Wagen fährt auf kaum befestigten Straßen durch die karge unermessliche Landschaft Algeriens. Die Finsternis scheint grenzenlos zu sein. Der Kutscher hat eine Laterne angezündet, das einzige Licht in der regnerischen Nacht.
Das Paar auf dem Pferdewagen hat es eilig, die Frau liegt in den Wehen. Sie halten bei einem Gut in einem winzigen Dorf. In einer Küche wird eine Matratze neben einer Feuerstelle auf den Boden gelegt. Ein Geruch von Verwahrlosung und Elend hängt in der Luft.
Das Kind kommt in dieser Nacht im Spätherbst 1913 mit Hilfe einer Araberin und der Kantinenwirtin des Gutes neben dem prasselnden Holzfeuer zur Welt. Sein erstes Lebenszeichen gleicht einem «unterirdischen Knirschen», «wie manche Zellen unter dem Mikroskop es machen»[1]. Es wird gewickelt und in einen Wäschekorb gelegt. Das Gesicht der Mutter beim Anblick des Sohnes ist «verklärt» – das wird der Sohn später behaupten.
Nicht viele Autoren haben gewagt, ihre Geburt zu beschreiben. Goethe tat es: «Am 28. August 1749 mittags mit dem Glockenschlage zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich». So beginnt seine Autobiographie Dichtung und Wahrheit.
Und Camus tat es in seinem letzten Werk, Der erste Mensch. In den Monaten vor seinem Unfalltod am 4. Januar 1960 hatte er wie besessen an seiner literarischen Autobiographie geschrieben. Sie wurde sein Vermächtnis. Er hatte das handschriftliche Manuskript bei sich, als das Auto, in dem er starb, an einer Platane zerschellte. Auf den ersten Seiten dieses Buches schreibt Camus, wie sein Leben begann. Es ist Dichtung und enthält doch die Wahrheit seines Lebens, so wie er sie erfunden hat.
Verklärt ist nicht nur das Gesicht der Mutter, sondern die ganze Geburtsszene, die hinter der Goethe’schen Schicksalsstunde nicht zurücksteht. Kosmische Kräfte und schlichtere Frankfurter Glockenschläge unterlegen die Geburt des deutschen Klassikers mit allen Vorzeichen des Triumphalen. Camus arrangiert seine Geburt in biblischer Ärmlichkeit und Einfachheit, ein schutzsuchendes Paar in dunkler Nacht, ein einsam dahineilendes Licht, das von einer Laterne in die tiefe Finsternis der Welt geworfen wird, eine bescheidene Herberge. Über dieser Geburtsszene wachen keine Engel, kein Stern zu Bethlehem leuchtet am Himmel. Nur der vom Westwind Tausende von Kilometern übers Meer getriebene Regen trommelt seine Sphärenmusik zu dem Ereignis, das sich in Wahrheit weit weniger erhaben zugetragen hat.
Camus’ Vater, Lucien Auguste Camus, arbeitet als Kellermeister seit dem Spätsommer 1913 auf einem Weingut in Saint-Paul im algerischen Mondovi, 420 Kilometer östlich der Hauptstadt gelegen, wo er seine Frau und seinen Sohn Lucien zurückgelassen hat. Er wohnt in einer Hütte mit einem Boden aus gestampftem Lehm. Im November 1913 besteigen seine Frau Catherine und der dreijährige Sohn Lucien in Algier einen Zug, der sie in einer achtzehnstündigen Fahrt nach Bône (heute Annaba) bringt. Dort holt der Vater sie ab. Die 25 Kilometer von Bône zum Weingut in Mondovi (heute Déan) legt die Familie auf einem Karren zurück. Mutter und Sohn erkranken am Sumpffieber, das die Mücken verbreiten.
In der Lehmhütte des Kellermeisters wird Albert Camus am 7. November 1913 um zwei Uhr nachts geboren. Sein ärmliches Geburtshaus, das er so genau beschreibt, hat er nie gesehen. Es wurde noch zu seinen Lebzeiten abgerissen.
Auch seinen Vater hat er nie gekannt. Den ersten Teil seines letzten Buches hat er «Suche nach dem Vater» genannt. Lucien Camus wurde 1914 Soldat. Wenige Monate nach der Geburt des Sohnes ist er in der Marne-Schlacht gefallen.
Ein Foto, ein paar Feldpostkarten und der wie eine Reliquie aufgebahrte Granatsplitter, der den Vater getötet hat und der Witwe nach Algier geschickt wurde: mehr blieb vom Vater nicht. Camus’ Recherchen nach der väterlichen Familiengeschichte – Lucien Camus war ein französisches Kolonistenkind in der zweiten Generation, Albert Camus’ Urgroßvater wanderte in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts von Bordeaux nach Algerien aus – blieben ergebnislos. Der abwesende Vater ist die erste große Leerstelle in seinem Leben. Camus füllt sie mit einer erfundenen Ursprungslegende. In deren Zentrum steht eine in Schweigen gehüllte Frau, die Mutter. Ihr ist das Buch gewidmet.
Catherine Camus, geborene Sintès, hört schlecht und spricht kaum einen Satz. Sie verfügt über 400 Wörter, ist apathisch und zeigt keine Gefühle. Sie hat ihren Sohn nie liebkost, nie umarmt, sie greift nicht ein, wenn ihre eigene Mutter ihn drakonisch bestraft. Ihr Leben verlief in wortloser Ergebenheit, in einem Zimmer ohne Strom, ohne Gas oder fließendes Wasser, mitten im Armenviertel von Algier. Camus hat sie wie eine Heilige verehrt.
Camus’ Mutter Catherine, geb. Sintès, in späteren Jahren
Die Mutter steht am Anfang und am Ende seines Weges. Er beschreibt sie als eine Frau mit sanftem, ebenmäßigem Gesicht, das Haar gewellt wie bei einer Spanierin, mit einer geraden kleinen Nase, warmherzigen Augen und verbrauchten, holzartigen Händen. Sie sei, schreibt er, «zerstreut», «geistesabwesend», «höflich», «unzugänglich», «eingeschlossen in ihr eigenes enges Universum» gewesen. «Die Mutter» sollte das Schlusskapitel heißen. Im Manuskript findet man den Satz: «Sie war meistens schweigsam und mit kaum einigen hundert Worten zu ihrer Verfügung, um sich auszudrücken; er unentwegt redend und unfähig, mit Tausenden von Wörtern zu finden, was sie mit einem einzigen Schweigen sagen konnte.»[2] Die Mutter ist der Maßstab, den Camus an die Welt anlegt. Über sie und ihre Rolle als Schutzpatronin und Portalfigur seines zukünftigen Werks schreibt der junge Autor im Tagebuch: «Das alles soll in den Gestalten von Mutter und Sohn Ausdruck finden»[3]. Auf dem Höhepunkt des Algerienkrieges und seines eigenen Ruhmes wird er 1957 bei der Nobelpreisverleihung in Stockholm sagen: «Wenn ich zwischen meiner Mutter und der Gerechtigkeit wählen müsste, würde ich meine Mutter wählen»[4]. Mütter sind die einzig bedeutenden Frauenfiguren in seinem Werk.
Bis zum letzten Tag seines Lebens wird Camus seine Mutter, eine fast stumme, seelisch gestörte Analphabetin, als Urbild heiliger Einfalt verherrlichen. In ihr Schweigen hinein entwirft er sein Werk. Kurz vor seinem Tod notiert Camus: «Oh Mutter, oh Zarte, geliebtes Kind, das größer ist als meine Zeit, größer als die Geschichte, die dich unterwarf, wahrer als alles, das ich auf der Welt geliebt habe, oh Mutter, vergib deinem Sohn, dass er der Nacht deiner Wahrheit entfloh.»[5] Catherine Camus bleibt die wichtigste Frau seines an Frauen reichen Lebens – und sein größter Schmerz. Die Frau, mit der er nie sprechen konnte, war zugleich die «Einzige, mit der er hätte sprechen können».[6]
Unterm Ochsenziemer – eine Kindheit im 20. Jahrhundert
Im Sommer 1914 war Lucien Camus also nach Frankreich abgereist, um, kaum dort angekommen, zu sterben. Die Mutter zog mit den beiden Jungen zurück nach Algier, zu ihrer verwitweten Mutter und dem fast taubstummen Bruder Étienne. Die drei Generationen wohnen in der Rue de Lyon im Arbeiterviertel Belcourt. Als Catherine Camus dort die Nachricht erreicht, dass ihr Mann am 11. Oktober 1914 seinen Verletzungen in Nordfrankreich erlegen ist, steckt sie den Umschlag in ihre Kittelschürze und bleibt starr auf dem Bett sitzen, stundenlang. An diesem Tag beginnt Camus’ Kindheit zwischen zwei wortlosen Erwachsenen und einer groben alten Frau, seiner Großmutter.
Die Großmutter Catherine Marie Cordona Sintès wurde 1857 auf der spanischen Insel Menorca geboren und kam als Kind von Auswanderern nach Algerien. Schon sie war Analphabetin, lebte in großer Armut und arbeitete hart. Neun Kinder brachte sie zur Welt. Sie soll kalt und herzlos gewesen sein, Camus beschreibt sie als «unwissend und stur», eine nach altem Fleisch riechende Matrone mit eiskalten Augen und einem mächtigen «Altfrauenbauch», gekleidet in ein langes schwarzes «Prophetinnenkleid».[1] Zur Erziehung der Kinder und Enkel benutzt sie den Ochsenziemer, der in der Rue de Lyon an der Wand hängt.
Das Leben der beiden halbwaisen Brüder Lucien und Albert zwischen den drei seelisch und körperlich schwerbeschädigten Mitgliedern einer ursprünglich spanischen, inzwischen völlig französisierten bitterarmen Kolonistenfamilie – Camus sprach kaum Spanisch, war aber stolz auf seine spanische Herkunft – hatte regelrecht vorzivilisatorische Züge.
Albert mit seinem drei Jahre älteren Bruder Lucien
Die Wohnung der Familie ist eng und liegt im ersten Stock eines Mietshauses. Nur drei Zimmer, kahl und gekalkt, ohne jeden Komfort. In dem einen stehen ein Esstisch mit einer Wachstuchdecke und fünf Stühle, auf dem Boden liegt eine Matratze, auf welcher der stumme Onkel schläft, wenn es Nacht wird. Wenn Camus Mittagsschlaf halten muss, liegt er im hohen großen Bett im Zimmer der Großmutter. In der Küche gibt es keinen Herd und keinen Backofen, nur einen Spirituskocher. Die Kinder haben kein eigenes Bett und schlafen nachts neben der Mutter. Es gibt keine Toilette, nur einen Abtritt ohne Wasserspülung im Treppenhaus. Ein Fenster geht auf die Straße, zwei gehen zum Hof. Die Familie ist nicht religiös, besucht nie die Kirche. Wenn ein Nachbar gestorben ist, sagt die Großmutter: «Nun muss er nicht mehr furzen». Die Abendunterhaltung der Familie besteht im Winter darin, die Stühle ans Fenster zu rücken und hinauszuschauen. Im Sommer stellt man die Stühle auf die Straße und sieht den Passanten und den Straßenbahnen nach. Das 20. Jahrhundert hat in diesem Leben noch nicht Einzug gehalten – es gibt keine Elektrizität, kein Wasser, keine Zeitungen, keine Bücher, geschweige denn so etwas Seltenes wie einen Radioapparat, am Sonntag geht man gelegentlich ins Vorstadtkino. Die französische Zivilisation liegt in unerreichbarer Ferne – keiner von Camus’ noch lebenden Verwandten ist jemals in Frankreich gewesen oder hat auch nur eine Vorstellung von der französischen Kultur.
So schreibt Camus sein Werk für eine Kriegswitwe, die es nie lesen wird, die nichts weiß von der großen Geschichte, die nur eine sehr vage Idee von Frankreich und noch nie etwas von Österreich-Ungarn gehört hat, die weder «die vier Silben Sarajevo aussprechen kann» noch eine Ahnung davon besitzt, was ein Erzherzog sein könnte. Zeitlebens hält Catherine Camus den soliden Beruf ihres älteren Sohnes, der Versicherungsvertreter wird, für ehrbarer als die Literatur des berühmten Jüngsten. Niemals, so Camus, habe er seine Mutter lachen gehört. Und nie habe er mit ihr Erinnerungen austauschen können, da sie sich an ihr ereignisloses Leben nicht erinnern konnte – oder wollte. Einmal hat sie es gewagt, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen und sich die Haare kurz zu schneiden. Es ist die Zeit, als es einem maltesischen Fischhändler gefällt, der jungen Witwe den Hof zu machen. Doch ihr Bruder Joseph beschimpft sie als Hure, und sie zieht sich weinend in ihre gewohnte Lebensstarre zurück, einmal mehr bestätigt in der Gewissheit, «dass das ganze Leben aus Unglück bestand, gegen das man nichts tun und das man nur erdulden konnte».[2]
Camus’ Familie lebt – losgelöst von der religiösen und kulturellen Nabelschnur zum unbekannten europäischen Mutterland – ohne Kenntnis von der eigenen Geschichte und dem eigenen Herkommen in einem Niemandsland endloser Gegenwart, durch das hin und wieder lärmend eine Straßenbahn fährt.
Jean-Paul Sartre, der spätere Weggenosse und Gegenspieler Camus’, geboren 1905 und ebenfalls vaterlos aufgewachsen – bei Mutter, Großmutter und Großvater –, erzählt in seiner Autobiographie Die Wörter von einer ganz anderen, einer behüteten, emotional und intellektuell verwöhnten Kindheit. Das Schlafzimmer der Mutter, in welcher er bald eine ältere Schwester sieht, quillt über von Büchern, deren ständiger Zustrom aus dem örtlichen Lesekabinett nie versiegt. Der kleine, von allen bewunderte und verwöhnte Sartre sitzt zwischen Kunstbänden, Romanen und Reiseberichten und muss sich entscheiden, ob er zuerst die Erzählungen von Maupassant oder den Bildband über Rubens aufschlagen soll. Noch bevor er die Buchstaben entziffern kann, besteht er wie ein ausgewachsener Kulturbürger darauf, eine eigene Bibliothek zu besitzen, um in den Büchern schon einmal zu blättern und die Pose des Lesenden einzuüben.
Zwei Leben, wie sie unterschiedlicher nicht beginnen können. Über das eine regiert das eiserne Schweigen im Armenviertel einer französischen Kolonie. Das andere wird überrollt von den immer neuen Worten und Lektüren einer eilig voranpreschenden Gegenwart. Camus’ Leben beginnt im staubigen Stillstand einer monotonen Vormoderne, in der man viele Stunden am Tag hart arbeitet, um abends müde und erschöpft in den Himmel zu schauen, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Sartres Leben steht von Anfang an unter dem Stern der rasanten Eroberung und Beherrschung der Welt durch immer mehr Wissen und immer größere Worte.
Sartre ist immer schon da, wo er hingehört. Camus wird von der Rue de Lyon in Algier bis zum Boulevard Saint-Germain in Paris knapp tausend Kilometer in der Luft und gut fünfhundert Jahre in der Menschheitsgeschichte zurücklegen.
Die Tage gleichen einander. Der Onkel arbeitet in einer Böttcherei und kommt spät nach Hause, isst, legt sich hin und schläft. Die Mutter sortiert in einer Rüstungsfabrik Patronen; später putzt sie bei reichen Kolonisten, in Villen mit herrschaftlichem Blick über das Mittelmeer. Camus wird einmal in einer dieser schönen Villen wohnen. Vorerst sitzt er noch an dem einzigen Tisch neben dem zur Seite geräumten Geschirr, wenn er am Abend seine Schularbeiten macht.
Das Haus in der Rue de Lyon 93 gibt es noch immer. Eine enge Steintreppe führt durch ein dunkles Treppenhaus in den ersten Stock. In der kleinen Mietswohnung lebt inzwischen ein Hafenarbeiter, der sich «Mohamed Camus» nennt.[3] In den drei engen, hohen Räumen sieht es aus wie zu Zeiten Camus’: kaum Möbel, schmales Bett, ein paar Stühle, der Tisch mit Wachstuchdecke.[4] Camus wird diese karge Art des Wohnens immer bevorzugen.
«Ich liebe das kahle Haus der Araber oder der Spanier. Der Ort, an dem ich am liebsten lebe und arbeite (oder wo es mir im Gegensatz zu den meisten Menschen sogar gleich wäre, zu sterben), ist das Hotelzimmer. Der vielgelobten Häuslichkeit habe ich nie Geschmack abgewinnen können; das sogenannte bürgerliche Glück langweilt und erschrickt mich.»[5]
Der Ton in der Familie ist rüde und unsentimental. Die Tonlosigkeit, die man im Fremden als bahnbrechende Erneuerung der europäischen Literatur feiern wird, ist hier zu Hause. Sie war für Camus keine nur kühne literarische Pose, sie war seine Wirklichkeit, er hat sie nicht erfunden.
Besonders die Gleichgültigkeit der Mutter, die irgendwo im Abseits des Autismus ihr Leben verbracht hat, prägt sich dem Jungen tief ein. Camus und seine Figuren werden von einer ähnlichen Aura der Kälte umgeben sein und niemals die seelische Nähe anderer Menschen suchen.[6] Über die Gründe für die seelische Deformation der Mutter hat Camus nicht spekuliert.[7] Sie ist der erste Schmerz des Kindes, den der junge Schriftsteller später mit einigem literarischen Aufwand in das paradoxe Glück einer tragischen Existenzerfahrung umdeuten wird. Doch in einem seiner allerersten Texte, den er als Student in der Edition seines Freundes Edmond Charlot 1937 in Algier veröffentlicht, gesteht er offen, das Schweigen der Mutter «tut ihm so weh, dass er weinen möchte».[8]
Camus wird aus diesem Kälte-Trauma seine Philosophie entwickeln. In seinem Essay Der Mythos des Sisyphos wird er über die Erfahrung des Absurden nicht mehr schreiben, sie sei der «Zusammenprall eines kindlichen Rufes mit dem unbegreiflichen Schweigen der Mutter», sondern: «das Absurde ist der Zusammenprall des menschlichen Rufes mit dem unbegreiflichen Schweigen der Welt».[9] Aus der Psychopathologie einer in ärmsten Verhältnissen lebenden algerischen Analphabetin macht Camus die nicht aufzulösende Tragödie eines Menschen, der der Gleichgültigkeit des stummen und kalten Kosmos ausgesetzt ist.
Camus’ Philosophie des Absurden kann ihre Herkunft aus den seelischen und sozialen Verheerungen nicht verleugnen, die das Milieu der Ärmsten unter den Franzosen in Nordafrika prägen. Sie entsteht auf der Straße, im Angesicht der Menschen, die ihn umgeben. Zu Camus’ Geschichte gehören die «Seinen», die «Stummen» – ohne ihn wären sie vergessen. Camus hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass es für ihn undenkbar war, die Literatur von den elementaren Erfahrungen der Menschen zu lösen, von dem großen Schmerz und dem großen Glück, die ein Leben bestimmen.
Das Hohe Lied des französischen Schulsystems
Im Sommer 1918 beginnt für das Analphabetenkind aus der Rue de Lyon ein neues Leben. Albert wird eingeschult, zunächst in die École maternelle, dann in die Grundschule von Belcourt. Das Räderwerk des Bildungssystems der Grande Nation erfasst den Jungen und wird ihm den Weg nach Paris ebnen. Seinem Lehrer Louis Germain bleibt Camus zeitlebens verbunden, ihm widmet er seine Nobelpreisrede: «Ohne Ihre Erziehung und Ihr Beispiel wäre nichts davon geschehen.» Dem staatlichen Schulsystem Frankreichs und seinen strengen Lehrern hat er seine Karriere als Schriftsteller zu verdanken. Die Schule ist sein Nadelöhr in das Himmelreich der Gebildeten, der Bücher und Zeitungen, der Dichter und Intellektuellen. Er wird das nie vergessen. «Die staatliche Schule preisen!» steht in seinem letzten Manuskript am Rand vermerkt.
Louis Germain – Franzose, Soldat, Kriegsteilnehmer, Lehrer und Klarinettist an der Oper von Algier – widmet sich dem vaterlosen Schüler mit besonderer Aufmerksamkeit. Dass er selbst das Inferno des Weltkrieges überlebt hat und in die Heimat zurückgekehrt ist, kommt ihm wie ein Wunder vor. Jetzt möchte er als Lehrer die Vaterstelle der gefallenen Kameraden einnehmen. Seine pädagogische Mission lautet, die Jungen zu anständigen Bürgern der Dritten Republik zu erziehen – auch mit Hilfe eines Lineals, das ihm als Schlagstock dient. Die Züchtigungen finden am Lehrerpult vor den Augen aller Schüler statt. Den Kopf zwischen den gespreizten Beinen des verehrten Lehrers, muss der Straffällige den Hintern herausstrecken, auf den dann die brennenden Schläge des Pädagogen niedergehen.
Für alle, «die sich für den interessieren, der einmal mein lieber kleiner Albert war», wird Louis Germain 1958 einige Erinnerungen zu Papier bringen. Man erfährt, dass Camus, als er 1920 in die Primarschule kam, schon ein paar Buchstaben lesen und schreiben konnte und sehr schnell einer der besten Schüler wurde. Er sei still, konzentriert, nachdenklich und gutherzig gewesen. Am Ende des ersten Schuljahres, so Germain, konnte sein Schüler fließend lesen und schreiben. Der Lehrer mag sich und seine strenge Erziehung hier selbst loben. Germain beschreibt einen ernsten, zurückhaltenden und unermüdlich fleißigen Camus von kleinem Wuchs, der wenig und langsam sprach und viel beobachtete. Auf einem Klassenfoto aus dem Jahr 1923 sieht man Germains Zöglinge stolz und aufrecht, Brust raus, Kopf hoch. Camus steht in der letzten Reihe.
In der Grundschule von Belcourt
Glaubt man Camus’ eigenen Erinnerungen in seinem hinterlassenen autobiographischen Roman, dann wurde er in der Primarschule zusammen mit arabischen Kindern unterrichtet, doch die Klassenlisten und das Klassenfoto sagen etwas anderes: Die überwältigende Mehrheit derer, die mit ihm in den Genuss der französischen Staatsschule kommen, sind Söhne von kleinen Kolonisten, den Pieds-noirs des Armenviertels Belcourt. Nur im Fußballverein von Montpensier, in dem er es zum Torwart bringt, spielt er mit arabischen Kindern.
Für den jüngsten Sohn der Putzfrau Catherine Camus, der bei seiner Einschulung kein korrektes Französisch sprach, bedeuteten diese Jahre eine Initiation in eine vollkommen fremde Welt. Sein lebenslanger, manchmal etwas steifnackiger Respekt vor der französischen Kultur und Sprache hat hier seinen Ursprung. Sein gesprochenes Französisch wird immer etwas rau, beiläufig und kurzatmig klingen. Die klangvollen, breit ausgesungenen, schier endlosen Satzkaskaden des französischen Kulturbürgertums wird er nicht imitieren können – ja, er wird es gar nicht wollen.
Von den Methoden des Lehrers, der die Schüler zwingt, seinem Unterricht mit verschränkten Armen zu folgen, zeigt sich Camus noch als Erwachsener rückhaltlos begeistert. Germain, so beteuert er, habe es verstanden, den Unterricht lebendig und amüsant zu gestalten. Die Lehrbücher kamen aus Paris und erzählten Geschichten von einer Welt, in der man Wollmützen trug, durch tiefen Schnee einem Haus entgegenstrebte, in dem ein warmes Kaminfeuer prasselte und in schönstem Französisch über die Freizeitvergnügungen des kommenden Wochenendes parliert wurde.
Camus’ Schulbiographie ist die eines edlen Wilden, der begierig jedes bisschen Druckerschwärze aus dem sagenhaften Jenseits des Bildungsbürgertums aufsaugt und am Abend zu Hause Wort für Wort nachbuchstabiert. Camus wird von der «mächtigen Poesie der Schule» schwärmen, die das Versprechen von einem anderen Leben schon im Geruch der Tinte, der Lederriemen und der Federkästen verströmt habe.[1]
Der erste Lehrer: Louis Germain
Monsieur Germain, der mit seinen runden braunen Augen, dem glatt gescheitelten braunen Haar, den weichen Gesichtszügen und dem dunklen Schnurrbart wie eine Provinzausgabe von Marcel Proust aussieht, ist nicht nur die personifizierte Dritte Republik der Kolonialmacht Frankreich, sondern auch der erste Botschafter der Pariser Kultur, der in dem algerischen Paralleluniversum des Schweigens und der Einfachheit auftaucht. Er habe, wird Camus später sagen, «ganz allein die Verantwortung dafür übernommen, ihn zu entwurzeln».[2] Die Kluft, die sich nun im Abstand von ein paar hundert Metern zwischen Elternhaus und Schule auftut, wird später in Camus’ Lebenspolen Algier und Paris einen endgültigen Ausdruck finden.
Germain sorgt dafür, dass Camus ein Stipendium für die höhere Schule erhält. Die Großmutter sträubt sich, sie möchte, dass die Kinder ihrer Tochter so früh wie möglich Geld verdienen. Germain sucht die beiden Frauen in der Rue de Lyon auf, setzt sich mit ihnen an den Esstisch, und tatsächlich gelingt es ihm, die Großmutter umzustimmen. Sie stellt nur eine einzige Bedingung: Der Enkel soll vor dem Schulwechsel zur Heiligen Kommunion gehen. Sicher ist sicher.
Das war knapp. Ohne Louis Germain gäbe es keinen Camus. Er wäre in irgendeiner Abstellkammer des Lebens gelandet – wie sein Onkel Gustave Acault, der Fleischer, der nachts Shakespeare und Gide liest und sonntags das große Wort in der Eckkneipe seines Viertels führt; oder wie Meursault, Held des Romans Der Fremde, der im Hafen von Algier arbeitet, vormittags und nachmittags jeweils genau vier Stunden, und sich nach Feierabend einsamen, unspektakulären Gedanken hingibt.
Germain gibt Camus Privatstunden, um ihn auf die Aufnahmeprüfung am Gymnasium vorzubereiten. Er begleitet ihn am entscheidenden Tag. «Geh, mein Sohn», soll er an der Pforte gesagt haben. Und Stunden später: «Bravo, Knirps. Du hast bestanden».[3] Dann überlässt er seinen Schützling, der nicht versteht, wie ihm geschieht, der Bildungsmaschinerie einer der führenden Kulturnationen der Welt. Bis zu seinem Lebensende glaubt Camus, in diesen Stunden aus dem Paradies vertrieben worden zu sein –
«um in eine unbekannte Welt geworfen zu werden, die nicht mehr seine war, von der er nicht glauben konnte, dass die Lehrer gelehrter waren als dieser, dessen Herz alles wusste, und er würde in Zukunft ohne Hilfe lernen und verstehen müssen, schließlich ein Mann werden müssen, ohne den Beistand des einzigen Menschen, der ihm geholfen hatte, schließlich ganz auf seine Kosten sich allein erziehen und erwachsen werden müssen». [4]
Camus hat sich niemals über seine Kindheit beklagt. Im Gegenteil: Die kindliche Begabung zur Hingabe an das, was ihm gegeben ist, zur rückhaltlosen Bejahung des Jetzt, wird er nicht verlieren. Er habe nicht in der Zerrissenheit, sondern in der Fülle begonnen, sagt er später einmal. Bei Nietzsche findet er den passenden Kommentar zu dieser jugendlichen Strategie der Weltumarmung und der blattgoldverzierten Verklärung seiner Kindheit im Armenviertel von Algier. Als er im Januar 1960 auf dem Weg nach Paris stirbt, steckt in seiner Tasche ein Exemplar von Nietzsches Fröhlicher Wissenschaft. Darin hatte er lesen können:
«Glattes Eis
Ein Paradeis
Für Den, der gut zu tanzen weiß.»
«Voilà. Sie ist tot …»
Hier ist Camus’ Geschichte als ein «erster Mensch», der ohne Vater und ohne große Worte in die Welt zieht, um sie erst zu umarmen und dann zu erobern, zu Ende. Nur wenige Jahre hat Camus in der Nacht eines anderen Zeitalters verbracht. Seit er die Schwelle des «Grand Lycée» unweit des Meeres, eine halbstündige Straßenbahnfahrt von Belcourt entfernt, überschritten hat, ist er kein afrikanischer Kaspar Hauser mehr, sondern ein ehrgeiziger Proletariersohn des französischen Imperiums, der Latein lernt und beginnt, sich seiner Herkunft zu schämen.
Seine ersten Zeilen wird Camus als Gymnasiast schreiben und in der Schulgazette Sud veröffentlichen, die sein Oberlehrer Jean Grenier herausgibt; Aufsätze im jugendlichen Renommierstil über Paul Verlaine, über den längst vergessenen Autor Jehan Rictus, über Henri Bergson oder über die Musik im Allgemeinen und bei Schopenhauer und Nietzsche im Besonderen.
Jahre nach dem Unfall auf der Landstraße bei Villeblevin werden Texte veröffentlicht, die er während und kurz nach der Schulzeit nur für sich selbst geschrieben und nie publiziert hat, darunter, vermutlich aus dem Jahr 1933, eine Skizze von zweieinhalb Seiten, die noch nie ins Deutsche übersetzt wurde. Es ist ein Abschiedstext von der Kindheit, von der Mutter, von den Frauen. Er heißt: «Voilà. Sie ist tot …» Er erzählt die Geschichte von einem Mann und einer toten Frau. Gestern hat sie noch gelebt, wurde geliebt. Jetzt ist sie tot, und er kann sie nicht mehr lieben. Er kann auch nicht weinen. Er wiederholt immer nur: Sie ist tot. Er hat sie geliebt, und sie wurde ihm genommen. Er möchte die tote Frau schlagen, so sehr ist er empört über ihre Leblosigkeit. Er vergleicht sie mit einem Stein. Dieser Stein ist nicht mehr die Frau, die er geliebt hat. Dann wäscht er sich die Hände. Er fragt sich nicht mehr, ob er sie liebt. Das war vorher. Jetzt denkt er an die Beerdigung. Er fragt sich, ob der Schmerz ihm eine Komödie vorspielt. Er weiß nicht, was unecht und was echt ist. Er misstraut sich selber, er kennt seine Eitelkeit und seinen Hang zu Pathos und Größe, zu vagen Ideen, die er mit Tiefsinn verwechselt. Er denkt an seinen Pessimismus, an seinen Selbstekel, seinen Ekel vor der Welt, an die vielen Fehler, aus denen er zusammengesetzt ist. Aber trauern kann er nicht. Er fürchtet sich vor der Beerdigung, vor den Posen, die man von ihm erwartet – und plötzlich spürt er, dass er frei ist. Seine Zukunft liegt vor ihm, klar und frisch, wie der Himmel nach einem schweren Regen. Der Tod hat die Liebe mitgenommen, aber was weiß man schon von der Liebe. Er wendet sich zur Tür, sieht die Felder, riecht die feuchte, frische Luft. Er findet, es tut gut zu leben. Und ein letztes Mal, «mit ein wenig Ironie», sieht er auf den toten Körper vor sich, der all das nicht mehr wahrnimmt. Hinter ihm die Tote – sein altes Leben. Vor ihm die geöffnete Tür – seine Zukunft. Jenseits der Tür – die Weite, die Luft, die Hoffnung. Er ohrfeigt die Tote und geht durch die Tür, ohne sich noch einmal umzudrehen.[1]
Die Skizze beschreibt nicht nur das Erstaunen über die Unzuverlässigkeit der Trauer, die Camus beim Tod seiner Großmutter zwei Jahre zuvor, 1931, empfunden haben mag. Sie spielt auf Größeres an – auf die Frage, die alle Jugendwerke Camus’, angefangen beim zu Lebzeiten nicht publizierten Erstling Der glückliche Tod über den Fremden und Die Pest bis zu Caligula und dem Mythos des Sisyphos, stellen und die für den an Tuberkulose erkrankten jungen Mann die naheliegende und alltägliche war: Wie lebt man auf Augenhöhe mit dem Tod?
Der kleine Text, in dem eine tote Frau geohrfeigt wird, bevor ein Mann frei und unbeschwert in sein Leben aufbricht, ist eine Einübung in die Verhaltensweisen der Kälte, die Camus in seinem Roman Der Fremde zur Meisterschaft führen wird.
Im Leben Camus’ verlaufen die Dinge ähnlich wie in der szenischen Skizze, jedoch mit vertauschten Rollen: Camus leidet an einer tödlichen Krankheit. Als er sechzehn Jahre alt ist, wird Tuberkulose diagnostiziert, und er befürchtet zu sterben. Die Mutter zeigt sich kaum besorgt. Als er zum ersten Mal Blut hustet, reagiert sie gleichgültig, und auch im weiteren Verlauf interessiert sie sich nicht für die Erkrankung ihres Sohnes. Doch ausgerechnet in der Kälte der Mutter – die wie eine Ohrfeige für den todkranken Sohn gewesen sein muss – sieht er einen Beweis für ein stilles Einverständnis, zu dessen Tiefen die alltäglichen Sprachen der Liebe und die Furcht vor dem Tod nicht hinab reichen. Im Fremden wird er diese überwältigende kalte Verbundenheit feiern als «zärtliche Gleichgültigkeit».[2]
Dieses Einverständnis bleibt Camus’ größtes Geheimnis. Weder er selbst noch seine Mutter glaubten, dass sie durch irgendetwas jemals getrennt werden könnten.[3] Die Verbundenheit mit der Mutter überwand den Tod und die Grenzen der Vernunft. Kein Wort reichte seinem Empfinden nach an das heran, was zwischen ihnen beiden geschah, kein moderner wissenschaftlicher Zugriff, keine psychologische Diagnose, keine therapeutische Analyse hätten erklären können, welche ursprüngliche, vorzeitliche Macht hier im Spiel war, so wenig wie sich die kosmischen Kräfte erklären lassen, die die Planeten in ihren Umlaufbahnen halten. Wie immer sich die Beziehung in den Augen Dritter darstellen mochte, für den Sohn war die Mutter ein Teil seiner selbst, die Urzelle, aus der sein Lebensgefühl erwuchs, die Art und Weise, wie er die Welt wahrnahm. Hinter dem faltigen Gesicht und den braunen Augen seiner Mutter sah er einen Gott verborgen, den einzigen, den er akzeptierte, den Gott einer unverbrüchlichen anfänglichen Nähe zwischen den Dingen und den Menschen, den Gott der Einfachheit.
2. KapitelDer Sommer
Ort und Zeit: Plage des Sablettes 1923. Hafen von Algier 1930. Krankenhaus von Mustapha 1930. Tipasa 1935.
Sonnenanbeter
Zum Strand sind es ein paar hundert Meter. Die Hitze verlangsamt die Bewegungen. Mittags steht hier die Zeit still. Sobald die Kinder aus Belcourt die Siesta neben den schnarchenden Verwandten hinter den geschlossenen Jalousien überstanden haben, rennen sie los, zum nächsten Strand, durch ein Gewirr aus Wagen, Eseln, Schafen, Hunden, schreienden Händlern und rasselnden Straßenbahnen.
Von der Rue de Lyon aus liegt die Plage des Sablettes am nächsten. Kein weißer Sand, keine unbetretene Wildnis erwartet sie hier. Nur ein grauer Streifen, begrenzt von einer Steinbalustrade, eingefasst von zweistöckigen Holzhäusern, Cafés und Tanzlokalen mit zum Meer offenen Tanzböden, beherrscht von alles überragenden Strommasten, bevölkert von Pommes-frites-Verkäufern, Damen mit Strohhüten und langen steifen Röcken, Kindern und Fischern, die, auf den Felsen hockend, geduldig auf ihren Fang warten. Am Horizont ziehen die großen Linienschiffe in Richtung Frankreich, das noch keiner von ihnen gesehen hat. Man hört aus der Ferne Sirenen.
Kaum haben die Jungen den Strand erreicht, sind sie nackt und stürzen ins Wasser, auf dem die Abfälle schaukeln. Das Schwimmen haben sie sich mit Hilfe von Korkgürteln selber beigebracht. Jetzt paddeln sie wie junge Hunde dem offenen Meer entgegen, johlen, prusten, wetteifern darin, wer am längsten unter Wasser bleiben kann. Bald wälzen sie sich im grauen Sand, lassen sich trocknen, rennen zurück ins Meer und vergessen über diesen Freuden die Zeit.
Die Dämmerung in Nordafrika dauert nicht lange. Kaum brennen die ersten Gaslaternen, wird es Nacht, und die Jungen hasten in der einbrechenden Dunkelheit nach Hause. Meistens kommen sie zu spät. In der Rue de Lyon enden solche Tage dann mit der Peitsche. Hiebe auf Beine und Hintern sind der Preis für die Stunden des Glücks. Camus muss der Großmutter den Ochsenziemer selbst bringen.
Die Sommertage am Meer in Algier hat Camus später – lungenkrank und den Tod vor Augen – als Urbilder des Glücks beschrieben und womöglich eine weit weniger vollkommene Wirklichkeit ein weiteres Mal überschrieben. Die Nachmittage an der grauen überfüllten Plage des Sablettes werden für ihn zum «Prachtvollsten, was die Welt zu geben hat». Camus schwärmt von dem «unersetzlichen Reichtum» und der «Herrlichkeit des Lichts», das sich über die Gassenjungen ergießt wie der Segen Gottes.[1] Je ferner und unerreichbarer ihm diese Tage werden, umso mehr wird er sie preisen.
In seinen Erinnerungen scheint in Algier immer die Sonne. Der Sommer ist heiß und endlos, die Luft riecht nach Meer, Salz und nackter Haut. Es gibt keinen Winter. Die langen, feuchten Regenmonate, in denen das Kind, gelähmt von Langeweile, wie ein gefangenes Tier den Esstisch umkreist, sind im Rückblick wie ausgelöscht. Noch in seiner Nobelpreisrede wird Camus von dem lichtdurchfluteten und glücklichen Leben schwärmen, das er als Kind führte und dessen emphatische Lesart er früh festlegte.
Die Schattenseiten Algiers konnten Camus allerdings kaum verborgen geblieben sein. Algier ist eine Stadt unter europäischer Herrschaft. Und Europa rüstet sich für das moderne Maschinenzeitalter – und für einen neuen Weltkrieg. Der Stadtteil Belcourt wandelt sich, neben den Arbeiterhäusern, in denen das einfache Leben gelebt wird, entstehen Fabriken und Lagerhäuser. Die Bewohner des «Quartier pauvre», wie Camus sein Viertel nennt, verschleißen schnell.
«Sie heiraten jung, sie beginnen sehr früh zu arbeiten und erschöpfen die Erfahrung eines ganzen Lebens innerhalb von zehn Jahren. Ein Arbeiter von dreißig Jahren hat bereits seine ganzen Trümpfe ausgespielt und wartet, umgeben von seiner Frau und seinen Kindern, auf sein Ende. Sein Glück war heftig und kennt kein Erbarmen. Genauso sein Leben.»[2]
Der Junge aus Belcourt, der dabei ist, dem harten Dasein, über das er schreibt, auf dem ersten Bildungsweg zu entkommen, schiebt die Verantwortung für den rasanten Verschleiß der Algerier auf die Sonne, das Klima und das im Übermaß genossene Glück. Über die Lebensbedingungen im sich atemlos industrialisierenden Europa verliert er kein Wort. Auf seinem Weg zum Meer dürfte der Schüler die Fabriken und die Stromtrassen am Strand von Algier gesehen haben. Doch einen Zusammenhang zwischen der Düsternis und Enge in der Rue de Lyon und der Industrialisierung am Beginn des 20. Jahrhunderts hat er nicht hergestellt. Die Abhängigkeit der kleinen von der großen Welt war in seiner Familie nicht augenfällig. Die Mutter putzte für die vermögenden Kolonisten, die beiden Onkel verkauften derselben Klientel den Sonntagsbraten oder stellten in ehrbarer Handarbeit die Fässer her, in die sie ihren Wein abfüllen konnte. Und der junge Mann dieser Familie sucht nach einer einfachen Formel des Glücks, mit der er festhalten kann, was er gerade verliert.
Mit dreizehn Jahren soll für Camus die Zeit der Strandsommer vorbei sein. Die Großmutter verlangt von ihm, in den Ferien zu arbeiten. Er ist empört: Für das bisschen Geld, das er mit diesen Aushilfsarbeiten verdiene, könne er sich nicht den millionsten Teil der Schätze kaufen, die der Sommer am Strand für ihn bereithalte. Wozu brauche man Geld, wenn man in den einfachen und unmittelbaren Freuden den ersten und letzten Lebenssinn finde? Camus revoltiert gegen das Prinzip Befriedigungsaufschub, das die westliche Welt in Gang hält.
Ein Sketch aus dem Tagebuch des Jahres 1937 veranschaulicht die Rangordnung der Dinge, die für ihn zählen:
«– Und was ist Ihr Beruf?
– Ich zähle.
– Wie bitte?
– Ich zähle. Ich sage: Eins, das Meer, zwei, der Himmel (oh, wie schön!), drei, die Frauen, vier, die Blumen (oh, wie ich mich freue!).
– Das wird ja mit der Zeit albern.
– Du liebe Zeit, Sie vertreten die Meinung Ihres Morgenblattes. Ich vertrete die Meinung der Welt. Wenn sie in Licht getaucht ist, wenn die Sonne brennt, habe ich Lust zu lieben und zu umarmen, in Körper wie in Lichter hineinzugleiten, in Sonne und lebendigem Fleisch zu baden. Wenn die Welt grau ist, erfüllen mich Wehmut und Zärtlichkeit. Ich habe das Gefühl, besser zu sein, fähig, zu lieben, ja sogar zu heiraten. Im einen wie im anderen Fall hat das keine Bedeutung.»[3]
Der Weltliebhaber verabscheut das Fortschrittsethos – verzichte auf das einfache Glück, das du jetzt genießen kannst, arbeite emsig und vertraue darauf, dass du morgen durch ein größeres entlohnt wirst. Das Meer, der Himmel, die Sonne, die Frauen, die Blumen – das reicht ihm, solange das Wetter gut ist (nur bei schlechtem Wetter wäre er bereit, langfristige Lebensinvestitionen zu tätigen und zum Beispiel zu heiraten). Der Abonnent des Morgenblattes wird sich damit nicht zufriedengeben, er verlangt bei jedem Wetter nach Sicherheit, Statussymbolen, Bequemlichkeit und Belohnung für seinen Verzicht. Camus hält dagegen: Warum sollte man für den Fortschritt einen so hohen Preis zahlen, wenn das Glück vom Himmel scheint und alle versorgt? Er möchte ihn nicht zahlen. 40 Stunden Arbeit, Heirat, Büro – das ist kein wirkliches Leben.
Der Mensch an den Küsten des Mittelmeers, der – jedenfalls nach Ansicht des Mittelmeerbewohners Camus – alle Freuden und alle Leiden mit ganzer Kraft und ganzem Herzen genießt, ist sein Vorbild. Niemals würde dieser Sommermensch den trüben Ideen des Aufschubs, des Sparens, der Sublimation und des Triebverzichts im Namen einer kalten Vernunft folgen.
Der Lungenkranke
Die wichtigste Aufgabe des sechzehnjährigen Hafenangestellten besteht darin, in der glühenden Hitze, die Verladeliste und Frachtbriefe in der Hand, zwischen dem Maklerbüro und den Schiffen hin und her zu laufen. Er magert ab und beginnt zu husten. Zunächst glaubt man, er habe sich beim Sport erkältet, doch einige Monate darauf erleidet Camus Erstickungsanfälle und spuckt Blut. Im Krankenhaus stellt man eine schwere Lungentuberkulose fest. Er schwebt in Lebensgefahr, wirksame Medikamente gegen Tbc sind noch nicht verfügbar. Camus muss sich im Krankenhaus de Mustapha in Algier einer langwierigen Pneumothorax-Behandlung unterziehen, deren therapeutische Nutzlosigkeit damals nicht bekannt war. Zum ersten Mal in seinem Leben schläft er in einem eigenen Bett. Auf dem Höhepunkt der Krankheit geben die Ärzte ihn auf. Er hat ein Todesurteil erhalten, das nicht sofort vollstreckt, sondern auf unbestimmte Zeit verschoben wird. So fühlt er sich. Sein literarisches Begleitprogramm zu diesem Urteil ist die Lektüre des griechischen Stoikers Epiktet.
Als er das Krankenhaus – nicht geheilt – verlassen kann, rät man ihm, in die klamme Wohnung in der Rue de Lyon möglichst nicht zurückzukehren. Camus zieht daraufhin zur Schwester seiner Mutter, Antoinette, und zu deren Gatten, dem Fleischermeister Gustave Acault. Die Acaults wohnen in einem besseren Viertel, in der Rue de Languedoc; der Onkel unterhält hier eine kleine Bibliothek und die Tante vornehmes Geschirr. Der siebzehnjährige Neffe bekommt ein eigenes Zimmer. Das tägliche Hackfleisch auf den Tellern im Fleischerhaushalt soll den Lungenkranken kräftigen und die Heilung unterstützen. Sein großes Sommerglück am Strand, Baden und Fußballspielen sind ein für alle Mal beendet. Er ist verbittert und verändert sich. Die Krankheit bringt ihn, mehr noch als die Lehrer, zum Lesen und zum Schreiben. Eine Zeit der rauschhaften Lektüren beginnt. Sein Bruder Lucien behauptet bald, ihn gar nicht wiederzuerkennen.
In seinem ersten eigenen Zimmer über der Fleischerei schreibt der dem Tod nur knapp Entronnene den kurzen Prosatext: «L’Hôpital du quartier pauvre» (Das Krankenhaus des Armenviertels). Der erste Satz ist ein hauchzarter Lyrismus: «Aus dem blauen Himmel senkte sich millionenfach ein kleines weißes Lächeln».[1] Dann kommt der Erzähler auf die Kranken, auf ihr Husten, ihre Hässlichkeit und Magerkeit zu sprechen. Ein gewisser Jean Perès soll trotz seiner kranken Lunge seine Frau zwei, drei Mal am Tag bestiegen haben. Die Krankheit habe ihn so wild gemacht. Doch ein kranker Mann halte so etwas nicht aus. Am Ende sei er gestorben. Überhaupt seien die meisten Kranken inzwischen gestorben, die anderen klammerten sich an die Hoffnung. Zwischendurch wird es einmal ganz still. Nur die Sonne ist zu sehen und, hoch oben am Himmel, ein Flugzeug.
Nach zweieinhalb Seiten fällt der Vorhang. Die Geschichte ist zu Ende. Sie ist komisch und poetisch und lakonisch, als sei das nicht der Ort für viele Worte, als verstehe sich alles von selbst. In der Einsilbigkeit wohnt die Todesangst wie ein altbekannter Gast.
Gides Früchte der Erde
Onkel Acault ist ein lesender Fleischermeister, ein Genussmensch und ein Libertin, der seine Freizeit mit Victor Hugo, Anatole France und Honoré de Balzac verbringt. Er drückt dem kranken Neffen fürs Erste die Bücher von André Gide in die Hand. Gides algerischer Hymnus Früchte der Erde erschien 1897, nach langen Reisen durch Tunesien und Algerien, die er mit dem Maler-Freund Paul Albert Laurens unternahm. Camus findet hier seine Welt wieder. Gide erkrankte in Algerien ebenfalls an Tuberkulose, und auch für ihn war die Krankheit nur ein Grund mehr, die Schönheiten dieses Landes zu besingen, den heißen Sand, die nackten Körper, die «wunderbare Strahlkraft jedes Augenblicks vor dem tiefdunklen Hintergrund des Todes»[1].
Wenn sich Camus später von Gide distanziert, soll man sich nicht täuschen lassen: Die Früchte der Erde haben einen großen Eindruck auf den schwer erkrankten Gymnasiasten gemacht. Gide ist Camus’ Erweckungserlebnis. Nachdem er dessen trunkene und ekstatische Essays gelesen hat, fasst er den Entschluss, Schriftsteller zu werden. Seine frühen algerischen Texte sind unmittelbar von Gides Früchte der Erde inspiriert. Legt man die Essays beider Autoren nebeneinander, fallen die Ähnlichkeiten beinahe auf jeder Seite ins Auge. Lesen wir bei Gide: «Mach keinen Unterschied zwischen Gott und deinem Glück und lege all dein Glück in den Augenblick»[2]; so schreibt Camus: «Ich lerne, dass es kein übermenschliches Glück gibt und keine Ewigkeit außer dem Hinfließen der Tage».[3]
In seinem Nachruf auf Gide wird Camus trotzdem darauf beharren, dass die Früchte der Erde – von denen er immerhin einräumt, sie seien damals das «Evangelium der Armut» gewesen, dessen er bedurfte – kein Vorbild für ihn waren. Er habe das Buch dem Onkel enttäuscht zurückgegeben. In den Kriegsjahren habe er mit Gide in einer Wohnung in der Rue Vaneau gewohnt, das sei aber alles, was sie jemals geteilt hätten.[4]
Der Grund für diese merkwürdige Abkehr von Gide war der stärkere Eindruck, den der wahre Meister und Lehrer seiner Jugendjahre, Jean Grenier, auf Camus machte. Noch im Vorwort zu dessen Jugendwerk Die Inseln, das Camus wenige Monate vor seinem Tod verfasste, spielt er die beiden Ziehväter Gide und Grenier gegeneinander aus:
«Die ‹Früchte der Erde› waren ein Schock für meine ganze Generation. Aber was die ‹Inseln› uns an Neuem eröffneten, war ganz anderer Art. Sie kamen uns entgegen; der Gidesche Überschwang rief bei uns Bewunderung und Ratlosigkeit zugleich hervor. Wir mussten nicht erst von den Fesseln der Moral befreit werden, noch mussten wir in die Hymnen auf die Naturfrüchte einstimmen. Die Gideschen Früchte hingen greifbar vor unseren Augen, wir brauchten nur hineinzubeißen. Einige von uns mussten mit dem Elend und dem Leiden leben. Doch wir lehnten uns mit der ganzen jugendlichen Kraft dagegen auf. Die Wahrheit der Welt lag für uns in ihrer Schönheit, in den Freuden, die sie uns bot. Wir lebten also mit dieser Empfindung an der Oberfläche der Welt, zwischen Farben und Wellen und dem starken Duft der Erde. Aus diesem Grund kamen die Gideschen ‹Früchte› mit ihrer Einladung zum Glück viel zu spät. […] Wir brauchten feinsinnigere Lehrer, einen Mann etwa, der von anderen Ufern kam, der auch das Licht und die Herrlichkeit des Körpers liebte und der uns in einer unnachahmlichen Sprache sagte, dass die Erscheinungen der Natur schön, aber auch vergänglich seien, und dass man sie also ohne Hoffnung lieben müsse».[5]
Diese Zurückweisung eines weltberühmten Buches zugunsten der heute zu Recht in Vergessenheit geratenen essayistischen Prosa seines Lehrers verrät viel über das Loyalitätssystem, dem Camus folgte. Wieder sind es die Treue und die Hingabe zu den «Seinen», die ihn veranlassen, seine Geschichte umzuschreiben. Jean Grenier, Camus’ Förderer, Ratgeber, Lektor und Lehrer, gehört zu ihnen, André Gide, der großbürgerliche Weltenbummler, der nicht arbeiten musste, nie arm war und in Begleitung junger Männer exotische Länder wie Algerien bereiste, eben nicht. Man sucht sich seine Freunde selber aus.
Noces – die Hochzeit des Lichts
Die vier kurzen lyrischen Prosatexte, die Camus 1939 in einer Auflage von 225 Exemplaren unter dem Titel Noces (Hochzeit des Lichts) in der Edition seines Freundes Edmond Charlot in Algier herausbrachte, gehören zu den schönsten Texten seines Werkes. Es ist nach L’Envers et l’Endroit (Licht und Schatten) sein zweites Buch und hat nicht mehr dessen sympathische Schutzlosigkeit, sondern ist bis in den Satzrhythmus hinein durchkomponiert. Das belegen auch die zahlreichen Korrekturen der Manuskriptfassungen. Drei dieser Essays führen an algerische Schauplätze, der letzte, «Wüste» überschrieben, in die Toskana. Entstanden sind sie in der Zeit, als Camus nicht mehr im Fleischerhaushalt lebt, sondern als Dandy in Anzug und Fliege durch Algier und seine Frauenbetten vagabundiert. Sie gehen zurück auf Reisen, die er mit der algerischen Jeunesse dorée nach Florenz und Tipasa unternahm, und auf einen Ausflug mit der Baronin Marie Viton, die den mondänen Jungautor zu einer Besichtigung der römischen Ruinen mit dem eigenen Flugzeug nach Djemila flog. Sie erzählen von einer Überschwänglichkeit und einem Übermut, den der Verfasser längst verloren hat und mit seinen Freundinnen für die Fotokamera nur noch nachstellt.
Mit Freundinnen in Tipasa, 1935
Der Eröffnungsessay, «Hochzeit in Tipasa», ist eine Meditation über die römische Ruinenstätte Tipasa, knapp 70 Kilometer westlich von Algier hoch über dem Meer gelegen. Der erste Satz dieses Essays ist berühmt: «Im Frühling wohnen in Tipasa die Götter.» Camus hat für die Feier des Lichts, der glühenden Landschaft aus Meer, Hibiskus, Teerosen, Zypressen und Kiefern einen antiken Hintergrund gewählt. Wie alle algerischen Bücher Camus’ – und Camus hat beinahe ausschließlich algerische Bücher geschrieben – versteht man sie nur, wenn man sie auch liest als ein Zeugnis poetischer Landeskunde.
Tipasa – eine phönizische Handelsniederlassung, römische Kolonie und frühchristliche Pilgerstätte, die vom Chenoua-Massiv überragt wird – ist ein touristisches Ausflugsziel für die Bewohner von Algier und ein kompliziertes historisches Monument: Die Ruinenstätte war Zeugnis der Überlagerung und Vernetzung dreier Hochkulturen, also alles andere als der geeignete Ort für die Feier des geschichtslosen Augenblicks eines mystischen Naturerlebens. Camus vertieft die komplexe historische und weltanschauliche Ausgangslage nicht, doch er versucht, die geistige Flughöhe zu halten.
Der Essay badet in den Gerüchen der Erde, er singt von der Liebe und der Freude, die vom Himmel aufs Meer niedergehen, er wirft sich in die Wermutbüsche, atmet ihren Duft.
Im Tagebuch des Jahres 1938 findet man eine geheimnisvolle Notiz zu Noces: «Es ist die Aufgabe des Menschen, den großen, von den Göttern verlassenen Tempel mit unbenennbaren Idolen nach seinem Bilde zu bevölkern: diese ungeheuerlichen Idole der Freude, Antlitz der Liebe und tönerne Füße».[1] Es ist die Aufgabe des Menschen – so schreibt Camus in diesen Jahren gern.