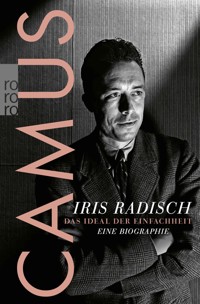9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jean-Paul Sartre hat einst von Paris aus eine ganze Generation junger Europäer geprägt. Michel Houellebecq beschreibt Frankreich inzwischen als Land in der Krise: Die französische Literatur der Nachkriegszeit war stets Programm, mal existenzialistisch, mal politisch, immer verführerisch. Iris Radisch begibt sich auf einen Streifzug durch die neuere französische Literatur und stellt die wichtigsten Autoren vor. Die «Zeit»-Journalistin und Verfasserin eines Bestsellers über Albert Camus lässt sich von ihren eigenen Treffen mit den Autoren leiten und liefert einen einfühlsamen Überblick über die Welt von Sartre bis Duras, von Assia Djebar bis zu Patrick Modiano, Yasmina Reza und Houellebecq. Das Buch ist ein persönlicher Kanon der bedeutendsten Schriftsteller und Schriftstellerinnen Frankreichs – und richtet sich an alle, für die das Nachbarland schon immer der kulturelle und literarische Sehnsuchtsort war. In einem Jahr, in dem Frankreich einen neuen Präsidenten gewählt hat und vor dem Aufbruch steht, will dieses Buch gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Debatte über den intellektuellen Stand der Dinge leisten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Iris Radisch
Warum die Franzosen so gute Bücher schreiben
Von Sartre bis Houellebecq
Über dieses Buch
Jean-Paul Sartre hat einst von Paris aus eine ganze Generation junger Europäer geprägt. Michel Houellebecq beschreibt Frankreich inzwischen als Land in der Krise: Die französische Literatur der Nachkriegszeit war stets Programm, mal existenzialistisch, mal politisch, immer verführerisch.
Iris Radisch begibt sich auf einen Streifzug durch die neuere französische Literatur und stellt die wichtigsten Autoren vor. Die «Zeit»-Journalistin und Verfasserin eines Bestsellers über Albert Camus lässt sich von ihren eigenen Treffen mit den Autoren leiten und liefert einen einfühlsamen Überblick über die Welt von Sartre bis Duras, von Assia Djebar bis zu Patrick Modiano, Yasmina Reza und Houellebecq.
Das Buch ist ein persönlicher Kanon der bedeutendsten Schriftsteller und Schriftstellerinnen Frankreichs – und richtet sich an alle, für die das Nachbarland schon immer der kulturelle und literarische Sehnsuchtsort war.
In einem Jahr, in dem Frankreich einen neuen Präsidenten gewählt hat und vor dem Aufbruch steht, will dieses Buch gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Debatte über den intellektuellen Stand der Dinge leisten.
Impressum
Redaktion Barbara Hoffmeister
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-00118-3
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1. KapitelDie Sartre-Jahre
Sommer 1944
Am 5. August 1944 lässt sich Ernst Jünger zum letzten Mal in Paris die Haare schneiden. Er ist sich sicher, dass es das letzte Mal ist. Und sein Friseur weiß es auch. Die Amerikaner stehen schon bei Rennes. Vier Jahre lang ist Hauptmann Jünger in der besetzten Stadt stationiert gewesen und hat jeden Schriftsteller getroffen, der bereit war, einem Besatzungsoffizier aus dem Hauptquartier des deutschen Militärbefehlshabers die Hand zu geben, Jean Cocteau, Jean Giraudoux, Marcel Jouhandeau, Henry de Montherlant, Paul Léautaud, Pierre Drieu la Rochelle. Jünger geht noch einmal hinauf nach Montmartre und sieht hinunter auf die Stadt in der flirrenden Sonne. Er macht einen Abschiedsbesuch im literarischen Salon von Florence Gould in der Avenue de Malakoff. Er kauft sich in der Rue Copernic ein Notizbuch. «J’espère que les choses s’arrangerons», ich hoffe, dass sich alles regelt, sagt der Friseur zum Abschied.
Jean-Paul Sartre stand vor wenigen Wochen zum letzten Mal in seinem Leben vor einer Schulklasse im Lycée Condorcet. Ende Mai war sein Stück Geschlossene Gesellschaft am Théâtre du Vieux-Colombier uraufgeführt worden. Ein großer Erfolg. Wenige Tage später landeten die Alliierten in der Normandie. Die Befreiung liegt in der Luft, und ein über Nacht berühmt gewordener und schielender Philosophielehrer ist ihr Held.
Noch flattern auf den Pariser Straßen die Hakenkreuzfahnen. Noch trinken Herren mit strengem Scheitel und Reichsadler an der feldgrauen Brust im Café de Flore ihre Limonade. Im April meldeten die Zeitungen über vierhundert Tote bei Luftangriffen an der Gare de la Chapelle. Im Juni verbrannte die SS in Oradour-sur-Glane Hunderte von Zivilisten bei lebendigem Leib in der Dorfkirche; es gibt Gerüchte über Kinder, die an Fleischerhaken erhängt worden seien. Die Deutschen, die im Salon der reichen Amerikanerin Florence Gould über das Pariser Theaterleben parlieren und in den Kästen der Bouquinisten an den Quais französische Gedichtbände suchen, verhaften des Nachts ihre Feinde, foltern und exekutieren. In «jeder Sekunde», schreibt Sartres Lebensgefährtin Simone de Beauvoir im Rückblick über das Sommergefühl des Jahres 1944, «konnte jemand, den man liebte, getötet werden».[1]
Albert Camus hatte zwei Jahre zuvor einen kleinen Essay veröffentlicht, in dem es darum ging, dass der Mensch in der Welt fremd sei, ausgesetzt und verstoßen, einsam in einem Meer des Absurden. Der Mythos des Sisyphos sprach den Parisern aus der Seele. Doch nicht jeden Tag ist Weltuntergang. Es gibt auch Nächte, in denen Camus mit der Sartre-Geliebten Simone Jollivet einen Paso doble tanzt. Es gibt Nächte, in denen man sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen muss, in denen man trinkt und sich verliebt. Die Feste der französischen Schriftsteller dauern bis weit nach der Sperrstunde. Im Morgengrauen fährt man dann durch das menschenleere Paris nach Hause.
Die Pariser Sommergäste, die in dieser Saison in den Künstlerwohnungen von Saint-Germain-des-Prés die Nacht zum Tag machen, sind Albert Camus und die Schauspielerin Maria Casarès, Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre, Michel und Louise Leiris, der Schriftsteller und Gallimard-Lektor Raymond Queneau, Jacques-Laurent Bost und Olga Kosakiewicz, Pablo Picasso und dessen Muse Dora Maar, der frisch aus dem Gefängnis entlassene Schriftsteller Jean Genet, der Bibliothekar Georges Bataille, der Psychoanalytiker Jacques Lacan und der Dichter Paul Éluard.
Das Ehepaar Leiris wohnt in einem großen Appartement am Seineufer, ganz in der Nähe von Picassos Atelier. Michel Leiris, Schwiegersohn des einflussreichen Kunsthändlers Daniel-Henry Kahnweiler und vier Jahre älter als Sartre, ist bereits ein bekannter Ethnologe, der Forschungsreisen nach Afrika unternommen hat und am Musée de l’Homme arbeitet. Sartre hatte Leiris’ Autobiographie Mannesalter begeistert besprochen, Leiris nicht weniger freundlich Sartres Fliegen, auch Sartre und Camus haben einander reichlich mit literaturkritischem Lob bedacht – man weiß, was sich gehört.
In Leiris’ Wohnung am Quai des Grands-Augustins hören die Freunde BBC und Jazz, verbünden sich, planen die Zukunft Frankreichs, die sich, anders als die Pariser Friseure glauben, nicht von allein regeln wird. In der Erwartung einer endgültigen Niederlage der Deutschen hält sich im Herzen von Paris eine kleine Gruppe junger Schriftsteller bereit, die französische Geistesrepublik zu übernehmen. Man kann es auch so sagen: Die Sartre-Jahre stehen vor der Tür.
Kein Zweifel, der 39-jährige Schullehrer will an die Macht. Sartre, Pariser Bildungsbürgerkind und Absolvent der École Normale Supérieure, kennt die Regeln, nach denen im Quartier Latin gespielt wird. Er will zusammen mit dem Gallimard-Lektor Camus und seinem Schulkollegen, dem Philosophielehrer Maurice Merleau-Ponty, eine Zeitschrift gründen, er will ein Gruppenmanifest, er will die Pariser Theater beherrschen, er will Chansons schreiben, Drehbücher, Zeitungsartikel, Literaturkritiken, philosophische Grundsatzwerke; Letztere wenn möglich im Größenmaßstab von Martin Heideggers Sein und Zeit, seit seinem Berlin-Aufenthalt vor zehn Jahren die Lektüre, für die er sich begeistert. Die Zukunft ist ein freies Spielfeld, und Sartre ist dabei, seine Mannschaft zusammenzustellen, um es zu besetzen und der Nachkriegszeit seinen Stempel aufzudrücken. In den weinseligen Nächten dieses letzten Sommers alter Zeitrechnung klettert er schon mal auf einen Schrank und dirigiert ein imaginäres Orchester, während Camus am Boden auf Kochtöpfe schlägt.
Lesung eines Picasso-Stücks am 9. März 1944; vorn Sartre, Camus und Michel Leiris, hinten l. Jacques Lacan, 4. v.l. Louise Leiris neben Picasso, 2.v.r. Simone de Beauvoir.
Die Voraussetzungen für eine intellektuelle Machtübernahme waren günstig. Sartres Debüt Der Ekel (1938) und sein Erzählungsband Die Mauer (1939) wurden in Paris gefeiert. Im Jahr zuvor war sein achthundertseitiges philosophisches Hauptwerk Das Sein und das Nichts mit Erlaubnis des NS-Zensors Gerhard Heller bei Gallimard erschienen. Zwar haben seitdem nur wenige das grandios redselige Evangelium des französischen Existentialismus – Sartres von den deutschen Philosophen Hegel, Husserl und Heidegger inspirierte philosophische Grundlegung der menschlichen Freiheit – bewältigt, doch ist man vorauseilend begeistert.
Camus macht eine höfliche Bemerkung in seinem Tagebuch, aus der man schließen kann, dass er das Werk bis zur Seite 136 gelesen hat (Sartre wird dem Freund acht Jahre später, bei ihrem großen Zerwürfnis, nicht zu Unrecht unterstellen, er habe sich nicht die Mühe gemacht, Das Sein und das Nichts zu lesen). Martin Heidegger, dem das Buch von seinem französischen Gewährsmann Jean Beaufret zugesandt wurde, machte ein paar artige Bemerkungen über das literarische Talent des jungen Franzosen, legte das Werk jedoch schnell zur Seite. Das beste Buch des Vorjahres war für ihn nicht Das Sein und das Nichts, sondern Der kleine Prinz, dessen Erfinder Antoine de Saint-Exupéry seit ein paar Tagen, nach einem Aufklärungsflug über dem Mittelmeer, vermisst wird.
Bei Kriegsbeginn ist Sartre noch nicht der große Sartre gewesen, der er jetzt ist: der Mann, der mit seinen Werken die Nachkriegszeit neu ordnen will. Damals war er eher eine kleine Nummer – Soldat Nr. 1991 der 70. Artilleriedivision, ein schreibender Wetterbeobachter der 11. Armeegruppe, der sich die Langeweile mit autobiographischen Gelegenheitsarbeiten vertrieb. Er führte ein mehrtausendseitiges Kriegstagebuch[2], das heute zu seinen besten Werken zählt, schrieb Hunderte von Briefen an Simone de Beauvoir und seine zahllosen Nebenlieben, arbeitete an seiner Romantrilogie Die Wege der Freiheit.
Seine persönliche Kriegsbilanz umfasst 2500 Druckseiten. Schreiben ist Sartre so lebenswichtig wie atmen. Acht bis zehn Stunden ist das tägliche Minimum, um nicht zu ersticken, durchschnittlich zwanzig Seiten pro Tag wird Sartre bis zu seinem Lebensende geschrieben haben. Der «reizende Castor», wie Simone de Beauvoir sich in ihren Briefen an den «lieben Kleinen» nennt, antwortete dem Soldaten Sartre postwendend in mehrseitigen Depeschen[3] auf die Wetterstation – Eilmeldungen über ihre Kleider, ihren neuen Nagellack «im Heidekrautton», ihren Schulstundenplan, ihre Liebschaften und vieles andere Unaufschiebbare mehr. Tägliche Briefe aus dem Dôme, aus dem Viking oder aus der Milk Bar, in denen sie schreibt, dass sie Briefe schreibend im Dôme, im Viking, in der Milk Bar sitzt und die Szene zu Hause noch ins Tagebuch übertragen muss.
Die Schreibsucht des Paares trug von Anfang an hochnervöse Züge: vormittags vier Stunden, nachmittags vier Stunden. Der rigide Schreibstundenplan wurde jahrzehntelang um jeden Preis eingehalten, zur Not mit Hilfe von Aufputschmitteln. «Man leidet und leidet daran, nicht genug zu leiden», schreibt Sartre in Das Sein und das Nichts[4]. Manchmal heißt das aber auch: Man schreibt und schreibt darüber, dass man nichts zu schreiben hat. Der Blick hinter die Kulissen des legendären Paares in den posthum publizierten Kriegsbriefen war reichlich ernüchternd.
Der Briefstrom versiegte, als Sartre im März 1941 aus deutscher Kriegsgefangenschaft zurückkehrte und nicht zögerte, 1942 im besetzten Paris den Posten am renommierten Lycée Condorcet anzunehmen, nachdem dort jüdische Kollegen entlassen worden waren. Sartre mochte die Begabung zum Chefstrategen haben, ein Vorbild war er nicht. Nach ein paar folgenlosen Zusammenkünften der intellektuellen Widerstandsgruppe «Socialisme et liberté», die sich schnell wieder auflöste, bewegten Sartre und Beauvoir sich mühelos durch das besetzte Paris und hatten keine Bedenken, mehrfach und sogar noch im Februar 1944 in Kollaborationszeitungen wie Comœdia[5] zu publizieren oder bis zum April 1944 für den nationalsozialistisch kontrollierten Staatsfunk Radio-Vichy zu arbeiten. Ein aufrechter Résistancekämpfer wie Camus’ Freund Pascal Pia nannte Sartre dann auch in boshafter Anspielung auf die Vichy-Regierung den «Vichinsky vom Café de Flore».
Doch so einfach, wie der Moralist Pia meinte, waren die Dinge nicht. Das literarische Paris, nur ein paar weltberühmte Quadratkilometer groß, war ein Dorf, in dem jeder jeden kannte, und in dem sich die meisten in den vergangenen Jahren mehr schlecht als recht durchschlugen. Albert Camus arbeitete tagsüber im Verlag Gallimard unter der Kontrolle der deutschen Propagandastaffel und nachts für den Combat der Résistance. Bei den Sitzungen des Lektoratskomitees im Verlag traf Camus häufig auf den Lektor Ramon Fernandez, der am Abend zuvor in seiner Wohnung in der Rue Saint-Benoît den NS-Zensor Gerhard Heller oder den Direktor des Deutschen Instituts Karl Epting empfangen hatte, aber ebenso seine Nachbarin Marguerite Duras, deren Wohnung eine Etage tiefer wiederum ein Résistancetreffpunkt ihres Ehemannes Robert Antelme war, was Fernandez wusste und für sich behielt.
Häufiger Gast war auch der kollaborierende Autor und Chefredakteur der renommierten Nouvelle Revue Française Pierre Drieu la Rochelle, der alles unternahm, um den Gallimard-Lektor Jean Paulhan, nachdem dessen Verbindungen zur Résistance entdeckt worden waren, aus der Gestapohaft zu befreien. Paulhan hat den linientreuen Verlag in der Rue Sébastien Bottin sogar für Résistancetreffen genutzt, an denen auch der junge Dionys Mascolo teilnahm, nachdem er zum Liebhaber der noch nahezu unbekannten Marguerite Duras aufgestiegen war. Mit anderen Worten: Die Lage war alles andere als übersichtlich. Es gab keine klaren Fronten zwischen Kollaborateuren und Résistancekämpfern, weil alle miteinander bekannt oder befreundet waren, Tür an Tür wohnten und arbeiteten.
Am Freitag, dem 18. August 1944, erholt sich Ernst Jünger bei einem Flußbad in der Meurthe im lothringischen Saint-Dié von den Strapazen seiner Flucht aus Paris. Hitlers Befehl, beim Abzug die Seine-Brücken zu sprengen und die Stadt zu zerstören, war vom letzten deutschen Kommandanten in Paris, General von Choltitz, im Einvernehmen mit dem Stabschef der Heeresgruppe B, Generalmajor Hans Speidel, nicht befolgt worden. Hauptmann Jünger ist auf dem Weg nach Hause ins niedersächsische Kirchhorst. Er billigt die Befehlsverweigerung seiner Vorgesetzten. Im Tagebuch nennt er Speidel und von Choltitz «mutige Geister, die sich dieser Schändung widersetzten».[6] Am nächsten Tag werden in Paris die Straßen aufgerissen, Bäume gefällt und Barrikaden gebaut. Während die Alliierten auf Paris vorrücken und die Armee Leclerc schon vor den Toren steht, hat Paris beschlossen, sich zu befreien.
Und was machen der reizende Castor und Sartre? Was sie in den letzten Jahren immer getan haben. Sie sitzen morgens, mittags und abends im oberen Stockwerk des Café de Flore. Sie sind das Flore, und wenn sie einmal sterben, muss man ihnen unter dem Fußboden des Cafés ein Loch ausheben, wie manche sagen. Einzig mittags verschwinden sie für ein paar Augenblicke, um im Hotel Chaplain ein paar Ölsardinen aus der Dose zu verschlingen oder auf dem Rechaud eine Suppe zu kochen. Zur Zeit des Apéritifs sitzen sie wieder auf der Terrasse des Flore in der Sonne und trinken mit Camus einen Gin. Picasso und Dora Maar kommen mit ihrem Hund an der Leine dazu. Am Nachbartisch schwingt Jacques Prévert große Reden. Er hat die Dreharbeiten zu den Kindern des Olymp vor kurzem beendet. In der Hauptrolle die berühmte Arletty, die sich im realen Leben in einen deutschen Offizier verliebt hat und deswegen eine glänzende Karriere in den Sand setzt. «Mein Herz schlägt französisch, aber mein Hintern ist international», wird sie sich später rechtfertigen.
Das Lehrerpaar Sartre-Beauvoir ist gerade mit dem Fahrrad aus der Sommerfrische in Neuilly-sous-Clermont zurückgekehrt. Ein Weltkrieg ist das eine, die Schulferien sind das andere. Erholung muss sein, Abendessen in der Dorfgaststube, Spaziergänge über Felder, auf denen der Sommerwind das Korn wiegt. Michel und Louise Leiris waren dort mit der Nachricht aufgekreuzt, dass der Schriftsteller Jean Prévost, der das Flore gegen den Maquis getauscht und sich dem Widerstand angeschlossen hatte, am 1. August von den Deutschen erschossen worden war. Prévost war ein guter Freund des Kollaborateurs Fernandez aus der Rue Saint-Benoît und ein noch viel besserer Freund des Tags zuvor verschollenen Antoine de Saint-Exupéry. Die toten Dichter dieses Sommers. Am 11. August versuchte Drieu la Rochelle sich umzubringen, ohne Erfolg. Es wird ihm erst im März 1945 gelingen.
Der Wetterbericht meldet für den 19. August 39 Grad im Schatten. Die Pariser nehmen mitten im Aufstand ein kühlendes Bad in den Seine-Bädern. In den Zeitungen: Menschenmengen im Badetrikot. Die Gäste des Hotels Chaplain sonnen sich auf der Dachterrasse. Michel Leiris fährt seine Mutter in einem Fahrradanhänger durch die Stadt. Auf den Straßen ein ungeheurer Verkehr, Lastwagen, Busse, luxuriöse Karossen – der deutsche Exodus.
Deutsche Soldaten versuchen mit der Waffe in der Hand, den Verkehr zu regeln. In der Rue de Buci wird auf Hausfrauen geschossen, die ihre Einkäufe machen. Junge Aufständische schleichen mit dem Gewehr in der Hand die Mauern entlang, auf der Suche nach Milizsoldaten oder Deutschen. In der Rue de Seine gehen Maschinengewehrsalven auf Passanten nieder. Ein alter Mann, der nicht schnell genug weglaufen kann, trommelt vergeblich an eine Tür, um eingelassen zu werden, bevor er von den Schüssen niedergestreckt wird. Sartre, Leiris, Jacques Bost und ein paar andere besetzen die Comédie-Française, haben aber nur vier Revolver.
Am Abend essen Sartre, Leiris und der Theatermann Armand Camille Salacrou zusammen mit der Filmschauspielerin Madeleine Robinson in einem Restaurant in der Rue Montpensier. Es gibt keinen Strom, man trinkt sehr viel Rosé, Madeleine Robinson singt im Dunkeln «Aux marches du palais, aux marches du palais, y une tant belle fille». Ein brennender deutscher Lastwagen in der Gegend um Notre-Dame erleuchtet die Szenerie. Leiris notiert im Tagebuch: «Der Aufstand ist nur mehr der Hintergrund für einen durchaus angenehmen Abend.»[7]
Am Donnerstag, dem 24. August, wird im Radio gemeldet, dass die Division Leclerc in Paris einmarschiert sei. Die große Glocke von Notre-Dame beginnt zu läuten, andere Glocken fallen ein, auf den Straßen singt man die Marseillaise, Sprechchöre skandieren «Libération! Libération!». Selbst die spröde Simone de Beauvoir tanzt und singt jetzt am Boulevard du Montparnasse Hand in Hand mit den Parisern um ein Freudenfeuer.
Es wäre falsch zu behaupten, die berühmte Freiheits- und Verantwortungsethik von Sartre sei in diesen Tagen entstanden. Die elektrisierende Idee, der zufolge der Mensch in die von Gott verlassene Welt geworfen und zur Freiheit verurteilt sei, weshalb er ohne jede Hilfe den Kampf mit der Geschichte aufnehmen müsse, gab es schon in Das Sein und das Nichts. Allerdings erst auf den letzten Seiten, auf denen Sartre nach einer langwierigen phänomenologischen Erörterung des Seins und des Bewusstseins damit herausrückt, dass der Mensch «das ganze Gewicht der Welt» allein auf seinen Schultern trägt und «verantwortlich ist für die Welt und für sich selbst».[8] Dennoch liefern diese Tage die Bilder für die Geburtsstunde des Existentialismus, die bleiben werden: das euphorische Glockengeläut einer neuen Epoche und der französische Philosoph, der mit seinem Revolver die Comédie-Française bewacht, während die amerikanischen Panzer die Stadt befreien.
Es gibt keinen stichhaltigen Grund, es zu erwähnen, aber einmal muss es gesagt sein, warum also nicht jetzt: Sartre war 152 cm groß.
Camus hat sich inzwischen mit seiner Widerstandszeitung Combat in den Redaktionsräumen von Paris-Soir in der Rue Réaumur eingerichtet. An diesem Donnerstag wird die Zeitung zum ersten Mal offen auf der Straße verkauft und findet reißenden Absatz. Camus wird von einem auf den anderen Tag zu einem der einflussreichsten Chefredakteure Frankreichs. Er bittet Sartre um eine große Reportage. Der hat noch nie eine Reportage geschrieben und erst recht keine Journalistenschule besucht, aber sein Bericht über den Pariser Aufstand, der vom 28. August 1944 an in sieben Folgen in der Zeitung erscheint, wird ein journalistisches Meisterwerk: einfach, direkt, ohne Pathos. Er beschreibt die Ungewissheit, das Chaos und die leeren Straßen, die Angst und die Furchtlosigkeit der Pariser, die mitten im Gefecht in einem Bistro rasch einen Schluck Wein trinken. Sein Herz schlägt im Takt der Stadt, über die er wie über eine Gefährtin spricht: Paris schläft, Paris erhebt sich, Paris kämpft um seine Freiheit. Und mittendrin und überall dabei – Sartre. Er schreibt:
«Wer möchte schon allein in seinem Zimmer bleiben, wenn Paris um seine Freiheit kämpft? Im Übrigen ist die Gefahr unvorhersehbar. Um drei Uhr nachmittags ist sie hier, um vier Uhr ist sie dort. Warum soll man versuchen, sie zu meiden? In dieser Schicksalhaftigkeit liegt, wie ich finde, eine gewisse Größe. Sie verleiht Paris diese außergewöhnliche Physiognomie: Man läuft hundert Meter auf einer belebten, fröhlichen Straße, an der Straßenbiegung wird man festgehalten: Kampf, Kugelgeprassel, Tod. Als ich gestern aus der friedlichen rue Montorgueil wegging und bis zu den Hallen kam, herrschte dort fast die Einöde. Mitten auf der Fahrbahn lag ein riesiger umgestürzter Lastwagen, wie eine Krabbe auf dem Rücken.»[9]
Der passende Ton fliegt ihm zu, denn Sartre ist in Personalunion Akteur, Zeuge und erster Interpret des historischen Augenblicks, über dessen schicksalhafte Bedeutung er die Leser des Combat keinen Moment im Unklaren lässt. Alle in Paris, so behauptet der Reporter, spürten, dass es hier um mehr gehe als nur darum, die Deutschen aus Frankreich zu verjagen. Dies sei ein Kampf um die «Eroberung einer neuen Ordnung». Eine Ordnung, für deren ideologische Ausarbeitung und internationale Verbreitung der Berichterstatter ab sofort bis zur Erschöpfung bereitsteht.
Niemand – auch der größere und entschieden besser aussehende Frankoalgerier Albert Camus nicht – wird ihm die Rolle des ersten Intellektuellen der Nation in den kommenden Jahrzehnten streitig machen. Der bisherige Amtsinhaber, der die französische Geistesrepublik auf unzähligen Vortragsreisen durch das alte Europa repräsentierte, hat sich nach Nordafrika zurückgezogen und Camus sein Pariser Appartement überlassen – André Gide ist 74 Jahre alt und hat von sich selbst genug. Im Augenblick verbringt er seine Tage mit dem Studium Vergils in der Originalfassung. Die große Ermüdung seiner Augen zwingt ihn immer wieder, die Lektüre des lateinischen Klassikers zu unterbrechen.
Es ist zwar nicht allzu lange her, dass Marcel Proust in der behaglichen Melancholie der Gide-Jahre mit der Angelschnur seiner endlosen Sätze nach der verlorenen Zeit des alten Frankreichs fischte. Doch die schönen Tage, an denen Gebäck in Tee getunkt, Konversation betrieben und Marquisen aus der Kutsche geholfen wurde, sind Literaturgeschichte. Im Sommer 1944 ist das lange 19. Jahrhundert endgültig zu Ende gegangen.
Es ist Liebe
«Ich küsse Sie ganz leidenschaftlich, kleiner Entzückender, ganz entzückender Kleiner, alles entzückender Kleiner», «ich liebe Sie», «ich liebe Sie leidenschaftlich, mon amour», «niemand auf der Welt ist Ihren kleinen Finger wert», «ich bin außer mir vor Dankbarkeit und Bewunderung für Sie», «ich sterbe vor Sehnsucht nach Ihnen».
Es war unzweifelhaft Liebe zwischen dem besten und dem zweitbesten Abschlusskandidaten der École Normale Supérieure, an der die beiden sich 1929 kennengelernt hatten. Das Liebesarrangement von Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre ist weltbekannt, oft kopiert und unerreicht: die Zweierbeziehung ohne Monogamie, ohne Heimlichkeit, ohne Geschirrspülen. Sie überdauerte alle Krisen und endete erst nach fünfzig Jahren mit Sartres Tod im Jahr 1980. Die lebenslange Arbeitsteilung der beiden war ein wichtiger Teil ihrer Erfolgsgeschichte. Er kümmerte sich um das Sein, die Freiheit, den Kommunismus, den Algerienkrieg, das Theater und die anderen großen Männer der französischen Kultur (Flaubert, Baudelaire, Mallarmé, Genet). Sie erfand den Feminismus und arbeitete am Mythos des Paares, indem sie in ihren Memoiren und Romanen die gemeinsame Geschichte minuziös für die Nachwelt aufbereitete.
Beauvoirs annähernd dreitausendseitiges autobiographisches Werk – Memoiren einer Tochter aus guten Hause, In den besten Jahren, Der Lauf der Dinge, Alles in allem, Ein sanfter Tod, Zeremonie des Abschieds – gehört zu den umfangreichsten individuellen Lebensdokumentationen des 20. Jahrhunderts. Hinzukommen noch mehrere tausend Seiten Tagebücher und Briefe und, nicht zu vergessen, die beiden großen autobiographischen Romane Sie kam und blieb und Die Mandarins von Paris, zusammen ebenfalls annähernd zweitausend Seiten, in denen «la Grande Sartreuse», wie sie von ihren Verächtern zu Unrecht genannt wurde, die politischen und amourösen Dramen der Sartre-Jahre in verschlüsselter Form in enorm erfolgreiche und preisgekrönte Meisterwerke eines dokumentarischen Realismus überführte. Der unangefochtene Held dieses in der Schlusskalkulation etwa achttausendseitigen Versuchs einer Lebensselbstbeschreibung heißt von Anfang bis Ende: Sartre.
Was wurde an Simone de Beauvoir nicht alles bemängelt: der Rigorismus, die Kälte, das abgebremste Fünfziger-Jahre-Lächeln, der Bienenfleiß, die Frisur. Einer der häufigsten Vorwürfe entzündete sich an dem offenkundigen Widerspruch, dass die Ikone des Feminismus sich mit der Rolle der Pressesprecherin und Interpretin des französischen Meisterdenkers benügt habe.
Ihre selbstverständlich ebenfalls über tausend Seiten starke Untersuchung der Lage der Frau von der Urzeit bis zur Moderne, die unter dem Titel Das andere Geschlecht 1949 erschien und das Patriarchat mit der Parole «Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht» in Aufruhr versetzte, vertrug sich nach Ansicht ihrer Kritiker nur schlecht mit den real existierenden Machtverhältnissen hinter den Kulissen des Modellpaares. Leben und Standardwerk, so hieß es, seien unvereinbar. Während Beauvoir den Frauen empfehle, dem männlichen Entwurf nachzueifern und sämtliche traditionell vorgefundenen Weiblichkeitsbilder «zu transzendieren», stelle sie sich in den Dienst eines Mannes, dessen Gipshände auf ihrem Schreibtisch herumlägen.
Das mit den Gipshänden ist wahr, der Rest ist Unsinn. Die Sprödheit und Widersprüchlichkeit Simone de Beauvoirs fallen, gemessen an ihrer Pionierleistung als erste öffentliche weibliche Intellektuelle, kaum ins Gewicht. Außerdem hat sie für sich nie in Anspruch genommen, eine Jahrhundertschriftstellerin zu sein und die Grenzen der literarischen Konfektion zu sprengen.
«Ich bin keine virtuose Schriftstellerin gewesen, ich habe nicht – wie Woolf, wie Proust oder wie Joyce – das schillernde Spiel der Empfindungen wieder zum Leben erweckt und die Außenwelt in Worten eingefangen»[1], wird sie am Ende selbst sagen. Und in der Tat: Niemand liest die Mandarins von Paris wegen ihrer literarischen Dichte. Die wurde schon beim Erscheinen des Romans im Jahr 1954 vermisst. Doch noch immer sind die Romane von Simone de Beauvoir unverzichtbare Zeitdokumente vom Aufbruch einer jungen Pariser Elite in ein noch nie erprobtes Leben, das zum Modell für die Nachkriegsgenerationen in ganz Europa wurde.
Das Paar, das sich fast täglich sah, jeden Sommer miteinander verreiste und nur ein einziges Mal unversöhnt zu Bett ging, hat nie eine Wohnung miteinander geteilt. Sartre lebte viele Jahre mit seiner Mutter in der Rue Bonaparte, Beauvoir, abgesehen von einigen Jahren, die sie zusammen mit Claude Lanzmann in der Rue de la Bûcherie wohnte, immer allein. Über die sinnliche Dimension ihrer Liebe zu Sartre unterrichtete Simone de Beauvoir ihren amerikanischen Liebhaber Nelson Algren dahin gehend, dass Sartre erotisch nicht besonders begabt sei und man entsprechende Versuche nach ein paar Jahren eingestellt habe.
Der Entschluss, keine Kinder zu zeugen und dem kleinfamiliären Käfig, dieser zweifelhaften Hinterlassenschaft des 19. Jahrhunderts, auf diese Weise zu entkommen, wurde literarisch überhöht: Der dringend erwünschte Abbruch einer in allen Farben des Ekels ausgemalten Schwangerschaft ist der einzige Handlungsfaden in Sartres Roman Der Pfahl im Fleische. Beauvoir, die es auch nicht besser weiß, vergleicht eine Schwangerschaft mit dem Angriff eines «Polypen», der sich Tag für Tag am Körper der Frau «mästet».[2] Am Ende ihres Lebens adoptierten beide jeweils ihre letzte junge Liebhaberin an Kindes statt; so entkamen sie den Strapazen einer Familiengründung, ohne auf deren Ergebnis verzichten zu müssen. Bis dahin stand das erloschene Hauptliebespaar im Zentrum eines sich ständig erweiternden Systems wechselnder Nebenlieben namens Bianca, Olga, Wanda, Bost, Nathalie, Dolorès, Nelson, Michelle und wie sie alle hießen.
Das Rezept, nach dem hier vermeintlich hochmodern geliebt wurde, gehört in Wahrheit in die lange französische Tradition der Galanterie und kunstvollen Verstellung. Der Hochmut und die Lust an erotischen Fachsimpeleien über die jungen Liebhaberinnen, mit denen das Philosophenpaar seinen Briefwechsel würzt, stehen jenen zwischen dem Vicomte de Valmont und der Marquise de Merteuil, den unsentimentalen adligen Herrschern über ein geistreich kalkuliertes Liebessystem in Choderlos de Laclos’ Roman Gefährliche Liebschaften aus dem Jahr 1782, in nichts nach. Simone de Beauvoir an Sartre am 7. Oktober 1939 aus dem Dôme: «Ich langweile mich nicht, wie Sie sehen, die Zeit fehlt mir fast, um alles zu lesen, was ich lesen möchte; und ich werde mich in Kürze an meinen Roman setzen. Ich bin auch nicht deprimiert; wenn ich all diese Wracks sehe und all die kleinen liebenswerten und schwachen Gestalten wie Védrine, Kos, usw., dann ist mir die Vorstellung angenehm, wie stark wir sind, Sie und ich. Ich finde, bis jetzt ist es ein Erfolg für unsere Moral und unsere Lebensform; mon amour, es ist nicht nur unser Verhältnis, das Ihnen gelungen ist, es ist wirklich Ihr Leben, Ihre Moral, und im Gegenzug auch mein Leben.»[3]
Ja, die beiden haben es nicht leicht mit «Védrine, Kos, usw.». Immer wieder sind Sartre und Beauvoir gezwungen, die vollkommene erotische Freizügigkeit inklusive ausführlicher gegenseitiger Berichtspflicht mit einem ausgetüftelten Management der Nebenlieben zu kombinieren, das sich am klassischen Intrigenrepertoire der Heimlichkeiten, getarnten Reisen, Ausreden, Vertröstungen und arrangierten Treffen orientiert.
Im Sommer 1944 ist die Lage wieder einmal besonders unübersichtlich: Simone de Beauvoir und Sartre können sich die gemeinsame Geliebte, Beauvoirs ehemalige Schülerin Olga Kosakiewicz, genannt Kos, nicht mehr teilen, da diese es vorgezogen hat, Beauvoirs Liebhaber und Sartres ehemaligen Schüler Jacques-Laurent Bost zu heiraten, daraufhin verlegt sich Sartre auf Beauvoirs ehemalige Liebhaberin Bianca, genannt Védrine, sowie auf Olgas Schwester Wanda, während Beauvoir sich mit dem geehelichten Bost zufriedengeben muss. Die daraus resultierenden Probleme füllen Briefbände und sind der Rohstoff für Romane: Nebenliebhaberin Eins weiß um die Existenz der Hauptliebhaberin, ahnt aber nichts von Nebenliebhaberin Zwei, die ihrerseits Ansprüche auf ein Avancement zur Hauptliebhaberin erhebt und so weiter. Im Einzelnen ist das nachzulesen in den Romanen Sie kam und blieb, Die Mandarins von Paris und Die Zeitder Reife, die allesamt beweisen, dass die Franzosen unter anderem deswegen so gute Bücher schreiben, weil sie ein so ungewöhnlich kompliziertes Liebesleben haben.
In einer Zeit, in der die Parole der französischen Republik Liberté, Égalité, Fraternité (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) an öffentlichen Gebäuden durch den Wahlspruch Travail, Famille, Patrie (Arbeit, Familie, Vaterland) ersetzt wurde, war dies eine besondere Provokation. Versuchsteilnehmer wie Védrine, alias Bianca Lamblin, oder Nelson Algren, über dessen Verführungskünste der Schlüsselroman Die Mandarins von Paris umfangreich Auskunft gibt, sind verletzt. Bianca Lamblin schreibt Memoiren eines getäuschten Mädchens[4], und ein verbitterter Nelson Algren wird dem Playboy-Magazin anvertrauen, dass Beauvoir und Sartre andere Menschen in schlimmerer Weise benutzten als ein Zuhälter seine Prostituierte.
Das war bösartig, aber nicht abwegig. Sartre, der die Umgangsformen des Wüstlings mit der neuzeitlichen Forderung nach Transparenz verband, hat in Das Sein und das Nichts etwas vergleichbar Mitleidloses, allerdings in bestem hegelianischen Philosophenfranzösisch formuliert: «Der Geliebte fasst den Liebenden als einen Objekt-Anderen zwischen den Anderen auf, das heißt, er nimmt ihn auf dem Hintergrund der Welt wahr, er transzendiert und benutzt ihn.»[5] Was rückübersetzt in etwa bedeutet: Ja, es kommt vor, dass der Geliebte den Liebenden wie ein Objekt benutzt, aber das lässt sich nicht verhindern. Besonders dann nicht, wenn man gerade dabei ist, eine sexuelle Revolution vorzubereiten, die die Welt erschüttern soll.
Existentialismus
Am Montag, dem 29. Oktober 1945, stand in Le Monde zu lesen: 20 Uhr 30, Salle des Centraux, 8, Rue Jean Goujon, Métrostation Marbeuf, Jean-Paul Sartre spricht über das Thema «Der Existentialismus ist ein Humanismus». Dieselbe Ankündigung erschien im Combat, im Figaro und in Libération. Am Abend stürmt das Publikum die Kasse und strömt ohne Eintrittskarten in den Saal. In der wogenden Menge auszumachen: der Verleger Gaston Gallimard, der Theaterautor Armand Salacrou, die Buchhändlerin Adrienne Monnier und der Schauspieler Jean-Louis Barrault, der im Frühjahr mit den Kindern des Olymp neben der schon erwähnten Arletty Triumphe gefeiert hatte.
Es verging in diesem Herbst keine Woche, in der in den Zeitungen nicht von Sartre die Rede gewesen wäre. Gerade sind die beiden ersten Bände seines Romanzyklus Die Wege der Freiheit erschienen. Ein Sartre sehr ähnlicher Lehrer und Gelegenheitsschriftsteller namens Mathieu Delarue zappelt darin im dichten Netz der Pariser Freundschaften, hin und her gerissen zwischen den Betten verschiedener Frauen, angeekelt von der Gleichgültigkeit der Franzosen zur Zeit des Münchener Abkommens, auf der Suche nach etwas, wofür es sich lohnte zu sterben, besessen von der Panik, das Leben könnte ereignislos vergehen und man wäre an dessen Ende noch ganz derselbe wie am Anfang.
Die Zeit der Reife, Band 1, beginnt in der absurden Lebensstimmung von Sartres Der Ekel und Camus’ Der Fremde, welche eine Spätfolge der Verheerungen des Ersten Weltkrieges war. Doch anders als seine duldsamen Vorgänger Roquentin und Meursault ist der Protagonist Mathieu Delarue von der pochenden Ungeduld eines Menschen getrieben, der sich selbst nicht mehr erträgt. Sein Problem ist noch immer hochaktuell: Er hat nicht die geringste Ahnung, was er mit seiner Freiheit anfangen soll; zugleich sieht es so aus, als fände er sich in seinem Terminkalender kaum noch zurecht.
Das rasante Gesprächs- und Rendezvous-Tempo dieses ersten Teils der Trilogie bildet einen Höhepunkt in der von Balzac bis Proust reichenden Tradition des redseligen Pariser Gesellschaftsromans, dem es darauf ankommt, aus dem Leben ein soziales und urbanes Ereignis zu machen. Auch das haben die Franzosen uns voraus – in der deutschen Literatur hat sich eine vergleichbare Leidenschaft für das Gesellschaftliche selten bemerkbar gemacht.
Im zweiten und überzeugendsten Band Der Aufschub steht der Zweite Weltkrieg unmittelbar bevor. Die gespannte Atmosphäre explodiert in einem Feuerwerk gleichrangiger Erzählperspektiven, die unablässig hin und her springen und von vier verschiedenen Schauplätzen berichten, ohne dass verständlich würde, worauf dies alles hinausläuft. Mit der Rückkehr des Ministerpräsidenten Édouard Daladier nach Paris am 30. September 1938, nach der Unterzeichnung des Münchener Abkommens, endet nicht nur der Roman, sondern auch die Geduld des Autors mit der Vorkriegsmelancholie der Franzosen:
«So viele Züge und Lastwagen durchzogen Frankreich, so viel Leid, so viel Geld, so viele Tränen, so viel Geschrei in allen Radios der Welt, so viele Drohungen und Herausforderungen in allen Sprachen, so viele geheime Zusammenkünfte, und dann läuft man schließlich in einem Hof im Kreis herum und wirft Geldstücke in die Luft».[1]
So konnte es nicht weitergehen. Dieser Ansicht wird der dritte Band, Der Pfahl im Fleische, Rechnung tragen – mit geschultertem Gewehr. In diesem letzten Teil gibt ein kommunistischer Genosse namens Brunet nach dem vermeintlichen Soldatentod des wild um sich schießenden Mathieu allerhand konstruktive Unteroffiziersprosa von sich, die Sartres Ideal von einer geschichtsbezogenen Literatur leider allzu sehr entsprach. Aus dieser Sackgasse fand Sartre nie mehr heraus. Den geplanten vierten Band der Wege der Freiheit wird er nicht vollenden und auch keinen weiteren Roman mehr in Angriff nehmen. Der Ekel bleibt sein bester Roman.
Doch zurück in die Rue Jean Goujon. Als Sartre allein und zu Fuß am Abend des 29. Oktober dort eintrifft, versperren ihm mehrere hundert Leute den Weg in den Saal. In der Enge kommt es zu einem Handgemenge, Menschen fallen in Ohnmacht, Stühle werden zertrümmert. Sartre braucht eine Stunde, um sich zum Rednerpult durchzukämpfen. Er beginnt zu sprechen wie einer, der weiß, dass er das Spiel gewonnen hat, nachsichtig, aber bestimmt, ohne Manuskript, die Hände in den Hosentaschen.
Sartre hat oft gesagt, der Krieg habe sein Leben in zwei Teile geteilt. Und jetzt begann der bessere Teil. Europa lag zwar in Trümmern, es gab Berichte über den Holocaust, keine drei Monate war es her, dass die Atombombe auf Hiroshima fiel. Doch hier steht kein gebrochener Mensch, sondern ein lässiger, nicht mehr ganz junger Mann mit Schlips und gestreiftem Anzug, runder Hornbrille und leuchtend blauen Augen, der gerade von einer Amerikatournee zurückgekehrt ist und eine amerikanische Geliebte hat.
Was er an diesem Abend vorträgt, ist eine Kurzfassung seines Denkens. Anfangs wehrte sich Sartre gegen den – von dem Philosophen Gabriel Marcel stammenden – Begriff Existentialismus. Er sei kein Existentialist, hat er in Amerika noch bei jeder Gelegenheit verkündet. Inzwischen war er der Meinung, dass es nicht schaden konnte, unter der Flagge eines verheißungsvollen philosophischen Großbegriffs in See zu stechen.
Seinen Vortrag beginnt er mit dem ersten und wichtigsten existentialistischen Lehrsatz: «Die Existenz geht der Essenz voraus.» Soll heißen, der Mensch ist allein und frei. Nichts definiert ihn a priori. Das ist einerseits beängstigend, weil dieses Nichts einer absoluten Freiheit sinnlos und leer erscheinen kann – als sei man «zur Freiheit verurteilt». Andererseits ist die absolute Freiheit eine Herausforderung, aus der sich etwas Großartiges machen lässt, nämlich die Essenz, das eigene Leben. Das ist Sartres Ausgangssituation.
Den Weg, auf dem die Franzosen vom unbestimmten Sein zum Wesen gelangen sollen, malt der Redner in düsteren Farben. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass man seine Freiheit zu nichts nutzt und nur zusieht, wie andere um einen herum handeln. So erging es Roquentin in Sartres Ekel und Mathieu in Zeit der Reife. So erging es auch Sartre selbst, als er während der Besatzungszeit im Café de Flore saß. Es ist nicht auszuschließen, dass er deswegen ein schlechtes Gewissen hat. Es ist auch nicht auszuschließen, dass seine Theorie des Engagements den Widerstand nachholt, den er zur rechten Zeit nicht aufbrachte. Jedenfalls klingt er heute Abend ein wenig wie eine alte Gouvernante, die ihre Schützlinge ermahnt: «Der Mensch ist nichts anderes als das, wozu er sich macht.»[2]
Das mochte sich einfach anhören, in der Literatur bedeutete es ein Erdbeben. Insofern der Mensch, wie Sartre behauptete, «nur in dem Maße existiert, in dem er sich verwirklicht»[3], wird man in seinen Romanen vergeblich nach Kostproben aus dem verborgenen Seelenleben der Figuren suchen – sie haben keines. Alles liegt offen und geheimnislos zutage; jeder wird lediglich durch das bestimmt, was er tut. Er ist der Angestellte, der seinem Chef nie die Meinung sagt, auch wenn er glaubt, im Grunde wild und leidenschaftlich zu sein («ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur nie dazu»). Und er wird der Mensch auf dem Sterbebett sein, der es womöglich bereut, alles Wichtige in seinem Leben aufgeschoben und auf später vertagt zu haben, obwohl es nun gar kein Später mehr gibt. Die Beispiele sind erfunden. Nicht erfunden ist der Satz, auf den sie hinauslaufen: «Die Menschen haben nie ein anderes Leben als das, welches sie verdienen.»[4] Das hatte Sartre 1943 in seinem Baudelaire