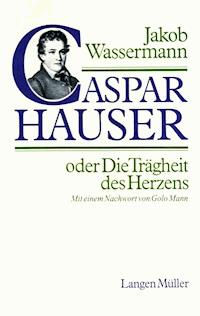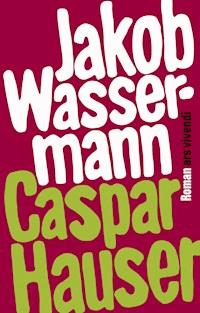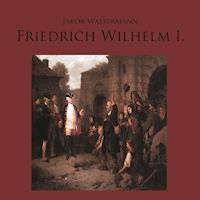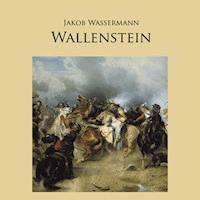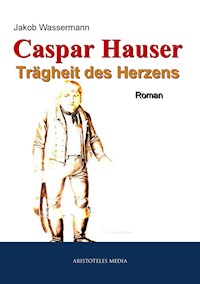
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: aristoteles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die letzten sechs Lebensjahre des Caspar Hausers: Am 26. Mai 1828 tauchte ein namenloses Findelkind in Nürnberg auf. Es war vermutlich 16 Jahre, schien geistig zurückgeblieben und war wortkarg. Seine Aussagen, dass er, solange er denken könne, bei Wasser und Brot in einem dunklen Raum gefangen gehalten worden war, erregten internationales Aufsehen. Einem Gerücht zufolge soll Caspar Hauser, wie er schließlich genannt wurde, der Erbprinz von Baden sein, den man im Kampf um die Thronfolge gegen einen sterbenden Säugling ausgetauscht und beiseite geschafft habe. Hauser starb am 14. Dezember 1833 an einer Stichwunde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jakob Wassermann
Caspar Hauser
Es ist noch dieselbe Sonne, die derselben Erde lacht; aus demselben Schleim und Blute sind Gott, Mann und Kind gemacht. Nichts geblieben, nichts geschwunden, alles jung und alles alt, Tod und Leben sind verbunden, zum Symbol wird die Gestalt.
Erster Teil
Der fremde Jüngling
In den ersten Sommertagen des Jahres 1828 liefen in Nürnberg sonderbare Gerüchte über einen Menschen, der im Vestnerturm auf der Burg in Gewahrsam gehalten wurde und der sowohl der Behörde wie den ihn beobachtenden Privatpersonen täglich mehr zu staunen gab.
Es war ein Jüngling von ungefähr siebzehn Jahren. Niemand wußte, woher er kam. Er selbst vermochte keine Auskunft darüber zu erteilen, denn er war der Sprache nicht mächtiger als ein zweijähriges Kind; nur wenige Worte konnte er deutlich aussprechen, und diese wiederholte er immer wieder mit lallender Zunge, bald klagend, bald freudig, als wenn kein Sinn dahintersteckte und sie nur unverstandene Zeichen seiner Angst oder seiner Lust wären. Auch sein Gang glich dem eines Kindes, das gerade die ersten Schritte erlernt hat: nicht mit der Ferse berührte er zuerst den Boden, sondern trat schwerfällig und vorsichtig mit dem ganzen Fuße auf.
Die Nürnberger sind ein neugieriges Volk. Jeden Tag wanderten Hunderte den Burgberg hinauf und erklommen die zweiundneunzig Stufen des finstern alten Turmes, um den Fremdling zu sehen. In die halbverdunkelte Kammer zu treten, wo der Gefangene weilte, war untersagt, und so erblickten ihre dichtgedrängten Scharen von der Schwelle aus das wunderliche Menschenwesen, das in der entferntesten Ecke des Raumes kauerte und meist mit einem kleinen weißen Holzpferdchen spielte, das es zufällig bei den Kindern des Wärters gesehen und das man ihm, gerührt von dem unbeholfenen Stammeln seines Verlangens, geschenkt hatte. Seine Augen schienen das Licht nicht erfassen zu können; er hatte offenbar Furcht vor der Bewegung seines eignen Körpers, und wenn er seine Hände zum Tasten erhob, war es, als ob ihm die Luft dabei einen rätselhaften Widerstand entgegensetzte.
Welch ein armseliges Ding, sagten die Leute; viele waren der Ansicht, daß man eine neue Spezies entdeckt habe, eine Art Höhlenmensch etwa, und unter den berichteten Seltsamkeiten war nicht die geringste die, daß der Knabe jede andre Nahrung als Wasser und Brot mit Abscheu zurückwies.
Nach und nach wurden die einzelnen Umstände, unter denen der Fremdling aufgetaucht war, allgemein bekannt. Am Pfingstmontag gegen die fünfte Nachmittagsstunde war er plötzlich auf dem Unschlittplatz, unweit vom neuen Tor, gestanden, hatte eine Weile verstört um sich geschaut und war dann dem zufällig des Weges kommenden Schuster Weikmann geradezu in die Arme getaumelt. Seine bebenden Finger wiesen einen Brief mit der Adresse des Rittmeisters Wessenig vor, und da nun einige andre Personen hinzukamen, schleppte man ihn mit ziemlicher Mühe bis zum Haus des Rittmeisters. Dort fiel er erschöpft auf die Stufen, und durch die zerrissenen Stiefel sickerte Blut.
Der Rittmeister kam erst um die Dämmerungsstunde heim, und seine Frau erzählte ihm, daß ein verhungerter und halbvertierter Bursche auf der Streu im Stall schlafe; zugleich übergab sie ihm den Brief, den der Rittmeister, nachdem er das Siegel erbrochen, mit größter Verwunderung einige Male durchlas; es war ein Schriftstück, ebenso humoristisch in einigen Punkten wie in andern von grausamer Deutlichkeit. Der Rittmeister begab sich in den Stall und ließ den Fremdling aufwecken, was mit vieler Anstrengung zustande gebracht wurde. Die militärisch gemessenen Fragen des Offiziers wurden von dem Knaben nicht oder nur mit sinnlosen Lauten beantwortet, und Herr von Wessenig entschied sich kurzerhand, den Zuläufer auf die Polizeiwachtstube bringen zu lassen.
Auch dieses Unternehmen war mit Schwierigkeiten verknüpft, denn der Fremdling konnte kaum mehr gehen; Blutspuren bezeichneten seinen Weg, wie ein störrisches Kalb mußte er durch die Straßen gezogen werden, und die von den Feiertagsausflügen heimkehrenden Bürger hatten ihren Spaß an der Sache. »Was gibt’s denn?« fragten die, welche den ungewohnten Tumult nur aus der Ferne beobachteten. »Ei, sie führen einen betrunkenen Bauern,« lautete der Bescheid.
Auf der Wachtstube bemühte sich der Aktuar umsonst, mit dem Häftling ein Verhör anzustellen; er lallte immer wieder dieselben halb blödsinnigen Worte vor sich hin, und Schimpfen und Drohen nutzte nichts. Als einer der Soldaten Licht anzündete, geschah etwas Sonderbares. Der Knabe machte mit dem Oberkörper tanzbärenhaft hüpfende Bewegungen und griff mit den Händen in die Kerzenflamme; aber als er dann die Brandwunde verspürte, fing er so zu weinen an, daß es allen durch Mark und Bein ging.
Endlich hatte der Aktuar den Einfall, ihm ein Stück Papier und einen Bleistift vorzuhalten, danach griff der wunderliche Mensch und malte mit kindisch-großen Buchstaben langsam den Namen Caspar Hauser. Hierauf wankte er in eine Ecke, brach förmlich zusammen und fiel in tiefen Schlaf.
Weil Caspar Hauser – so wurde der Fremdling von nun ab genannt – bei seiner Ankunft in der Stadt bäurisch gekleidet war, nämlich mit einem Frack, von dem die Schöße abgeschnitten waren, einem roten Schlips und großen Schaftstiefeln, glaubte man zuerst, es mit einem Bauernsohn aus der Gegend zu tun zu haben, der auf irgendeine Weise vernachlässigt oder in der Entwicklung verkümmert war. Der erste, der dieser Meinung entschieden widersprach, war der Gefängniswärter auf dem Turm. »So sieht kein Bauer aus,« sagte er und deutete auf das wallende, hellbraune Haar seines Häftlings, das etwas nicht ausdrückbar Unberührtes hatte und glänzend war wie das Fell von Tieren, die in Finsternis zu leben gewohnt sind. »Und diese feinen weißen Händchen und diese sammetweiche Haut und die dünnen Schläfen und die deutlichen blauen Adern zu beiden Seiten des Halses, wahrhaftig, er gleicht eher einem adligen Fräulein als einem Bauern.«
»Nicht übel bemerkt,« meinte der Stadtgerichtsarzt, der in seinem zu Protokoll gegebenen Gutachten neben diesen Merkmalen die besondere Bildung der Knie und die hornhautlosen Fußsohlen des Gefangenen hervorhob. »So viel ist klar,« hieß es am Schluß, »daß man es hier mit einem Menschen zu tun hat, der nichts von seinesgleichen ahnt, nicht ißt, nicht trinkt, nicht fühlt, nicht spricht wie andre, der nichts von gestern, nichts von morgen weiß, die Zeit nicht begreift, sich selber nicht spürt.«
Die hohe Polizeibehörde ließ sich durch ein solches Urteil nicht aus dem vorgesetzten Gang der Untersuchung lenken; es bestand der Verdacht, daß der Stadtgerichtsarzt durch seinen Freund, den Gymnasialprofessor Daumer, beeinflußt und zu diesen Überschwenglichkeiten verführt worden sei. Der Gefängniswärter Hill wurde beauftragt, den Fremdling insgeheim zu belauern. Er spähte oft durch das verborgene Loch in der Türe, wenn sich der Knabe allein wähnen mußte; aber es war immer derselbe traurige Ernst in den bald schlaffen und beklommenen, bald wie durch den Anblick eines unsichtbaren Furchtgebildes verzerrten und zerrissenen Zügen. Es war auch vergeblich, nachts, wenn er schlief, an sein Lager zu schleichen, hinzuknien, auf den Atem zu horchen und zu warten, ob er verräterische Worte aus dem Innern auf die Lippen trug; Leute, die Übles im Schild führen, pflegen nämlich aus dem Schlaf zu reden, auch schlafen sie eher bei Tag als bei Nacht, wo sie ihren Gedanken und Entwürfen nachhängen, aber diesen umfing der Schlummer, sobald die Sonne sank, und er erwachte, wenn sich der erste Morgenstrahl durch die verschlossenen Läden zwängte. Es konnte Argwohn wecken, daß er jedesmal zusammenzuckte, wenn die Tür seines Gefängnisses geöffnet wurde; wahrscheinlich jedoch gab sich darin nicht die Angst eines schuldbewußten Gemüts zu erkennen, sondern vielmehr eine übermäßige Erregbarkeit der Sinne, denen jeder Laut von außen zu qualvoller Nähe kam.
»Unsre Herren auf dem Rathaus werden noch viel Papier beschmieren müssen, wenn sie auf dem Weg weiterkommen wollen,« sagte der gute Hill eines Morgens – es war der dritte Tag der Haft Caspar Hausers – zu Professor Daumer, der den Fremdling besuchen wollte; »ich kenne gewiß alle Schliche des Lumpenvolks, aber wenn der Bursche ein Simulante ist, will ich mich hängen lassen.«
Hill sperrte auf, und Professor Daumer trat in die Kammer. Wie gewöhnlich erschrak der Gefangene, aber als der Ankömmling einmal im Raum war, schien ihn Caspar Hauser nicht mehr zu gewahren und schaute, bezaubert im dumpfen Nichtwissen, still vor sich nieder.
Da geschah es, als Hill den Fensterladen geöffnet hatte, daß der Knabe, vielleicht wie nie zuvor in seinem Leben, den gefesselten Blick erhob, ihn von der schweigenden, gleichmäßigen Furcht wegkehrte, die das Innere seiner Brust beherbergen mochte, und ihn durchs Fenster hinausschweifen ließ in das besonnte Freie, wo Ziegeldach an Ziegeldach sich steil und glühendrot auf einem Hintergrund von bläulich dämmernden Wiesen und Wäldern malte. Er streckte seine Hand aus; Überraschung und freudloses Staunen verzog seine Lippen, zögernd griff er mit dem Arm in das funkelnde Gemälde, als ob er das bunte Durcheinander draußen mit den Fingern anfassen wolle, und als er sich überzeugt hatte, daß es nichts war, etwas Fernes, Trügerisches, Ungreifbares, da verfinsterte sich sein Gesicht, und er wandte sich unwillig und enttäuscht ab.
Am selben Nachmittag kam der Bürgermeister Binder in Daumers Wohnung und teilte im Verlauf eines Gesprächs über den Findling mit, daß die Herren vom Stadtmagistrat eher feindlich und ungläubig als wohlwollend gegen diesen gestimmt seien.
»Ungläubig?« entgegnete Daumer verwundert, »in welcher Beziehung ungläubig?«
»Nun ja, man nimmt an, daß der Bursche sein Gaukelspiel mit uns treibt,« versetzte der Bürgermeister.
Daumer schüttelte den Kopf. »Welcher Mensch von Verstand oder Geschicklichkeit wird sich aus purer Heuchelei dazu herbeilassen, von Brot und Wasser zu leben, und alles, was dem Gaumen behagt, mit Ekel von sich weisen?« fragte er. »Um welches Vorteils willen?«
»Gleichviel,« antwortete Binder unschlüssig; »es scheint eine verwickelte Geschichte. Da niemand sagen noch vermuten kann, worauf das Spiel hinaus will, ist Vorsicht um so mehr geboten, als man durch leichtsinnige Gutgläubigkeit den gerechten Hohn der Urteilsfähigen herausfordert.«
»Das klingt ja beinahe, als ob nur die Zweifler und Neinsager urteilsfähig heißen könnten,« bemerkte Daumer stirnrunzelnd. »Von der Gilde haben wir leider genug.«
Der Bürgermeister zuckte die Achseln und blickte den jungen Lehrer mit jener milden Ironie an, welche die Waffe der Erfahrenen gegenüber den Enthusiastischen ist. »Wir haben eine neuerliche Untersuchung durch den Gerichtsarzt beschlossen,« fuhr er fort. »Der Magistratsrat Behold, der Freiherr von Tucher und Sie, lieber Daumer, sollen dieser Untersuchung kommissarisch beiwohnen. Der aufzunehmende Akt wird dann, zusammen mit den bereits vorhandenen polizeilichen Protokollen, der Kreisregierung überschickt.«
»Ich verstehe: Akten, Akten,« sagte Daumer spöttisch lächelnd.
Der Bürgermeister legte ihm die Hand auf die Schulter und erwiderte gutmütig: »Seien Sie nicht so überlegen, Verehrter; unsre Welt schmeckt nun einmal nach Tinte, und daran habt ihr Bücherwürmer doch wahrlich nicht die wenigste Schuld. Übrigens,« er griff in die Rockbrust und brachte ein zusammengefaltetes Stück Papier zum Vorschein, »als Mitglied der Kommission werden Sie gebeten, Einblick in ein wichtiges Dokument zu nehmen. Es ist der Brief, den unser Gefangener beim Rittmeister Wessenig abgegeben hat. Lesen Sie.«
Das mit keiner Namensunterschrift versehene Schreiben lautete: »Ich schicke Ihnen hier einen Burschen, Herr Rittmeister, der möchte seinem König getreu dienen und will unter die Soldaten. Der Knabe ist mir gelegt worden im Jahre 1815, in einer Winternacht, da lag er an meiner Tür. Hab’ selber Kinder, bin arm, kann mich selber kaum durchbringen, er ist ein Findling, und seine Mutter hab’ ich nicht erfragen können. Hab’ ihn nie einen Schritt aus dem Haus gelassen, kein Mensch weiß von ihm, er weiß nicht, wie mein Haus heißt, und den Ort weiß er auch nicht. Sie dürfen ihn schon fragen, er kann es aber nicht sagen, denn mit der Sprache ist es noch schlecht bei ihm bestellt. Wenn er Eltern hätte, wie er keine hat, wär’ was Tüchtiges aus ihm geworden, Sie brauchen ihm nur etwas zu zeigen, da kann er es gleich. Mitten in der Nacht hab’ ich ihn fortgeführt, und er hat kein Geld bei sich, und wenn Sie ihn nicht behalten wollen, müssen Sie ihn erschlagen und in den Rauchfang hängen.«
Als Daumer gelesen hatte, gab er dem Bürgermeister das Schriftstück zurück und ging mit ernster Miene auf und ab.
»Nun, was halten Sie davon?« forschte Binder; »einige unsrer Herren sind der Ansicht, der Unbekannte selbst könne den Brief geschrieben haben.«
Daumer hielt mit einem Ruck in seiner Wanderung inne, schlug die Hände zusammen und rief: »Ach, du himmlische Gnade!«
»Dazu ist natürlich gar kein Grund vorhanden,« beeilte sich der Bürgermeister hinzuzufügen. »Daß bei der Abfassung des Schreibens eine zweckvolle Tücke gewaltet hat, daß es dazu bestimmt ist, Nachforschungen zu erschweren und irrezuführen, ist offenbar. Es ist eine schnöde Kaltherzigkeit im Ton, die mir von Anfang an den Verdacht erregt hat, daß der Jüngling das unschuldige Opfer eines Verbrechens ist.«
Eine mutige Meinung, in welcher der Bürgermeister durch einen Vorgang sehr bestärkt wurde, der sich ereignete kurz nachdem die Herren von der Kommission am folgenden Morgen das Gefängnis Caspar Hausers betreten hatten. Während der Wärter damit beschäftigt war, den Knaben zu entkleiden, ließ sich drunten in einer Gasse am Burgberg eine Bauernmusik hören und zog mit klingendem Spiel an der Mauer vorüber. Da lief ein grauenhaft anzuschauendes Zittern über den Körper Hausers, sein Gesicht, ja sogar seine Hände bedeckten sich mit Schweiß, seine Augen verdrehten sich, alle Fibern lauschten dem Schrecken entgegen, dann stieß er einen tierischen Schrei aus, stürzte zu Boden und blieb zuckend und schluchzend liegen.
Die Männer erbleichten und sahen einander ratlos an. Nach einer Weile näherte sich Daumer dem Unglücklichen, legte die Hand auf sein Haupt und sprach ein paar tröstende Worte. Dies wirkte beruhigend auf den Jüngling, und er wurde stille; nichtsdestoweniger schien der ungeheure Eindruck des gehörten Schalls seinen Leib von innen und von außen verwundet zu haben. Tagelang nachher zeigte sein Wesen noch die Spuren der empfundenen Erschütterung; er lag fiebernd auf dem Strohsack, und seine Haut war zitronengelb. Teilnahmsvollen Fragen gegenüber war er allerdings herzlich bewegt, und er suchte nach Worten, um seine Erkenntlichkeit zu beweisen, wobei sein sonst so klarer Blick sich in dunkler Pein trübte; besonders für den Professor Daumer, der zwei- bis dreimal täglich zu ihm kam, legte er eine zärtliche Dankbarkeit, schweigend oder stammelnd, dar.
Bei einem dieser Besuche war Daumer mit dem Knaben ganz allein, und das zum erstenmal; der Wärter hatte auf seine Bitte das untere Tor abgesperrt. Er saß dicht neben dem Gefangenen, er redete, fragte, forschte, alles mit einem vergeblichen Aufwand von Innigkeit, Geduld und List. Zum Schluß beschränkte er sich darauf, das Tun und Lassen des Jünglings voll Spannung zu beobachten. Plötzlich stieß Caspar Hauser seine verworrenen Laute aus: er schien etwas zu fordern und spähte suchend herum. Daumer erriet bald und reichte ihm den gefüllten Wasserkrug, den Hill auf die Ofenbank gestellt hatte. Caspar nahm den Krug, setzte ihn an die Lippen und trank. Er trank in langen Schlücken, mit beseligter Gelöstheit und einem begeisterten Aufleuchten der Augen, wie wenn er für den kurzen Zeitraum des Genusses vergessen hätte, daß das dämonisch Unbekannte auf allen Seiten ihn bedrängte.
Daumer geriet in eine seltsame Aufregung. Als er nach Hause kam, durchmaß er länger als eine halbe Stunde mit großen Schritten sein Studierzimmer. Gegen acht Uhr pochte es an der Tür, seine Schwester trat ein und rief ihn zum Abendessen. »Was glaubst du, Anna,« rief er ihr lebhaft und mit beziehungsvollem Ton zu, »zweimal zwei ist vier, wie?«
»Es scheint so,« erwiderte das junge Mädchen, verwundert lachend, »alle Leute behaupten es. Hast du denn entdeckt, daß es anders ist? Das sähe dir ähnlich, du Aufwiegler.«
»Nicht gerade das hab’ ich entdeckt, aber doch etwas der Art,« sagte Daumer heiter und legte den Arm um die Schulter der Schwester. »Ich will einmal unsre braven Philister tanzen lassen! Ja, tanzen sollen sie mir und staunen.«
»Betrifft es etwa gar den Findling? Hast du was mit ihm vor? Sei nur auf der Hut, Friedrich, und laß dich nicht in Scherereien ein, man ist dir ohnedies nicht grün.«
»Gewiß,« gab er, rasch verstimmt, zur Antwort, »das Einmaleins könnte Schaden leiden.«
»Nun, weiß man noch gar nichts über den Sonderling?« fragte bei Tisch Daumers Mutter, eine sanfte alte Dame.
Daumer schüttelte den Kopf. »Vorläufig kann man nur ahnen, bald wird man wissen,« entgegnete er mit starr nach oben gerichtetem Blick.
Am folgenden Tag brachte die »Morgenpost« einen Artikel, der die Überschrift trug: Wer ist Caspar Hauser? Wenngleich auf diesen Appell keiner der Leser eine Antwort zu erteilen vermochte, wurde der Zudrang der Neugierigen so groß, daß das Bürgermeisteramt sich genötigt sah, die Besuchsstunden durch eine strenge Vorschrift zu regeln. Bisweilen standen die Leute Kopf an Kopf vor der offenen Tür des Gefängnisses, und in allen Gesichtern war die Frage zu lesen: Was ist es mit ihm? Was ist es für ein Mensch, der die Worte nicht versteht und dennoch sprechen kann, die Dinge nicht erkennt und dennoch sehen kann, der zu lachen vermag, kaum daß sein Weinen zu Ende, der arglos scheint und geheimnisvoll ist und hinter dessen unschuldig leuchtenden Augen vielleicht Übeltat und Schande verborgen sind?
Sicherlich spürte der Gefangene, spürte es schmerzlich, was die lüstern auf ihn gerichteten Blicke begehrten, und der Wunsch, ihnen zu willfahren, erzeugte möglicherweise die erste erhellende Dämmerung, welche ihm selbst die Vergangenheit langsam begreiflich machte, so daß er in beunruhigter Brust nach dem Gewesenen tastete, ein Gewesenes erst fühlte und die Gegenwart damit verband, im tiefsten schaudernd an der Zeit messen lernte, was sie verändernd mit ihm getan, und was er sah, mit dem verglich, was er ehedem gesehen. Er begriff das Fordernde der Frage und ward des Mittels inne, die verlangenden Mienen zu befriedigen.
Mit durstigen Sinnen suchte er das Wort. Sein flehentlicher Blick grub es heraus aus dem sprechenden Mund der Menschen.
Hier war Daumer in seinem Element. Was keinem andern, dem Arzt nicht, dem Wärter nicht, dem Bürgermeister nicht, den Protokollanten erst recht nicht gelingen wollte, das vermochte nach und nach seine Behutsamkeit und zweckvolle Geduld. Die Person des Findlings beschäftigte ihn aber auch dermaßen, daß er seiner Studien und privaten Obliegenheiten, ja beinahe seines öffentlichen Amtes darüber vergaß, und er erschien sich wie ein Mann, den das Schicksal vor das ihm allein bestimmte Erlebnis gestellt hat, wodurch sein ganzes Leben und Denken eine glückliche Bestätigung erfährt. Unter seinen Notizen über Caspar Hauser lautete eine der ersten wie folgt: »Diese in einer fremden Welt hilflos schwankende Gestalt, dieser schlafumfangene Blick, diese angstverhaltene Gebärde, diese über einem etwas verkümmerten Untergesicht edel thronende Stirn, auf welcher Frieden und Reinheit strahlen: es sind für mich Zeugen von unbesiegbarer Deutkraft. Wenn sich die Vermutungen bewahrheiten, mit denen sie mich erfüllen, wenn ich die Wurzeln dieses Daseins aufgraben und seine Zweige zum Blühen bringen kann, dann will ich der stumpfgewordenen Welt den Spiegel unbefleckten Menschentums entgegenhalten, und man wird sehen, daß es gültige Beweise gibt für die Existenz der Seele, die von allen Götzendienern der Zeit mit elender Leidenschaft geleugnet wird.«
Es war ein schwieriger Weg, den der eifervolle Pädagoge ging. Da, wo er zu beginnen hatte, war die menschliche Sprache ein wesenloses Ding, Wort um Wort mußte erst seinem Sinn angeheftet, Erinnerung erst erweckt, Ursache und Folge in ihrer Verkettung erst entschleiert werden. Zwischen einer Frage und der nächsten lagen Welten des Begreifens, ein Ja, ein Nein, oft hilflos hingeworfen, galt noch nichts, wo jeder Begriff erst aus der Dunkelheit erstand und die Verständigung von Vokabel zu Vokabel stockte. Und doch schien ein Licht wie aus weit entfernter Vergangenheit den Geist des Jünglings viel rascher zu beflügeln, als selbst der hoffnungsselige Daumer zu erwarten gewagt hatte. Es war erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit und Kraft er einmal Gesagtes festhielt und wie er aus dem Chaos unlebendiger Laute das für ihn Lebendige und Bedeutungsvolle bildvoll hervorzauberte, so daß es Daumer zumute war, als hebe er bloß Schleier von den Augen seines Schützlings, als spiele er die Rolle des Lauschers bei den langsam hervorquellenden Erinnerungen. Er hielt den Körper, indes der Geist des Knaben zurückkehrte in den Bezirk, von wo er kam, und eine Kunde brachte, dergleichen kein Ohr je vernommen.
Bericht Caspar Hausers, von Daumer Aufgezeichnet
Soweit Caspar sich entsinnen konnte, war er immer in einem dunkeln Raum gewesen, niemals anderswo, immer in demselben Raum. Niemals den Menschen gesehen, niemals seinen Schritt gehört, niemals seine Stimme, keinen Laut eines Vogels, kein Geschrei eines Tieres, nicht den Strahl der Sonne erblickt, nicht den Schimmer des Mondes. Nichts vernommen als sich selbst, und doch nichts von sich selber wissend, der Einsamkeit nicht inne werdend.
Das Gemach muß von geringer Breite gewesen sein, denn er glaubte, einmal mit ausgestreckten Armen zwei gegenüber liegende Wände berührt zu haben. Vordem aber schien es unermeßlich groß; angekettet an ein Strohlager, ohne die Fessel zu sehen, hatte Caspar niemals den Fleck Erde verlassen, auf dem er traumlos schlief, traumlos wachte. Dämmerung und Finsternis waren unterschieden, so wußte er also um Tag und Nacht; er kannte ihre Namen nicht, allein er sah die Schwärze, wenn er einmal in der Nacht erwachte und die Mauern entschwunden waren.
Er hatte kein Maß für die Zeit. Er konnte nicht sagen, wann die unergründliche Einsamkeit begonnen hatte, er dachte zu keiner Stunde daran, daß sie einmal enden könne. Er spürte keinerlei Verwandlung an seinem Leibe, er wünschte nicht, daß etwas anders sein solle, als es war, es schreckte ihn kein Ungefähr, nichts Künftiges lockte ihn, nichts Vergangenes hatte Worte, stumm lief die regelvolle Uhr des kaum empfundenen Lebens, stumm war sein Inneres wie die Luft, die ihn umgab.
Wenn er am Morgen erwachte, fand er frisches Brot neben dem Lager und den Wasserkrug gefüllt. Bisweilen schmeckte das Wasser anders als sonst; wenn er getrunken hatte, verlor er seine Munterkeit und schlief ein. Nach dem Aufwachen mußte er dann das Krüglein sehr oft in die Hand nehmen, er hielt es lange an den Mund, doch floß kein Wasser mehr heraus; er stellte es immer wieder hin und wartete, ob nicht bald Wasser komme, weil er nicht wußte, daß es gebracht wurde; hatte er doch keinen Begriff, daß außer ihm noch jemand sein könne. An solchen Tagen fand er reines Stroh auf seinem Bette, ein frisches Hemd am Körper, die Nägel beschnitten, die Haare kürzer, die Haut gereinigt. All das war im Schlaf geschehen, ohne daß er es gemerkt, und kein Nachdenken darüber umflorte seinen Geist.
Ganz allein war Caspar Hauser nicht; er besaß einen Kameraden. Er hatte ein weißes Pferdchen aus Holz, ein namenloses, regungsloses Ding und gleichwohl etwas, in dem sein eignes Dasein sich dunkel spiegelte. Da er die lebendige Gestalt in ihm ahnte, hielt er es für seinesgleichen, und in den matten Glanz seiner künstlichen Augenperlen war alles Licht der äußeren Welt gebannt. Er spielte nicht mit ihm, nicht einmal lautlose Zwiesprach hielt er mit ihm, und obwohl es auf einem Brettchen mit Rädern stand, dachte er nie daran, es hin und her zu schieben. Aber wenn er sein Brot aß, reichte er ihm jeden Bissen hin, bevor er ihn selbst zum Mund führte, und bevor er einschlief, streichelte er es mit liebkosender Hand.
Das war sein einziges Tun in vielen Tagen, langen Jahren.
Da geschah es einst während der Zeit des Wachens, daß sich die Mauer auftat, und von draußen her, aus dem Niegesehenen, erschien eine ungeheure Gestalt, ein Niegesehener, der erste Andre, der das Wörtchen Du sprach und den Caspar deshalb den Du nannte. Die Decke des Raumes ruhte auf seinen Schultern, etwas unverständlich Leichtes und Veränderliches war in der Bewegung seiner Glieder, ein Lärm war um ihn, der das Ohr füllte, Laut um Laut floß rasch von seinen Lippen, zu atemlosem Hören zwang das Leuchten seiner Augen, und an seinen Kleidern hing das Draußen als ein betäubender Geruch.
Von den vielen Worten, die aus dem Munde des Du kamen, verstand Caspar zunächst keines, aber durch tieferregtes Aufmerken begriff er allmählich, daß der Ungeheure ihn fortbringen wolle, daß das Ding, das seine Einsamkeit geteilt, den Namen Roß trug, daß er andre Rosse erhalten werde und daß er lernen solle.
»Lernen,« sagte der Du immer wieder, »lernen, lernen.« Und wie um klarzumachen, was das heiße, stellte er einen Schemel mit vier runden Füßen vor ihn hin, legte ein Blatt Papier darauf, schrieb zweimal den Namen Caspar Hauser und führte beim Nachschreiben Caspars Hand. Dies gefiel Caspar, weil es schwarz und weiß aussah.
Darauf legte der Du ein Buch auf den Schemel und sprach, auf die winzigen Zeichen deutend, die Worte vor. Caspar konnte sie alle wiederholen, ohne irgend den Sinn erfaßt zu haben. Auch andre Worte und gewisse Redensarten plapperte er nach, die ihm der Mann vorsagte, zum Beispiel: »Ich möcht’ ein solcher Reiter werden wie mein Vater.«
Der Du schien zufrieden; jedenfalls um ihn zu belohnen, zeigte er ihm, daß man das Holzpferd auf dem Boden hin und her rollen könne, und damit vergnügte sich Caspar, als er am andern Morgen erwachte. Er schob das Rößlein vor seinem Lager auf und ab, wobei ein Geräusch entstand, das den Ohren wehe tat; deshalb ließ er es wieder und begann dafür mit dem Pferd zu reden, indem er die unverständlichen Laute aus dem Munde des Du nachahmte. Es war eine wunderliche Lust für ihn, sich selbst zu hören, er hob die Arme und füllte den Raum mit seinem freudigen Gelall.
Seinen Kerkermeister mochte dies verdrießen und beunruhigen, er wollte ihn zum Schweigen bringen: auf einmal sah Caspar einen Stab über seine Schulter sausen und spürte zugleich einen so heftigen Schmerz auf dem Arm, daß er vor Schrecken nach vorne fiel. Mitten in der Angst machte er die erstaunliche Wahrnehmung, daß er nicht mehr ans Lager angebunden war. Eine Zeitlang verhielt er sich ganz stille, dann versuchte er, vorwärts zu rutschen, aber ihm graute, als er mit seinen bloßen Füßen die kalte Erde berührte. Mit Mühe erreichte er sein Lager und versank sofort in Schlaf.
Es wurde dreimal Nacht und Tag, ehe der Du wiederkam und versuchte, ob Caspar noch seinen Namen schreiben und die Worte aus dem Buch lesen konnte. Er verbarg nicht seine Verwunderung, als der Knabe dies mühelos vermochte. Er wies auf Dinge rings im Raum und nannte ihre Namen; er redete langsam, Aug’ in Aug’ mit Caspar, und hielt ihn dabei an der Schulter fest; durch seine Blicke, seine Gebärden, das Verzerren seiner Züge hindurch ahnte Caspar, was er sagte, und ihm schauderte, während seine stotternde Zunge dem Mann gehorsam war.
In der folgenden Nacht wurde er aus dem Schlaf gerüttelt. Lange und mit Qual spürte er es und konnte doch nicht ganz erwachen. Als er endlich die Augen aufschlug, war die Mauer geöffnet, und ein purpurroter Schein floß in den Raum. Der Du war über ihn gebeugt und sprach leise, vielleicht um Caspars Furcht zu stillen. Er richtete ihn empor und bekleidete ihn mit Hosen, mit einem Kittel und mit Stiefeln, dann stellte er ihn auf die Füße, lehnte ihn gegen die Wand und kehrte sich mit dem Rücken gegen ihn. Er umfaßte seine Beine, hob ihn auf, Caspar umschlang mit den Armen seinen Hals, und nun ging es hinauf, einen hohen Berg hinauf, so schien es Caspar; in Wirklichkeit war es wahrscheinlich die Treppe des unterirdischen Verlieses. Furchtbar dröhnte der Atem des Mannes, etwas Kühles und Feuchtes schlug Caspar ins Gesicht, setzte sich in seinen Haaren fest, die sich von selbst zu bewegen anfingen, und klammerte sich an seine Haut.
Plötzlich wich die Schwärze, sie rauschte auf den Boden nieder; alles wurde weit, weich und blieb doch dunkel; in der Tiefe, in der Ferne wuchteten fremde große Dinge; von oben brach ein blauer Strahl und verlor sich wieder, das Schlüpfrig-Feuchte blähte die Falten der Kleider, durchdringende Gerüche wogten umher, Caspar begann zu weinen und schlief auf dem Rücken des Mannes ein.
Beim Erwachen lag er auf dem Boden, das Gesicht zur Erde gekehrt, und von unten strömte Kälte in den Leib. Der Du richtete ihn auf. Die Luft brannte sonderbar, und ein unerträglich heller Schein flirrte vor den Augen. Der Du machte ihm begreiflich, daß er gehen lernen müsse; er zeigte ihm, wie er gehen solle, er hielt ihn von hinten unter den Armen und stieß seinen Kopf gegen die Brust, ihm so befehlend, daß er auf den Boden sehen solle. Caspar gehorchte wankend und zitternd, die Luft und der Schein brannten ihm die Augenlider, die Gerüche machten ihn schwindeln, die Sinne vergingen.
Er schlief wieder; wie lange, das wußte er nicht. Auch wußte er nicht, wie oft er zu gehen probiert hatte, als es wieder dunkel wurde. Vielleicht glaubte er, es sei Nacht geworden, während sie sich nur in einem Wald befanden. Den Weg gewahrte er nicht, er konnte nicht sagen, ob es aufwärts oder abwärts ging. Ob Bäume oder Wiesen oder Häuser da waren, wußte er nicht. Bisweilen schien ihm alles ringsum in rote Glut getaucht, aber wenn das Weiche, Dunkle kam, dehnten sich Luft und Erde bläulich und grün. Ob Menschen vorübergingen, konnte er nicht sagen, er gewahrte nicht den Himmel, er sah nicht einmal das Gesicht des Mannes. Einmal fiel Wasser von der Höhe; er dachte, der Du schütte ihn mit Wasser an, und beklagte sich, doch jener entgegnete, er schütte ihn nicht an, er deutete in die Luft und rief: »Regen! Regen!«
Wie lange er so unterwegs gewesen, wußte er nicht. Ihm dünkte, jedesmal wenn er sich, erschöpft vom Gehen, zur Ruhe niedergelegt, sei ein Tag vergangen. Furcht zog ihn hin und bemeisterte seine Müdigkeit, sie spannte seine Gelenke und riß sein Haupt nach oben, indes die Augen unaufhörlich zur Tiefe starrten. Der Du gab ihm dasselbe Brot zu essen, das er im Kerker genossen, und ließ ihn Wasser aus einer Flasche trinken. Caspars Erschöpfung und seine Angst, wenn der Wind durch die Büsche sauste, oder wenn ein Tier schrie, oder wenn das Gras um seine Füße klirrte, suchte er durch das Versprechen schöner Pferdchen zu besiegen, und als Caspar endlich längere Zeit allein gehen konnte, sagte er, nun seien sie bald da. Er wies mit dem Arm in die Ferne und sagte: »Große Stadt.«
Caspar sah nichts, taumelnd tappte er vorwärts; nach einer Weile hielt ihn der Du bei den Armen zum Zeichen, daß er stehenbleiben solle, gab ihm einen Brief und sagte, den Mund nahe an Caspars Ohr: »Laß dich weisen, wo der Brief hingehört.«
Caspar machte noch ein paar Schritte, und als er sich dann umsah, war der Du verschwunden. Er spürte plötzlich Steine unter den Füßen, er tastete nach allen Seiten, um sich zu halten, er sah Steinmauern, die im Sonnenlicht feurig lohten, aber Entsetzen packte ihn erst, als er Menschen gewahrte, erst einen, dann zwei, dann viele. Grauenhaft nah kamen sie heran, umstanden ihn, schrien ihm zu, einer ergriff ihn und schleppte ihn vorwärts, alles ringsumher war Lärm und Getöse; er begehrte zu schlafen, sie verstanden ihn nicht; er sprach von seinem Vater, von den Rossen, sie lachten und verstanden ihn nicht; er jammerte über seine wunden Füße, sie verstanden es nicht; er schlief im Stall des Rittmeisters, dann kamen wieder andre Gestalten, um, kaum daß sie sich gezeigt, mit unbegreiflicher Hast wieder zu fliehen, die Luft war schwer und kaum zu atmen, die gewaltigen Dinge, als welche ihm die Häuser erschienen, drängten sich an ihn an, und auf der Wachtstube erschreckten ihn die wilden Mienen und Gebärden der Leute so, daß er zu Tränen seine Zuflucht nahm.
Wiederum schlief er lange, und danach wurde er auf den Turm gebracht. Der Mann, der ihn die große Stiege hinaufführte, sprach mit starker Stimme und öffnete eine Tür, die einen besonderen Hall von sich gab. Kaum hatte er sich auf dem Strohsack niedergelassen, so begann die Turmuhr zu schlagen, worüber Caspar in unermeßliches Erstaunen geriet. Er lauschte angestrengt, aber nach und nach hörte er nichts mehr, seine Aufmerksamkeit verlor sich und er fühlte nur das Brennen seiner Füße. In den Augen hatte er keine Schmerzen, da es dunkel war. Er setzte sich auf und wollte nach dem Krüglein langen, um seinen Durst zu stillen. Er sah kein Wasser und kein Brot, anstatt dessen sah er einen Boden, der ganz anders beschaffen war als dort, wo er früher gewesen. Nun wollte er nach seinem Pferdchen greifen und mit ihm spielen, es war aber keines da, und er sagte: »Ich möcht’ ein solcher Reiter werden wie mein Vater.«
Das sollte heißen: Wo ist das Wasser hin und das Brot und das Pferdchen?
Er bemerkte den Strohsack, auf dem er lag, betrachtete ihn mit Verwunderung und wußte nicht, was es sei; mit dem Finger darauf klopfend, vernahm er dasselbe Geräusch wie von dem Stroh, das sonst sein Lager gewesen. Dies erfüllte ihn mit Beruhigung, so daß er wieder einschlief und erst mitten in der Nacht vom oftmals wiederholten Ton der Glocke erwachte. Er lauschte lang, und als der Schall verklungen war, sah er den Ofen, der eine grüne Farbe hatte und einen Glanz von sich gab (denn Caspar vermochte selbst in tiefer Dunkelheit die Farben zu unterscheiden). Er blickte sehr angespannt hinüber und murmelte wieder: »Ich möcht’ ein solcher Reiter werden wie mein Vater.«
Das sollte heißen: Was ist denn dieses und wo bin ich denn? Auch drückte er damit sein Verlangen nach dem glänzenden Ding aus.
In der Frühe öffnete der Wärter die Fensterläden, das helle Tageslicht tat Caspars Augen wehe; er fing zu weinen an und sagte: »Hinweisen, wo der Brief hingehört,« und damit wollte er sagen: Warum tun mir die Augen weh? Tu es weg, was mich brennt, gib mir das Pferdchen zurück und plag mich nicht so. Denn er sprach im Geiste mit dem Du, von dem er glaubte, daß er Abhilfe schaffen könnte. Er hörte die Uhr wieder schlagen, das nahm ihm die Hälfte der Schmerzen, und indes er horchte, kam ein Mann und stellte allerhand Fragen, aber Caspar gab keine Antwort, weil seine Aufmerksamkeit auf den verhallenden Klang gerichtet war. Der Mann faßte ihn am Kinn, hob seinen Kopf in die Höhe und redete mit starker Stimme. Jetzt hörte Caspar zu und sagte all seine gelernten Worte her, aber der Mann verstand ihn nicht. Er ließ seinen Kopf los, setzte sich neben Caspar und fragte immerfort; als nun die Uhr wieder tönte, sagte Caspar: »Ich möcht’ ein solcher Reiter werden wie mein Vater.«
Das sollte bedeuten: Gib mir das Ding, das so schön klingt.
Der Mann verstand ihn nicht und redete weiter, da fing Caspar an zu weinen und sagte: »Roß geben,« womit er den Mann bat, er möge ihn nicht so quälen.
Er saß dann lange Zeit allein. Aus weiter Ferne klang ein Trompetenschall aus der Kaiserstallung, und als ein andrer Mann eintrat, sagte Caspar die Redensart mit dem Brief; das sollte heißen: Weißt du nicht, was das ist? Der Mann brachte den Wasserkrug und ließ Caspar trinken, danach ward es ihm leicht zumute und er sagte: »Möcht’ ein solcher Reiter werden wie mein Vater.« Das bedeutete: Jetzt darfst du nicht mehr fortgehen, Wasser. Bald erklang wieder die Trompete und Caspar lauschte freudig; er dachte, wenn sein Pferdchen käme, würde er ihm erzählen, was er gehört.
An diesem Tag aber begann schon die Peinigung, die er von den vielen Menschen auszustehen hatte.
Eine hohe amtliche Person wird Zeugeeines Schattenspiels
Natürlich hatte es wochenlang gedauert, bis Professor Daumer einen so vollständigen Einblick in die Vergangenheit des Jünglings gewonnen hatte. Dies alles ans Licht zu bringen, kündbar, greifbar, hatte Ähnlichkeit gehabt mit der Arbeit eines Brunnengräbers. Was anfangs ein Fiebertraum geschienen, besaß nun die Züge des Lebens.
Daumer verfehlte nicht, der Behörde den Sachverhalt in einer gewissenhaften Niederschrift vorzulegen. Die Folge davon war, daß sich der Magistrat entschloß, die Bahn förmlicher Verhöre zu verlassen und in eine vertrautere Beziehung zu dem Unglücklichen zu treten. Die auffälligen Besonderheiten seines Wesens sollten noch einmal überprüft werden, hieß es in einer der gerichtlichen Noten, deshalb wurden Ärzte, Gelehrte, Polizeibeamte, scharfsinnige Juristen, kurz unzählige Personen, die an seinem Schicksal freien Anteil nahmen, zu ihm auf den Turm geschickt. Es war ein endloses Schnüffeln und Debattieren, Zweifeln und Staunen, doch die verschiedenen Erklärungen liefen alle auf eins hinaus, und die bloße Kraft des Augenscheins mußte den Daumerschen Bericht bestätigen.
Wenige Tage später, gegen Anfang Juli, veröffentlichte der Bürgermeister einen Aufruf, der im ganzen Land Verwunderung und Beunruhigung erregte. Zunächst wurde darin das Erscheinen Caspar Hausers geschildert, und nachdem die eigne Erzählung des Jünglings mit tunlichster Ausführlichkeit wiedergegeben war, beschrieb der Verfasser diesen selbst. Er sprach von der alle Umgebung bezaubernden Sanftmut und Güte des Knaben, in der er anfangs immer nur mit Tränen und nun, im Gefühl der Erlösung, mit Innigkeit seines Unterdrückers gedenke; von seiner rührenden Ergebenheit an diejenigen, die häufig mit ihm umgingen, von seiner unbedingten Willfährigkeit zum Guten, die mit der Ahnung dessen verbunden sei, was böse ist, ferner von seiner außerordentlichen Lernbegierde.
»Alle diese Umstände,« fuhr der beredsame Erlaß fort, »geben in demselben Maß, in dem sie die Erinnerungen des Jünglings bekräftigen, die Überzeugung, daß er mit herrlichen Anlagen des Geistes und des Herzens ausgestattet ist, und berechtigen zu dem Verdacht, daß sich an seine Kerkergefangenschaft ein schweres Verbrechen knüpft, wodurch er seiner Eltern, seiner Freiheit, seines Vermögens, vielleicht sogar der Vorzüge hoher Geburt, in jedem Fall aber der schönsten Freuden der Kindheit und höchsten Güter des Lebens verlustig geworden ist.«
Eine kühne und folgenschwere Vermutung, die eher dem mitleidigen Gemüt und dem romantischen Geist als der behördlichen Vorsicht eines hohen Bürgermeisteramtes zur Ehre gereichte!
»Zudem beweisen mancherlei Anzeichen,« hieß es weiter, »daß das Verbrechen zu einer Zeit verübt worden, wo der Jüngling der Sprache schon einmal mächtig gewesen und der Grund zu einer edeln Erziehung gelegt war, die gleich einem Stern in finsterer Nacht aus seinem Wesen hervorleuchtet. Es ergeht daher an die Justiz-, Polizei-, Zivil- und Militärbehörden und an jedermann, der ein menschliches Herz im Busen trägt, die dringende Aufforderung, alle, auch die unbedeutendsten Spuren und Verdachtsgründe bekanntzugeben. Und nicht etwa deswegen, um Caspar Hauser zu entfernen, denn die Gemeinde, die ihn in ihren Schoß aufgenommen, liebt ihn, betrachtet ihn als ein von der Vorsehung ihr zugeführtes Pfand der Liebe, das sie ohne gültigen Beweis der Ansprüche andrer nicht abtreten wird, sondern nur, um die Übeltat zu entdecken und den Bösewicht samt seinen Gehilfen der gerechten Sühne auszuliefern.«
Wahrscheinlich wurden von den Urhebern große Hoffnungen an das Manifest geknüpft, aber die Sache nahm einen ganz unerwarteten Verlauf und bereitete den Nürnberger Herren mancherlei Verlegenheiten. Zunächst lief eine Menge unsinniger und verleumderischer Bezichtigungen ein, durch welche eine Reihe von adligen Familien und von intimen Vorgängen in aristokratischen Kreisen dem Gerede ausgesetzt wurden: Kindesmord, Kindesraub, Kindesunterschiebung waren nach Ansicht des gemeinen Volks Verbrechen, welche die vornehmen Leute täglich und zum Vergnügen begehen.
Schlimmer war es, daß die magistratische Bekanntmachung dem Appellhof des Rezatkreises auf nichtamtlichem Weg zu Händen kam. Irgendein grimmiger Hofrat am selben Gerichtshof erließ allsogleich ein gepfeffertes Schreiben an die Kreisregierung in Ansbach, worin erstlich die Publikation des Nürnberger Bürgermeisters als vorschriftswidrig, zweitens als abenteuerlich bezeichnet wurde, worin drittens der lebhafte Tadel darüber ausgedrückt war, daß durch das verfrühte Preisgeben wichtiger Umstände eine Kriminaluntersuchung wenn auch nicht vereitelt, so doch sehr erschwert worden sei. Der ergrimmte Hofrat ersuchte daher die Regierung, den Magistrat zu strenger Rechenschaft zu ziehen und zu befehlen, daß die den Fall behandelnden Polizeiakten unverzüglich anher zu senden seien.
Die Regierung ließ sich das nicht zweimal sagen. Sie sendete ein Reskript an den Stadtkommissär von Nürnberg und äußerte sich dahin, daß die erzählte Lebensbeschreibung des Findlings so viele grobe Unwahrscheinlichkeiten enthalte, daß der Gedanke an eine ärgerliche Täuschung nicht abzuweisen sei. Gleichzeitig wurden die noch vorhandenen Exemplare des »Intelligenzblattes« und des »Friedens- und Kriegskuriers«, in welchen Zeitungen der Aufruf erschienen war, beschlagnahmt. Dies wurde dem Appellhof ordnungsgemäß mitgeteilt und die Erwägung daran geknüpft, ob die strafrechtliche Verfolgung des Häftlings einzuleiten sei oder nicht.
Den Magistratsherren fuhr ein heilloser Schrecken in die Glieder. Schleunigst ließen sie die Aktenfaszikel zusammenpacken und schickten sie mit Eilpost nach Ansbach hinüber. Vielleicht wähnten sie, daß nun alles gut sei, aber der grimme Hofrat dortselbst erhob alsbald wieder seine Stimme. »Die Verhöre mit dem Häftling und die Zeugnisse über ihn sind aktenmäßig nicht einwandfrei,« zeterte er; »es sind keineswegs alle Personen, die zuerst mit ihm in Berührung getreten sind, polizeilich vernommen worden; ferner hätte der Professor Daumer, um der öffentlichen Bekanntmachung des Magistrats eine rechtliche Basis zu geben, seine Gespräche mit dem Findling zu den Akten legen sollen.«
Die Regierung, um ein übriges zu tun, warnte den Magistrat vor einseitigem Verfahren. Darauf erwiderte der Magistrat in einem Anfall von Trotz und Entrüstung: ja, aber in den Maßregeln, wie ihr sie verlangt, liegt Gefahr, die Entdeckung zu hemmen, welche Anklage die vorgesetzte Behörde mit zorniger Energie zurückwies. Holt eure Versäumnisse nach, diktierte sie, protokolliert Verhöre, schickt Akten, Akten, nichts als Akten.
Mit innerer Wut hatte der Professor Daumer diese Vorgänge verfolgt. Er bezeichnete das Treiben der Ansbacher Behörde als widerwärtige Federfuchserei und hatte allen Ernstes die Absicht, seinem Unmut in einer geharnischten Epistel an die Regierung Luft zu machen. Mit Mühe hielten besonnene Freunde ihn davon zurück. »Aber es muß doch etwas geschehen!« warf er ihnen voll Empörung entgegen, »man ist ja auf dem besten Weg, einen Justizmord zu begehen, und soll ich dazu die Hände in den Schoß legen?«
»Das ratsamste wäre,« antwortete der Freiherr von Tucher, der bei diesem Auftritt anwesend war, »sich persönlich an den Staatsrat Feuerbach zu wenden.«
»Das hieße also, nach Ansbach reisen?«
»Gewiß.«
»Aber nehmen Sie denn an, daß er, als Präsident des Appellgerichts, von den Maßnahmen seiner untergebenen Beamten nicht schon unterrichtet ist und sie etwa gar mißbillige?«
»Gleichviel, ich verspreche mir etwas von einer mündlichen Auseinandersetzung; ich kenne Herrn von Feuerbach, er ist der letzte, der einer gerechten Sache sein Ohr verschließt.«
Die Reise wurde beschlossen. Daumer und Herr von Tucher befanden sich am andern Tag schon in Ansbach. Unglücklicherweise war der Präsident Feuerbach gerade auf einer Inspektionsreise durch den Bezirk, sollte erst am fünften Tag zurückkommen, und die beiden Herren, sofern sie das vorgesetzte Ziel erreichen wollten, mußten ihren Aufenthalt in der Kreishauptstadt über Gebühr verlängern.
Mittlerweile hatte der Findling eine gar böse Zeit. Sein Turmgefängnis wurde das Ziel aller Müßiggänger und Neugierlinge der ganzen Stadt. Man lief hin wie zu der Ausstellung einer unterhaltsamen Rarität, denn der magistratische Erlaß hatte ihn zu einem öffentlichen Gegenstand gemacht. Seine bisherigen Beschützer waren ein wenig zurückhaltender geworden, denn man wußte ja nicht, wie die Geschichte enden würde und ob nicht ein hochweises Appellgericht ihn zum gewöhnlichen Schwindler stempeln würde. Der Turmwärter durfte der allgemeinen Volksbelustigung nicht steuern, der Bürgermeister selbst hatte die früheren Befehle aufgehoben, weil es zweckmäßig schien, daß möglichst viele Leute den Fremdling sahen. Oft erbarmte ihn der wehrlose Knabe, doch schmeichelte es anderseits seiner Eitelkeit, Herr über ein solches Wunderding zu sein, auch spazierte nebenbei mancher Groschen in den Beutel.
Brach der Morgen an und Caspar Hauser erhob sich vom Schlaf, seltsam müde, mit den Augen das Licht meidend; saß er traurig stumm in der Ecke, während Hill den Strohsack aufschüttelte und Wasser und Brot brachte, dann erschienen schon die ersten Besucher, die berufsmäßigen Frühaufsteher: Straßenkehrer, Dienstmägde, Bäckergesellen, Handwerker, die zur Arbeit gingen, auch Knaben, die auf dem Weg zur Schule einen ergötzlichen Abstecher machten, sogar einige höchst unbürgerliche Erscheinungen, zerlumpte Herren, die die Nacht im Stadtgraben oder in einer Scheune verbracht hatten.
Mit dem Verlauf des Tages wurde die Gesellschaft vornehmer; es kamen ganze Familien, der Herr Rendant mit Weib und Kind, der Herr Major a. D., der Schneidermeister Bügelfleiß, Graf Rotstrumpf mit seinen Damen, Herr von Übel und Herr von Strübel, die ihre Morgenpromenade zum Zweck einer Besichtigung des kuriosen Untiers unterbrachen.
Es war ein heiteres Treiben; man konversierte, wisperte, lachte, spottete und tauschte Meinungen aus. Man war freigebig und brachte dem Jüngling allerlei Geschenke, die er ansah wie ein Hund, der noch nicht apportieren gelernt hat, den fortgeworfenen Spazierstock seines Herrn ansieht. Man legte Eßwaren vor ihn hin, um seinen Appetit zu reizen; so schleppte zum Beispiel die Kanzleirätin Zahnlos einmal eine ganze Schinkenkeule herauf, die allerdings am andern Tag verschwunden war – wohin, das wußte niemand; doch zog man bedeutsame Schlüsse daraus.
Vor allem hieß es: zeigt uns das Wunder, das angepriesene Wunder! Aber da der schweigsame, sanftherzige Knabe nichts von alledem tat, was sie in ihrer lüsternen Erwartung sich eingebildet, so begannen sie entweder zu schimpfen – als ob sie Eintrittsgeld bezahlt hätten und darum betrogen worden wären – oder stellten die erstaunlichsten Torheiten an. Indem sie ihn fortwährend mit Fragen quälten, woher er komme, wie er heiße, wie alt er sei und ähnliches, kamen sie sich sowohl witzig wie überlegen vor. Sein flehentliches Kopfschütteln, sein ungereimtes Nein oder Ja, das wie aus Kindermund froh-bereitwillig und furchtsam zugleich klang, sein Gestotter, sein gläubiges Lauschen, alles das erregte ihr Behagen. Einige brachten ihr Gesicht ganz nah an seines und waren höchst vergnügt, wenn er vor ihren Starrblicken sichtlich bis ins Innerste erschrak. Sie befühlten seine Haare, seine Hände, seine Füße, zwangen ihn, durchs Zimmer zu spazieren, zeigten ihm Bilder, die er erklären sollte, und taten zärtlich mit ihm, während sie einander listig zuzwinkerten.
Aber die Harmlosigkeit solcher Versuche ward den unternehmenderen Geistern bald überdrüssig. Man wollte sich doch überzeugen, ob es seine Richtigkeit damit hatte, daß der Gefangene jede Nahrung außer Brot und Wasser verschmähe. Man hielt ihm Fleisch und Wurst, Honig oder Butter, Milch oder Wein vor die Nase und amüsierte sich köstlich, wenn der Knabe vor Ekel förmlich außer sich geriet. »Ei, der Komödiant,« kreischten sie dann, »tut, als ob er unsre Leckerbissen verachte! Hat sich wahrscheinlich mal in eines großen Herrn Küche überfressen!«
Einen Hauptspaß gab’s, als einmal zwei junge Meister der Goldschlägerinnung Schnaps herbeibrachten und sich verabredeten, dem Hauser das Getränk mit Gewalt aufzunötigen. Der eine hielt ihn, der andre wollte ihm das volle Glas zwischen die Lippen schütten. Doch konnten sie ihren Plan nicht ausführen, weil ihr Opfer durch den bloßen Geruch, der aus dem Gefäß strömte, das Bewußtsein verloren hatte. Sie waren einigermaßen verdutzt und wußten mit dem Ohnmächtigen nichts anzufangen; zum Glück sahen sie ihn atmen und hatten weiter keine Furcht. »Glaubt ihm doch seine Kniffe nicht,« meinte ein stutzerhaft gekleidetes Bürschlein, das bisher gelangweilt dabeigestanden, »ich will ihn schon wieder munter kriegen.« Sprach’s, zog lächelnd die goldene Schnupftabaksdose und steckte eine volle Prise unter die Nase des vermeintlichen Simulanten, dessen Gesicht sogleich von heftigen Zuckungen bewegt wurde, worüber alle drei in Gelächter ausbrachen. Als dann der Wärter kam und sie derb zur Rede stellte, zogen sie schimpfend ab und räumten den Plan einem gravitätischen älteren Herrn, der den langsam zum Leben zurückkehrenden Caspar von vorn und von hinten beschnüffelte, den Finger an die Stirn legte, sich räusperte, den Kopf schüttelte, erst französisch, dann spanisch, dann englisch auf den Jüngling einredete, mit dem Wärter tuschelte, kurz von Wichtigkeit förmlich barst.
Caspar jedoch sah ihn immer nur an und sagte in jämmerlichem Ton: »Heimweisen.«
»Warum spielst du nicht mit dem Rößlein?« fragte, als die wichtige Person gegangen war, der Wärter. Man verständigte sich mit Caspar noch immer mehr durch Gesten als durch Worte, und er selbst las, was Worte ihm nicht mitteilen konnten, von den Augen und den Händen der Menschen ab.
Er blickte auch Hill lange an und sagte: »Heimweisen.«
»Heimweisen?« antwortete der Wärter, halb verdrießlich, halb mitleidig. »Wohin denn heim? Wo bist du denn daheim, du Unglückswurm? In dem unterirdischen Loch vielleicht? Nennst du das daheim?«
»Der Du soll kommen,« sagte Caspar klar, langsam und hell.
»Der wird sich hüten,« versetzte Hill, bärbeißig lachend.
»Der Du kommt, bald kommt,« beharrte Caspar, und er schaute mit einem Ausdruck feierlicher Inbrunst gegen den abendlichen Himmel, als sei er überzeugt, daß der Du durch die Lüfte schreiten könne. Dann erhob er sich in seiner mühevollen Weise, nahm sein Spielpferdchen und versuchte es zu tragen, denn dies allein wollte er von den Gegenständen, die er geschenkt erhalten, mitnehmen, wenn der Du käme, sonst nichts.
Hill begriff sein Vorhaben. »Nein, Caspar,« sagte er, »jetzt mußt du schon in dieser Welt bleiben. Daß sie dir nicht gefallen mag, versteh’ ich wohl. Mir gefällt sie auch nicht, aber dableiben mußt du.«
Caspar, wenngleich er den Worten nicht ganz folgen konnte, erfaßte doch den unabänderlichen Beschluß, den sie enthielten. Er begann an allen Gliedern zu beben, laut weinend warf er sich zu Boden, aber auch später, als es dem bestürzten Hill gelungen war, ihn zu trösten, schien es, wie wenn er vor Kummer sein Herz verhauche. Die Traurigkeit seines Gemüts überflutete das kindhafte Gesicht wie ein dunkler Schleier, und am Morgen waren seine Lider durch die während des Schlummers vergossenen Tränen verklebt.
Er wollte zum erstenmal nicht mehr mit dem Pferdchen spielen, sondern kauerte stundenlang ohne Regung auf einem Fleck. Bei jedem Krachen der Treppe schüttelte es ihn, und er schauderte, wenn sich wieder und wieder ein neues Gesicht über der Schwelle zeigte. Zitternd sah er die Menschen an, der Geruch ihres Atems war ihm eine Pein und unerträglich, wenn sie ihn berührten. Am meisten Furcht hatte er vor ihren Händen. Zuerst sah er immer die Hände an, merkte sich ihre verschiedene Gestalt und Farbe, und ehe er sie an seiner Haut spürte, erschrak er schon, denn sie erschienen ihm wie selbständige Geschöpfe, kriechende, klebrige, gefährliche Tiere, deren Tun von einem Augenblick zum andern gar nicht abzuschätzen war.
Nur Daumers Hand, die einzige, deren Berührung angenehm war, war verschwunden. Warum? dachte Caspar, warum war dies alles? Warum das seltsame Getöse von früh bis spät? Woher kamen die fremden Gestalten, warum so viele, und warum war ihr Mund und ihr Auge böse?
Das frische Wasser schmeckte ihm nicht mehr, auch hungerte ihn nicht mehr nach dem gewürzten Brot. In seiner Erschöpfung dünkte ihm mitten am Tage, es sei Nacht geworden, und das Heißgleißende, -funkelnde, von dem man ihm gesagt, daß es der Schein der Sonne sei, wurde vor seinen müden Augen zu purpurnem Dunst. Es beängstigte ihn das Geräusch des Windes, denn er verwechselte es mit den Stimmen der Menschen. Er sehnte sich in die Einsamkeit seines Kerkers zurück; heimweisen war sein einziger Gedanke.
Es war ein Sonntag. Spätnachmittags waren Daumer und Herr von Tucher aus Ansbach wieder angelangt, und in ihrer Begleitung befand sich der Staatsrat von Feuerbach, der sich entschlossen hatte, den Findling selbst zu besuchen und womöglich Klarheit in das unfruchtbare Hinundher von Akten und Erlässen zu bringen. Nachdem er im Gasthof zum Lamm Quartier gemietet hatte, ließ sich der Präsident von den beiden Herren sogleich zur Burg und auf den Turm führen. Es hatte schon neun Uhr geschlagen, als sie dort ankamen. Groß war ihre Überraschung, als sie das Zimmer Caspars leer fanden; die Frau des Wärters erklärte verlegen, ihr Mann sei mit Caspar ins Wirtshaus zum Krokodil gegangen. Der Rittmeister von Wessenig habe nämlich einigen seiner von auswärts zugereisten Freunde den Findling zu zeigen gewünscht, habe heraufgeschickt und befohlen, daß man Caspar bringe.
Daumer war erbleicht und schaute, Schlimmes ahnend, finster zu Boden; Herr von Tucher vermochte seinen Unwillen kaum zu bemeistern, und über die bartlosen Lippen des Präsidenten huschte ein halb mokantes, halb verächtliches Lächeln; seine gebietende Haltung erinnerte an einen durch Pflichtversäumnisse vielfach beleidigten Fürsten, als er sich mit der schroffen Aufforderung zu seinen Begleitern wandte: »Führen Sie mich zu diesem Wirtshaus!«
Die Dunkelheit war eingebrochen, über dem Dach des Rathauses stand fahlleuchtend der Mond. Schweigend schritten die drei Männer den Berg hinab, und kaum waren sie, das winklige Gassengewirr verlassend, auf den Weinmarkt getreten, als Daumer stehenblieb und mit erregter Stimme flüsterte: »Da ist er.«
In der Tat sahen sie Caspar, der gleich einem zu Tod Erkrankten am Arme Hills aus dem Tor des Krokodilwirtshauses wankte. Der Präsident und Herr von Tucher blieben ebenfalls stehen, und sie bemerkten jetzt, daß der Jüngling plötzlich innehielt, zurückschauderte und, ein maßloses Staunen in den vor Angst weit aufgerissenen Augen, zu Boden starrte. Die drei Männer näherten sich eilig, um zu erfahren, was es sei. Sie sahen nichts weiter als die Mondschatten des Jünglings und seines Begleiters auf dem Pflaster.
Caspar wagte nicht mehr sich zu regen, weil er jede Bewegung seines Körpers nachgeahmt sah von dem unbegreiflichen Ding. Seine Lippen waren wie zum Schrei geöffnet, seine Wangen schneeweiß und die Knie schlotterten ihm. War es doch, als ob alles Grauenhafte und Geheimnisvolle einer Welt, in die ein Ungefähr ihn geschleudert, sich zu dem seltsam zuckenden Gebild am Boden verdichtet habe.
Daumer, Herr von Tucher und der Wärter bemühten sich um ihn, der Präsident stand wortlos daneben. Als er emporblickte, bemerkte Daumer, der ihn heimlich und gespannt beobachtete, in seinem strengen Gesicht eine unverstellte Erschütterung.
Es fehlte nicht viel, so wäre Hill, den der Zorn des Präsidenten am ersten traf, noch am selben Abend aus seinem Amt gejagt worden; nur die mutige Fürsprache des Herrn von Tucher rettete ihn und lenkte das Gewitter auf schuldigere Personen ab, denn die Vernachlässigung, die der Gefangene erlitten, war allzu offenbar. Seiner ungestümen Art gemäß suchte der Präsident sogleich den Bürgermeister Binder auf, dem er die heftigsten Vorwürfe machte. Herr Binder konnte nicht umhin, dem Präsidenten kleinmütig beizupflichten; die Entschiedenheit, mit der er den Gegenstand behandelt sah, übte tiefen Eindruck auf ihn, und er mußte einen kaum wieder gutzumachenden Fehler vor sich selber eingestehen. Von seiner Seite war nur Lauheit im Spiel gewesen, die Scherereien mit der Regierung hatten ihn verdrossen, jetzt auf einmal, da der mächtige Mann seine Stimme für den Findling erhob, wurde er sich seiner Bereitwilligkeit bewußt, alles Fördernswerte für Caspar Hauser zu tun, und er erklärte sich ohne weiteres einverstanden, als Herr von Feuerbach verlangte, der Knabe müsse seiner bisherigen Lage entrissen werden. »Er soll in eine geordnete Pflege kommen,« sagte der Präsident, »Professor Daumer hat sich freiwillig erboten, ihn zu sich ins Haus zu nehmen, und ich wünsche nicht, daß dieser Schritt im geringsten verzögert werde.«
Binder verbeugte sich. »Ich werde morgen mit dem frühesten die nötigen Anstalten treffen,« antwortete er.
»Nicht, bevor ich selbst mit dem Knaben gesprochen,« versetzte der Präsident hastig; »ich werde um zehn Uhr auf dem Turm sein und bitte, daß man mich eine Stunde lang mit dem Gefangenen allein lasse.«
Auch Daumer war ziemlich erregt heimgekommen. Kaum daß er, nach tagelanger Abwesenheit, Mutter und Schwester ordentlich begrüßte. »Die Herrschaften müssen artig gewütet haben,« grollte er, indem er unaufhörlich durch das Zimmer wanderte, »der Knabe ist ja ganz verstört. Das heiß’ ich menschlich sein, das heiß’ ich Einsicht haben! Barbaren sind sie, Schlächter sind sie! Und unter solchem Volk zu leben bin ich gezwungen!«
»Warum sagst du es ihnen nicht selbst?« bemerkte Anna Daumer trocken. »Hinter deinen vier Wänden zu schimpfen fruchtet wenig.«
»Sag mal, Friedrich,« wandte sich nun die alte Dame an ihren Sohn, »bist du denn wirklich fest davon überzeugt, daß du dein Herz nicht wieder einmal an einen Götzen wegwirfst?«
»Aus deiner Frage erkennt man, daß du ihn noch immer nicht gesehen hast,« antwortete Daumer fast mitleidig.
»Das wohl; es war mir ein zu groß Gerenne.«
»Also. Wenn man von ihm spricht, kann man nicht übertreiben, weil die Sprache zu ärmlich ist, um sein Wesen auszudrücken. Es ist wie eine uralte Legende, dies Emportauchen eines märchenhaften Geschöpfs aus dem dunkeln Nirgendwo; die reine Stimme der Natur tönt uns plötzlich entgegen, ein Mythos wird zum Ereignis. Seine Seele gleicht einem kostbaren Edelstein, den noch keine habgierige Hand betastet hat; ich aber will danach greifen, mich rechtfertigt ein erhabener Zweck. Oder bin ich nicht würdig? Glaubt ihr, daß ich nicht würdig bin dazu?«
»Du schwärmst,« sagte Anna nach einem langen Stillschweigen fast unwillig.
Daumer zuckte lächelnd die Achseln. Dann trat er an den Tisch und sagte in einem Ton, dessen Sanftheit gleichwohl einen gefürchteten Widerstand im voraus zu bekämpfen schien: »Caspar wird morgen in unser Haus ziehen; ich habe Exzellenz Feuerbach darum angegangen und er hat meiner Bitte willfahrt. Ich hoffe, daß du nichts dawider einzuwenden hast, Mutter, und daß du mir glaubst, wenn ich versichere, es ist eine Sache von großer Bedeutung für mich. Ich bin höchst wichtigen Entdeckungen auf der Spur.«
Mutter und Tochter sahen erschrocken einander an und schwiegen.
Am nächsten Morgen um zehn fanden sich Daumer, der Bürgermeister, der Stadtkommissär, der Gerichtsarzt und einige andre Personen im Burghof vor dem Gefängnisturm ein und warteten dritthalb Stunden auf den Präsidenten, der bei dem Findling oben war. Daumer, der Gespräche mit andern vermeiden wollte, stand fast ununterbrochen an der Umfassungsmauer und blickte auf das malerische Gassen- und Dächergewirr der Stadt hinunter.
Als der Präsident endlich unter den Wartenden erschien, drängten sich alle mit Eifer heran, um die Meinung des berühmten und gefürchteten Mannes zu hören. Doch das Gesicht Feuerbachs zeigte einen so düsteren Ernst, daß niemand ihn mit einer Anrede zu belästigen wagte; sein machtvolles Auge blickte brennend nach innen, die Lippen waren gleichsam aufeinander geballt, auf der Stirn lag eine von Nachdenken zitternde senkrechte Falte. Das Schweigen wurde vom Bürgermeister mit der Frage unterbrochen, ob Exzellenz nicht geruhen wolle, das Mittagessen in seinem Haus zu nehmen. Feuerbach dankte; dringende Geschäfte nötigten ihn zu sofortiger Rückkehr nach Ansbach, entgegnete er. Darauf wandte er sich an Daumer, reichte ihm die Hand und sagte: »Sorgen Sie sogleich für die Übersiedlung des Hauser; der arme Mensch braucht dringend Ruhe und Pflege. Sie werden bald von mir hören. Gott befohlen, meine Herren!«
Damit entfernte er sich in raschen, kleinen, stampfenden Schritten, eilte den Hügel hinab und verschwand alsbald gegen die Sebalderkirche. Die Zurückbleibenden machten etwas enttäuschte Mienen. Da sie alle überzeugt waren, daß der Scharfsinn dieses Mannes ohne Grenzen sei und daß kein andres als sein Auge das Dunkel durchdringen könne, welches über Untat und Verbrechen brütete, waren sie verstimmt über eine Schweigsamkeit, die ihnen beabsichtigt und planvoll erschien.
Am Abend befand sich Caspar in der Wohnung Daumers.
Der Spiegel spricht
Das Daumersche Haus lag neben dem sogenannten Annengärtlein auf der Insel Schütt; es war ein altes Gebäude mit vielen Winkeln und halbfinstern Kammern, doch erhielt Caspar ein ziemlich geräumiges und wohleingerichtetes Zimmer gegen den Fluß hinaus.
Er mußte sogleich zu Bett gebracht werden. Es zeigten sich jetzt mit einem Schlag die Folgen der jüngstdurchlebten Zeit. Er war wieder ohne Sprache, ja bisweilen wie ohne Gefühl des Lebens. Auf den ungewohnten Kissen warf er sich fiebernd herum. Wie jammervoll, ihn bei jedem Knacken der Dielen erschaudern zu sehen; auch das Geräusch des Regens an den Fenstern versetzte ihn in aufgewühlte Bangnis. Er hörte die Schritte, die auf dem weiten Platz vor dem Haus verhallten, er vernahm mit Unruhe die metallenen Schläge aus einer fernen Schmiede, jeder Stimmenlärm brachte auf seiner eingeschrumpften Haut ein Zeichen des Schmerzes hervor; und von Moment zu Moment vertauschten seine Züge den Ausdruck der Erschöpfung mit dem gepeinigter Wachsamkeit.
Drei Tage lang wich Daumer kaum von seinem Bett. Diese Opferkraft und Hingebung erregte die Bewunderung der Seinen. »Er muß mir leben,« sagte er. Und Caspar fing an zu leben. Vom dritten Tag ab besserte sich sein Zustand stetig und schnell. Als er am Morgen erwachte, lag ein besinnendes Lächeln auf seinen Lippen. Daumer triumphierte.
»Du tust ja, als ob du selbst dem Kerker entronnen wärst,« meinte seine Schwester, die nicht umhin konnte, an seiner Freude teilzunehmen.
»Ja, und ich habe eine Welt zum Geschenk erhalten,« antwortete er lebhaft; »sieh ihn nur an! Es ist ein Menschenfrühling.«
Am andern Tag durfte Caspar das Bett verlassen. Daumer führte ihn in den Garten. Damit das grelle Tageslicht seinen Augen nicht schade, band er ihm einen grünen Papierschirm um die Stirn. Späterhin wurden die Dämmerungszeit oder die Stunden bewölkten Himmels für diese Ausgänge vorgezogen.
Es waren ja Reisen, und nichts geschah, was nicht zum Ereignis wurde. Welche Mühe, ihn sehen, ihn das Gesehene nennen zu lehren. Er mußte erst zu den Dingen Vertrauen gewinnen, und ehe nicht ihre Wirklichkeit ihm selbstverständlich ward, machte ihn ihre unvermutete Nähe bestürzt. Als er endlich die Höhe des Himmels und auf der Erde die Entfernung von Weg zu Weg begriff, wurde sein Gang ein wenig leichter und sein Schritt mutiger. Alles lag am Mut, alles lag daran, den Mut zu kräftigen.