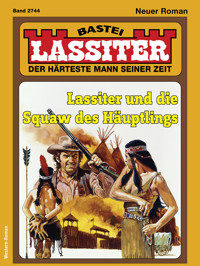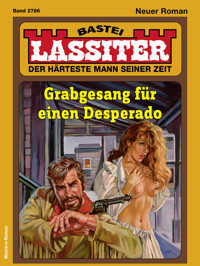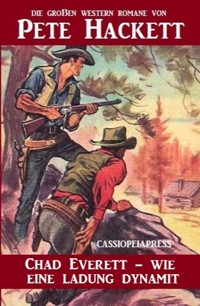
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es war die Zeit, als die Sonne hinter den Bergen versunken war und der Himmel in ihrem Widerschein purpurn leuchtete, als würde er in Flammen stehen. Chad Everett führte den Hengst, den er soeben zugeritten hatte, in den Corral zu den anderen Pferden, die aneinanderdrängten und schnaubend zurückwichen. Es war eine Herde von zwanzig Tieren. Wildpferde, die Feuer im Blut hatten, die von Chad zwar eingebrochen worden waren, in deren Augen aber immer noch die Wildheit leuchtete.
Chad wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn und aus den Augenhöhlen, verschloss den Corral und blickte Jennifer entgegen, die langsam herankam. Sie lächelte und bewunderte ihn. Es gab wohl keinen besseren Mustangjäger und Bronco Breaker als ihn, als Chad Everett, ihren Mann. Und sie lebten nicht schlecht von seiner knochenbrechenden Arbeit.
Cover: Klaus Dill
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Chad Everett - wie eine Ladung Dynamit
Ein Cassiopeiapress Western
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenChad Everett – wie eine Ladung Dynamit
Western von Pete Hackett
Über den Autor
Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt, wie sie sonst nur dem jungen G.F.Unger eigen war - eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen.
Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren. Für den Bastei-Verlag schrieb er unter dem Pseudonym William Scott die Serie "Texas-Marshal" und zahlreiche andere Romane. Ex-Bastei-Cheflektor Peter Thannisch: "Pete Hackett ist ein Phänomen, das ich gern mit dem jungen G.F. Unger vergleiche. Seine Western sind mannhaft und von edler Gesinnung."
Hackett ist auch Verfasser der neuen Serie "Der Kopfgeldjäger". Sie erscheint exklusiv als E-book bei CassiopeiaPress.
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author
© 2012 der Digitalausgabe 2012 by AlfredBekker/CassiopeiaPress
www.AlfredBekker.de
Es war die Zeit, als die Sonne hinter den Bergen versunken war und der Himmel in ihrem Widerschein purpurn leuchtete, als würde er in Flammen stehen. Chad Everett führte den Hengst, den er soeben zugeritten hatte, in den Corral zu den anderen Pferden, die aneinanderdrängten und schnaubend zurückwichen. Es war eine Herde von zwanzig Tieren. Wildpferde, die Feuer im Blut hatten, die von Chad zwar eingebrochen worden waren, in deren Augen aber immer noch die Wildheit leuchtete.
Chad wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn und aus den Augenhöhlen, verschloss den Corral und blickte Jennifer entgegen, die langsam herankam. Sie lächelte und bewunderte ihn. Es gab wohl keinen besseren Mustangjäger und Bronco Breaker als ihn, als Chad Everett, ihren Mann. Und sie lebten nicht schlecht von seiner knochenbrechenden Arbeit.
»Fertig!«, rief Chad, ein großer, geschmeidiger Mann mit schmalen Hüften und breiten Schultern, einem kantigen Gesicht, das von einem stahlblauen Augenpaar beherrscht wurde, und semmelblonden Haaren, die ihm bis in den Nacken hingen. »Das war der letzte und wildeste Gaul. Morgen treibe ich die Herde nach Fort Mohave. Und auf dem Rückweg kaufe ich dir in Kingman das schönste und teuerste Kleid, das ich auftreiben kann.«
»Darauf freue ich mich«, erwiderte sie und ließ sich von ihm in die Arme nehmen. Sie sah in sein erhitztes Gesicht. Er konnte auf dem Grund ihrer grünbraunen Augen Liebe und Wärme erkennen. »Allerdings werde ich das Kleid hier draußen nicht tragen können«, gab sie lachend zu bedenken.
Er küsste sie flüchtig. »Dann lassen wir, wenn ich wieder zurückkehre, für eine Woche die Ranch einfach Ranch sein und machen in Kingman Urlaub. Und in der Stadt führe ich dich jeden Abend aus.«
Sie lachten vergnügt und gingen Arm in Arm hinüber zu dem flachen Ranchhaus, das Chad aus Baumstämmen selbst gebaut hatte. Ja, sie waren guter Dinge. Aber das Schicksal hielt für sie bereits Tod und Verderben bereit. Es näherte sich in stiebendem Galopp, und das Dröhnen der wirbelnden Hufe mutete wie ein furchtbares Gewitter an.
Sie vernahmen es in dem Moment, als sie das Haus betreten wollten. Chads Stirn legte sich in Falten.
»Wer mag das sein?«, fragte Jennifer ein wenig nervös.
Chad antwortete mit einem Achselzucken. »Keine Ahnung. Aber es scheint sich um eine ziemliche Schar zu handeln«, murmelte er nachdenklich. »Und sie reitet wie der Teufel. Das bedeutet sicher nichts Gutes. Schnell, ins Haus, Jenny. Sie werden jeden Augenblick aus dem Canyon kommen. Und …« Er brach ab, drängte Jennifer in den düsteren Flur, folgte ihr und verriegelte hinter sich die Tür. »Geh in die Küche und zeig dich nicht.«
Er lief in die Wohnstube und holte sein Gewehr, hebelte eine Patrone in den Lauf und trat ans Fenster, schob es mit einem Ruck in die Höhe. Der Vorhang bewegte sich träge im Luftzug. In Chads Miene arbeitete es. Nur selten kam jemand in dieses Hochtal, in dem er seine Pferderanch aufgebaut hatte. Und wenn, dann hatten er und Jennifer nichts zu befürchten. Aber dieser Horde, die da herandonnerte, eilten die Schatten des Unheils voraus. Chad fühlte es instinktiv, konnte aber nicht sagen, woher er diese seltsame, nicht zu deutende Ahnung hatte.
Schließlich jagte die Kavalkade aus der Schlucht, die einen der drei Zugänge zu dem weitläufigen Tal, das idyllisch zwischen den bewaldeten Hängen und nackten Felsbastionen eingebettet lag, bildete. Es waren, sechs Reiter, und sie fielen ihren abgehetzten, schwitzenden und verstaubten Pferden abrupt in die Zügel.
Überrascht starrten sie zwischen engen Lidschlitzen hervor auf die Ranchgebäude, auf deren Dächern das rote Licht des schwindenden Tages allmählich zu verblassen begann.
Chad schluckte trocken. Nur undeutlich konnte er auf die Entfernung ihre Gesichter erkennen, die überdies im Schatten der Hutkrempen lagen. Aber der Strom von Wildheit und Härte, der von ihnen ausging, blieb ihm nicht verborgen. Unbehaglich reckte er die Schultern. Seine Hände legten sich fester um die Winchester. Ihm wurde schnell klar, dass diese bis an die Zähne bewaffneten Satteltramps Verdruss in sein Tal brachten. Und es wurde zur Gewissheit, als sie, nachdem sie sich von ihrer Überraschung erholt hatten, ihre Revolver herausrissen und ihre Pferde antrieben.
Der Pulk zog sich auf einen staubheiseren Befehl hin auseinander. Dumpf und drohend pochte der Hufschlag heran.
Chads Gedanken drehten sich wie ein Karussell. Eine nachdenkliche Falte zog sich von seiner Nasenwurzel bis unter seinen Haaransatz. Furchtbare, quälende Ahnungen ließen sein Herz hart hämmern, jagten ihm das Blut wie im Fieber durch die Adern. Dann je näher sie kamen, desto deutlicher wurde das Fluidum von Unerbittlichkeit und Brutalität, das sie zu umgeben schien.
»Heh, Ranch!«, platzte es rau in das chaotische Durcheinander seiner Empfindungen. »Ist da jemand?«
Ein Ruck durchlief Chad. Die Reiter waren auf dreißig Schritte herangekommen und hielten erneut an. Misstrauisch sprangen ihre Blicke in die Runde, tasteten jeden Winkel, jeden Quadratzoll zwischen den Ranchgebäuden ab. Die Metallteile ihrer Waffen schimmerten matt. Die Mündungen gähnten schwarz und Unheil verkündend.
»Was wollt ihr?«, rief Chad.
Einer der Reiter stieß sich mit einer knappen Geste den breitrandigen Stetson aus der Stirn. Chad sah ein stoppelbärtiges, hohlwangiges Gesicht, in dem ein lasterhaftes, unstetes Leben tiefe Spuren eingegraben hatte. Und ihm entging nicht die helle Narbe, die sich über die linke Wange des Fremden zog und von einem Messer herrühren mochte. Alles an diesem dunklen, indianerhaften Burschen wirkte raubtierhaft.
Die Stimme des Burschen mit der Narbe prallte heran. »Wir haben es ziemlich eilig, Mister. Unsere Gäule sind am Ende. Und in deinem Corral sehe ich ein Rudel prächtiger, ausgeruhter Pferde. Was dagegen, wenn wir unsere Klepper gegen ein halbes Dutzend von deinen Klassegäulen eintauschen?«
Gegen diesen Vorschlag hatte Chad eine ganze Menge. Die Pferde waren das Ergebnis wochenlanger, härtester Sattelarbeit. Sie bedeuteten eine Menge Geld. Und er war nicht bereit, auch nur ein einziges dieser Tiere herzugeben. Andererseits aber schrillte alles in ihm Alarm. Sie würden sich die Pferde einfach nehmen und ihn und Jenny nicht ungeschoren lassen. Jenny! Alles in ihm wehrte sich gegen den Gedanken, dass sie diesen zweibeinigen, ausgehungert wirkenden Sattelwölfen in die Hände fallen könnte. Er erschauderte.
»Die Pferde sind für die Armee bestimmt, der Kaufvertrag ist längst unterzeichnet. Wenn ich denen statt meiner Pferde eure Gäule liefere, kriege ich den größten Ärger an den Hals und bin für alle Zeit aus dem Rennen. Tut mir leid, Leute, aber ihr werdet euch anderswo frische Tiere besorgen müssen.«
»Gib sie ihnen!«, raunte von der Tür her Jennifer, und ihr Tonfall war drängend und eindringlich. »Sie sehen aus, als nähmen sie sich, was sie wollen. Es sind Banditen.«
Chad atmete gepresst. Er wog seine Chance ab. Draußen lachte der Narbige kalt auf. Sein Lachen traf Chad bis ins Mark.
»Wenn du uns die Gäule nicht freiwillig gibst, Mister, dann nehmen wir sie uns einfach. Wie ich schon sagte: Wir haben es höllisch eilig. Und ich habe nicht die Absicht, mit dir zu feilschen.« Er drehte den Kopf. »Holt die Tiere aus der Fence, Leute. Und wenn der Bursche Zicken macht, dann pumpen wir ihn voll Blei.«
Chad dachte wieder an Jenny. Es stieg heiß in ihm auf. Er sagte laut und spröde. »All right, nehmt euch die Pferde …« Er verschluckte den Rest. Er wollte hinzufügen: »Und dann verschwindet schleunigst wieder!« Aber ihm fiel ein, dass sie es ohnehin höllisch eilig zu haben schienen.
Die Begleiter des Narbigen warfen sich aus den Sätteln, schnappten ihre Lassos und rannten zum Corral. Die Lassoschlingen kreisten in der Luft, flogen und senkten sich über den Köpfen der unruhigen Pferde. Ein heilloses Durcheinander entstand in der Fence. Staub wölkte dicht und undurchdringlich. Schrilles Wiehern erhob sich, unbeschlagene Hufe lösten ein rumorendes Dröhnen aus.
Der Narbige sprang vom Pferd. Er ließ die Zügelleinen einfach fallen. Steifbeinig stakste er auf das Haus zu. Scharf traten Chads Wangenknochen hervor, als er die Zähne zusammenbiss. »Nehmt euch die Pferde und reitet weiter!«, rief Chad nun doch. Er hob das Gewehr an und zielte auf die Brust des heruntergekommenen Burschen.
Und wieder ließ ihn dessen eisiges Lachen frösteln. Er erkannte die Verschlagenheit in den tiefliegenden, kleinen Augen, die nun auf das Fenster, hinter dem er stand, geheftet waren. Besorgt sah er über die Schulter auf Jenny. Sie presste die rechte Hand auf ihren Halsansatz, und in den Tiefen ihrer Augen offenbarte sich Chad eine Welt von unbeschreiblichen Gefühlen. Er sah den Ausdruck von Angst und Entsetzen. Sein Blut geriet in Wallung, sein Blick verkrallte sich wieder an der hageren, drahtigen Gestalt, die unbeirrbar näher stiefelte.
»Stehen bleiben!«, stieß er gepresst hervor. »Ich habe dich genau vor der Mündung, Mister. Und wenn du noch einen Schritt machst, drücke ich ab.«
»Das würde ich dir nicht raten, mein Freund«, kam es gelassen zurück. »Meine Partner würden dir die Haut streifenweise abziehen. Nun, du hast meine Neugier geweckt. Was hast du denn zu verbergen, weil du mich nicht in dein Haus lassen möchtest? Einen Schatz vielleicht?«
Der Bursche war stehen geblieben und starrte furchtlos, ganz im Gefühl seiner Überlegenheit und Stärke, auf das Fenster, aus dem die Winchester unmissverständlich auf ihn angeschlagen war. Er bleckte grinsend die Zähne, aber sein Grinsen konnte nicht über die erwartungsvolle, drohende Spannung hinwegtäuschen, die Chad plötzlich unerträglich anmutete. Ein schmerzlicher Zug glitt über sein Gesicht. »Verbirg dich, Jenny, schnell, kriech in den Vorratskeller!«, befahl er ihr leise. Und laut gab er zu verstehen: »Es gibt hier keinen Schatz, Mister. Es gibt nur mich. Und das einsame Leben hier draußen in der Wildnis macht einen Mann argwöhnisch.«
Jenny huschte davon. Der Narbige stapfte weiter. Chad trat vom Fenster weg und glitt aus dem Zimmer. Der Bandit rüttelte an der verschlossenen Haustür. Mit gemischten Gefühlen, zögernd, durchquerte Chad den Flur, stieß den Riegel zurück. Die Tür schwang auf, die letzte Helligkeit des Tages flutete herein, und einen schrecklichen Augenblick lang starrte Chad in die Mündung des Colts, die genau auf sein Gesicht gerichtet war. Sein entsetzter Aufschrei erstarb im Ansatz, als der Schuss aufbrüllte. Er nahm noch den grellen Mündungsblitz wahr, wollte instinktiv den Kopf zur Seite reißen, spürte den grässlichen Schlag, als jäh sein Denken abschaltete. Er fiel in ein tiefes schwarzes Loch, spürte keinen Schmerz und hörte nicht mehr Jennys gellenden, vom Grauen erfüllten Aufschrei, und er sah nicht mehr den gierigen Ausdruck, der in den Augen des Banditen zu glitzern begann.
*
Chad erwachte wie aus tiefem Schlaf. Über seinem verschleierten Blick spannte sich eine weißgekalkte Zimmerdecke. Er lag in einem Bett, jemand hatte ihn bis unter das Kinn zugedeckt. Er begriff nichts. Matt bewegte er den Kopf. Eine Welle stechenden Schmerzes raste durch sein Gehirn und brach sich Bahn aus seinem Mund in einem erstickten Röcheln. Es stach wie mit tausend Nadeln, die Qualen trieben Chad den kalten Schweiß auf die Stirn. Aber dann ließ der Schmerz nach. Er entspannte sich.
Bruchstückhaft kam die Erinnerung. Jenny! Der stumme Aufschrei fuhr wie eine glühende Klinge durch sein Gemüt. Angst und Sorge um sie rissen ihn aus den Tiefen seiner Benommenheit. Seine Gedanken wurden klarer.
Er zog seinen rechten Arm unter der Bettdecke hervor. Es geschah alptraumhaft langsam und schwerfällig. In seinem vom Blutverlust gezeichneten, eingefallenen und bleichen Gesicht zuckten die Muskeln. Und während seine Hand nach seinem Kopf tastete und die Fingerspitzen den weichen Verband fühlte, fluteten die schlimmsten Befürchtungen und schreckliche Ahnungen in langen, heißen Wogen durch seine gequälten Sinne.
Knarrend wurde die Tür geöffnet. Ein kühler Luftzug wehte herein und streifte sein fieberndes Gesicht. Fußbodendielen ächzten, dann beugte sich ein Mann über Chad. Es war Doc Wayne, und Chad wusste, dass er sich in Walapai befand, der kleinen Ortschaft am Fuße der Peacock Mountains. »Doc …«, krächzte er.
»Ruhig, Everett, ganz ruhig. Du bist schlimm verwundet und solltest dich kaum bewegen. Dabei hattest du noch Glück im Unglück. Die Kugel ist am Stirnbein abgeglitten, als du wahrscheinlich reflexartig den Kopf zur Seite gerissen hast, und sie hat dir nur ein Stück Knochen herausgemeißelt.«
»Wo ist Jenny?«, quoll es über Chads rissige, ausgetrocknete Lippen.
Die Linien und Furchen in Doc Waynes Miene vertieften sich. Er richtete sich auf und blickte betreten zur Seite.
»Wo?«, stöhnte Chad und hob ein wenig den Kopf. Angst umkrallte sein Herz. Sein Körper verkrampfte sich.
Der Doc kratzte sich am Kinn, dann meinte er abgehackt und ohne jede Festigkeit im Tonfall: »Jenny geht's gut, Chad. Sie wird dich bald besuchen kommen, schätze ich.«
Und schnell wechselte er das Thema, als Chads Kopf kraftlos zurücksank. »Das Aufgebot aus Kingman fand dich. Es war hinter den Kerlen her, weil sie in der Stadt die Bank ausgeraubt und zwei Männer erschossen haben. Es handelt sich um John Davies' mörderischen Haufen. Einen der Burschen schossen sie aus dem Sattel, als der hold up schon gelaufen war. Ehe er starb, verriet er die Namen. Die Halunken werden in einer ganzen Reihe Staaten und Territorien steckbrieflich gesucht.«
»Sag mir die Wahrheit, Doc!«, stieg es gurgelnd aus Chads Kehlkopf. »Was haben sie mit Jenny gemacht?«
Wayne bemühte sich, noch einmal abzulenken. »Die Bande konnte entkommen. In der Unwegsamkeit der Berge und auf den frischen, ausgeruhten Pferden fiel ihr das nicht schwer. Aber …«
»Ich will die Wahrheit wissen, Doc!«
Die lahme Stimme geißelte den Arzt regelrecht. Doc Wayne begann sich zu winden, rang die Hände, seine Lippen vibrierten, und er mied es, Chads Blick zu begegnen. Schließlich aber sagte er schwerfällig und kratzend: »Sie haben Jenny umgebracht, Chad. Vorher aber haben sie das arme Geschöpf …« Alles in ihm sträubte sich, es auszusprechen. Aber jetzt, da es heraus war, fühlte er sich auf seltsame Art erleichtert. Chad hätte es sowieso erfahren. Und dann wäre der Schock nur noch größer gewesen, wenn er seine Hoffnungen, seine Zuversicht, durch weitere Lügen am Leben erhalten hätte.
In Chad hallten die Worte nach wie Totenglocken. Jenny — tot! Er schloss die Augen. Wie schreckliche Visionen stieg ein chaotisches Durcheinander von Bildern vor seinem geistigen Auge empor. Er sah Jenny, sah das Entsetzen, das namenlose Grauen in ihren angstverzerrten Zügen, hörte sie schreien, wimmern und flehen, und er sah die feixenden Gesichter der Banditen, die Begierde, mit der sie sich auf Jenny stürzten.
Er rang nach Luft und versuchte, die unerbittliche, grausame Wahrheit zu begreifen. Seine Lider flatterten, hoben sich, sein Blick schien von irgendwoher in die Wirklichkeit zurückzukehren. Brüchig sagte er, und jedes Wort kostete ihm übermenschliche Anstrengung und Willenskraft: »John Davies …« Der Name brannte sich ihm unauslöschlich ein. Hass flackerte in seinen Augen - vernichtender, verzehrender Hass. »Ich werde ihn finden, ich werde ihn nach Jenny fragen - und dann töte ich ihn.« Sein Mund zitterte in den Winkeln heftig.