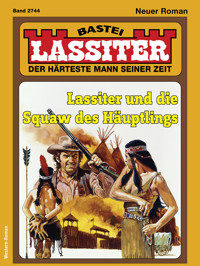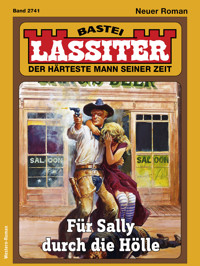Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Trevellian und die Organ-Mafia: Action Krimi Krimi von Pete Hackett Der Umfang dieses Buchs entspricht 124 Taschenbuchseiten. Organe auf Bestellung! Auf Kosten von arglosen Obdachlosen in Kolumbien werden benötigte Organe von einer gut vernetzten Verbrecherbande ganz nach Wunsch geliefert. Die Toten werden entsorgt wie Müll. Als die Ermittler Trevellian und Tucker sich damit befassen müssen, stechen sie in ein Wespennest hochrangiger Mitglieder der "feinen" Gesellschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Trevellian und die Organ-Mafia: Action Krimi
Pete Hackett
Published by BEKKERpublishing, 2021.
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Trevellian und die Organ-Mafia: Action Krimi
Copyright
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Sign up for Pete Hackett's Mailing List
Further Reading: 1000 Seiten Krimi Spannung - Acht Top Thriller
Also By Pete Hackett
Trevellian und die Organ-Mafia: Action Krimi
Krimi von Pete Hackett
Der Umfang dieses Buchs entspricht 124 Taschenbuchseiten.
Organe auf Bestellung! Auf Kosten von arglosen Obdachlosen in Kolumbien werden benötigte Organe von einer gut vernetzten Verbrecherbande ganz nach Wunsch geliefert. Die Toten werden entsorgt wie Müll. Als die Ermittler Trevellian und Tucker sich damit befassen müssen, stechen sie in ein Wespennest hochrangiger Mitglieder der „feinen“ Gesellschaft.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2021 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen .
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www. AlfredBekker.de
Folge auf Twitter
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Prolog
Bogota, Kolumbien. In einem Park machten spielende Kinder eine grauenhafte Entdeckung. Unter einem dichten Busch fanden sie einen grauen Plastiksack, und als sie ihn mit kindlicher Neugierde öffneten, sahen sie die nackten Füße eines Menschen – eines toten Menschen.
Es war ein Obdachloser aus den südlichen Slums der Stadt, der zwei Tage zuvor spurlos verschwunden war.
Er war aufgeschnitten. Ein sauberer, anatomisch fachgerechter Schnitt.
Seine Nieren waren fachmännisch entfernt worden ...
1
Es war ungefähr 10 Uhr abends, und es war ziemlich kalt. Waren die Tage schon nicht besonders warm, so fielen die Temperaturen in den Nächten selbst in der wärmsten Jahreszeit auf Gradwerte, die unter 10 lagen.
Im Stadtviertel San Louise, in dem die Ärmsten der Armen in windschiefen Holzschuppen oder Wellblechbaracken, manchmal nur in sogenannten „Kartonburgen“ hausten, waren alte Ölfässer aufgestellt, in denen hohe Feuer loderten. Männer, Frauen und Kinder drängten sich um diese Wärmequellen. Denn in ihren menschenunwürdigen Behausungen gab es oftmals keine Öfen, an denen sie sich wärmen konnten.
Die Leute sprachen kaum miteinander. Es gab nicht viel, worüber es sich für sie zu sprechen lohnte. Die bittere Not, in der sie lebten, bot keinen Gesprächsstoff. Über ihre Unzufriedenheit redeten sie schon lange nicht mehr ...
Ein Auto fuhr vor. Es war ein roter Mitsubishi-Jeep, ein Pajero älterer Bauart. Der Motor wurde abgestellt, die Scheinwerfer erloschen. Die Wagenschläge flogen auf, zwei Männer stiegen aus, der dritte blieb im Fond des Wagens sitzen.
Sie erregten Aufmerksamkeit. Die beiden Männer näherten sich einer Menschengruppe, die eines der wärmespendenden Ölfässer umringten. Ihre Anzüge saßen einwandfrei. Und obwohl es finster war, trugen sie schwarze Sonnenbrillen. Der fingerdicke Schlamm, durch den sie schritten, verschmutzte ihre Schuhe. Sie achteten nicht darauf.
„Pedro Rodriguez!“, rief einer der beiden schroff, nachdem sie am Rande des Feuerscheins angehalten hatten. Ihre Gesichter waren nur undeutlich zu erkennen.
Nach kurzem Zögern trat ein etwa 30-jähriger Mann aus dem Pulk. Er war mit einem ausgewaschenen, zerschlissenen Hemd und einer abgewetzten Jeans bekleidet. Er war hager und hohlwangig. Seine Augen lagen tief in ihren Höhlen. Der Blick seiner dunklen Augen war müde. Seine Hände zitterten.
„Hier, Señor“, sagte er mit belegter Stimme. Er hatte Angst. Es bedeutete niemals etwas Gutes, wenn gutgekleidete Männer aus der Stadt in einem teuren Auto vorfuhren. „Ich – ich bin Pedro Rodriguez.“
„Mitkommen!“, kam es kurz angebunden. „Du bist verhaftet.“
„Aber – ich – weshalb?“
„Das erfährst du früh genug.“ Der Mann zog mit seinem letzten Wort eine Pistole unter der Jacke hervor. Der Stahl der Waffe reflektierte den Schein des Feuers. „Vorwärts, in den Wagen.“
Die Menschen rund um das Feuer schwiegen. Wortlos beobachteten sie, was sich abspielte. Niemand stellte Fragen. Sie waren abgestumpft und desinteressiert.
„Müssen wir dir Beine machen?“, schnappte der andere der beiden Kerle.
Pedros Kinn sank auf die Brust. Müde, mit hängenden Schultern setzte er sich in Bewegung.
Sie dirigierten ihn zum Auto, der dritte Mann öffnete von innen die hintere Tür, dann rutschte er auf die andere Seite. Pedro musste neben ihm Platz nehmen. Der Bursche bedrohte Pedro mit einer Pistole.
Die beiden, die Pedro abgeholt hatten, warfen sich auf Fahrer- und Beifahrersitz. Der Motor wurde gestartet, die Scheinwerfer bohrten sich wie zwei Lichtbalken in die Dunkelheit hinein. Der Wagen fuhr an ...
Ein Junge, elf Jahre alt, merkte sich Modell und Kennzeichen des Wagens. Pedros Neffe. Sein Name war Sancho.
„Was hat dein Onkel angestellt, dass ihn die Polizei abgeholt hat, Sancho“, fragte ihn ein alter, ausgemergelter Mann.
„Nichts“, antwortete der Junge. Und bedrückt fügte er hinzu: „Das waren keine Polizisten. Die Polizei hätte gesagt, weshalb er mitkommen muss.“
Betroffen starrte der Alte den Knaben an.
2
Zwei Tage später fand man Pedro Rodriguez‘ Leiche auf einer Müllhalde weit außerhalb der Hauptstadt. Sie lag in einem grauen Plastiksack. Der Leichnam wies einen sauberen, anatomischen Schnitt auf. Seine Nieren fehlten ...
Die Polizei ermittelte halbherzig.
Alles, was sie herausfand, war die Tatsache, dass die Männer, die Pedro Rodriguez abholten, keine Polizisten waren.
Die Marke des Autos und die Zulassungsnummer, die der elfjährige Sancho den Ermittlungsbeamten verriet, erschienen nicht einmal in den Ermittlungsberichten.
Der Fall wurde ad acta gelegt.
Ebenso wie alle anderen identischen Fälle.
3
Miguel Santana war Journalist bei „El Tiempo“. Die Organentnahmen im Zusammenhang mit den kaltblütigen Morden an Obdachlosen und Asozialen beschäftigten ihn seit Längerem.
Er fing an zu ermitteln, recherchierte und stieß in der Mordsache Pedro Rodriguez auf dessen Neffen Sancho.
Sancho war mehr oder weniger eines der vielen tausend Straßenkinder, die die Straßen Bogotas bevölkerten. Er gehörte aber noch zur harmloseren Sorte. Mit kleinen Diebstählen hielt er sich über Wasser. Manchmal konnte er sein Diebesgut in der Stadt an den Mann bringen. Dann klimperten in seinen Taschen einige Centavos, manchmal sogar Pesos.
Andere Kids in seinem Alter oder noch jünger waren schon dem Rauschgift oder dem Alkohol verfallen. Zehnjährige trugen schon Geschlechtskrankheiten mit sich herum.
Sancho ging seinen eigenen Weg. Trotz seiner jungen Jahre hatte er sehr schnell begriffen, dass er sich in dieser zwielichtigen Welt nicht treiben lassen durfte. Sein Ziel war es, eines Tages dieser Hölle zu entfliehen und ein Leben innerhalb der Gesellschaft und nicht an deren Rand zu führen.
Miguel Santana gelang es, Sancho aufzugabeln, als der Junge wieder einmal in die Elendssiedlung San Louisa zurückkehrte, um in dem Bretterverhau zu übernachten, den sein Onkel Pedro errichtet hatte, damit sie wenigstens ein Dach über dem Kopf hatten.
Er stieß auf bedingungsloses Misstrauen bei dem Jungen. Lange musste er intensive Überzeugungsarbeit leisten, bis der Junge endlich redete.
Am allermeisten beschäftigte den Journalisten die Frage, nach welchem System die Organspender‘ ausgesucht wurden.
Denn eines wusste er auch als medizinischer Laie: Es kann einem x-beliebigen Körper nicht ein x-beliebiges Organ entnommen und in einen anderen x-beliebigen Körper eingesetzt werden. Da sind eine Reihe von Faktoren zu beachten wie Blutgruppe, Gewebebeschaffenheit, Größe und Gewicht des Empfängers und noch einige Dinge mehr.
Miguel Santana hatte sich mit Thema ziemlich ausgiebig befasst.
„War dein Onkel in ärztlicher Behandlung?“, fragte er den Jungen.
Er erntete dafür von Sancho einen Blick, der ihn sekundenlang selbst am Sinn seiner Frage zweifeln ließ.
Der Junge antwortete: „Wir hätten einen Arzt nicht mal mit Hosenknöpfen bezahlen können, Señor. Wenn wir krank werden, dann ist es entweder eine Krankheit, an der wir zugrunde gehen, oder wir werden von selbst wieder gesund.“
„Hattet ihr nie Kontakt mit einem Doktor?“
„Doch. Ein Arzt, der in der Sozialstation tätig ist. Er kommt einmal in zwei Wochen her, verbringt einen Tag hier, untersucht die Leute und verteilt Medikamente an Kranke. Ich glaube, die Stadt bezahlt ihn. Ich weiß es aber nicht genau. Es spielt auch keine Rolle. Es ist eine Massenabfertigung.“
Miguel Santana musste sich wundern. Eines begriff er sehr schnell. Diese Straßenkids waren in ihrer Entwicklung ihren Altersgenossen in den behüteten Häusern fernab vom täglichen Kampf ums Überleben um einiges voraus. Sancho war von einem unerbittlichen Daseinskampf geprägt und von einer brutalen Realität am Rande der gutbürgerlichen Gesellschaft erzogen worden. Er redete wie ein Mann, der auf eine zwanzig- oder dreißigjährige Lebenserfahrung zurückgreifen konnte.
„Warst du auch schon bei diesem Arzt? Wie heißt er?“, erkundigte sich der Journalist.
„Nein, ich war noch nie bei ihm. Ich bin gesund. Ich kann es mir nicht leisten, krank zu sein. Denn wenn ich nicht auf die Straße kann, habe ich nichts zu essen. Und dann werde ich erst recht krank.“
Der Journalist seufzte. Der Junge verblüffte ihn immer mehr. Ja, es war ein teuflischer Kreislauf. Als Obdachloser kannst du es dir nicht leisten, krank zu sein, durchwehte es den Verstand des Journalisten wie ein heißer Wind. Es klingt wie ein Hohn. Das ist ja schlimmer als zur Zeit der Jäger und Sammler. Die mussten auch täglich raus aus ihren Höhlen, um zu überleben ...
„Dein Onkel?“, bohrte er weiter. „War Pedro schon mal bei diesem Doktor? Wenn ja, hat er erzählt, was der Arzt mit ihm gemacht hat?“
„Si, si. Pedro war einige Male dort.“ Der junge nickte. „Mehr, um die Zeit totzuschlagen, als dass ihm wirklich etwas gefehlt hätte. Der Doktor hat ihn abgehorcht. Und dann hat er ihn wohl wieder heimgeschickt. Pedro war auch gesund.“
„Hat er ihm Blut abgezapft?“
Sancho zuckte mit den schmalen, hageren Schultern. „Kann schon sein, ich weiß es nicht. Pedro und ich – wir sahen uns nicht oft. Wenn wir hierher kamen, schliefen wir meistens. Wir haben kaum miteinander gesprochen.“
„Wie heißt der Arzt?“ Miguel Santana stellte diese Frage bereits zum zweiten Mal.
Sancho musste nicht überlegen. „Dr. Ramon Estralda“, sagte er. „Irgendwo am Rand der Siedlung hat er eine Praxis. Manche Leute gehen dorthin, wenn ihnen was fehlt. Meistens Mütter mit ihren Kindern.“
Miguel Santana bedankte sich bei dem Jungen und drückte ihm einige Geldscheine in die Hand. Es würde Sancho helfen, wieder für ein paar Tage über die Runden zu kommen ...
4
Bei Carl Stoneborn läutete das Telefon. Stoneborn war ein Zweieinhalbzentner-Mann von 46 Jahren. Er war Geschäftsführer einer Golfanlage im Marine Park in Brooklyn. Sein schütteres Haar war rotblond, seine Stirn schimmerte ständig feucht vom Schweiß, und er gehörte zu jener Sorte Mensch, die ständig Stress demonstrierten.
„Stoneborn, Golf-Anlage Marine-Park!“, kam es über seine feuchten, aufgeworfenen Lippen, zwischen denen sich beim Sprechen ein weißer Speichelfaden zog.
„Svenson. Wir brauchen Nachschub.“
Das war kurz und bündig, aber beide wussten, wovon die Rede war.
Stoneborns blass-blaue Augen zeigten jähes Interesse. „Was soll‘s diesmal sein, Doc?“
„Ein Herz. Allerdings können wir es nicht tausende von Kilometer mit dem Flugzeug transportieren. Es muss spätestens sechs Stunden nach der Entnahme transplantiert werden.“
„Wie viel?“ Die blassblauen Augen zeigten grenzenlose Habgier.
„750.000 Dollar. Mein Honorar nicht inbegriffen. Der Patient ist ein schwerreicher Ölmagnat aus Texas.“
Stoneborn pfiff zwischen den Zähnen. Dann sagte er in die Muschel: „Soll ich in New York einen Spender beschaffen?“
„Nein. Ich habe bereits mit Professor Alvarez in Bogota Verbindung aufgenommen. Ich fliege mit dem Patienten übermorgen hinunter. Heute ist der vierte. Wir brauchen das Spenderherz also am siebten oder achten dieses Monats. Lässt sich das einrichten?“
„Kein Problem. Ich nehme sofort mit Bogota Verbindung auf.“
„Okay. Passen Sie auf: Der Empfänger ist eins-fünfundachtzig groß, wiegt neunzig Kilo und hat Blutgruppe A, positiv.“
„Moment.“ Stoneborn nahm einen Stift und ein Blatt Papier und vermerkte die Daten. „Alles klar. Ich werde die Sache in die Wege leiten.“
„Well. Ich verlasse mich auf Sie. Vor allem müssen die Papiere in Ordnung sein.“
Carl Stoneborn stieß die Luft scharf durch die Nase aus. „Sie konnten sich bisher immer auf mich verlassen, Doc. Wie sieht‘s mit nem Vorschuss aus?“
„150.000 gehen heute noch auf Ihr Konto. Zufrieden?“
„Klar.“
Das Gespräch war beendet. Carl Stoneborn schaute auf seine teure Armbanduhr. Es war kurz nach 14 Uhr. In Bogota war es eine Stunde später.
Er wählte eine Nummer, eine sehr lange Nummer, dann vernahm er das Freizeichen. Schließlich hob jemand ab. Es knackte in der Leitung. Die Stimme kam etwas unklar durch: „Herrero.“
„Pepe, ich bin‘s, Stoneborn. Kannst du mich verstehen.“
„Aaah, Stoneborn! Si, ich kann dich hören. Hast du einen Job für uns, Amigo?“
„Yeah. Ein Herz.“ Er gab Größe, Gewicht und Blutgruppe des Patienten durch.
„Wann?“, fragte der Kolumbianer am anderen Ende der Leitung.
„In vier Tagen. Den Spender lieferst du wie immer mit entsprechenden Papieren im San Carlos Hospital ab. Verstanden?“
„Bezahlung wie immer?“
„Sicher, wie immer und unverzüglich.“
„Bueno. Wir werden prompt liefern.“
„Adios, Amigo.“ Carl Stoneborn legte auf.
Sein feistes Gesicht glänzte vor Zufriedenheit. Er rieb sich die fleischigen Hände. 150.000 waren nur die Anzahlung. Den Rest, noch einmal die selbe Summe, erhielt er nach erfolgreich verlaufener Transplantation. 250.000 würde Dr. José Alvarez kassieren, was übrig blieb, erhielten Herrero und seine Mörder-Komplizen.
Ja, er war zufrieden, der fette Mister, der als Mittelsmann zwischen einem verbrecherischen Arzt in New York und einer Mörderbande in Bogota tätig war.
Er war ein Wolf im Schafspelz.
5
Bogota, einen Tag später.
Dr. Ramon Estralda klopfte dem kleinen, braunhäutigen Jungen kameradschaftlich auf die Schulter. An die Mutter des Knaben gewandt sagte er: „Es ist nur ein Husten, eine Erkältung, Señora. Ich gebe Ihnen ein Medikament, einen Saft, von dem Sie dem kleinen Kerl dreimal täglich jeweils zehn Tropfen verabreichen. In drei Tagen wird er wieder quietschvergnügt mit seinen Altersgenossen herumtollen können.“
Der Arzt ließ das Stethoskop fallen, so dass es vor seiner Brust baumelte, ging zu einem Medikamentenschrank, öffnete ihn und nahm eine kleine braune Flasche heraus. Er reichte sie der verhärmten Frau, die noch keine 30 war, die aber um einiges älter aussah. Sie gehörte zu den Armen des Landes, den Hoffnungslosen, deren Dasein ein einziger, fortwährender Überlebenskampf war.
„Danke, Doktor, vielen Dank.“ Die Frau nahm das Fläschchen und steckte es in die Tasche ihrer abgerissenen Jacke. „Sie sind so gut zu uns, Doktor. Sie sind ein Samariter. Wenn ich Sie bezahlen könnte, dann ...“
Der Arzt unterbrach sie lächelnd: „Keine Sorge, Señora. Die Behandlungskosten trägt die Stadtverwaltung. Ja, unser Land ist sehr sozial eingestellt. Keiner soll krank sein und leiden, nur weil er arm ist.“
„Der Himmel wird es Ihnen eines Tages vergelten, Doktor. Ich werde für Sie beten. Sie sind ein gütiger Mann.“
„Damit soll sich der Himmel nur noch etwas Zeit lassen“, lachte der Arzt. Er war um die 50, grauhaarig, und hatte freundliche, braune Augen.
Die Frau zog dem Knirps das Hemd über.
Dann bedankte sie sich noch einmal überschwänglich und verließ schließlich mit dem Knaben an der Hand die Praxis.
Der Arzt schaute die junge Frau an, die ihm bei seiner täglichen Arbeit zur Hand ging. Sie war schwarzhaarig, rassig, und sogar der formlose, weiße Kittel, in dem sie steckte, betonte ihre weiblichen Proportionen. „Wie viele noch?“, fragte er.
„Sieben“, antwortete Conchita. So hieß die rassige Lady.
Dr. Estralda drehte die Augen zur Decke. „Dann wird‘s wieder spät“, gab er zu verstehen und schaute zum Fenster hinaus.
Es wurde schon düster. Am Himmel trieben graue Regenwolken. Das Wetter in Bogota war eigentlich immer hässlich. Die Sonne schien hier, je nach Jahreszeit, zwischen drei und sechs Stunden am Tag.
Im Wartezimmer wurde es laut. Die dunkle Stimme eines Mannes war durch die geschlossene Tür zu vernehmen: „Ich muss den Doktor auf der Stelle sprechen, Señorita. Es ist ...“
Der Sprecher verstummte, als der Arzt die Tür öffnete. Da stand seine Sprechstundenhilfe mitten im Wartezimmer, vor ihr stand ein dunkelgesichtiger Mann mit straff nach hinten gekämmten, gelglänzenden Haaren und dichten Koteletten bis zu den Kinnwinkeln.
„Ah, Doktor“, rief der Bursche. „Ich muss Sie sprechen. Es dauert nur ein paar Minuten.“
Der Arzt nickte. „Kommen Sie herein, Señor.“ Er drehte den Kopf zu Conchita herum. „Nehmen Sie sich der einfachen Fälle an, Conchita? Ich muss mit dem Señor einige Dinge besprechen. Ich werde gleich wieder zur Verfügung stehen.“
Er lächelte sie an.
„Gewiss, Doktor“, nickte Conchita und verließ das Behandlungszimmer.
Die Sprechstundenhilfe gab den Weg frei.
Dr. Estralda schloss die Tür, als Pepe Herrero eingetreten war. „Was ist es diesmal?“, stieß er hervor.
„Ein Herz. Wir brauchen einen gesunden Burschen, ungefähr eins-fünfundachtzig groß, neunzig Kilo schwer, Blutgruppe A, positiv.“
Dr. Estralda zog den linken Mundwinkel in die Höhe. „Eins-fünfundachtzig vielleicht, neunzig Kilo auf keinen Fall, bei den ausgemergelten Burschen, die ich betreue. A, positiv ist kein Problem.“
Er ging zum Computer und griff nach der Maus. Einige Klicks, und das Suchfenster seiner Datenbank wurde geöffnet. Er gab in die verschiedenen Textfelder die entsprechenden Kriterien ein. Das Suchergebnis war Null.
„Hab ich Ihnen doch gesagt“, murmelte der Arzt. Er klickte wieder das Suchfenster her. Er gab als Kriterien dieses Mal die Größe mit eins-fünfundsiebzig an, das Gewicht mit 65 Kilo.
Dann klickte er Ok.
Der Computer zeigte fünf Treffer an.
Dr. Ramon Estralda druckte die Personendaten aus. Er reichte die Liste Pepe Herrero. Der überflog sie mit den Augen, nickte und grinste: „Sehr gut, Doktor. Einen der Kerle werden Sie in vier Tagen aus Ihrer Datenbank löschen können.“
„Langsam nimmt es einen Umfang an, Herrero“, knurrte der Arzt, „der die Polizei zwingt, der Sache auf den Grund zu gehen. Da nützt es auch nichts, dass ...“
„Es gibt eben viele reiche Americanos, die kaputte Herzen, Nieren und Lungen haben. Wir leben doch gut davon. Und nach den Hungerleidern, die wir zu Organspendern machen, kräht kein Hahn. Sie kriegen es doch nicht mit der Angst, Doktor?“
„Was heißt hier Angst? Sorgen werde ich mir wohl machen dürfen?“
„Bleiben Sie nur schön bei der Stange. Sie stecken genauso tief drin wie wir.“
„Ich weiß.“
„Bueno. Also dann, bis zum nächsten Mal. Spielen Sie jetzt weiter den Engel der Armen und Entrechteten, Doktor.“
Pepe Herrero verließ die Praxis.
Von einer Telefonzelle aus rief er einen seiner Komplicen an. Er studierte die Liste der Kandidaten, die ihm der Arzt ausgehändigt hatte, während das Freizeichen tutete. Dann hatte er seinen Mann an der Strippe.
„Pass auf, Paco. Der Name ist Benito LaVega. Er wohnt in der Barackensiedlung San Louise.“
„Ich kenne das Elendsviertel. Alles klar. Wann?“
„Am siebten.“
„In Ordnung. Übergabe wie immer?“
„Si.“
6
Benito LaVega lag in seiner Behausung auf einer alten, fleckigen Matratze, aus der an manchen Stellen ganze Büschel von Seegras quollen.