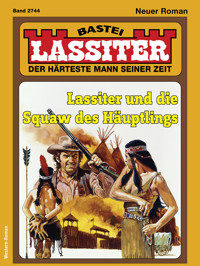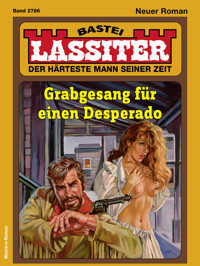Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Krimis: (399) Trevellian und die Millionenleiche (Pete Hackett) Trevellian und der Sumpf des Verbrechens (Pete Hackett) Ein Neuling in Hamburg (Henry Rohmer) Wer lässt Verbrecher, die von der Polizei nicht überführt werden konnten, ermorden? Zurück bleibt jedes Mal ein Bekennerschreiben des Vollstreckers. Wer beauftragt diesen Mann? Der Name The Court taucht auf. Als der Vollstrecker beginnt, auch für das organisierte verbrechen zu arbeiten, kommt es zu einem Interessenkonflikt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
3 Spitzenkrimis in einem Band Januar 2024
Inhaltsverzeichnis
3 Spitzenkrimis in einem Band Januar 2024
Copyright
Trevellian und die Millionenleiche: Action Krimi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Trevellian und der Sumpf des Verbrechens
Ein Neuling in Hamburg
3 Spitzenkrimis in einem Band Januar 2024
Pete Hackett, Henry Rohmer
Dieser Band enthält folgende Krimis:
Trevellian und die Millionenleiche (Pete Hackett)
Trevellian und der Sumpf des Verbrechens (Pete Hackett)
Ein Neuling in Hamburg (Henry Rohmer
Wer lässt Verbrecher, die von der Polizei nicht überführt werden konnten, ermorden? Zurück bleibt jedes Mal ein Bekennerschreiben des Vollstreckers. Wer beauftragt diesen Mann? Der Name The Court taucht auf. Als der Vollstrecker beginnt, auch für das organisierte verbrechen zu arbeiten, kommt es zu einem Interessenkonflikt.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER TONY MASERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Trevellian und die Millionenleiche: Action Krimi
Krimi von Pete Hackett
Der Umfang dieses Buchs entspricht 119 Taschenbuchseiten.
Leute werden entführt und trotz Lösegeldzahlung tot aufgefunden. Gleichzeitig wird ein Journalist ermordet, der gegen eine ganze Verbrecher-Bande ermittelte; Drogenhandel, Prostitution, Menschenhandel und Erpressung gehören ebenso dazu wie Mord. Aber die Hintermänner wissen sich zu schützen, vor allem gegen die FBI-Agenten Trevellian und Tucker.
1
Donnerstag, 31. Oktober, 20.10 Uhr.
Gilbert Fairchild duschte ausgiebig. Nach anderthalb Stunden intensiven Trainings war er ziemlich ins Schwitzen gekommen. Der Geschäftsmann hatte seinen überflüssigen Pfunden den Kampf angesagt. Nun fühlte er sich gut.
Nachdem er sich den Seifenschaum abgeschwemmt hatte, verließ er die Dusche und griff nach dem Handtuch. Fünfundzwanzig Minuten später verließ er das Fitnessstudio. Er warf einen Blick auf seine Uhr. Es war kurz vor dreiviertel 9 Uhr.
Auf dem Parkplatz stand sein Cadillac. Es war ein CTS 3.6 Sport Luxury. Fairchild sah auch den weißen Chevy, in dem zwei Männer saßen. Er hatte keine Ahnung, dass sie auf ihn warteten. Einer der Kerle sagte grinsend: »Wenn der wüsste, dass er für uns eine Million wert ist.« Er lachte auf. »Eine ganze Million!«
Es klang geradezu euphorisch.
Fairchild öffnete den Kofferraum des Cadillacs und stellte seine Sporttasche hinein. Dann setzte er sich ans Steuer, startete den Motor und fuhr los. Das Studio befand sich in der Canal Street. Fairchilds Wohnung lag in Clinton, genauer gesagt in der 55th Street. Es handelte sich um eine sehr teure Wohngegend, aber Fairchild war ein betuchter Mann, der sich des Geldes wegen keine Gedanken zu machen brauchte.
Der weiße Chevy folgte ihm. Es war bereits dunkel. Leichter Nieselregen hatte eingesetzt. Fairchild bog auf den Broadway ein und wandte sich nach Norden. Das Autoradio lief. Fairchild pfiff leise mit.
Im Chevy sagte der Beifahrer in sein Handy: »Wir hängen an ihm dran. Es wird ohne Komplikationen über die Bühne gehen. Der Bursche macht sicher keine Zicken, wenn wir ihm die Knarre unter die Nase halten.«
»Ich verlasse mich auf euch. Wie ich schon sagte: Wir können es zu einem lukrativen Geschäft ausbauen. Allerdings dürft ihr keinen Fehler machen.«
»Sie können sich auf uns verlassen.«
»Gebt mir Bescheid, wenn ihr ihn im Versteck habt.«
»Das ist selbstverständlich.«
Der Mann beendete das Gespräch und sagte zum Fahrer: »Wir werden den Boss überzeugen. Wie fühlst du dich?«
»Bei mir ist alles in Ordnung. Nicht die Spur von Nervosität. Warum fragst du?«
»Nun, wir machen das zum ersten Mal. Es kann auch schief gehen. Fehler duldet der Boss nicht.«
»Wir dürfen eben keinen Fehler machen.«
Von nun an schwiegen die beiden Kerle. Sie blieben an dem Cadillac dran. Oft standen die Ampeln auf Rot. Anfahren, bremsen, anfahren … Die Scheibenwischer waren auf Intervall geschaltet. Im Auto war es warm. Schließlich bog der Cadillac in die 55th Street ein.
Fairchild hielt an der Schranke der Abfahrt in die Tiefgarage an, holte seine Plastikkarte aus der Innentasche seiner Jacke, schob sie ins Lesegerät, die Schranke schwang hoch und Fairchild gab etwas Gas.
Der Chevy wurde vor dem Gebäude in eine Parklücke rangiert. Die beiden Männer stiegen aus und folgten Fairchild zu Fuß in die Tiefgarage. Fairchild hatte seinen Wagen auf den Stellplatz gefahren. In der Garage roch es nach Abgasen. An der Betondecke waren Neonleuchten befestigt. Die beiden Kerle trugen Sportschuhe, und so waren ihre Schritte nicht zu hören, abgesehen von einem leisen Quietschen, das die Gummisohlen hervorriefen.
Fairchild war ausgestiegen, hatte den Kofferraum geöffnet und hob seine Sporttasche heraus. Als er das leise Quietschen vernahm, drehte er unwillkürlich den Kopf. Zwei Männer kamen auf ihn zu. Fairchild verspürte jähe Anspannung. Schlagartig war ihm klar, dass er das Ziel der beiden war, und er dachte an einen Überfall. Jähe Angst stellte sich ein. Fairchild ließ die Tasche los und wandte sich den beiden Kerlen zu. Diese zogen plötzlich Pistolen unter ihren Jacken hervor und richteten sie auf Fairchild.
»Keinen Laut!«, stieß einer der Kerle hervor.
Fairchilds Magen krampfte sich zusammen. Sein Herz begann zu rasen, seine Atmung beschleunigte sich. Der Schreck ging tief. »Was – was wollt ihr?«, keuchte der Geschäftsmann.
»Gib mir die Karte, mit der man die Schranke öffnet«, forderte einer der Kerle.
Eine unsichtbare Hand schien Fairchild zu würgen. Er schluckte. Seine Rechte zuckte unter die Jacke und holte die Karte hervor. Der Bursche nahm sie, machte kehrt und schritt schnell davon.
»Setz dich in dein Auto«, gebot der andere der beiden Kerle.
Mit weichen Knien ging Fairchild zur Fahrertür, öffnete sie und ließ sich auf den Sitz fallen. »Wenn – wenn Sie Geld wollen …«
Der Gangster lief vorne um das Auto herum, hielt dabei die Pistole unverwandt auf Fairchild gerichtet, und gleich darauf setzte er sich auf den Beifahrersitz.
»Wie viel Geld hast du denn einstecken?«
»Etwas über hundert Dollar.«
»Her damit.«
Fairchild gab dem Gangster das Geld, und dieser steckte es in die Tasche. Kurze Zeit verstrich, in der Fairchild dem eisigen Wind seiner Gedanken ausgesetzt war. Dann wurde Motorengeräusch laut. Das Licht der Scheinwerfer kroch vor dem Chevy über den Betonboden. Hinter dem Cadillac wurde der Chevy angehalten.
»Aussteigen!«, kommandierte der Gangster, der mit Fairchild im Cadillac saß. Der Geschäftsmann kam dem Befehl nach. Er musste sich auf den Rücksitz des Chevy setzen, der Gangster nahm neben ihm Platz. Dann fuhren sie aus der Tiefgarage.
2
Um 23.05 Uhr klingelte bei Wanda Fairchild das Telefon. Sie war voll Sorge um ihren Mann. Er hätte längst zu Hause sein müssen. Telefonisch war er nicht erreichbar. Die Frau nahm den Hörer aus der Ladestation, hob ihn an ihr Ohr und meldete sich.
Eine dunkle Stimme sagte: »Hör zu, Lady. Wir haben deinen Mann und fordern eine Million Dollar Lösegeld. Keine Polizei! Verstehst du? Wenn du die Bullen ins Spiel bringst, wird es dein Mann büßen.«
»Aber …« Wanda Fairchild verspürte Schwindelgefühl. Einen Moment schien sich um sie herum der Raum zu drehen. Das Herz schlug ihr hinauf bis zum Hals. Ihre Stimmbänder versagten.
»Du bringst das Geld morgen Abend um zwanzig Uhr zu einem Schließfach in der Penn Station. Dann fährst du zum Central Park. Beim Eingang des Wildlife Conservation Centers wirst du erwartet. Du wirst dem Mann den Schließfachschlüssel übergeben. Hast du alles verstanden, Lady?«
Wanda Fairchild musste zweimal ansetzen. »Ja«, würgte sie schließlich hervor. »Bitte, fügen Sie meinem Mann kein Leid zu. Ich – ich werde das Lösegeld zahlen.«
»Keine Polizei!«
»In – in Ordnung.«
Dann war die Leitung tot. Der Anrufer hatte das Gespräch beendet. Wanda Fairchild ging zu einem Sessel. Ihre Beine wollten sie kaum tragen. Sie ließ sich hinein sinken. Die Frau war nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Ihre Psyche drohte zu versagen. Nur nach und nach beruhigte sich der Aufruhr in ihrem Innern. Mit zitternden Fingern tippte sie eine Nummer, dreimal ertönte das Freizeichen, dann erklang eine männliche Stimme: »Hallo, Ma, was veranlasst dich, um diese Zeit anzurufen?«
»Etwas Schreckliches ist geschehen.« Die Frau kämpfte gegen die Tränen. »Dein Dad wurde entführt.«
»Was?«
»Du hast richtig verstanden. Dein Dad wurde entführt.«
»Hast du die Polizei schon informiert?«
»Keine Polizei«, murmelte die Frau. »Sie haben gedroht, Gilbert umzubringen.«
»Was – was fordern die Schufte?«
Wanda Fairchild erzählte es ihrem Sohn. Als sie geendet hatte, stieß Dennis Fairchild hervor: »Ich werde die Million beschaffen und in dem Schließfach hinterlegen. Den Schlüssel gebe ich anschließend dir, damit du ihn überbringen kannst. Hoffen wir, dass die Kidnapper Wort halten und Dad laufen lassen.«
»Wenn wir zahlen und keine Polizei einschalten, haben sie keinen Grund, Gilbert ein Leid zuzufügen.«
»Solche Gangster sind unberechenbar.«
»Mal den Teufel nicht an die Wand.«
3
Mittwoch, 5. November. Milo und ich hatten vor zehn Minuten den Dienst angetreten. Für diesen Vormittag hatten wir uns vorgenommen, etwas von den Packen Papier abzuarbeiten, die sich auf unseren Schreibtischen angesammelt hatten. Unsere Computer waren hochgefahren, ich hatte einen dünnen Schnellhefter aufgeschlagen und las ein Vernehmungsprotokoll durch, da läutete mein Telefon. Ich schnappte mir den Hörer. »Trevellian, FBI New York.«
Es war die wohlvertraute Stimme des Assistant Directors, die sagte: »Guten Morgen, Jesse. Kommen Sie und Milo bitte doch gleich einmal zu mir.«
»Guten Morgen, Sir. Wir sind in einer Minute bei Ihnen.«
Als wir das Büro unseres Chefs betraten, erhob er sich, kam um seinen Schreibtisch herum und begrüßte uns per Handschlag, dann forderte er uns auf, an dem kleinen Besprechungstisch Platz zu nehmen. Er nahm eine dünne Mappe von seinem Schreibtisch und setzte sich zu uns. »Es geht um Kidnapping und Mord«, eröffnete Mr. McKee das Gespräch. »An was arbeiten Sie gerade?«
»Wir sind einer Bande von Kreditkartenbetrügern auf der Spur«, antwortete ich. »Zwei der Kerle konnten wir festnehmen, aber sie schweigen.«
»Am einunddreißigsten Oktober, abends, wurde der Geschäftsmann Gilbert Fairchild entführt. Seine Familie wurde aufgefordert, eine Million Dollar Lösegeld zu zahlen und die Polizei aus dem Spiel zu lassen. Das Lösegeld wurde am ersten November gezahlt. Gestern Nachmittag hat man die Leiche von Gilbert Fairchild gefunden. Sie lag in einem Waldstück außerhalb New Yorks. Ein Spaziergänger ist auf sie gestoßen.«
»Er wurde ermordet, obwohl seine Familie bezahlte?«, entfuhr es mir ungläubig. »Himmel, das entspricht nicht der Regel.«
»Womit Sie recht haben«, pflichtete mir der Chef bei. »Vielleicht hat Fairchild die Gesichter seiner Entführer gesehen.« Mr. McKee zuckte mit den Schultern. »Wir wissen nicht, was dahintersteckt.« Die Stimme des Assistant Directors hob sich. »Ich übertrage den Fall Ihnen beiden. Bei Ihnen weiß ich ihn in den besten Händen. Tun Sie alles, um die Mörder zu überführen.«
Ein glasklarer Auftrag!
Der Chef reichte mir die dünne Mappe. Wir waren entlassen. Zurück in unserem Büro schauten wir uns an, was die Mappe zu bieten hatte. Der Geschäftsmann war erschossen worden. Die Kugel hatte den Körper durchschlagen. Fairchilds Hände waren gefesselt. Die Mörder hatten ihn unter einem Haufen Reisig versteckt, aber der Hund des Spaziergängers hatte den Leichnam erschnüffelt und keine Ruhe gegeben, bis sein Herr unter dem Reisig nachschaute.
Ich rief bei der SRD an und hatte wenig später einen kompetenten Mann an der Strippe. Nachdem ich erklärt hatte, weshalb ich anrief, sagte der Kollege: »Keine Spuren. Die Kugel, mit der Fairchild getötet wurde, haben wir nicht gefunden. Der Mann war schon ein paar Tage tot. Sicher ist nur, dass er nicht am Fundort getötet wurde. Man hat ihn dort abgeladen und einen Haufen Reisig über ihn geschichtet.«
»Heißt das, dass er zum Zeitpunkt der Lösegeldzahlung möglicherweise schon tot war?«
»Wir schließen es nicht aus. Es kann aber auch sein, dass er unmittelbar nach Zahlung des Lösegelds umgebracht wurde. Jedenfalls sind die Mörder mit einer Brutalität sondergleichen vorgegangen. Sie haben Fairchild aus nächster Nähe zwischen die Schulterblätter geschossen.«
Ich bedankte mich und legte auf. »Wir sollten uns mit Mrs. Fairchild unterhalten.«
Milo nickte und erhob sich, nahm seine Jacke vom Stuhl und schlüpfte hinein. Wenig später waren wir auf dem Weg. In der 55th Street fand ich einen Parkplatz. Bei dem Gebäude, in dem sich die Wohnung der Fairchilds befand, handelte es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus mit über fünfzig Stockwerken. Rechtsanwälte, Ärzte, Steuerberater und die Verwaltungen verschiedener Betriebe waren hier untergebracht. Die Fairchild-Wohnung befand sich in der siebzehnten Etage.
Wir trafen auf eine verhärmte Frau mit rotgeweinten Augen. Wanda Fairchild war um die fünfzig. Sie war dunkel gekleidet. Nachdem ich uns vorgestellt hatte, bat sie uns in die Wohnung. In einem der Sessel saß ein Mann von etwa dreißig Jahren. Die Frau stellte ihn uns als ihren Sohn Dennis vor. Wir gaben ihm die Hand, dann folgten wir der Aufforderung, Platz zu nehmen.
Zuerst drückte ich der Frau und ihrem Sohn mein Beileid aus. Dann fragte ich Mrs. Fairchild, ob sie sich in der Lage fühle, unsere Fragen zu beantworten. Sie bejahte. Also forderte ich sie auf, zu erzählen.
Sie sagte mit lahmer Stimme: »Mein Mann war im Studio. Er wollte so gegen halb zehn zu Hause sein. Er kam jedoch nicht. Kurz nach elf Uhr erhielt ich den Anruf. Der Kidnapper forderte eine Million Dollar. Mein Sohn brachte das Geld am späten Nachmittag des folgenden Tages zur Penn Station und schloss es in ein Schließfach ein. Anschließend fuhr ich den Schlüssel zum vereinbarten Ort im Central Park.«
»Was war das für ein Ort?«, fragte ich.
»Der Mann wartete am Eingang des Wildlife Conservation Centers. Ich gab ihm den Schlüssel, und er verschwand, ohne ein Wort zu verlieren. Danach bin ich nach Hause gefahren, in der festen Meinung, dass die Kidnapper meinen Mann laufen lassen.«
Die Frau barg das Gesicht in ihren Händen. Ihr Körper erbebte. Sie verlor die Kontrolle über ihre Empfindungen. Ihr Sohn erhob sich schnell, trat hinter ihren Sessel und legte ihr die Hände auf die Schultern. »Das alles ist viel zu viel für Ma«, murmelte er. »Sie ist nicht stark genug.«
»Wie sah der Mann aus?«, erkundigte sich Milo, als Wanda Fairchild die Hände wieder sinken ließ. Tränen rannen über ihre Wangen.
Die Frau dachte kurz nach, dann antwortete sie: »Ungefähr dreißig Jahre alt, eins-achtzig groß, dunkelhaarig. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einem schwarzen Anorak.«
»Hatte er ein Auto? Wissen Sie gegebenenfalls die Zulassungsnummer?«
»Er ging zu Fuß davon.«
Ich richtete den Blick auf Dennis Fairchild. »Sie haben das Schließfach gemietet und das Geld dort deponiert. Was war es für eine Schließfachnummer?«
Dennis Fairchild nannte sie mir. Dann sagte er: »Die Entführung muss in der Tiefgarage geschehen sein. Der Wagen meines Vaters steht unten. Er war nicht abgesperrt.«
Ich wandte mich wieder an Mrs. Fairchild. »Sie wurden telefonisch zur Lösegeldzahlung aufgefordert. Wies die Stimme irgendwelche Besonderheiten auf?«
Die Frau schüttelte den Kopf. »Nein.«
Wir verließen die Wohnung. Vom Sportwagen aus veranlasste ich, dass das Schließfach, in dem das Geld deponiert war, von der SRD unter die Lupe genommen wurde. Dann kehrten wir ins Field Office zurück. Zunächst erstatteten wir dem AD kurzen Bericht. Unterm Strich hatte uns der Besuch bei Mrs. Fairchild nicht weitergebracht. Nachdem der Chef gebeten hatte, ihn auf dem Laufenden zu halten, begaben wir uns in unser Büro. Ich klickte mich ins Archiv ein und filterte die Männer heraus, auf die die Beschreibung der Frau passte und die einen Wohnsitz in New York hatten. Das Programm spuckte einige hundert Treffer aus. Wir würden es Mrs. Fairchild nicht ersparen können, ins Field Office zu kommen und sich die Bilder der in Frage kommenden Kerle anzusehen.
Ich rief die Frau an und bat sie, um 16 Uhr zu uns zu kommen. Sie sagte zu.
4
Wade Montgomery verließ die Redaktion. Er hatte um 14 Uhr in einem Lokal in der Lower East Side eine Verabredung mit einem Informanten. Der Journalist setzte sich in seinen Camaro und fuhr los. Das Lokal befand sich in der Stanton Street. Montgomery war schon voller Ungeduld. In ihm war der Jagdtrieb erwacht und er hoffte, einige wichtige Hinweise zu erhalten, die ihn in seinen Recherchen weiterbrachten.
Montgomery wandte sich vom Times Square aus auf dem Broadway nach Süden. Autokolonnen bewegten sich von Norden nach Süden und von Süden nach Norden. Es war diesig. Der Himmel über New York war grau. Der Wetterbericht hatte erste Schneefälle angekündigt.
Der Journalist wechselte auf die Bowery und wandte sich auf der Houston Street nach Osten, bis er auf die Allan Street abbog und schließlich sein Ziel, die Stanton Street, erreichte. Er fand vor dem Pub, in dem er mit seinem V-Mann verabredet war, einen Parkplatz, rangierte den Camaro hinein und stieg aus. Montgomery reckte die Schultern.
Ein Ford näherte sich. Der Zeitungsmann achtete nicht darauf, sondern wandte sich dem Eingang des Lokals zu. Plötzlich verspürte er einen furchtbaren Einschlag im Rücken. Er stolperte. Ein zweiter Einschlag erfolgte. Die Detonationen wurden von einem Schalldämpfer geschluckt. Das Geräusch, das die Pistole verursachte, ging im Lärm unter, der auf der Straße herrschte.
Die Kraft verließ Montgomery. Er fiel auf die Knie nieder, sein Kinn sank auf die Brust. Im nächsten Moment kippte er vornüber und fiel aufs Gesicht. Ein Gurgeln kämpfte sich in seiner Brust hoch. Mit einem verlöschenden Atemzug starb er.
Der Ford beschleunigte. Einige Passanten sahen den Journalisten auf dem Gehsteig liegen. Sehr schnell umringten ihn die Menschen. Ein Mann ging neben der reglosen Gestalt auf das linke Knie nieder. »Da ist Blut!«, rief er entsetzt. »Mein Gott, der Mann wurde erschossen!«
Der Ford war längst in die Norfolk Street abgebogen und verschwunden.
5
Um 16 Uhr kam Mrs. Fairchild in Begleitung ihres Sohnes. Wir setzten die Frau vor einen Computer, dann ließen wir die Bilder von den Gesichtern der Männer ablaufen, die ich aufgrund ihrer Beschreibung herausgefiltert hatte. Immer wieder schüttelte die Frau den Kopf. Und schließlich war die Vorführung zu Ende. Mrs. Fairchild sagte: »Tut mir leid, Agents. Der Mann war nicht darunter.«
»Sie sind sich sicher?«
»Das Gesicht hätte ich wieder erkannt. Es hat sich in mein Gedächtnis regelrecht eingebrannt.«
»Da kann man nichts machen«, mischte sich Milo ein. »Wäre ja auch zu schön gewesen.«
Die Frau wiederholte noch einmal, dass es ihr leid täte.
»Wer von Ihnen wird Mister Fairchilds Erbe sein?«, fragte ich und wechselte das Thema.
Fassungslos starrte mich Dennis Fairchild an. »Was soll diese Frage?«
»Es interessiert uns«, erwiderte ich. »Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber im Rahmen unserer Ermittlungen ist es wichtig, das zu wissen.«
»Die Agents machen nur ihren Job, Dennis«, mahnte Mrs. Fairchild und legte die Hand auf den Arm ihres Sohnes.
Dennis Fairchilds Schultern sanken nach unten. »Es gibt ein Testament. Das vorhandene Vermögen erbt meine Mutter. Auch die Firma. Allerdings werde ich als Geschäftsführer tätig sein und in dieser Position an die Stelle meines Vaters treten. Das heißt, die Geschicke der Firma werde künftig ich leiten.«
»Vielen Dank, Mister Fairchild.«
»Sie denken doch nicht, dass meine Mutter oder ich …« Dennis Fairchild brach ab. Es war, als hätte ihm alleine die Ungeheuerlichkeit dieses Gedankens die Stimme verschlagen.
»Die Agents dürfen nichts außer Acht lassen«, erklärte Mrs. Fairchild. »Und die Erbschaft könnte ein Motiv sein.« Sie heftete den Blick auf mich. »Es ging mir gut, Agent.« Ihre Stimme klang sachlich und klar. »Ich war finanziell unabhängig. Und ich liebte meinen Mann. Es gab für mich keinen Grund, ihn zu ermorden.«
»Wie Sie selbst sagten, Mrs. Fairchild: Wir dürfen nichts außer Acht lassen. Und dazu gehört auch, dass wir das nähere Umfeld des Toten durchleuchten.«
Dennis Fairchild musterte mich nicht gerade freundlich. Er schien kein Verständnis dafür zu haben. Zwischen ihm und mir war eine Kluft aufgerissen. Er ließ es mich deutlich spüren.
Mutter und Sohn verabschiedeten sich.
Milo schaute mich durchdringend an. »Wie groß ist dein Verdacht?«
»Er brennt auf Sparflamme. Aber er ist da, und wir können ihn nicht vernachlässigen. Die ganze Entführungsgeschichte kann getürkt sein.«
6
6. November, 9.15 Uhr.
Sarah Anderson und Josy O'Leary betraten Mandys Büro. Die hübsche Sekretärin lächelte und sagte: »Geht nur hinein, der Chef wartet schon.«
Sarah klopfte, und ohne die Aufforderung, einzutreten, abzuwarten, öffnete sie die Tür.
»Ah, Sarah«, rief der Assistant Director. »Kommen Sie herein.« Mr. McKee drückte sich hoch. Sarah und Josy betraten das Büro, Josy schloss die Tür hinter sich. Der AD gab den beiden Agents die Hand, und als sie saßen, sagte er: »Wade Montgomery wurde ermordet.«
»Der bekannte Zeitungsmann?«, fragte Josy.
»Genau der. Er wurde in der Lower East Side auf offener Straße erschossen.«
»Gibt es einen Hinweis auf seinen Mörder?«, wollte Sarah wissen.
»Nein, aber beim Department vermutet man, dass eine Organisation dahintersteckt, der Montgomery vielleicht zu nahe gekommen ist. Er war ja bekannt für seine Publikationen kontra das organisierte Verbrechen in New York. Er hat sich auch nicht gescheut, Namen zu nennen und den einen oder anderen Gangster gewissermaßen an den Pranger zu stellen.«
»Ja«, pflichtete Sarah bei, »Montgomery nahm kein Blatt vor den Mund. Die Frage wird sein, wem er vielleicht in letzter Zeit auf die Zehen getreten ist.«
»Seine letzte Publikation ist zwei Wochen alt und richtete sich gegen Bradford Allister«, erklärte Mr. McKee. »Allister befindet sich seitdem in Rikers Island. Das Beweismaterial, das Montgomery gegen ihn gesammelt hat, reicht aus, um ihn für die nächsten zwanzig Jahre wegzusperren.«
»Allister hat sicher Freunde«, wandte Sarah ein.
»Ich glaube nicht, dass Allister dahintersteckt«, murmelte der AD. »Das Beweismaterial gegen Allister befindet sich in Händen der Staatsanwaltschaft. Nach dem Mord an Montgomery wurde aber dessen Wohnung auf den Kopf gestellt. Die Festplatte seines Computers fehlt. Man müsste vielleicht in Erfahrung bringen, an wem er aktuell dran war. Ich denke, dass der Mord an Montgomery auf das Konto desjenigen geht.«
»Man hat den Fall an das FBI abgegeben?«, fragte Josy.
»Ja, da man den Mord dem organisierten Verbrechen zuordnet.«
»Ich nehme an, Sir, dass Sarah und ich den Fall haben.«
»So ist es, Josy. Bringen Sie Licht in das Dunkel, das den Mord umgibt.«
Sarah Anderson und Josy O'Leary fuhren zur New York Times. Dort sprachen Sie mit einer jungen Frau, die für mehrere Journalisten und Reporter als Sekretärin arbeitete, so auch für Montgomery. Ihr Name war Brenda Hollister.
Brenda Hollister sagte: »Ich habe keine Ahnung, woran Wade derzeit arbeitete. Er hielt seine Recherchen immer ausgesprochen geheim, und erst, wenn sie abgeschlossen waren, trat er damit an die Öffentlichkeit.« Die Sekretärin machte eine kurze Pause. Mit fahriger Geste strich sie sich über die Augen. Der Mord an Montgomery schien sie ziemlich mitgenommen zu haben. In ihren Mundwinkeln zuckte es. »Wade war nur selten im Verlag. Er arbeitete meistens zu Hause. Vielleicht unterhalten Sie sich mal mit Mister Calmire. Er ist stellvertretender Chefredakteur. Sicherlich weiß der mehr als ich.«
James Calmire war ein Mann von etwa fünfundvierzig Jahren. Ein dicker Schnurrbart zierte sein Gesicht. Seine Haare waren ziemlich licht. Er forderte die Agents auf, Platz zu nehmen, nachdem ihm Sarah den Grund ihrer Vorsprache erklärt hatte, dann sagte er: »Wade war ein ziemlich Geheimniskrämer, der sich nicht in die Karten blicken ließ. Ich weiß nicht, wen er dieses Mal an der Angel hatte. Zuletzt war es Bradford Allister. Der Gangster sitzt seitdem hinter Gittern. Wades Veröffentlichungen hatten Hand und Fuß. Er hatte sich dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen verschrieben und lebte gefährlich. Aber Warnungen war er nicht zugänglich.«
»Hat er mit Ihnen vielleicht mal darüber gesprochen, dass er bedroht wurde?«, fragte Sarah.
Calmire schüttelte den Kopf. »Wade sprach mit niemandem über seine Arbeit. Er kam meist nur in den Verlag, wenn er wieder einen seiner umfangreichen Artikel zur Veröffentlichung vorbeibrachte. Er hatte sozusagen sein Ohr am Pulsschlag des Verbrechens.« Calmire seufzte. »Ich kann Ihnen nicht helfen, Agents. Denn ich weiß nichts.«
»War Montgomery verheiratet?«, fragte Josy.
»Er war geschieden.«
»Gibt es eine Lebensgefährtin?«
»Er hat eine Freundin. Sie heißt Kim Fletcher und wohnt in der siebzehnten Straße. Kim arbeitet auch im Verlag. Soll ich sie rufen?«
»Wir bitten darum«, murmelte Sarah.
Kim Fletcher war eine attraktive Erscheinung um die vierzig. Sie war ziemlich bleich, unter ihren Augen lagen dunkle Ringe. Sie setzte sich zu den Agents und zum stellvertretenden Chefredakteur an den Tisch. Sarah übernahm es, sich und Josy vorzustellen, dann fragte sie: »Sie waren mit Mister Montgomery gut bekannt?«
Kim Fletcher nickte, schwieg aber.
»Haben Sie eine Ahnung, woran Mister Montgomery arbeitete?«
»Nein. Er hat mit mir nie über seine Aktivitäten gesprochen.«
»Wurde er bedroht?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Denken Sie nach«, sagte Sarah eindringlich. »Hat er nie erwähnt, dass er wieder irgendeinem Gangster auf der Spur ist?«
»Mit keinem Wort.«
Unverrichteter Dinge kehrten die beiden Agents ins Bundesgebäude zurück. Sarah telefonierte mit dem Police Department. Sie sprach mit dem Beamten, der die Ermittlungen am Tatort geleitet hatte, und erfuhr, dass die Passanten nichts zur Klärung des Falles beitragen hatten können. Man habe zwar mehrere Autos vorbeifahren sehen, aber niemand hatte einen Grund, sich eine Zulassungsnummer zu merken oder sie aufzuschreiben. Schüsse waren nicht zu hören gewesen. Man war erst aufmerksam geworden, als Montgomery auf dem Gehsteig zusammengebrochen war.
Sarah und Josy beschlossen, mit Bradford Allister zu sprechen. Der Gangster hatte allen Grund, auf Montgomery wütend zu sein. Ehe sie nach Rikers Island fuhren, machten sie sich kundig. Montgomery hatte Allister Drogenhandel im großen Stil nachgewiesen. Der Haftbefehl gegen Allister war nur noch reine Formalität gewesen. Der Richter hatte es abgelehnt, Allister gegen Kaution auf freien Fuß zu setzen.
Nachdem die beiden Agents in Rikers Island angekommen waren, dauerte es noch einmal fast eine halbe Stunde, bis Allister vorgeführt wurde. Er musste sich an den Tisch in der Mitte des Vernehmungsraumes setzen. Sarah nahm ihm gegenüber Platz. Josy O'Leary blieb stehen.
»Zwei Miezen«, murmelte der Gangster frech und grinste anzüglich. »Zwei ausgesprochen hübsche noch dazu. Was verschafft mir die Ehre?«
»Ihnen sagt sicher der Name Wade Montgomery etwas«, gab Sarah zu verstehen. Während sie sprach, ließ sie Allister nicht aus den Augen und registrierte jede seiner Reaktionen.
Der Gangster presste die Lippen aufeinander, dass sie nur noch einen dünnen, blutleeren Strich bildeten. In seinen Augen glitzerte Hass. »Ja, der Name sagt mir etwas!«, knirschte er. »Den Hurensohn soll die Hölle verschlingen.«
»Kein besonders frommer Wunsch«, murmelte Sarah.
»Ihm habe ich meinen Aufenthalt hier zu verdanken«, zischte Allister. »Soll ich ihn vielleicht lieb haben?«
»Das verlangt kein Mensch von Ihnen«, versetzte Josy. »Montgomery ist tot.«
»Also hat der Himmel meine Gebete erhört.«
»Montgomery wurde ermordet«, erklärte Sarah. »Und Sie stehen auf der Liste der Verdächtigen ziemlich weit oben.«
»Ich!« Allister tippte sich mit dem Daumen gegen die Brust. »Hölle, ich sitze hinter Gittern und habe das sicherste Alibi der Welt. Versuchen Sie bloß nicht, mir etwas in die Schuhe zu schieben.«
»Sie haben Freunde«, konstatierte Sarah, »und Sie hassen Montgomery.«
»Bleiben Sie mir damit bloß vom Hals«, knurrte Allister. »Ja, ich hasse Montgomery. Er ist ein verdammter Aasgeier …«
»War, Mister Allister.«
»Na schön, dann war er eben ein verdammter Aasgeier. Aber mit seinem Tod habe ich nichts zu tun. Mord ist nicht mein Ding.«
»Vielleicht hat einer Ihrer Freunde Rache geübt«, stellte Josy in den Raum.
Allister schüttelte den Kopf. »Das wäre nicht ohne Absprache mit mir geschehen. Und ich hätte sicher nicht zugestimmt. Es ist doch klar, dass der Verdacht sofort auf mich gefallen wäre …«
»Er ist auf Sie gefallen.«
»Vergessen Sie‘s«, stieß Allister hervor. Er knetete seine Hände. Sein Blick sprang zwischen den beiden Agents hin und her. Sein Atem ging stoßweise.
»Wir werden herausfinden, mit wem Sie in letzter Zeit telefoniert haben, Allister«, versprach Sarah. »Und wir werden auch erfahren, wer Sie hier im Gefängnis besucht hat. An diese Leute werden wir uns halten.«
»Mit dem Mord an Montgomery habe ich nichts zu tun«, sagte Allister mit Nachdruck und hielt Sarahs Blick stand.
Als sich die beiden Agents wieder auf dem Weg nach Manhattan befanden, murmelte Sarah: »Ich glaube nicht, dass Allister hinter dem Mord steckt. Dass die Wohnung Montgomerys auf den Kopf gestellt wurde, untermauert meine Meinung. Montgomery hatte einen anderen Gangster aufs Korn genommen. Der bekam Wind davon und ließ den Journalisten ermorden.«
»Und wir haben nicht den Hauch einer Ahnung, wer dies sein könnte«, erwiderte Josy. »Uns wird nichts anderes übrig bleiben, als in einschlägigen Kreisen zu ermitteln.«
Sarah verzog das Gesicht und nickte.
7
Ich telefonierte mit der Spurensicherung. An der Tür des Schließfaches waren eine ganze Reihe von Fingerabdrücken festgestellt worden. Man hatte sie allerdings noch nicht ausgewertet. Ich drängte auf eine schnelle Erledigung. Kurz nach 15 Uhr erfolgte der Rückruf. Der Kollege sagte: »Zwei der Prints konnten wir zuordnen. Einer der Kerle ist Richard McIntosh, wohnhaft dreihundertvierzehn West siebenundachtzigste Straße, der andere ist Elliott Duncan, letzte bekannte Anschrift vierhundertzweiundsechzig East hunderterste Straße.«
Ich bemühte das Archiv. McIntosh war fünfunddreißig Jahre alt, eins-fünfundachtzig groß und blond. Auf ihn passte Mrs. Fairchilds Beschreibung nicht. Elliott Duncan war zweiunddreißig, eins-neunundsiebzig groß und hatte brünette Haare. Er könnte der Bursche im Central Park gewesen sein.
Wir verloren keine Zeit. McIntosh wohnte noch unter der registrierten Anschrift. Sein Apartment befand sich in der dritten Etage. Ich legte den Daumen auf die Klingel. Eine Frau öffnete uns und schaute uns fragend an. Ich erklärte ihr, wer wir waren, dann sagte ich: »Wir möchten mit Mister McIntosh sprechen.«
»Mein Mann ist nicht zu Hause.«
»Wo ist er denn?«
»Er arbeitet als Kraftfahrer bei der Spedition Saddler und Sohn in Brooklyn. Mein Mann ist oft die ganze Woche unterwegs.«
»Wann kommt er nach Hause?«
»Wahrscheinlich am Freitagabend.«
»Also morgen.«
»Ja.«
»Wo war Ihr Mann am einunddreißigsten Oktober, abends, gegen einundzwanzig Uhr?«
»Was war das für ein Tag?«
»Freitag.«
»Da kam er gegen acht Uhr nach Hause. Wir haben den Abend in der Wohnung verbracht. Warum fragen Sie? Besteht gegen meinen Mann irgendein Verdacht?«
»Wir werden uns mit Ihrem Mann selbst darüber unterhalten. Vielen Dank.« Wir verabschiedeten uns.
»McIntosh dürfte mit der Entführung nichts zu tun haben«, sagte ich, als wir uns auf der Straße befanden und zum Sportwagen gingen. »Es ist unwahrscheinlich, dass jemand mit einer Million in petto als Kraftfahrer arbeitet.«
Wir wechselten in den Ostteil Manhattans und wandten uns nach Norden. Elliott Duncan war zu Hause. Nachdem ich uns vorgestellt hatte, entging mir nicht die Unruhe, die er plötzlich an den Tag legte. In seinen Augen flackerte es. Sein Blick irrte zur Seite ab. »Was wollen Sie?«, fragte er mit belegter Stimme.
»Können wir drin sprechen?«
Er zögerte kurz, dann gab er die Tür frei und machte eine einladende Handbewegung. »Bitte, kommen Sie herein.«
Wir betraten die Wohnung. Im Wohnzimmer saßen zwei Männer. Jetzt erhoben sie sich. »Wir gehen jetzt, Elliott«, erklärte einer. »Ich rufe dich an.«
Die beiden drängten an uns vorbei und verließen die Wohnung. Sie schienen es sehr eilig zu haben. Duncan drückte hinter ihnen die Tür zu.
»Wir wollten ihre Freunde nicht vertreiben«, gab ich zu verstehen.
Duncan winkte ab. »Sie wollten sowieso gehen. – Bitte, setzen Sie sich.«
Ich ging hinter den Tisch, um mich auf die Couch zu setzen, als mein Blick auf einen kleinen Beutel fiel, das am Boden lag. Er war aus Zellophan und enthielt ein weißes Pulver. »Sieh an«, stieß ich hervor und bückte mich, hob den Beutel auf und legte ihn auf den Tisch. »Sieht nach Kokain oder Heroin aus.«
Duncan trat von einem Fuß auf den anderen. Das Unbehagen stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Das – das muss einer meiner Freunde verloren haben«, entrang es sich ihm. »Ich – ich hatte keine Ahnung.«
»Wie heißen Ihre Freunde?«
»Mitch und Mike.«
»Sie haben doch sicher auch Familiennamen.«
»Die kenne ich nicht.«
»Was! Sie kennen die Familiennamen Ihrer Freunde nicht?«
»Nein. Ich habe mich nie dafür interessiert.«
»Wissen Sie, was ich denke?«
»Nein.«
»Ich denke, dass die beiden bei Ihnen Rauschgift abgeholt haben.«
Duncan prallte zurück. »Ich – ich bin doch kein Dealer.«
Ich hatte schon mein Telefon bei der Hand und stellte eine Verbindung mit dem Narcotic Squad im Police Department her. Als sich jemand meldete, sagte ich: »Hier spricht Special Agent Trevellian vom FBI. Wir befinden uns in der Wohnung von Elliott Duncan, vierhundertzweiundsechzig East hunderterste Straße, vierte Etage. Ich habe auf dem Fußboden der Wohnung ein Tütchen mit Kokain oder Heroin gefunden. Wir haben Duncan im Verdacht, dass er mit dem Zeug handelt. Wenn Sie gleich jemand herschicken könnten?«
Der Mann sagte mir zu, sofort ein Team in Marsch zu setzen.
Ich beendete das Gespräch und wandte mich an Duncan. »Wenn Sie Rauschgift in der Wohnung haben, finden es die Narcs.«
Duncan zog die Schultern an. Er sah aus wie ein Mann, der sich im nächsten Moment herumwerfen und die Flucht ergreifen würde. Jeder Zug seines Gesichts verriet, wie sehr er unter Anspannung stand.
»Reden Sie schon!«, forderte Milo den Burschen auf. »Wo haben Sie das Zeug versteckt?«
»Ich – ich …«
»Sie erweisen sich nur selbst einen Gefallen«, gab ich zu verstehen.
Duncan holte tief Luft. »Es ist im Schlafzimmer. Im Schrank, in der Schachtel, die da auf dem Schrankboden steht.«
Milo holte die Schachtel und stellte sie auf den Tisch, hob den Deckel ab und bekam große Augen. »Die ist ja fast voll.«
»Es ist Kokain«, murmelte Duncan. »Ich – ich bin nur so etwas wie ein Zwischenhändler.«
»Daran werden die Narcs das allergrößte Interesse haben«, erklärte ich. »Wir sind wegen einer anderen Frage hier. Am Schließfach Nummer siebzehn-null-fünf in der Penn Station wurden Ihre Fingerabdrücke festgestellt. Wie kommen sie dorthin?«
»Ich habe vor drei Wochen einen Koffer dort aufbewahrt.«
»Wo waren Sie am einunddreißigsten Oktober gegen einundzwanzig Uhr?«
»Bei meiner Freundin. Ihr Name ist Samantha Welsh. Was war am einunddreißigsten um einundzwanzig Uhr?« Duncan winkte ab. »Was auch immer – ich kann es nicht gewesen sein.«
»Okay« sagte ich. »Dann sagen Sie mir, wo sie am ersten November gegen neunzehn Uhr waren?«
»Das war am Samstagabend, nicht wahr?«
»Sehr richtig.«
»Ich war zu Hause. Am Samstag hatte Sam ein Treffen mit ein paar Freundinnen. Da bin ich zu Hause geblieben.«
»Sie haben also kein Alibi.«
»Himmel, worum geht es denn?«
»Um Entführung und Mord.«
Duncan hob abwehrend die Hände. Mit dem Ausdruck des Entsetzens starrte er mich an. »Wer wurde ermordet?«
»Ein New Yorker Geschäftsmann. Kann es sein, dass Sie am ersten November gegen neunzehn Uhr im Central Park waren, um einen Schließfachschlüssel entgegenzunehmen?«
»Wir werden Sie Mrs. Fairchild gegenüberstellen«, fügte Milo hinzu.
»Sie haben sich den falschen Mann ausgesucht«, erwiderte Duncan nach einem tiefen Atemzug.
»Für wen arbeiten Sie?«
»Das werdet ihr von mir nicht erfahren. Gebt euch also keine Mühe.«
»Nun, die Jungs vom Narcotic Squad werden Ihnen schon die Würmer aus der Nase ziehen«, versprach ich.
Wir mussten fast eine Stunde warten, bis die Kollegen aus dem Police Department aufkreuzten. Sie übernahmen Duncan. Milo und ich räumten das Feld. Ich wies die Kollegen noch darauf hin, dass sie uns Duncan noch einmal zur Verfügung stellen müssten, wobei ich nicht daran glaubte, dass er der Mann war, der im Central Park den Schließfachschlüssel in Empfang genommen hatte.
Dies wurde mir am folgenden Tag bestätigt, als wir den Dealer Mrs. Fairchild gegenüber stellten.
8
Sarah Andersons Telefon läutete. Sie schnappte sich den Hörer und meldete sich. »Guten Tag«, sagte eine etwas heisere Stimme. »Mein Name ist Walt Finestra. Ich habe mit dem Police Department telefoniert, und man hat mich an Sie verwiesen.«
»Worum geht es, Mister Finestra?«
»Ich hatte mit Montgomery ‘ne Verabredung in Rocky‘s Pub in der Stanton Street. Leider kam es nicht mehr zu dem Treffen. Aber ich glaube, ich habe einige Hinweise für Sie.«
Sarah war wie elektrisiert. »Wo und wann können wir uns treffen, Mister Finestra?«
»Kommen Sie in den Pub in der Stanton Street. Sagen wir in einer Stunde.«
»Wir werden da sein.«
Eine halbe Stunde später brachen die beiden Agents auf. Sie benutzten einen Dienstwagen. Sarah saß am Steuer. Sie fand in der Stanton Street direkt vor dem Pub einen Parkplatz. Der Pub war nur mäßig besucht. Die meisten Tische waren unbesetzt. Sarah und Josy schauten sich um. Ein Mann bedeutete ihnen per Handzeichen, dass er derjenige war, nach dem sie Ausschau hielten. Er war ungefähr vierzig und machte einen etwas heruntergekommenen Eindruck. Tage alte Bartstoppeln wucherten in seinem eingefallenen Gesicht. Die Augen lagen in tiefen Höhlen und waren gerötet. Vor ihm auf dem Tisch standen ein Bier und ein leeres Whiskyglas. Die beiden Agents gingen hin.
»Mister Finestra?«, kam es fragend von Sarah.
Er nickte. »Bitte, setzen Sie sich.«
Sarah und Josy ließen sich nieder. Sofort kam eine Bedienung und fragte nach ihren Wünschen. Sie bestellten Wasser. Dann heftete Sarah den Blick auf Finestra. »Was haben Sie uns zu erzählen?«
Finestra legte beiden Hände flach auf den Tisch und beugte sich etwas nach vorn. »Montgomery war hinter einem Burschen namens Howard Bundy her. Ich habe ihn mit Informationen versorgt. Sicher habe ich auch einiges auf Lager, was für Sie von Interesse sein könnte.«
»Davon sind wir überzeugt«, versetzte Josy. »Dann schießen Sie mal los.«
»Montgomery hat mich bezahlt.«
Sarahs Brauen schoben sich zusammen. »Uns werden Sie die Auskünfte kostenlos erteilen müssen.«
Finestra seufzte. »Das habe ich schon befürchtet. Wenn ich rede, habe ich etwas gut bei Ihnen.«
»Sind Sie darauf angewiesen?«
Finestra grinste. Dann begann er zu sprechen.
9
Samstag, 8. November, 0.55 Uhr. Roger Meredith und seine Frau Jane lagen in ihren Betten und schliefen tief und fest. Keiner von ihnen hörte, dass sich jemand an der Wohnungstür zu schaffen machte. Es waren zwei Männer. Die Tür zu öffnen kostete einen der Kerle ein müdes Lächeln. Sie betraten die Wohnung und drückten die Tür hinter sich zu. Durch die beiden Fenster fiel genügend Licht, sodass sich die Eindringlinge gut zurecht fanden. Sie zogen sich Sturmhauben über die Köpfe und holten die Pistolen unter den Jacken hervor.
Einige Türen zweigten in andere Räume ab. Leise öffnete einer der Kerle eine der Türen. Er blickte in das Badezimmer. Nachdem er die nächste Tür geöffnet hatte, vernahm er tiefe, gleichmäßige Atemzüge. Die betraten das Schlafzimmer. Licht flammte auf.
Roger Meredith wurde wach, als ihm die Mündung einer Pistole gegen die Stirn gedrückt wurde. Mit dem törichten Ausdruck des Nichtbegreifens starrte er die beiden Gestalten an. »Was – was …« Dann begriff er und verschluckte sich.
Nun wurde auch die Frau wach. Ihr Oberkörper ruckte hoch. Erschreckt fixierte sie den Burschen, der am Fußende ihres Bettes stand und eine Pistole auf sie gerichtet hielt.
Roger Meredith hustete. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Schließlich hatte er den Anfall überwunden. »Wir – wir haben kein Geld im Haus«, keuchte er außer Atem.
»Ziehen Sie sich an, Lady«, forderte einer der Gangster.
»Aber …«
»Machen Sie schon!« Ungeduldig winkte der Sprecher mit der Pistole.
Der andere sagte: »Pass auf, Meredith. Wir nehmen deine Frau mit. Du kriegst sie wieder, sobald du eine Million Dollar bezahlt hast. Das Geld hinterlegst du in einem Schließfach im Grand Central Terminal. Den Schließfachschlüssel bringst du am Montag um achtzehn Uhr zum Eingang des Museums of Modern Art. Hast du alles verstanden?«
»Ja – ja. Montag, achtzehn Uhr, beim Eingang des Museums of Modern Art. Du lieber Himmel, Sie – Sie werden meiner Frau doch kein Leid zufügen?«
Der andere der beiden Gangster packte Jane Meredith am Handgelenk und zerrte sie aus dem Bett. »Du hast wohl was an den Ohren, Lady.«
»Bitte …«, flehte die Frau. Ihre bleichen Lippen zuckten. Mit dem fiebrigen Ausdruck des grenzenlosen Entsetzens starrte sie den Gangster an.
»Zieh dich an!«
Jane Meredith ging zu einer Tür, hinter der sich ein begehbarer Kleiderschrank befand. Jeglichen Gedankens, jeglichen Willens beraubt kleidete sie sich an. Einer der Gangster war ihr gefolgt und stand im Türrahmen. Ohne die Spur einer Gemütsregung beobachtete er die Siebenundvierzigjährige.
Im Schlafzimmer sagte der andere der Gangster: »Lass die Polizei aus dem Spiel, Meredith. Wenn wir merken, dass du die Bullen eingeschaltet hast, wird es deine Frau auszubaden haben.«
»Ich – ich werde zahlen und – und die Polizei außen vor lassen«, stammelte Meredith.
»Ein kluger Entschluss.« Der Gangster trat an Meredith heran und schlug zu. Der Lauf der Pistole knallte gegen Merediths Schläfe. Vor Merediths Augen schien die Welt zu explodieren. Der Mann verlor im nächsten Moment die Besinnung. Aus einer kleinen Platzwunde sickerte Blut.
10
Mittwoch, 12. November, 11 Uhr 25. Mein Telefon läutete, und ich schnappte mir den Hörer. Es war ein Kollege aus dem Police Department. Er sagte: »Heute Morgen wurde der Leichnam der Frau des Stadtverordneten Meredith auf einer Müllhalde in Staten Island gefunden. Die Frau wurde in der Nacht vom siebten auf den achten November entführt. Meredith zahlte eine Million Dollar Lösegeld. Dennoch haben die Kidnapper seine Frau ermordet.«
Ich stellte eine Reihe von Fragen und machte mir Notizen. Nachdem das Gespräch beendet war, sagte ich zu Milo: »Die Sache weist dieselbe Handschrift auf wie der Fall Fairchild. Mir scheint, wir haben es mit einer Bande zu tun, die sich darauf spezialisiert hat, Leute zu entführen, Lösegeld zu kassieren und die Entführten dann umzubringen.«
»Es kann sich auch um einen Zufall handeln«, erwiderte Milo.
»Fahren wir zu Meredith.«
Der Stadtverordnete wohnte in der Bethune Street. Er bat uns in die Wohnung. Meredith sah krankhaft bleich aus. Seine Augen waren gerötet. »Ich – ich dachte, wenn ich zahle und die Polizei nicht einschalte, lassen diese Verbrecher meine Frau frei.« Er schlug beide Hände vor das Gesicht. Einige Sekunden verstrichen. Seine Schultern zuckten. Dann ließ er die Hände wieder sinken. »Was sind das nur für Menschen?«
»Erzählen Sie«, forderte ich Meredith auf. »Wie lief die Entführung ab?«
Meredith berichtete. Er sprach abgehackt. Immer wieder versagte seine Stimme. Schließlich endete er mit den Worten: »Ich habe die Million beschafft und in dem Schließfach hinterlegt. Den Schlüssel habe ich übergeben.« Seine Stimme hob sich etwas. »Ich habe alles getan, was diese Verbrecher von mir verlangten. Und trotzdem haben sie Jane ermordet.«
»Wie sah der Mann aus, dem Sie den Schlüssel übergaben?«
»Sein Alter schätze ich auf dreißig Jahre, er ist etwas eins-achtzig groß und dunkelhaarig.«
»Was trug er für Kleidung?«
»Eine Jeans und einen schwarzen Anorak.«
Milo und ich wechselten einen schnellen Blick. Der Beschreibung nach handelte es sich um denselben Mann, dem auch Wanda Fairchild einen Schließfachschlüssel übergeben hatte.
»Sprach der Bursche irgendetwas?«
»Nein, kein Wort.«
»Stieg er in ein Auto?«
Der Stadtverordnete verneinte. Wir hatten auch dieses Mal keinen Ansatzpunkt.
Als wir wieder auf dem Weg zur Federal Plaza waren, sagte Milo: »Damit dürften Wanda Fairchild und ihr Sohn aus dem Schneider sein.«
Ich gab meinem Partner recht. Wir veranlassten, dass Merediths Wohnung nach Spuren durchsucht wurde und ließen auch an dem Schließfach eventuelle Spuren sichern. Für den nächsten Tag, 9 Uhr, hatten wir Meredith vorgeladen, damit er sich die Bilder der in Frage kommenden Männer anschaute. Meine Zuversicht, dass wir auf diesem Weg weiterkamen, war allerdings nicht sehr groß. Wie es schien, war der Bursche, der jeweils die Schlüssel entgegengenommen hatte, nicht registriert. Dies bestätigte sich am folgenden Tag, nachdem sich Meredith die Konterfeis der Männer angesehen hatte, auf die die Beschreibung des Gangsters passte.
Gegen Mittag erhielt ich einen Anruf. Es war ein Beamter von der SRD, der sagte: »Jane Meredith wurde, ehe man sie erschoss, vergewaltigt. Wir konnten Sperma sicherstellen. Wenn wir Glück haben, ist der Vergewaltiger registriert.«
»Setzen Sie mich bitte sofort in Kenntnis, wenn die DNA ausgewertet ist.«
»Mach ich.«
Vierundzwanzig Stunden später teilte mir der Kollege mit, dass es sich bei dem Vergewaltiger um einen Burschen namens James Carson handelte. Carson war einundvierzig Jahre alt und einschlägig vorbestraft. Laut unseren Unterlagen wohnte er in West 92nd Street. Endlich hatten wir etwas Konkretes in den Händen. Wir machten uns sofort auf den Weg. Bei dem Gebäude in der 92nd Street handelte es sich um einen Wohnblock. Carsons Wohnung lag in der zweiten Etage. Da es an der Rückseite des Gebäudes eine Feuertreppe gab, postierte sich Milo im Hof, um Carson diesen Fluchtweg zu verlegen.
Ich stieg die Treppe empor und läutete an der Wohnungstür. In der Wohnung blieb es ruhig. Also versuchte ich es bei einem Nachbarn. Eine junge Frau öffnete mir. Ich wies mich aus und fragte: »Haben Sie eine Ahnung, wo Mister Carson gegebenenfalls arbeitet?«
»Der ist Türsteher im Hawaii Club. Normalerweise schläft er tagsüber. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo er ist.«
»Wo befindet sich der Hawaii Club?«, fragte ich.
»Irgendwo in East Harlem. Ich habe keine Ahnung. Ich treffe Carson nur selten, und wenn, dann sprechen wir kaum miteinander. Wie ich schon sagte: Er schläft tagsüber. Abends verlässt er immer gegen neunzehn Uhr die Wohnung. Er fährt einen Ford Mustang. Ein älteres Modell. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen.«
»Welche Farbe hat das Auto?«
»Blau.«
»Vielen Dank.«
Ich verließ das Gebäude, holte Milo aus dem Hof, dann warteten wir im Sportwagen. Es dauerte etwa eine Stunde, dann näherte sich ein blauer Ford Mustang. Der Wagen wurde in eine Parklücke rangiert, ein Mann stieg aus. Es war James Carson. Er verschloss seinen Wagen und ging zur Tür des Gebäudes, in dem er wohnte. Milo und ich stiegen aus. Mit schnellen Schritten überquerte ich die Straße. Milo begab sich ebenfalls auf die andere Straßenseite. Es gelang mir, Carson den Weg zur Haustür abzuschneiden. Milo näherte sich ihm von hinten.
»Mister Carson!«
Der Bursche hielt an und kniff die Augen leicht zusammen. »Was wollen Sie?«
»Ich bin Special Agent Trevellian vom FBI New York. Im Namen des Gesetzes verhafte ich Sie …«
Blitzschnell griff der Gangster unter seine Jacke. Als seine Hand wieder zum Vorschein kam, hielt sie eine Pistole. Ehe ich die SIG ziehen konnte, repetierte Carson schon und richtete die Waffe auf mich. Ich sprang zur Seite. Carson fand nicht mehr die Zeit, sich auf das so jäh veränderte Ziel einzustellen und schoss vorbei. Im nächsten Moment warf er sich herum. Da sah er Milo, der die Dienstwaffe gezogen hatte. Carson rannte in den Schutz eines parkenden Autos. Auch ich lief in Deckung und duckte mich neben einem Toyota. Die SIG lag in meiner Hand. Milo hatte ebenfalls Schutz gesucht.
»Carson, hören Sie mich?«, rief ich.
Plötzlich sprang der Gangster auf und rannte in Richtung Amsterdam Avenue. Da sich auf dem Gehsteig Menschen bewegten, konnten wir nicht schießen.
»Bleiben Sie stehen!«, schrie ich und nahm die Verfolgung auf.
Carson drehte sich halb herum und schoss auf mich. Er nahm keine Rücksicht auf die Passanten. Ich hörte Geschrei. Der Gangster verschwand wieder hinter einem Auto. Schnell ging auch ich in Deckung. Von Milo sah ich nichts. Die Menschen, die mitbekommen hatten, was sich hier abspielte, waren entsetzt in Deckung gelaufen.
Einige Sekunden verstrichen. Ich spähte über das Dach eines Buicks hinweg, bereit, blitzschnell zu reagieren, sollte Carson auf mich schießen. Plötzlich sah ich Milo. Er kam hinter einem parkenden Wagen hervor und lief geduckt über die Straße. Drüben verschwand er hinter einem Pontiac.
Ich schlich an der Reihe der parkenden Fahrzeuge entlang. Da sah ich Carson hochschnellen und weiterlaufen. Er schlug Haken wie ein Hase. Ich nahm sofort die Verfolgung auf. Als Carson auf mich schoss, sprang ich zur Seite. Dann erreichte er die Amsterdam Avenue und verschwand um die Ecke. Eng an eine Hauswand geschmiegt schob ich mich weiter. Dann schaute ich vorsichtig um die Ecke.
Carson war verschwunden. Die Anspannung fiel von mir ab. Ich drehte mich um und winkte Milo, der sich sofort in Bewegung setzte. Als er bei mir anlangte, sagte ich: »Er ist uns entkommen. Wir geben ihn in die Fahndung. Es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis er auf Nummer sicher ist.«
11
James Carson war in ein Gebäude geflüchtet. Er nahm sein Handy aus der Tasche und tippte eine Nummer, dann ging er auf Verbindung. Als sich jemand meldete, sagte er: »Ich wurde vor meiner Wohnung erwartet. Es waren zwei Feds. Sie wollten mich verhaften.«
»Du hast die beiden abgehängt, wie?«
»Ja, mit Mühe und Not. Es gab eine Schießerei. Mein Glück war, dass sich Passanten auf dem Gehsteig befanden, sodass die Feds nicht schießen konnten. Was soll ich tun? Zu meiner Wohnung kann ich nicht.«
»Wo befindest du dich?«
»In der Amsterdam Avenue, zwischen zwei- und dreiundneunzigsten Straße.«
»Ich schicke Fred. Er wird dich abholen.«
Es dauerte eine knappe Dreiviertelstunde, dann fuhr ein Chevy heran. Carson, der zwischen zwei Gebäuden wartete, erkannte seinen Kumpan und stieg zu. Er atmete auf. »Na endlich. Hat ja ‘ne Ewigkeit gedauert.«
»Nun, ich kann nicht fliegen«, erwiderte Fred Malone ärgerlich.
»Wohin sollst du mich bringen?«
»Das wirst du sehen.«
»Du bist heute wohl mit den linken Fuß zuerst aufgestanden?«
Malone fuhr an. Es ging ein Stück nach Norden, dann bog Malone in die 96th Street ein, und wenig später durchquerten sie den Central Park auf der Transverse Road Nummer 4. Auf der Third Avenue wandten sie sich nach Norden.
»Willst du mir nicht endlich sagen, wohin du mich bringst?«, fragte Carson.
»Zu einem Wochenendhaus auf Randall‘s Island.«
»Was soll ich da?«
»Ich habe die Weisung, dich dorthin zu bringen. Alles andere musst du mit dem Boss besprechen.«
Sie benutzten die Triborough Bridge, um auf die andere Seite des Harlem River zu gelangen. Auf Randall‘s Island fuhren sie ab. Wenig später ging es über eine holprige Straße, die von hohen Büschen und Bäumen gesäumt wurde. Plötzlich fuhr Malone rechts ran, griff unter die Jacke und zog eine Pistole, die er auf Carson richtete. »Die Fahrt ist zu Ende. Aussteigen.«
Fassungslos starrte Carson seinen Kumpan an. »Was soll das?«
»Steig aus, vorwärts.«
Carson wollte noch etwas sagen, schwieg aber und kam dem Befehl nach. Seine Nerven waren zum Zerreißen angespannt. Als er Malone den Rücken zuwandte, zog er unbemerkt die Pistole. Er richtete sich auf, bereit, sein Leben so teuer wie möglich zu verkaufen. Aber Malone ließ ihm keine Chance. In dem Moment, als Carson herumwirbeln wollte, feuerte er. Carson bekam die Kugel zwischen die Schulterblätter. Sie zerschmetterte seine Wirbelsäule. Wo sie in der Brust austrat, riss sie ein faustgroßes Loch. Carson war sofort tot.
Malone stieg aus und öffnete den Kofferraum. Es kostete ihn einige Mühe, den Leichnam aufzuheben und hineinzulegen. Die Pistole, die Carson entfallen war, schleuderte er ins Gebüsch. Dann knallte er den Kofferraumdeckel zu und setzte sich wieder ans Steuer. Er holte sein Handy aus der Tasche und stellte eine Verbindung her, und als sich jemand meldete, sagte er: »Das Problem ist gelöst. Carson endet als Fischfutter im Long Island Sound.«
»Hervorragend. Auf dich ist eben Verlass.«
»Ich hoffe, du weißt das zu gegebener Zeit auch zu honorieren.«
»Worauf du dich verlassen kannst.«
12
Der »Hawaii Club« befand sich in der 119th Street. Es war 21 Uhr vorbei, als Milo und ich bei dem Lokal ankamen. Ein breitschultriger Mann fungierte als Türsteher. Er maß uns mit einem schnellen Blick und nickte. Wir betraten den Club. Stimmendurcheinander und leise Musik empfingen uns. Der Gastraum war in Nischen unterteilt. Es gab eine Bühne mit einer Chromstange, die bis zur Decke reichte. Im Moment fand jedoch kein Auftritt statt.
Wir fanden einen freien Tisch und setzten uns. Nach kurzer Zeit erschien eine hübsche Bedienung. Wir bestellten Wasser. Als es die junge Lady brachte, fragte ich: »James Carson ist heute nicht zur Arbeit erschienen, wie?«
»Was wollen Sie denn von James?«
»Wir möchten ihn verhaften«, erwiderte ich und zeigte der Bedienung meine ID-Card. »Wem gehört die Bar?«
»Howard Bundy. Aber Mister Bundy hat einen Geschäftsführer eingesetzt. Sein Name ist Jennison.«
»Ist er anwesend?«
»Natürlich. Soll ich ihn herholen?«
»Bitte.«
Wenig später kam ein Mann von etwa fünfunddreißig Jahren mit rötlichen Haaren zu unserem Tisch. Er stellte sich als Gary Jennison vor. Ich forderte ihn auf, sich zu uns zu setzen, dann sagte ich: »Wir suchen James Carson.«
»Das hat mir Lydia erzählt. Weswegen suchen Sie ihn denn?«
»Entführung, Vergewaltigung, Mord.«
Jennison schluckte würgend. Dann sagte er: »Carson ist heute Abend nicht zur Arbeit erschienen. Er hat sich auch nicht entschuldigt.«
»Hat er Verwandte oder eine Freundin?«
»Seine Eltern leben in Queens. Die Anschrift kenne ich nicht. Außerdem hat James einen Bruder. Seine Freundin heißt Heather Leroy und wohnt in Stuyvesant Town.«
»Wissen Sie, was Carson in seiner Freizeit so treibt?«
»Nein. Interessiert mich auch nicht. Ich werde den Kerl feuern. Unzuverlässige Leute kann ich nicht brauchen.«
»Hatte Carson in der Nacht vom siebten auf den achten November Dienst?«
»Das war von Freitag auf Samstag, nicht wahr?«
»Sehr richtig.«
»Nein, er hatte in dieser Nacht keinen Dienst. Zwei Tage in der Woche hat James frei.«
Eine Viertelstunde später verließen Milo und ich die Bar. Im Sportwagen stellten wir sowohl die Telefonnummer von Carsons Eltern als auch die von Heather Leroy fest. Zuerst rief ich bei Bill und Laura Carson an. Bill Carson meldete sich. Ich erklärte ihm, wer ich war, dann fragte ich, ob er eine Ahnung habe, wo sich sein Sohn James aufhält.
»Ich habe von James schon mehr als zwei Wochen nichts mehr gehört«, antwortete der Mann. »Was wollen Sie denn von ihm?«
»Haben Sie eine Handynummer von ihm?«
»Natürlich.«
»Diktieren Sie sie mir.«
»Einen Moment.« Eine halbe Minute verstrich, in der ich Milo bat, sein Notizbüchlein bereitzuhalten. Dann erklang wieder Bill Carsons Stimme: »Haben Sie etwas zum Schreiben?«
»Ja. Sagen Sie mir Nummer.«
Bill Carson diktierte mir die Zahlenreihe. Ich sprach die Ziffern nach, und Milo vermerkte sie. Anschließend bedankte ich mich und rief bei Heather Leroy an. Die Frau nahm ab.
Ich sagte: »Guten Abend, Ma‘am. Ich bin Special Agent Trevellian vom FBI. Wir suchen James Carson. Haben Sie eine Ahnung, wo er sich aufhalten könnte?«
»Nicht die geringste. Jennison, sein Chef hat schon bei mir angerufen. Er sagte mir, dass James unentschuldigt der Arbeit ferngeblieben ist. Sein Handy ist ausgeschaltet. Ich beginne mir langsam Sorgen zu machen.«
»Wo wohnen Sie?«
»In Stuyvesant Town.«
»Das weiß ich. Ich will die Hausnummer wissen.«
»Nummer dreiundzwanzig-null-sechs. Sie denken doch nicht, dass sich James bei mir befindet?«
»Wir möchten mit Ihnen sprechen. Zu diesem Zweck werden wir nun zu Ihnen kommen. Es macht Ihnen doch nichts aus?«
»Eine recht ungewöhnliche Zeit.«
»Wir können es leider nicht ändern.«
Nach dem Gespräch mit Heather Leroy wählte ich Carsons Handynummer. Es erklang das Besetztzeichen. Ich chauffierte uns nach Stuyvesant Town. Die Frau zeigte sich nicht gerade begeistert über die späte Störung. Widerwillig bat sie uns in die Wohnung und bot uns Sitzplätze an.
Ich sagte ohne Umschweife: »Es ist wohl so, dass Carson zu einer Bande gehört, die Menschen entführt, Lösegeld für sie kassiert und sie dann brutal ermordet.«
Heather Leroy prallte geradezu zurück. Ihr Gesicht hatte sich verschlossen. »Wie kommen Sie zu dieser Vermutung?«
»Carsons DNA wurde am Leichnam einer Frau festgestellt, die in der Nacht vom siebten auf den achten November entführt wurde.«
»O mein Gott.«
»Mit welchen Leuten verkehrt Carson?«
»Er hat eigentlich keine Freunde im engeren Sinn. James arbeitet nachts und verschläft die meiste Zeit des Tages. Seine freien Nächte verbringt er in der Regel bei mir.« Heather zuckte mit den Schultern. »Ich kann Ihnen nichts sagen.«
»Er hat nie über irgendwelche Freunde gesprochen? Hat er niemals Namen genannt?«
Die Frau dachte nach. Sie starrte dabei gedankenverloren auf einen unbestimmten Punkt. Schließlich schüttelte sie den Kopf. Ihr Blick schien aus weiter Ferne zurückzukehren. »Nein. James nannte keine Namen.«
»In der Nacht vom siebten auf den achten November hatte er frei. Das war von Freitag auf Samstag. War er in dieser Nacht bei Ihnen?«