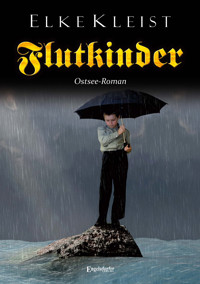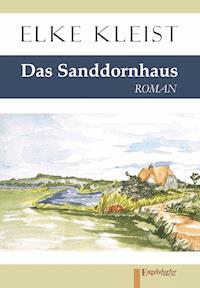Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das kann doch wohl nicht wahr sein! Kaum hat Jenny in Berlin das Ende ihrer langjährigen Ehe verdaut, Verzweiflung, Selbstmitleid und unbändige Wut hinter sich gelassen, zwingt ein beruflicher Auftrag sie, sich ausgerechnet im Ort ihrer Kindheit, in Prerow an der Ostsee, ihrer Vergangenheit und obendrein diesem selbsternannten Robin Hood des Darßwaldes mit dem Charme eines Herings zu stellen. Was bildet dieser Typ sich ein, wer er ist? Zum Glück gibt es da ja auch noch andere, wirklich nette Männer. Doch allmählich erkennt Jenny, dass auch Heringe ihren Charme haben ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elke Kleist
Charmefaktor Hering
Roman
Engelsdorfer Verlag 2009
Bibliografische Information durch
die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright (2009) Engelsdorfer Verlag
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Charmefaktor Hering
Nachwort
„Auf dein neues Leben!“
„Auf die Freiheit!“
Die Frauen hielten Jennifer aufmunternd ihre Gläser entgegen, aber die zuckte merklich zusammen.
„Pst!“, sie schaute sich unsicher in dem kleinen Café um, aber ihr Einwand kam zu spät. Die anderen Gäste waren schon auf die drei Frauen aufmerksam geworden.
Jennifer zog den Kopf leicht zwischen die Schultern, als wollte sie sich verstecken. Mit ihrem sorgfältig hochgestecktem blonden Haar und ihrer vornehmen Eleganz strahlte sie nach außen ein unerschütterliches Selbstbewusstsein und spröde Unnahbarkeit aus. Aber ihre verkrampfte Haltung und ein hektisches Flackern in ihren Augen sprachen dagegen. Ihre scheinbar heile Welt hatte gerade einen gewaltigen Riss bekommen.
Da saßen sie ihr gegenüber, ihre beiden besten Freundinnen und erwarteten von ihr, dass sie sich nun befreit und zufrieden fühlen sollte. Bea, die Ausgeflippte, immer hochmodisch gekleidet (Ich kann verdienen, was ich will, es sind immer tausend Euro zu wenig!) und perfekt gestylt. Sie flatterte wie ein Schmetterling von einem Mann zum nächsten und konnte oder wollte sich doch nie entscheiden. Sie hatte sich in all den Jahren ihren jungmädchenhaften Charme erhalten und brachte damit immer wieder eine Menge frischen Wind in ihre Freundschaft.
Ganz anders Karin. Sie war der Ruhepol in ihrer kleinen Gemeinschaft, die Korrekte, die Beständige. Sie brauchte keinen modischen Schnickschnack. Ordentlich, sauber und praktisch musste es sein.
Karin sorgte stets dafür, dass Jennifer und Bea nach ihren Höhenflügen wieder sicher auf dem Boden landeten.
Jennifer sah ihre Freundinnen an. Was war es, was sie selbst in diese Freundschaft einbrachte? Womit hatte sie diese großartigen Frauen verdient?
Vielleicht lag es daran, dass sie normalerweise von beiden etwas in sich vereinte. Die kleinen Teufel, die in Bea steckten und die bodenständigen Engel, die Karins Wesen bestimmten. Normaler weise. Aber im Moment war nichts normal. Es herrschte Ausnahmezustand.
„Auf den Neuanfang“, flüsterte sie dann doch mit belegter Stimme und stieß zurückhaltend mit den beiden an.
Bea prostete den anderen Gästen, die neugierig zu ihrem Tisch herüber schauten fröhlich zu. „Wir haben uns nämlich scheiden lassen“, teilte sie ihnen triumphierend mit.
Manche von ihnen wendeten ihre Blicke schnell ab, als wären sie bei etwas Unerlaubten ertappt worden. Andere grinsten breit und erhoben ihrerseits ihre Gläser.
„Bea!“ Jennifer versuchte ihre Freundin zu bremsen und rutschte unruhig auf ihrem Stuhl hin und her. „Das geht doch nun wirklich keinen etwas an, außerdem, was heißt hier wir haben?“
„Wir sind schließlich deine besten Freundinnen, da ist deine Scheidung irgendwie doch auch unsere. Ein gemeinsamer Akt der Befreiung sozusagen.“
Karin sah Bea zurechtweisend an und gab ihr ein Zeichen, still zu sein. Sie legte ihre Hand auf die von Jennifer.
„He, Jenny, nun lach doch mal. Es ist vorbei, und du weißt, dass es gut so ist. Du bist doch immer die Stärkste von uns gewesen. Eigentlich hättest du längst Schluss machen sollen. Das war doch keine Ehe mehr. Du brauchst ihn nicht. Denk nur mal an all die ungeahnten Möglichkeiten, die dir jetzt wieder offen stehen. Die ganze Welt breitet die Arme für dich aus.“
„Und die Männer auch. Was meinst du, wie viele schon in den Startlöchern stehen, weil du wieder zu haben bist“, Bea kicherte vergnügt vor sich hin.
„Bea!“ Karin schüttelte vorwurfsvoll den Kopf.
Jennifers Gesicht verfinsterte sich zusehend und eine tiefe Furche bildete sich zwischen ihren Augenbrauen.
„Ich will nichts mehr von Männern wissen. Ich hab` die Nase gestrichen voll. Ich brauche diese männliche Selbstverliebtheit nicht mehr, ihre Alkoholexzesse, nächtliches Geschnarche und fremde Haare auf ihren Jacketts.“ Oh nein, sie würde sich nicht noch einmal von einem Mann demütigen lassen.
Ihr Blick schweifte durch das Fenster hinaus. Berlin hatte sich kurz vor Frühlingsbeginn noch einmal in ein schimmerndes Winterkleid gehüllt. Die Menschen hasteten eingemummt mit herum wirbelnden Schneeflocken um die Wette durch die Straßen. Jennifer spürte die Kälte in sich hoch kriechen.
„Ich dumme Kuh hab` nichts gemerkt, hab` gedacht, meine Ehe wäre, na ja, in Ordnung eben, mein Leben normal, wie es war. Ich war so verdammt blind“, sagte sie wie zu sich selbst.
Zugegeben, sie hatte sich die Ehe immer anders vorgestellt. Besser irgendwie. Aber an ein Ende hatte sie dennoch nie gedacht.
Der Kellner kam und servierte das Essen. Jennifer nahm ihren Salat kaum zur Kenntnis, aber Karin bedankte sich strahlend bei ihm. Sie sollte es nicht, aber sie liebte diese in Sahne ertränkten Nudeln.
„Du isst wieder nichts, Bea?“ Karin griff nach ihrem Besteck.
„Nein, nein. Das bisschen, was ich esse kann ich auch trinken“ antworte Bea und leerte ihr Sektglas in einem Zug, um sich sofort nachzuschenken.
„Und du solltest nicht immer dieses fette Zeug essen. Fett gehört in Gesichtcremes und sonst nirgends wohin.“
„Ich weiß, ich weiß. Aber ich habe mich entschieden, meinen Körper ab jetzt zu nehmen wie er ist. Ich lasse ihn nicht mehr darben, noch dazu für eine Figur, die nun mal sowieso nicht für mich gedacht ist.“ Genüsslich machte Karin sich über ihr Essen her.
Jennifer hatte gar nicht zugehört. Sie stütze das Kinn auf die Handfläche und hing ihren Gedanken nach. Warum hatte sie die Zeichen übersehen? Wahrscheinlich wollte sie sie gar nicht wahrhaben. Es war alles so schön bequem und eingefahren. Warum also sich dagegen auflehnen?
Rüdiger war ihr Traumprinz gewesen. Groß, schlank, ein Bild von einem Mann. Sie war geblendet von seinem gepflegten Äußeren und seiner Klugheit. Aber manchmal ist Intuition nützlicher als Intelligenz. Doch sie ließ die Zweifel nicht an sich heran.
Sie führten ein Leben in Wohlstand. Jeder hatte seine Arbeit, seine Karriere und schon bald seine eigenen Interessen. Sie waren beide viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Mit der Zeit blieben auch die letzten Gemeinsamkeiten auf der Strecke. Und die Liebe auch.
Wenn eine Beziehung nicht mehr stimmt, dann genügt oft ein winziger Funke von außen, um alles in Asche zerfallen zu lassen. Am Ende hatten sie sich gegenseitig nur noch genervt und es war zu vieles geschehen, dass nicht hätte passieren dürfen. Irgendwann meinte er dann, es wäre richtiger sich zu trennen, bevor sie sich hassen würden. Eine schmerzliche Wahrheit wäre besser als eine tröstende Lüge, hatte er gesagt.
Sie stocherte lustlos in ihrem Salat.
Sie wollte keine Scheidung. Sie wollte sich nicht eingestehen, dass es vorbei war. Liebte sie ihn noch? War es ihr Glaube an die Ehe? Nein, nichts von alledem, musste sie sich jetzt eingestehen, eher die Furcht vor dem, was danach kommen würde und das krampfhafte Festhalten an vertrauten Gewohnheiten. Außerdem konnte sie es nicht ertragen, verloren zu haben. Doch sein Koffer stand schon bei der anderen.
Jennifer hatte ihm ihre Ängste nicht gezeigt, gab sich bis zum Schluss beherrscht, stark und überlegen. Wie immer.
Zusammengebrochen ist sie dann erst bei ihren Freundinnen. Und wurde aufgefangen.
Karin wischte sich den Mund ab und legte die Serviette zusammengeknüllt auf den blitzblank leer gegessenen Teller und lehnte sich zurück. „Mm, das hat mir aber gut geschmeckt.“ Sie stieß Jennifer leicht an. „Hallo, Jenny, wir sind hier“, und holte sie in die Gegenwart zurück. „Nun zerbrich dir nur nicht deinen hübschen Kopf. Daran stirbt man nicht. Im Gegenteil. Sieh es als eine wunderbare Chance!“
Jennifer schob ihren Salat fast unberührt von sich.
„Ist es das wirklich?“ sie schüttelte zweifelnd den Kopf. Eine Haarsträne befreite sich vorwitzig aus seinem Halt und fiel ihr leicht gekringelt über die Augen. Das verlieh ihrem Gesicht für einen Moment einen ungewohnt weichen Zug. Sie strich die Haare nervös beiseite und versuchte mit fahrigen Händen, sie wieder fest zu stecken.
„Natürlich ist es das. Du kannst nichts Neues haben, wenn du das Alte nicht vorher in die Tonne haust.“ Bea gestikuliert wild mit den Armen. „Der Markt ist voll mit phantastischen Männern. Warte nur ein bisschen, dann wirst du sie auch wieder sehen. Und du wirst sie wollen! Wetten?“
Karin lächelte Bea spöttisch an. „Es geht doch nicht immer nur um die Kerle. Abgesehen davon, wo sind sie denn bloß alle, deine ach so herrlichen Männer? Warum hast du dir denn bis heute keinen von ihnen eingefangen?“
„Irgendwann küsse ich schon mal den richtigen Frosch, ihr werdet` s schon erleben.“ Bea schlug die langen schlanken Beine übereinander und betrachtete aufmerksam ihre knallroten Fingernägel.
„Im Durchschnitt ist eine Frau heute mit 12,7 Männern zusammen, ehe sie den richtigen trifft. Wenn ich das richtig sehe, dann habe ich statistisch gesehen durch eure Zurückhaltung noch den einen oder anderen gut.“
Ihre Freundinnen wussten, dass sich hinter ihren Affären nicht nur Abenteuerlust, sondern auch eine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit und Liebe verbarg, die sie aber bisher noch nirgends gefunden hatte. Sie erwartete einfach zu viel. Er sollte gut aussehen, intelligent, fürsorglich und treu sein. Ein toller Liebhaber natürlich, reichlich Geld haben, und eine gute Herkunft wäre auch nicht schlecht.
„Nun, du hast den Durchschnitt wohl auch so schon ganz schön hoch getrieben.“ Karin lachte. „Aber du wirst dich nie entscheiden können. Der Prinz, von dem du träumst, den gibt es auf dieser Welt nicht.“
Bea nahm eine Serviette und polierte ihre Fingernägel wie Brillengläser und grinste schelmisch. „Oh doch, Karin. Ein paar gibt es mit Sicherheit. Nimm doch nur mal Jennys Ex. Der war eigentlich ein Paradebeispiel. Okay, bis dieses viel zu junge, verhuschte Mäuschen kam und ihm den Kopf verdreht hat.“ Sie schlug sich die Hand vor den Mund. „Oh, entschuldige Jenny, das war ganz blöd eben.“
Jenny winkte ab. „Ist schon gut. Meinetwegen kannst du ihn haben.“
„Oh nein, so verzweifelt bin ich dann doch nicht.“ Bea hob abwehrend die Hände. „Nein, nein. Der ist aus dem Rennen. Aber dein Martin, Karin, ein bisschen rund ist er ja, aber ansonsten… Vielleicht sollte ich es mal bei ihm versuchen?“
„Untersteh dich!“ Karin schlug lachend mit der Speisekarte nach ihr. „Such du dir mal schön deinen eigenen Frosch.“
Jennifer beugte sich über den unabgeräumten Teller hinweg zu Bea hinüber. „Fragt sich eben nur, wie lange der richtige Frosch tatsächlich auch der richtige bleibt. Manche werfen ihren Frosch immer und immer wieder an die Wand, in der Hoffnung, dass er ein Prinz wird und leben letztendlich eben doch nur mit einem ramponierten Frosch zusammen. Mir ging` s doch genau so, und jetzt küsst meinen jämmerlichen Frosch sogar noch eine andere.“ Jennifer nippte frustriert an ihrem Glas.
„Na besser jetzt als später“, meinte Bea. „Jetzt stehen dir noch alle Türen offen.“
Jennifer stellte ihr Glas derb auf den Tisch zurück.
„Unfug. Machen wir uns doch nichts vor, mit über vierzig. Welche Türen stehen dir da noch groß offen? Die Tür zur Küche, ja, die immer. Oder die zum Rheumaspezialisten…“
„Na, wenn er denn gut aussieht…“
„Nein, Bea, im Ernst, so ein Neuanfang kann toll und spannend sein, aber bitteschön vor dem Falten- und Fettzellenzeitalter. Wir können doch von Glück reden, dass wir `was auf dem Kasten haben und so den jungen Dingern wenigstens im Job noch das Wasser reichen können. Auf anderen Gebieten ist unser Zug doch längst abgefahren. Was soll da also noch kommen?“
„Na, sag` mal, so kenn ich dich ja gar nicht, das bist doch nicht du! Alt! Das würde ja bedeutet, ich wäre es auch. Oh nein, das geht gar nicht! Diesen Gedanke lasse ich gar nicht an mich heran. Alt ist immer fünfzehn Jahre älter als ich. Wirklich alt bist du erst,…“, Bea unterbrach ihren Satz als der Kellner kam, desinteressiert fragte, ob es geschmeckt hätte und abräumte.
„…wenn du in die Küche gehst und nicht mehr weißt, was du im Bad wolltest.“
„Oder wenn du nur noch die Wildecker Herzbuben hörst und dir dabei warm ums Herz wird.“ Karin schlug sich unerwartet auf ihre Seite. „Jenny, es gibt zigtausend Beispiele dafür, dass es nie zu spät dafür ist, wieder glücklich zu werden, auf welche Art auch immer. Natürlich, die beste Zeit einen Baum zu pflanzen war vor zwanzig Jahren. Aber die zweitbeste ist jetzt.“
Jennifer und Bea sahen sie überrascht an.
„Der ist nicht von mir. Das haben die alten Chinesen gesagt. Aber sie haben doch Recht. Oder?“
„Na sag ich doch. Ob man nun einen Baum pflanzen will oder nicht“, Bea malte sich die Lippen nach, „du hast allen Grund dich auf die Zukunft zu freuen. Du siehst klasse aus, hast einen tollen Job und dein Ex muss ordentlich löhnen. Bluten soll er, der Kerl. Das ist doch eine prima Ausgangsposition.“ Sie steckte den Lippenstift zurück in ihr Täschchen.
„Was heißt hier bluten?“ griff Karin ein bevor Jennifer etwas sagen konnte. „Jenny hat in all den Jahren schließlich genug gerackert für das, was sie jetzt haben. Außer einem gut bezahlten Job hat er doch auch nicht viel mehr mit in die Ehe gebracht. Da ist es ja wohl nur recht und billig, dass alles Halbe-Halbe geht.“
„Schade ist es schon um das schöne Haus“, sinnierte Jennifer. Als Rüdiger ihr das Haus das erste Mal gezeigt hatte, erschien es viel zu groß, zu protzig. Darüber hinaus lag es so weit draußen, fast schon ländlich. Aber er wollte es unbedingt.
Sie sah sich unter den großen Kastanien entlang auf die Altberliner Villa zugehen. Gott, wie hat sie das viele Laub gehasst. Jeden Herbst wieder. Immer stand sie allein mit der Arbeit da. Und mit den Schwielen an den Händen. Rüdiger hatte stets so viel Wichtigeres zu tun. Aber im Frühling, wenn die Bäume so traumhaft blühten, dann vergaß sie all das für kurze Zeit.
Sie sah sich die paar Treppenstufen rauf und an den beiden Säulen vorbei durch die breite Eingangstür gehen.
Im Laufe der Zeit lebte sie sich ein und akzeptierte es als ihr zu Hause. Der Gedanke wegzuziehen, erfüllte sie jetzt ein wenig mit Wehmut. Ihr vertrautes Leben zerbröckelte unter den Händen.
„Aber ich würde da auch nicht bleiben wollen. Ich kann die Vergangenheit um mich herum nicht mehr ertragen.“
Jennifer war sich nicht darüber im Klaren, ob es die Erinnerung an die schönen Momente war, vor denen sie sich fürchtete oder doch eher der Wunsch, sich von all den Hässlichkeiten der letzten Zeit zu trennen. Viel mehr setzte ihr wohl der eigene verletzte Stolz zu, der sich wie ein großer Schatten scheinbar von jeder der Zimmerwände herablassend auf sie nieder senkte und wie ein Krake mit seinen langen Armen umschlang, dass ihr oft die Luft weg blieb. In den Nächten war es am schlimmsten.
„Und ich glaube auch nicht, dass seine Neue mit meinem Geist in einem Haus tanzen möchte.“ Jennifer verschluckte sich fast bei dem Gedanken. „Eigentlich weiß ich noch gar nicht, was ich will, wohin ich will. Ich fühle mich so zerrissen, so unsicher und allein.“ Hilflos sah sie ihre Freundinnen an.
„He, du hast uns!“ Karin und Bea rückten näher an sie heran. „Das stehen wir zusammen durch. Und wenn du es dort nicht aushältst, bei uns ist jederzeit Platz für dich, bis du was Eigenes gefunden hast. Das weißt du.“
Bea griff nach der Flasche. „Na komm, darauf noch ein Gläschen Sekt.“
Jennifer guckte auf ihre Uhr und fuhr erschrocken auf, so dass ihr Stuhl nach hinten weg kippte.
„Oh Gott, schon so spät. Ich muss zurück in die Redaktion. Der Alte reißt mir den Kopf ab, und das kann ich gerade gar nicht gebrauchen.“ Sie merkte, dass einige der anderen Gäste ihren Aufbruch aufmerksam beobachteten. Automatisch setzte sie ihr unterkühltes Lächeln auf, ihr Körper straffte sich. Immer schön den Schein wahren. Es ging niemanden etwas an, wie es in ihr drinnen aussah. Keinen, außer ihren Freundinnen.
„Wir sehen uns am Wochenende. Ihr könnt mir dann vielleicht ein bisschen beim Packen helfen.“ Sie legte Geld auf den Tisch und umarmte ihre Freundinnen.
„Und danke, dass ihr so lieb und geduldig mit mir seid“, fügte sie leise hinzu.
Mit traumwandlerischer Sicherheit ging sie unter den neugierigen Blicken der Leute an den Nebentischen stolz erhobenen Hauptes zum Ausgang.
An der Tür drehte sie sich kurz um und winkte ihren Freundinnen noch einmal zu, bevor sie das Café verließ.
Ein eisiger Wind wehte ihr entgegen. Es hatte aufgehört zu schneien. Sie verharrte einen Moment unter dem geschützten Hauseingang und zog ihren Mantel fester um sich. Dann hob sie ihr Gesicht zu der bläulichen Sonne hoch und atmete tief durch. Nur eine einzige Wolke war zu sehen, allein wie sie selbst.
Jennifer konnte sich später nicht mehr erinnern, wie sie es geschafft hatte, die viel befahrenen Kreuzungen unbeschadet zu überqueren, die richtige S-Bahn zu erwischen und heil im Büro anzukommen. Verschwommene Gestalten huschten im grauen Zwielicht an ihr vorbei, Menschen, die wie sie beschlossen hatten, wieder einen Tag unter der Last ihres Lebens zu leiden, statt es mit Leichtigkeit zu nehmen, wie es war. Im Grunde fehlten die ganzen folgenden Tage in ihrem Gedächtnis. Hatte sie überhaupt gearbeitet, gegessen und geschlafen? Gelebt? Ein dichter Nebel lag über dieser Zeit.
Sie saß an ihrem Schreibtisch und starrte vor sich hin. Jeder ihrer halbherzigen Versuche, sich zu konzentrieren schlug fehl. So war es ihr noch nie ergangen. Bisher konnte doch nichts sie umhauen.
Kaffee! Sie brauchte unbedingt einen heißen Kaffee. Wie von unsichtbarer Hand gelenkt bediente sie den Automaten auf dem Flur.
Ihre Kolleginnen schielten zu ihr hinüber und tuschelten hinter vorgehaltenen Händen, aber Jennifer schien es nicht wahrzunehmen. Tief in ihre Gedankenwelt versunken ging sie zurück in ihr Büro. Mit dem Kaffeebecher in beiden Händen schaute sie aus dem Fenster und verfolgte die fliehenden Wolken am Himmel.
Es klopfte an den Rahmen ihrer stets offenen Tür und ihr Chef, Richard Wedekind, kam, ohne auf ihre Antwort zu warten, mit großen Schritten zu ihr an den Schreibtisch. Erst da erwachte sie aus ihrer Lethargie. Sie erschrak heftig und ihr Kaffee kippte fast um, als sie hektisch zu irgendwelchen Unterlagen griff, die auf ihrem Tisch lagen, als wäre sie intensiv mit deren Bearbeitung beschäftigt.
„Frau Dorn“, er sah ernst auf sie herab, „kommen Sie doch nachher bitte in mein Büro. Ich denke, wir sollten uns einmal in Ruhe unterhalten.“ Er sprach die Worte wie immer mit Bedacht besonders langsam und deutlich. Er hüstelte. „Um Fünfzehn Uhr. Das würde gut passen.“ Er ging zur Tür. „Und seien Sie pünktlich.“
Wie oft hatte sie sich über seine Behäbigkeit und überdimensionale Korrektheit, besonders wenn es um Termine ging amüsiert, manchmal auch aufgeregt. In diesem Moment fühlte sie die nackte Angst ihren Rücken hinauf kriechen. Was, wenn sie ihren Job auch noch verlieren würde?
Sie liebte ihre Arbeit als Reisejournalistin, und sie war gut. Das wusste sie. Aber ihr war plötzlich auch klar, dass sie in den letzten Wochen zwar physisch anwesend, aber mit ihren Gedanken doch nicht wirklich da gewesen war. Aber deswegen entließ man doch niemanden? Sie fühlte die Panik wie eiskalte fremde Hände auf ihrer Haut.
Wedekind war streng, aber gerecht, stand hinter seinen Mitarbeitern und forderte nie mehr von ihnen, als er sich selbst abverlangte. Aber auch nicht weniger. Er war eine Arbeitsmaschine, und als solche betrachtete er alle anderen auch. Das kam Jennifer gelegen. Ihr Privatleben ging niemanden hier etwas an, genau so, wie sie das der anderen nicht kennen wollte. Sie hielt stets eine gewisse Distanz zu ihren Kolleginnen, war freundlich und hilfsbereit, wenn es um die Arbeit ging, aber nie privat. Alle hier hielten es so. Sie waren Arbeitsmaschinen.
Wie sollte da auch nur einer von ihnen Verständnis für ihren momentanen Zustand haben? Hätte sie es denn im umgekehrten Fall?
Jennifer ging zum Fenster und öffnete es weit. Die frische kalte Luft drang tief in ihre Lunge ein und sie hatte das Gefühl, etwas klarer denken zu können. Aber sie konnte sich nach wie vor nicht vorstellen, was Wedekind ihr zu sagen hätte. Nein, raus schmeißen würde er sie nicht. Abmahnen vielleicht. Okay, damit musste sie leben. Wurde auch Zeit, dass jemand ihr ein bisschen Feuer unterm Hintern machte. Sie ärgerte sich selbst genug über sich. Normaler weise billigte sie sich keine Schwächen zu. Schwach waren nur andere. Dieses Gefühl, wie gelähmt zu sein, kannte sie nicht, und sie wusste nicht, wie sie mit dieser für sie neuen Situation umgehen sollte.
Sie schloss fröstelnd das Fenster.
Ihr Kaffee war inzwischen kalt geworden. Sie hasste kalten Kaffee. Aber sie hatte keine Zeit mehr, frischen zu holen. Wedekind erwartete sie.
Wedekind schaute auf seine wertvolle alte Taschenuhr und nickte kaum erkennbar. Er gab Jennifer ein Zeichen, ihm gegenüber Platz zu nehmen. Sie setzte sich auf die vorderst Stuhlkante und knete nervös ihr Taschentuch zwischen den Händen. Sie, die sonst so selbstbewusst jedem entgegentrat, keinen Blickkontakt scheute, traute sich jetzt kaum, ihren Chef anzusehen.
Wedekind lehnte sich in seinem Sessel zurück, faltete die Hände über dem Bauch und blickte Jennifer forschend an.
„Ihre Kolleginnen machen sich Sorgen um Sie, und auch ich habe sie beobachtet, Frau Dorn. Mir scheint, Sie haben eine schwere Last, die Sie da gerade mit sich herum tragen.“ Er beugte sich vor, stützte die Ellenbogen auf den Schreibtisch legte die Fingerspitzen aneinander.
Jennifer fühlte sich überrumpelt. Was wollte Wedekind? Mit ihr über ihre Sorgen reden? Sie verstand die Welt nicht mehr.
Wedekind drückte den Knopf der Wechselsprechanlage. „Frau Schulze, bitte bringen Sie uns Kaffee.“ Er wendete sich Jennifer zu, „Milch und Zucker?“
„Nein danke, schwarz“, antwortete Jennifer leise, immer noch irritiert, „ohne alles.“
„Also, Frau Schulze, einmal davon schwarz.“ Er machte eine kurze Pause. „Schwarz, ohne alles“, fügte er dann belustigt hinzu.
Jennifer sah ihn überrascht an. Sie glaubte nicht, sich erinnern zu können, ihn je lächeln gesehen zu haben. Ein Stein fiel ihr vom Herzen. Nein, er würde ihr nicht kündigen. Was auch immer er wollte, es konnte so schlimm nicht werden, solange sie bleiben durfte.
Einen Moment herrschte Schweigen. Wedekind hatte sich wieder zurück gelehnt und musterte Jennifer.
Erst als Frau Schulze den Kaffe gebracht und das Büro wieder verlassen hatte, sprach er weiter.
„Frau Dorn, Sie wissen, dass Sie eine meiner besten Mitarbeiterinnen sind. Was allerdings Ihre Stellung hier in unserem Team betrifft“, er räusperte sich und strich mit der Hand das Kinn, wie immer, wenn er sehr konzentriert war, als suchte er nach dem richtigen Wort, „nun ja, also, da weiß ich nie ganz, was ich davon halten soll.“
„Ich verstehe Sie nicht ganz, Herr Wedekind.“ Es war nur ein Flüstern. Jennifer hatte keine Ahnung, worauf dieses Gespräch hinauslief, und das verunsicherte sie noch mehr.
„Nun entspannen Sie sich doch erst mal. Sie sind ja nur noch ein Schatten Ihrer selbst.“ Wedekind stand auf und ging zum Wandschrank. Er goss golden schimmernden Cognac in einen edlen Schwenker und reichte ihn ihr.
„Hier, nehmen Sie. Sie werden sehen, der wärmt nicht nur den Körper, sondern auch die Seele.“ Er setzte sich wieder. „Und ich denke, die ist es, die Ihnen zu schaffen macht.“
Jennifer war perplex. Seit wann interessierte sich Wedekind für ihre Seele? Hat er überhaupt je gewusst, dass sie und ihre Kolleginnen eine hatten?
Sie hielt sich an dem Glas fest wie an einem Rettungsanker.
„Na ja“, sie schluckte heftig, „ich habe gerade eine“, sie stockte wieder, unschlüssig darüber, was sie preisgeben wollte, „ich habe tatsächlich momentan ein paar Probleme.“ Nun war es raus. „Aber die sind rein privater Natur“, ihre Stimme schien sich zu überschlagen, „und ich weiß, es ist unverzeihlich, dass meine Arbeit darunter leidet“, sprudelte es aus ihr heraus. Sie nahm schnell einen Schluck. „Aber es geht mir wieder gut. Sie können sich auf mich verlassen.“ Sie spürte, wie der Cognac sich seinen Weg durch ihren Körper bahnte und sie etwas ruhiger wurde.
„Ich weiß, dass Sie gerade geschieden worden sind.“
Jennifer riss vor Überraschung die Augen weit auf. „Sie wissen?“ Sie konnte nicht weiter sprechen und ihr ganzer Körper verkrampfte sich.
„Wo Informationen fehlen, Frau Dorn, entstehen Gerüchte. Sie kennen mich, ich liebe Klarheit. Also habe ich mich informiert.“
Jennifer wäre am liebsten im Erdboden versunken. Nun war genau das eingetroffen, was sie immer vermeiden wollte. Ihr Privatleben war öffentlich geworden. Aber warum machte Wedekind sich Gedanken um sie? Warum ihre Kolleginnen? War sie womöglich die einzige im Büro, die…, auf einmal fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Es war doch mehr als nur die Arbeit, die alle hier verband, nur sie selbst hatte sich nie für die anderen interessiert. Wie sehr mussten ihre Kolleginnen sie verachten.
„Frau Dorn, keine Angst, ich will hier nicht in Ihr Leben eindringen“, seine Stimme wurde ungewöhnlich sanft, „keiner von uns will das, aber erlauben Sie einem alten Mann, Ihnen zu sagen, so ist das Leben nun mal. Es besteht nicht nur aus Höhen. Pausenloses Wohlgefühl gibt es nicht, auch nicht in einer Partnerschaft.“
Er nahm die Brille ab und rieb sich die Augen. „Sicher, mit jedem neuen Lebensabschnitt wird es Dinge geben, die unwiederbringlich vorbei sind. Aber dafür kommen Neue, nicht weniger Schöne.“
Jennifer guckte auf ihre Schuhspitzen. „Es ist so schwer, nach fast dreißig Jahren vor einem Scherbenhaufen zu stehen. Ich bin nicht mehr gut genug. Ist das nicht der Anfang vom Ende?“ Sie schluckte heftig.
„Na, na, nun aber mal langsam. Niemand, wirklich niemand kann Ihnen ein Minderwertigkeitsgefühl einreden ohne Ihre Einwilligung. Wo ist Ihr unerschütterliches Selbstbewusstsein geblieben?“ Wedekind setzte seine Brille wieder auf, kam um den Schreibtisch herum und legte Jennifer die Hand auf die Schulter. „Das Leben ist ein ununterbrochener Abschiedsprozess. Aber es ergeben sich daraus oft ungeahnte Möglichkeiten.“
„Das haben meine Freundinnen auch gesagt“, schluchzte Jennifer.
Wedekind blickte freundlich auf sie herunter. „Heute glauben Sie noch, der Schmerz wird Ihnen den Verstand rauben, aber das einzig Gute am Schmerz ist nun mal, dass er irgendwann nachlässt. Vielleicht wachen Sie schon morgen auf, und es ist ausgestanden und vorbei.“
Jennifer heulte los. Das unerwartete Mitgefühl ließ sie jede Kontrolle über sich verlieren.
Wedekind schob ihr ein Paket mit Taschentüchern hin und wartete.
Als hätten die Tränen ihren Blick geklärt, sah Jennifer auf einmal alles wieder deutlich. Sie schnaubte geräuschvoll in ihr Taschentuch.
Wedekind schmunzelte zufrieden.
„Na sehen Sie, nun sieht die Welt doch schon wieder ein bisschen heller aus. Ich hab` mir gedacht, Sie sollten vielleicht, wenn Sie das aktuelle Projekt abgeschlossen haben, ein paar Tage Urlaub machen? Arbeiten Sie nicht gerade an einem Ostseebericht? Fahren Sie doch mal dort hin. Lassen Sie sich so richtig vom Sturm durchpusten. Das soll Wunder wirken.“ Er zwinkerte ihr aufmunternd zu.
Jennifer nickte zaghaft. „Ich werde darüber nachdenken.“
Wedekind hatte unbewusst eine tief in ihrem Innern versteckte Sehnsucht geweckt.
„Ich war als Kind oft an der Ostsee“, sagte sie zögernd, als scheute sie sich noch, darüber zu reden. „Ich bin dort geboren“, fügte sie leise hinzu.
Bilder aus der Kindheit tauchten vor ihren Augen auf. Sie sah das Haus mit dem Schilfdach und den bunten Fensterläden, in dem es immer nach Kakao und frisch gekochter Marmelade roch. Ihre Oma stand lachend mit Erdbeeren aus dem Garten in der Tür, und Opa, in seiner Schafwollstrickjacke, streichelte die Kaninchen. Ein verträumtes Lächeln zog für Sekunden über ihr Gesicht.
„Ach ja?“ Wedekind wurde hellhörig. „Wo denn da?“
„In Prerow. Auf dem Darß“, entgegnete Jennifer, in Gedanken weit weg. Das Bild in ihrem Kopf blieb. Wie hieß ihr kleiner geliebter Kater noch? Kasimir. Natürlich.
„In Prerow, mm, das ist ja sehr interessant“, sagte Wedekind nachdenklich und rieb sich wieder das Kinn, „aber“, und er winkte ab, „erholen Sie sich erst mal. Hören Sie auf meinen Rat, machen Sie Urlaub. Ja, fahren Sie nach Prerow.“
Jennifer stand auf und reichte Wedekind die Hand. „Vielleicht haben Sie Recht.“ Sie schwieg einen Moment verlegen.
„Und danke. Für alles.“ Sie ging zur Tür.
Wedekind sah ihr hinterher. „Vergessen Sie nicht“, Jennifer drehte sich noch einmal zu ihm um, „wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen.“
Als sie in ihr Büro kam stand ein heißer Kaffee für sie bereit. Schwarz, ohne alles.
Es gab Zeiten, da hatte Jennifer sich nicht vorstellen können, sich je an dieses dunkle Haus zu gewöhnen, an Fenster, die ihr wie tote Augen entgegen starrten und Bäume, die mit ihren herunter hängenden Ästen nach ihr griffen, wenn sie abends müde von der Arbeit kam. Am Anfang war Rüdiger häufig vor ihr zu Hause gewesen. Er konnte sich seine Zeit einteilen. Mit den Jahren kam er immer öfter spät, irgendwann sehr viel später, bis er ganz weg blieb.
Nachdenklich blieb sie an der Gartenpforte stehen und musterte das Haus. Die ersten Wochen nach Rüdigers endgültigem Auszug erschien es ihr bedrohlich und erschreckend. Es kostete sie sehr viel Überwindung, nicht einfach umzudrehen und bei Bea oder Karin Zuflucht zu suchen. Aber sie kämpfte dagegen an. Das war die Zeit, in der ununterbrochen Licht in allen Räumen brannte. So versuchte Jennifer, die Geister der Einsamkeit zu verscheuchen. Mit mäßigem Erfolg.
Jetzt lag das Haus vor ihr, und zum ersten Mal wurde sie sich der Ruhe, die es ausstrahlte bewusst. In den unbeleuchteten Fenstern spiegelte sich eitel der Mond, und es schien, als lachte er sie an. Die Äste der Kastanien strichen im leichten Wind zärtlich über das Dach und bald würden die Vögel in den Zweigen wieder leise ihren Schlafgesang zwitschern.
So hatte Jennifer es noch nie wahrgenommen.
Der Nachbarskater kam maunzend angesprungen und strich schnurrend um ihre Beine.
Und endlich machte sie ihren Frieden mit dem Haus und, ohne es schon richtig zu begreifen auch mit ihrem neuen Leben.
Die mächtige Eingangstür knarrte. `Guten Abend Jennifer`, schien sie zu sagen. Und Jennifer lächelte.
Sie streifte die Schuhe mit den hohen Absätzen von den Füßen und schlüpfte erleichtert in ihre warmen Wollsocken. Was für eine Wohltat.
Das Haus war abends nicht mehr richtig warm. Rüdiger hatte nie gefroren und nur gemeint, sie sollte sich etwas anziehen, wenn ihr kalt wäre. Nun war er weg, aber die Kälte war geblieben.
Jennifer wusste nicht, wie sie die Temperatur höher stellen konnte. Vielleicht sollte sie mal einen Fachmann kommen lassen. Aber es war fast Frühling, und außerdem würde sie bald ausziehen. Sollte sich doch die neue Hausherrin damit herum ärgern.
Sie zog die Augenbrauen zusammen und machte ein trotziges Gesicht. Na und, dann machte sie sich eben den Kamin an.
Holz war genug da. Rüdiger hatte als Jäger gute Beziehungen zum Förster des Stadtwaldes. Er wollte es sich irgendwann zu seinem neuen Haus holen. Wahrscheinlich war seine neue Madam genau so verfroren, wie eben die meisten Frauen. Nur mit dem Unterschied, dass sie ihn mit ihrem jugendlichen Charme noch becircen konnte zu heizen.
Jennifer zuckte mit den Schultern. Sie würde ihm schon zeigen, dass sie auch ohne ihn klar kam.
Sie sah in den Spiegel, warf den Kopf zurück und streckte sich, löste ihr hochgestecktes Haar und brachte es mit ein paar geübten Griffen locker in Form. Genug getrauert und gehadert. Es war an der Zeit, Pläne zu schmieden. Sie trat etwas näher an ihr Spiegelbild heran und untersuchte prüfend ihre Haut. Gar nicht so übel, dachte sie, trat einen Schritt zurück und steckte ihm die Zunge aus. Dann schaute sie sich um. Womit sollte sie beginnen? Ach ja, der Kamin.
Rüdiger Dorn, ich brauche dich nicht!
„So ein Mist! Warum brennst du nicht, du blödes Feuer?“ Jennifer schleuderte den untauglichen Kohlenanzünder wütend in die Ecke. Was für ein elendes Zeug. Wie hatte Rüdiger das noch immer gemacht? Sie hatte nie darauf geachtet. Feuer machen war Männersache. Basta. Das hatte sie nun davon. Zeitungspapier, ja, damit musste es gehen, und mit ein paar kleineren Scheiten.
Irgendwann brannte ihr Feuer tatsächlich und Jennifer empfand es als einen großen Sieg. Sie hatte Feuer gemacht. Aber warum qualmte es so schrecklich?
Als das Telefon klingelte verschluckte ein Hustenanfall ihren Namen.
„Hallo Mami, ich bins. Ich wollte nur mal hören, ob es dir gut geht. Was ist los bei dir?“
Jennifer war ein paar Schritte vom Kamin weg gegangen, aber der Rauch kratzte ohne Erbarmen in ihrem Hals.
„Ach, der doofe Kamin qualmt so. Erst wollte das Feuer nicht angehen, und jetzt das. Der Feuermelder wird noch Alarm schlagen, wenn das nicht aufhört.“ Jennifer hustete wieder und wedelte wild mit den Armen, als könnte sie den Rauch so vertreiben.
„Hast du die Lüftungsklappe zum Schornstein auf gemacht?“
„Was für `n Ding?“ Jennifer zog fragend die Augenbrauen zusammen. „Ach diesen Hebel hier? Ja, es funktioniert. Ha, wir haben es geschafft! Mein kluges Kind.“ Sie atmete erleichtert auf. „Hallo Juli, mein Schatz. Schön, dass du anrufst.“ Jennifer ließ sich erleichtert in den großen Sessel fallen. „Jetzt, wo mein Feuer endlich brennt, geht `s mir gut.“
„Schön, das zu hören. Ich hab` mir Sorgen gemacht, dass du allein nicht zu recht kommst.“
Jennifer spielte die Empörte. „He, du kennst mich doch.“
„Ja eben. Ich kenne dich.“ Julia lachte am anderen Ende der Leitung. „Erzähl mal, was machst du so?“
„Im Moment bin ich froh, dass ich keinen Schnee schippen muss.“
„Nein, das glaub ich nicht. Hier in München blüht es schon überall. Es ist so schön, kann ich dir sagen. Ich sitze gerade mit den Jungs aus der Kanzlei im Biergarten.“
„Ihr habt es ja gut. Hier ist es noch schweinekalt. Dabei freue ich mich so auf den Frühling und auf die Sonne.“ Jennifer legte ein paar Holzscheite nach. „Hast du noch ein paar Minuten Zeit, dann hole ich mir schnell ein Glas Wein. Warte bitte eine Sekunde.“ Jennifer goss sich den dunkelroten Wein in ihr Glas und machte es sich wieder gemütlich. „So, da bin ich wieder. Soll ich dir mal was Tolles erzählen? Ich werde nach Prerow fahren.“
„Nach Prerow? Wie kommst du plötzlich darauf? Wann warst du da überhaupt das letzte Mal?“
„Ich weiß gar nicht so genau.“ Jennifer schloss die Augen. Etwas über dreißig Jahre musste das her sein. Ihre ganze Kindheit lang hatte sie wunderschöne Ferien in Prerow verbracht. Dann waren von einem Jahr auf das andere plötzlich die Freunde in Berlin wichtiger geworden als die Großeltern. Sie hatte sie schlicht vergessen. Und als sie später die Sehnsucht nach Oma und Opa auf einmal wieder packte und sie zu ihnen wollte, kam der Tod dazwischen. Der unbarmherzige Tod. Tief in ihr blieben ein schlechtes Gewissen und eine quälende Traurigkeit. Sie war nie wieder nach Prerow gefahren.
„Ich dachte, mal ein paar Tage raus, das wäre gar nicht schlecht. Und irgendwie kam mir Prerow in den Sinn.“
„Find ich toll. Fährst du in Omas und Opas Haus?“
„Nein. Ich kann gar nicht sagen, ob es noch steht. Seit deine Großeltern das letzte Mal da waren ist dort doch nichts mehr passiert. Ich weiß nicht mal, ob ich es noch wieder finden würde.“
„Dass Oma und Opa gar nicht mehr hin fahren ist schon komisch. Meinst du nicht auch?“
„Na ja, wenn sie ihren Garten nun mal so lieben. Auf jeden Fall bin ich mächtig gespannt auf alles.“ Jennifer nahm einen Schluck von ihrem Wein und streckte die Füße näher an den Kamin heran. Herrlich, diese Wärme.
„Wann geht `s los?“
„Ein bisschen dauert `s noch. Zum einen muss ich erst eine angefangene Arbeit abschließen, außerdem sollte das Wetter wenigstens etwas besser sein. Aber jetzt erzähl du doch mal, wie geht es dir, meine Kleine? Sorgst du vernünftig für Recht und Ordnung bei den Bayern?“
„Oh, Mami, du wärst stolz auf mich, wenn du mich im Gerichtssaal erleben könntest. Ich kann es selber noch nicht glauben, dass ich es endlich geschafft habe und nun ausgerechnet hier arbeiten darf. Es ist total cool.“
„He, ich bin stolz auf dich!“
Julia hatte nach der Schule erst einen Beruf erlernt. Sie wollte unbedingt unabhängig sein, was ihr der Job ermöglichte. Erst danach hatte sie ihren Traum vom Jurastudium verwirklicht. Jennifer war als junge Frau genau so, aber viele ihrer Erwartungen an das Leben waren dann in ihrer Ehe mit Rüdiger verloren gegangen. Doch heute wusste sie, sie würde zu einer neuen Unabhängigkeit finden. Und sie würde sie nicht noch einmal aufgeben.
Jennifer ging zum Fenster und zog die Gardinen zu. Ihre kleine Julia war nun eine Rechtsanwältin. Wo war nur die Zeit geblieben?
„Und was machen die bayrischen Männer?“
„Ach, du weißt ja, wie das so ist. Die, die um einen rum wuseln, die will man nicht, aber der, der einem gefällt, der wuselt um andere herum. Aber ich habe ja noch eine Menge Zeit. Meine Frauenärztin hat gesagt, sechsunddreißig ist das beste Alter zum Kinderkriegen.“
„Na, wenn sie meint. Ich für meinen Teil bin froh, dass ich damals noch so jung war und heute eine so phantastische erwachsene Tochter habe. Du fehlst mir.“
Jennifer hatte immer behauptet, es würde ihr nichts ausmachen, dass Julia sich für München entschieden hatte. Die Kinder mussten ihr eigenes Leben führen, und Eltern sollten los lassen können. Das konnte sie auch, aber sie vermisste ihre Tochter trotzdem oft sehr.
„Dann komm doch einfach hier her, Mami. Prerow hat so lange auf dich gewartet, da kann es auch noch ein bisschen länger ohne dich sein.“
„Mein Chef hat gesagt, ich soll mich am Meer vom Sturm durchpusten lassen. Du weißt, man soll auf seinen Boss hören.“ Jennifer hob belehrend ihren Zeigefinger, als könnte Julia das sehen. „Und du hast doch bei all der vielen Arbeit gar keine Zeit für deine alte Mutter.“
„He, Mama, ich weiß genau, was du gerade tust.“ Julia lachte laut. „Na ja, ich habe wirklich gerade sehr viel zu tun. Das stimmt schon.“
Dann druckste sie ein bisschen herum, als traute sie sich nicht so richtig zu fragen. „Hast du mal was von Papa gehört?“
Jennifers Magen zog sich zusammen. Gerade war sie noch so entspannt gewesen. Seltsam, inzwischen wusste sie genau, dass sie Rüdiger nicht zurück haben wollte, aber es tat trotzdem noch weh. Sie bemühte sich, betont locker zu klingen. Sie wollte nicht, dass Julia es merkte. Es war so schon enttäuschend und traurig genug für sie.
„Ja, wir haben uns vorgestern getroffen um noch ein paar Dinge abzusprechen. Du brauchst dir keine Gedanken machen, wir bringen uns nicht gegenseitig um, obwohl“, Jennifer nahm einen Schluck Wein und lachte leise, „es gab schon Augenblicke, wo mir sehr danach war.“ Sie goss sich noch etwas Wein nach. „Ich kann noch eine Weile im Haus bleiben. Der neue Eigentümer hat es nicht so eilig. Der treibt sich irgendwo in Australien rum. Ich habe mich in Berlin Mitte schon mal umgesehen. Ich mag die Gegend dort. Da ist überall was los. Du weißt ja, mir war es hier eigentlich immer zu ruhig, und ich hab `s dann nachher auch viel näher zur Arbeit. Ich denke, ich habe da eine hübsche kleine Wohnung gefunden. Na, du wirst sie dir dann ja mal angucken kommen, wenn es soweit ist.“
„Klar. Das gibt dann ja wohl `ne Party. Und…“, Julia suchte nach den richtigen Worten, „meinst du, dass Papa glücklich ist? Hat sich das alles gelohnt?“
Jennifer wusste, wie sehr Julia ihren Vater liebte, aber wie schwer sie mit seiner Entscheidung umgehen konnte. Julia war die Entfremdung ihrer Eltern nicht entgangen. Als es dann aber tatsächlich zur Scheidung kam, war es doch wie ein Schock für sie. Genau wie Jennifer wollte auch sie nicht wahrhaben, dass dieses Ende lange vorprogrammiert war.
„Ich denke, für ihn schon, meine Kleine“, sagte Jennifer sanft. Es war nicht die Zeit und der Ort, um Julia zu gestehen, wie egal es ihr war, ob ihr Vater mit diesem jungen Ding klar kam oder nicht. Nein, es war ihr nicht nur egal, sie hegte zeitweise sogar sehr viel niederträchtigere Gedanken. Aber das würde sie Julia nicht sagen.
„Ach Mami, ich bin so froh, dass du so gut drauf bist. Du wirst sehen, es wird wieder alles richtig schön werden. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Die anderen trinken mir mein ganzes Bier weg.“
Jennifer hörte Julias Begleiter im Hintergrund singen. Fröhliche junge Leute. Die Tiefschläge des Lebens kamen erst später. Meistens.
„Ja, mein Schatz, klar. Es war schön, dich zu hören. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Macht Euch noch einen schönen Abend. Ich drücke dich.“
„Küsschen. Bis bald.“ Julia legte auf und Jennifer blieb allein zurück.
Sie ließ den Rotwein im Glas kreisen. War Rüdiger glücklich? Hatte er jetzt das, was er wollte? Ob seine Madam wohl wusste, wie er sein Steak am liebsten mochte? Konnte sie überhaupt kochen? Außerdem habe ich dir die beste Pizza der Welt gebacken, dachte Jennifer. Allerdings war das schon sehr lange her. Wann hatte sie das letzte Mal für ihn gekocht? Wann auch, die Arbeit hat alles andere verdrängt.
Da war so vieles auf der Strecke geblieben. Keine Zeit für das, was wir liebten. Wir haben uns einfach im Alltag verloren.
Was soll `s. Jennifer sprang auf und schüttelte die trüben Gedanken ab. Sie sah sich im Zimmer um. Rüdiger hatte ihr freie Hand gelassen zu entscheiden, was sie gern behalten wollte. Er war, nachdem die Trennung endgültig beschlossen war, überaus rücksichtsvoll und zuvorkommend gewesen. Was hatten sie sich vorher gestritten, beschimpft und verletzt. Er hatte lange vor ihr begriffen, dass nicht erst seine neue Beziehung das Ende ihrer Ehe war. Aber so ganz wollte Jennifer sich das immer noch nicht eingestehen.
Was würde sie mitnehmen? Eigentlich hatte Rüdiger die meisten Möbel ausgesucht. Alles so `n Biedermeierzeug, oder welcher Epoche sie auch immer entsprungen sein mochten. Jennifer konnte sie nie richtig leiden. Sie schlenderte wie im Museum von einem Stück zum anderen. In Rüdigers noblen Kreisen war genau das die angesagte Einrichtung und er wollte eben dazu gehören. Jennifer hatte das Spiel mitgespielt.
Sie strich liebevoll über ihren rostroten Sessel am Kamin. Der musste mit. Wenn sie sich da hinein kuschelte, war sie kaum noch zu sehen und wurde eins mit ihm. Er war wie eine schützende Festung für sie.
Ihre neue Wohnung konnte sie einrichten, wie sie allein es wollte. Das wurde ihr plötzlich klar und es jubilierte in ihr. Was sie vor ein paar Tagen noch nicht für möglich hielt, nahm immer deutlicher Gestalt an. Das neue Leben umwarb sie mehr und mehr mit seiner Sonnenseite.
Von diesem Gedanken beflügelt entschied sie, außer ihrem Lieblingssessel nichts weiter mitzunehmen. Weg mit den Altlasten.
Halt! Ihre Bilder, die gehörten natürlich auch in die neue Wohnung. Ihr Blick glitt sacht über die zarten Aquarelle. Das war das einzige Mal, dass sie sich gegen Rüdiger durchgesetzt hatte. Wenn es nach ihm gegangen wäre, dann hätten irgendwelche großen Schinken neben dem Kamin ihren Platz gefunden. Wenn er schon anfing von Kunst als Geldanlage und von Wertzuwächsen zu reden. Na, er konnte sein neues Haus ja nun mit solchen kapitalträchtigen Exemplaren tapezieren.
Das Feuer war inzwischen ausgegangen und Jennifer fror. In dem Moment schlug die große Standuhr im Flur zwölf Mal. Mitternacht. Wochenende.
Ein vorwitziger Sonnenstrahl bahnte sich seinen Weg durch das Fenster. Er tanzte an den gelben Gardinen hoch, die Wände entlang, um dann über die Bettdecke zu kriechen und Jennifer an der Nase zu kitzeln. Noch etwas verschlafen blinzelte sie in das Licht und rieb sich die Augen. Was für ein wunderschöner Morgen. Jennifer räkelte sich wohlig und fühlte sich so gut erholt wie lange nicht. Sie verschränkte die Arme hinter dem Kopf, genoss den Sonnen überfluteten Raum und spürte die neu erwachte Energie in sich. Dieser Sonnabend würde der erste richtig tolle Tag ihres neuen Lebens werden. Da war sie sich ganz sicher.
Mit einem Satz war sie raus aus dem Bett. Dabei achtete sie ganz penibel darauf, mit beiden Füßen zugleich auf dem Boden aufzusetzen. Was für eine alberne Angewohnheit. Sie war nicht abergläubisch, aber es konnte ja nicht schaden, eben nicht mit dem falschen Bein zuerst aufzustehen. Genau so, wie sie es grundsätzlich vermied, anderen über Kreuz die Hand zu geben und es auch nie übers Herz bringen würde, sich beim Anblick einer Sternschnuppe nichts zu wünschen. Aber nein, abergläubisch war sie gar nicht.
Sie zog ihre Socken an und trat ans Fenster. Der Frühling schien sich nun endlich gegen den Winter durchzusetzen. Er hatte sein ganz eigenes Licht und die Natur erwachte zum Leben.
Jennifers Schlafzimmer war kalt. Sie schlief grundsätzlich im ungeheizten Raum, am liebsten bei geöffnetem Fenster.
Aber der Rest des Hauses war schon angenehm warm. Eines der besten Dinge, die die Wende mit sich gebracht hatte, war definitiv, schon früh ein warmes zu Hause zu haben. Ohne Kohlenschleppen und Aschestaub. Es erfüllte Jennifer jeden Morgen aufs Neue mit großer Dankbarkeit. Sie erinnerte sich mit Schaudern an frühere Zeiten, als morgens eisige Kälte im ganzen Haus herrschte. Damals „heizte“ sie die Küche mit dem offenen Backofen, damit Julia beim Frühstück nicht so frieren musste, bevor sie dann in aller Herrgottsfrühe das Haus verließen. Wenn sie abends von der Arbeit kamen, wurde als erstes Feuer gemacht, aber ehe die Räume warm wurden, war es schon fast wieder Zeit, ins Bett zu gehen. Jennifer schüttelte sich. Frieren war schlimmer als Hunger und Durst.
Mit der Wende kam das Erdgas und damit das Ende der Kälte.
Jennifer lief im Schlafanzug durch alle Räume und empfand eine diebische Freude dabei. Das war etwas, das Rüdiger nicht geduldet hatte. Sein Credo lautete, immer so auszusehen, dass jederzeit Besuch auftauchen konnte. Was für ein Quatsch. Wer sollte sie früh um acht oder neun Uhr schon besuchen wollen. Jennifer lachte in sich hinein. Sie wollte jetzt alles das tun, worauf sie seinetwegen, oft schweren Herzens, verzichtet hatte.
Schon erfüllte Musik das ganze Haus. Rüdiger konnte laute Musik nicht ausstehen. Jennifer drehte die Lautstärke noch ein bisschen höher. Sie war allein, brauchte auf niemanden Rücksicht nehmen. Da kam Bruce Springsteen gerade recht. Den musste man einfach richtig laut hören. Mit tänzelnden Schritten ging Jennifer in die Küche und machte sich erst mal einen Kaffee. So, jetzt konnte sie ihren Tag planen.
Die Sonne hatte sich bereits jede Ecke der Küche erobert. Jennifer liebte diesen Raum. Darauf hätte sie bei der Wahl ihrer neuen Wohnung achten sollen, dachte sie. Sie kniff die Augen zusammen und überlegte. Aber ja doch, sie hatte von ihrem kleinen Balkon aus den verzagten Sonnenstrahl entdeckt, der versuchte, sich durch die dicken Wolken durchzuzwängen. Und ihre neuen Nachbarn, ein junges Schwulenpärchen, waren gleich mit einer Flasche Sekt angekommen. Sie würde also auch dort ihren Lieblingsplatz finden.
Sie schaute zur Küchenuhr hoch. Die glich eher einer Bahnhofsuhr, die mit penetrant lautem Ticken ständig mahnte, nur nicht zu spät zu kommen. Noch so ein Designerstück von Rüdiger. Na, sollte er sie doch mitnehmen, dann würde er wenigstens nie vergessen, welche Stunde ihm geschlagen hatte. Oh, er würde sich noch so manches Mal nach der Ruhe in dieser Küche zurück sehnen. Aber die gehörte nun ihr allein.
Jennifer liebte es schon als Kind, in der Küche zu sitzen und Mutti bei ihren Arbeiten zuzusehen, während Vati die Zeitung las. Und auch später, mit ihren Freundinnen, hockte sie am liebsten dort.
Jennifer griff zum Telefon.
„Hallo?“ Jennifers Mutter klang wie immer etwas unsicher. Nach wie vor war ihr das Telefon ein wenig unheimlich. Mit jemanden zu sprechen, dem man dabei nicht in die Augen gucken konnte, fiel ihr schon immer schwer.
„Hallo Mutti, guten Morgen. Wie schön, dass ihr zu Hause seid.“
„Hallo, Lieblingstöchterchen“, Jennifer spürte, wie die Spannung sofort von ihrer Mutter abfiel, als sie hörte, wer am Apparat war. „Ach, das ist aber schön, dass du anrufst. Wie geht es dir? Vati ist gerade zum Markt gegangen. Er wird wohl in einer Stunde zurück sein.“
„Na klar, pünktlich zum Cappuccino um halb elf“, Jennifer liebte die Rituale, die das Leben ihrer Eltern bestimmten. Es lag so viel Geborgenheit und Beständigkeit darin. „Wie sieht’s aus, habt ihr für mich auch einen?“
„Natürlich, Kind, wir freuen uns doch, wenn du kommst. Ich habe auch ganz frische Plätzchen. Soll Vati dich abholen? Dann rufe ich ihn an. Er hat das Handy mitgenommen. Er hat gesagt, falls ich was vergessen habe. Als wenn ich etwas vergessen würde. Dafür ist er doch zuständig.“
„Nein, nein, ich nehme die Bahn, ist schon gut. Also, bis gleich.“
Jennifer beschlich ein schlechtes Gewissen. Sie besuchte ihre Eltern viel zu selten, obwohl sie gar nicht so weit auseinander wohnten. Ja, sie telefonierten häufig. Besonders in der letzten Zeit. Jennifer tat es so gut, sich bei ihren Eltern den Schmerz von der Seele reden zu können. Da konnte sie ganz sie selbst sein, durfte das Kind sein, das gerade mal auf die Nase gefallen war und nun jemanden brauchte, der ihm wieder hoch half und es tröstete. Sie hatten getan, was Jennifer am meisten brauchte, sie hatten einfach zugehört.
Sie machten ihr keine Vorwürfe oder klagten, aber Jennifer spürte bei ihren seltenen Besuchen, dass sie sie gern öfter sehen würden, und dass sie sich große Sorgen um sie machten. Es war schon seltsam. Egal, wie alt man wurde, für die Eltern würde man immer das Kind bleiben.
Jennifer warf schnell noch einen Blick auf die Bahnhofsuhr. Na dann, ab unter die Dusche.
Das heiße Wasser prasselte auf sie nieder, während sie ihren Gedanken freien Lauf ließ. Ihre Eltern waren bald fünfzig Jahre verheiratet. Diese Generation war dazu noch in der Lage. Ob das in ihrer eigenen Altersgruppe überhaupt noch jemand schaffte? Oder gar von den noch Jüngeren?
Vati hatte damals aus Liebe zu Mutti sein ganzes Leben umgekrempelt. Vom Landei zum Großstadtmenschen. Das war ihm bestimmt nicht leicht gefallen. Nach all dem, was Jennifer wusste, war ihr Vater anfangs alles andere als der geborene Familienmensch.
Die Scharmbergs waren eine alteingesessene Prerower Familie. Oma kam als Dienstmädchen nach Prerow, und der erfolgreiche Fuhrunternehmer Emil Scharmberg wurde ihre Fahrkarte in ein besseres Leben.
Ihren einzigen Sohn hatte sie von Anfang an besonders verwöhnt. Alles drehte sich nur um „Amigo“. Er war ein toller Mann, konnte fast jedes Mädchen haben, das er wollte. Aber bei keiner war er geblieben. Bis Mutti kam. Jennifer schmunzelte bei dem Gedanken an Vatis alten Freund, der von dem Abend erzählte, als sie Mutti das erste Mal beim Tanz sahen.
„Guck dir die Kleine da drüben gut an“, hatte Vati zu ihm gesagt, „die wird mal meine Frau.“
Mutti kam aus Berlin. Sie war zur Kur nach Prerow verschickt worden. Wahrscheinlich sollte auch sie sich vom Sturm durchwehen lassen. Das war im Dezember.
Im April war schon Hochzeit. Sie kam im September sozusagen als „Sechs-Monats-Kind“ zur Welt. Ja, das ging alles ruck zuck damals.
Ihre Eltern wohnten bei Oma und Opa in einem kleinen Zimmerchen. Aber Mutti und Oma, das war wie Feuer und Wasser. Opa war immer lieb zu ihr, hatte aber leider nicht viel zu melden.
Vati wollte Mutti, aber zugleich auch sein altes freies Leben, und Oma hat ihrem Kronsohn grundsätzlich den Rücken gestärkt. Mutti hatte das Nachsehen.
Jennifer drehte das Wasser ab und hangelte nach dem Handtuch.
Irgendwann war Mutti mit ihr und ein paar Sachen zurück nach Berlin gegangen. Sie hatte es nicht länger ausgehalten. Da war Vati aufgewacht, hinterher gefahren und geblieben.
Jennifer rubbelte ihr langes Haar und fönte es dann trocken. Was wohl aus ihr geworden wäre, wenn ihre Eltern Prerow nicht verlassen hätten?
Jennifer durfte in den Ferien immer zu Oma und Opa fahren. Sie liebte die Zeit bei ihren Großeltern. Sie hatte die Spannungen zwischen ihrer Mutter und Oma erst viel später begriffen, als sie selbst schon nicht mehr nach Prerow fuhr. So blieb ihr die ungetrübte Erinnerung an eine wunderschöne Kindheit.
Aber heute in Prerow zu leben, das konnte sie sich beim besten Willen nicht vorstellen.
Trotz des herrlichen Sonnenscheins war die Luft noch kalt. Jennifer entschied sich für den grauen Hosenanzug und den blauen Kaschmirpullover.
Sie steckte das Haar mit Klammern fest nach oben und schminkte sich sorgfältig.
Sollte sie Stiefel anziehen? Ach was, so weit war es ja nicht, dachte sie und fuhr in die schwarzen Pumps. Sie war schon fast aus der Tür, als sie noch einmal kehrt machte und nach ihrem langen wollenen Schal griff und sich darin einkuschelte.
Eine halbe Stunde später stand sie vor dem Mehrfamilienhaus, in dem sie groß geworden war. Im Fenster hingen immer noch die selbst gehäkelten Gardinen, nur die beiden Turteltauben, die vor den Scheiben hin und her schaukelten waren neu.
Ihre Eltern nahmen sie ganz fest in die Arme, als sie die Wohnung betrat. Es bedurfte keiner weiteren Worte. Jennifer wollte nicht mehr über ihre gescheiterte Ehe sprechen und ihre Eltern akzeptierten das.
Ihre Mutter hatte nur vorwurfsvoll mit dem Kopf geschüttelt und ihr ungefragt die warmen Hausschuhe hingehalten. „Du wirst dir noch den Tod holen in diesen Trittchen. Bei diesen Temperaturen.“ Der Tadel fiel allerdings recht halbherzig aus. Sie hatte in ihrer Jugend selber nur solche Schuhe getragen. Sie konnten gar nicht elegant und hoch genug sein. Heute machten die Füße das nicht mehr mit.
In der Küche war es mollig warm. Es hatte sich in all den Jahren nichts verändert. Sogar das betagte Transistorradio spielte immer noch dieselbe Musik. „Der Blinden- und Sehschwachenverein gratuliert allen Einhundertfünfzigjährigen mit beliebten Liedern von Fred Frohberg und Co.“
Die Küchenmöbel waren uralt, aber blitzsauber geschrubbt. Jennifers Mutter gehörte zu den Frauen, denen man nachsagte, beim Saubermachen sogar die Fußleisten abzunehmen, um ja kein Staubkörnchen zu übersehen.
Jennifer schmunzelte, als sie sich an den Rat ihrer Mutter erinnert, bevor Rüdiger und sie ihren eigenen Hausstand gründeten. „Immer so viel, wie nötig, nicht wie möglich“, hatte sie gesagt, sich selbst aber nie daran gehalten.
Sie putzte eben gern. Sie empfand es nie als eine Belastung.
Jennifer teilte diese Begeisterung nicht, und so war es ihr leicht gefallen, ihren Rat zu befolgen.
Vor Jennifer dampfte der Cappuccino aus der Tasse und die Plätzchen verströmten ihren Vanilleduft im ganzen Raum. Auf dem Tisch stand ein kleiner Strauß gelber Rosen. Vati brachte immer Blumen vom Markt für Mutti mit.
„Erzähl, was gibt’s Neues“, ihr Vater griff beherzt in die Keksdose und stippte einen Stern mit Schokostreußeln in seinen Kaffee.
„Nun lass das Kind doch erst mal einen Schluck trinken“, ermahnte ihn seine Frau. „Sie wird schon reden.“
Jennifer lächelte. So verlief jeder Besuch bei ihren Eltern, und genau so liebte sie es.
„Ich fahre nach Prerow“, sagte sie und schlürfte vorsichtig ihren heißen Cappuccino.
Ihre Eltern sahen sie an, als hätte sie gerade verkündet, auf den Mond reisen zu wollen.
„Na, das ist ja eine Überraschung.“ Jennifers Vater beugte sich über seine Kaffeetasse und lächelte verschmitzt in sich hinein.
Ihre Mutter sagte nichts. Sie kniff die Lippen zusammen.
Immer noch quälten sie zu viele schlechte Erinnerungen an ihr Leben in Prerow. So lange ihre Schwiegereltern lebten, hatte sie gute Mine zum bösen Spiel gemacht und sie ein Mal im Jahr zusammen mit ihrem Mann besucht. Nach deren Tod wurden die Reisen nach Prerow immer seltener. Ihr Mann hatte im Schrebergarten seine neue Heimat gefunden und Prerow anscheinend nicht vermisst. Wozu sollten sie also noch dort hin fahren?
Sie konnte sich nicht erklären, warum es so war, aber ihr gefielen Jennifers Reisepläne nicht.
„He, Muttchen, mach nicht so ein Gesicht. Ich will nicht auswandern, ich mache nur ein paar Tage Urlaub“, Jennifer lachte und nahm ihre Mutter in den Arm. Sie wurde immer kleiner und zerbrechlicher.
Frau Scharmberg strich ihrer Tochter übers Haar und guckte besorgt. „Die Gene fordern ihr Recht. Ich hätte es wissen müssen, dass du eines Tages zurückgehst“, sagte sie leise wie zu sich selbst.
„Du tust ja gerade so, als wäre Prerow ein total unmögliches Reiseziel“, Jennifer lachte immer noch. „Wahrscheinlich werde ich nach drei Tagen wieder kommen, weil ich mich zu Tode langweile.“ Sie kniff nachdenklich die Augen zusammen. „Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendetwas zieht mich hin. Das will ich raus finden.“ Sie nahm die Hände ihrer Mutter und blickte ihr in die Augen. „Sag mal, ist da was dran, an dem Sturm am Meer, der einem die Seele frei pustet?“
Ihre Mutter drehte sich verschlossen zur Seite und schwieg, aber ihr Vater grinste nun breit über das ganze Gesicht. „Worauf du dich verlassen kannst, mein Mädchen“, er lehnte sich zufrieden zurück, „worauf du dich verlassen kannst.“
Er sah seine Frau liebevoll an. „Nun gib’s schon zu Rike, dir ging es doch damals genau so.“
Jennifers Mutter schob ihre Hand zu ihrem Mann rüber und nickte nun doch zaghaft mit dem Kopf. „Ja, der Sturm, der lässt oft seltsame Dinge geschehen.“
Sie verstanden sich ohne weitere Worte. Jennifer guckte fragend.
„Du wirst es erleben, Kind“, flüsterte ihre Mutter.
Würde sie ihre Jenny an Prerow verlieren? Sollte sie der Fluch ihrer Schwiegermutter nun doch noch einholen?
„Ja, da hat deine Mutter Recht. Wer weiß, was der Sturm mit dir anstellen wird.“
Jennifer griff nach einem dicken Schokoladenkeks. „Was sollte er mit mir schon anstellen? Was ist übrigens aus dem Haus geworden?“
„Nichts ist damit. Der alte Grell nebenan guckt immer mal nach dem Rechten. Aber viel los ist wohl nicht mehr damit. Es müsste allerhand dran gemacht werden.“ Jennifers Vater zog die Schultern hoch. „Wir hätten es schon hundert Mal verkaufen können, aber ich hab’s einfach nicht über’s Herz gebracht. Es ist dein Haus, Jenny. Für dich habe ich es behalten.“ Er lächelte wehmütig. „Vielleicht packt dich ja doch noch der Prerow-Virus?“
„Mich? Na, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Ich und Dorf, das ich nicht lache.“ Nein, das war das letzte, was Jennifer wollte.
„Nun, andere würden sonst was geben für ein Ferienhaus an der Ostsee“, meinte ihr Vater und guckte etwas gekränkt.
„Andere.“ Jennifer winkte abfällig ab. „Für eine Mütze voll Sturm brauche ich kein eigenes Haus. Ja, wenn das Haus in Nizza stehen würde.“
Sie entdeckte den verletzten Ausdruck in den Augen ihres Vaters und lenkte ein. „Andererseits, vielleicht ist es ja wirklich ganz schön.“
Sie hätte nie vermutet, dass er Prerow immer noch so sehr liebte.
War das grundsätzlich so, dass man für eine große Liebe eine andere aufgeben musste?
Mutti wollte sie überzeugen, zum Mittag zu bleiben, aber Jennifer musste noch einkaufen. Den Wochenmarkt hatte sie verpasst, also ab in den Supermarkt. Schließlich kamen heute Abend ihre Mädels, für die sie kochen wollte. Dem bevorstehenden Urlaub entsprechend wollte sie Fisch braten. Jennifer war eine recht gute Köchin, aber von Fisch hatte sie nicht viel Ahnung. Rüdiger aß grundsätzlich nichts, was aus dem Wasser kam, außer Enten natürlich. Aber so viel konnte da ja wohl nicht falsch zu machen sein.
Sie prüfte das Angebot in der Tiefkühltruhe. Gibt es in der Ostsee Thunfisch? Egal, bei mir gibt `s heute Abend welchen. Jennifer entschied sich noch für eine Variation von Salaten. Damit kannte sie sich aus.
Als Bea kam, hatte sie den Fisch schon in der Pfanne.
„He, der sieht hier auf der Packung aber dunkelrot aus, nicht weiß.“ Bea fuchtelte mit dem Karton vor Jennifers Nase herum. „Hast du überhaupt schon jemals Fisch gebraten? Oder sind wir deine Versuchskaninchen?“
„Na ja, nicht so direkt. Ich ekle mich vor rohem Fisch. Und wenn der mich womöglich noch mit seinen großen toten Augen anguckt, dann bin ich gleich satt. Darum habe ich die küchenfertige Variante genommen. Ich esse Fisch sonst immer nur im Restaurant.“ Jennifer versuchte, die Filets möglichst geschickt zu wenden. „Warum der nicht rot ist, weiß ich auch nicht.“
„Vielleicht wird der das erst, wenn er eine Weile gebraten wird?“ Bea verstand gar nichts vom Kochen.
Karin kam in die Küche. „Entschuldigt die Verspätung, Mädels. Ich weiß auch nicht, irgendwer hat mir in meiner Kindheit mal zwanzig Minuten geklaut, denen renne ich heute noch hinterher.“ Sie guckte den Freundinnen über die Schulter. „Den kannst du braten, bis er schwarz wird, aber rot wird er niemals. Das ist kein Thunfisch, das ist Seehecht. Da haben sie dir was Falsches in die Packung gemogelt.“ Sie war die Hausfrau in der Runde und konnte sich über die Unzulänglichkeiten ihrer Freundinnen in Sachen Küchenarbeit nur amüsieren.
„Nun“, Jennifer füllte den dunklen Rotwein in die Gläser, „das hat dann den Vorteil, dass er farblich sehr viel besser zum Wein passt. Prost.“
Karin nahm ihr Glas und stieß mit den Freundinnen an. „Ich bin ja froh, dass du uns so ein leichtes Essen servierst. Martin und ich sind nämlich auf Diät“, sagte sie scheinbar beiläufig und versuchte, ganz unbefangen zu wirken. „Keine Rundumtischmast mehr“, fügte sie dann aber doch schmerzverzerrt hinzu.
„Nein, das glaub ich nicht! Dickie-Schlaukopf auch?“ Bea riss die Augen weit auf und prustete los. „Hat da nicht vor ein paar Tagen gerade jemand was von ich liebe meinen Körper wie er ist und so weiter gesagt?“
„Na ja, wisst ihr“, Bea druckste ein wenig herum, „Martin und ich haben entsetzt feststellen müssen, dass viele unserer Sachen auf einmal zu körperbetont sitzen. Auf gut deutsch“, sie zog resigniert die Schultern hoch, „wir sind zu fett. Jetzt haben wir jeder eine Zielsetzungshose…“
„Eine was?“