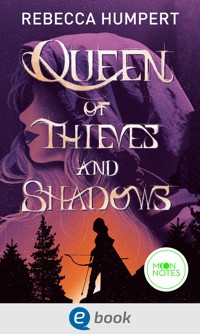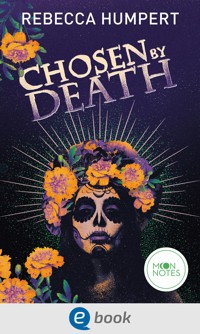
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine uralte Fehde verbietet ihnen, zusammen zu sein. Trotzdem erliegen sie einander. Einst von den Göttern verflucht, kann die 24-jährige Elena die Toten sehen – eine Bürde, die schwer auf ihr lastet. Die Seelen der Verstorbenen sind völlig entfesselt. Elena befürchtet, dass sie etwas mit den mysteriösen Todesfällen zu tun haben, von denen ihr Dorf heimgesucht wird. Als der attraktive, aztektische Gott Nan Elena erscheint, schließt sie widerwillig einen Pakt mit ihm, um ihre Gemeinde zu retten. So reist sie an seiner Seite ins Reich der Toten. An jenen Ort, an dem der Hass zwischen Menschen und Göttern geboren wurde. Doch Elena erkennt zu spät, dass sie dort unten nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz verlieren könnte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch
TWO SOULS IN DARKNESS
Eine uralte Fehde verbietet ihnen, zusammen zu sein. Trotzdem erliegen sie einander. Einst von den Göttern verflucht, kann die vierundzwanzigjährige Elena die Toten sehen – eine Bürde, die schwer auf ihr lastet. Die Seelen der Verstorbenen, denen eigentlich nur am Día de los muertos Zutritt ins Reich der Lebenden gestattet ist, sind bereits Monate zuvor völlig entfesselt. Elena befürchtet, dass sie etwas mit den mysteriösen Todesfällen zu tun haben, von denen ihr Dorf auf der Isla Mujeres heimgesucht wird.
Als der attraktive aztekische Gott Nan erscheint, schließt Elena widerwillig einen Pakt mit ihm, um ihre Gemeinde zu retten. An seiner Seite muss sie ins Reich der Toten reisen. An jenen Ort, an dem der Hass zwischen Menschen und Göttern geboren wurde. Doch Elena erkennt zu spät, dass sie dort unten nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz verlieren könnte …
1. Kapitel
Mit schwungvollen Strichen formte ich das Gesicht einer jungen Frau auf dem feinkörnigen Papier. Je länger ich zeichnete, desto kontrollierter wurde meine Hand, desto sorgsamer die tiefschwarzen Kohlestriche. Und desto skeptischer mein Blick.
Ich kniff ein Auge zusammen und neigte den Kopf leicht zur Seite. Irgendetwas stimmte nicht, aber ich konnte nicht genau sagen, was es war. Die Proportionen passten, trotzdem wirkte das Porträt steif und leer.
Seufzend band ich mein langes schwarzes Haar zurück, zerknüllte die Zeichnung und begann von vorn. Normalerweise fiel es mir leicht, das Markante eines Gesichts auf Papier zu bannen. Aber heute wollte es mir aus irgendeinem Grund nicht gelingen, die Seele der Frau einzufangen. Mein Blick glitt hinunter zu dem Namen, den ich hastig auf die Innenseite meines Blocks gekritzelt hatte.
Maria Villalobos.
Obwohl sie kaum mehr als eine Fremde gewesen war, erinnerte ich mich an ihr Gesicht. An die hohen Wangenknochen, die gerade Nase, die geschwungenen, vollen Lippen. Wann immer ich ihr begegnet war, hatte sie mir ein Lächeln geschenkt. Etwas, was nicht oft passiert war, zumindest nicht mir. Vielleicht fiel es mir deshalb so schwer, ihr Porträt anzufertigen. Es schmerzte, ein Lächeln einzufangen, das nicht länger existierte.
Meine Finger krampften sich um das Stück Kohle, während sich ein leichtes Ziehen in meinem Handgelenk ankündigte. Die dritte Zeichnung in dieser Woche.
Die dritte Tote innerhalb weniger Tage, die jung und kerngesund gewesen war. Ein Sterben, das hätte verhindert werden sollen. Jeder und jede Tote tat weh, aber in den letzten Wochen hatte ich eine Qual kennenlernen müssen, die ich nicht einmal meinen Feinden wünschte.
»Du verweilst zu oft bei den Verstorbenen, Elena de Jesús.«
Ich sah auf und entdeckte Marisol, die sich, auf ihren Gehstock gestützt, zu mir hinunterbeugte und meine Zeichnung betrachtete. Das hüftlange schneeweiße Haar der Dorfältesten war zu einem kunstvollen Zopf geflochten, der über ihre schmale Schulter fiel und das Papier streifte.
»Das ist schließlich mein Job, Abuela.« Marisol war nicht wirklich meine Großmutter, obwohl ich wünschte, sie wäre es. Wann immer es einen neuen Todesfall zu beklagen gab, war sie diejenige, die mir half, ein Grab auszuheben. Sie harrte die vier Tage mit mir aus, bis ich den Leichnam gemäß den alten Riten bestatten durfte, und sie besorgte das leuchtend orangefarbene Flor de muerto, um die letzten Ruhestätten mit seinen Blüten zu schmücken. Sie ließ mich nicht allein, während ich Körper um Körper begrub, die Totenwachen abhielt und die farbenfrohen Grabsteine bemalte. Während ich hoffte, dass die Verstorbenen ihren Frieden finden würden. In einem Dorf, das den Tod seit jeher fürchtete.
»Hör auf, mich so zu nennen, de Jesús«, brummte Marisol, setzte sich neben mich und lehnte ihre Gehhilfe an die Bank, die am Rande der runden Plaza Eterna stand. Sie warf mir einen finsteren Blick zu, die Arme empört vor der Brust verschränkt. »Ich komme mir dann immer so alt vor.«
Lächelnd beugte ich mich zu ihr hinüber und drückte einen Kuss auf ihr Haar. »Wird nicht wieder vorkommen.«
Ohne Vorwarnung griff Marisol nach meinem Block und riss ihn mir aus der Hand.
Ich wollte protestieren, aber ehe ich ein Wort über die Lippen bringen konnte, presste Abuela ihre schmale Hand auf meinen Mund. Die Dorfälteste warf einen enttäuschten Blick auf meine Zeichnung.
»Schon wieder nicht Alberto.« Sie blätterte durch meine Porträts auf der Suche nach dem verhärmten Gesicht jenes Mannes, der einst ihr Herz gebrochen hatte. Ich versuchte derweil mühsam, ihre Finger von meinem Gesicht zu lösen. Sie war definitiv stärker, als ihr vom Alter gebeugter Körper vermuten ließ.
»Ich hoffe für dich, dass ich noch erleben darf, wie du seine hässliche Visage zeichnest.«
»Alberto erfreut sich bester Gesundheit«, erklärte ich ihr kopfschüttelnd, konnte mir ein Lächeln jedoch nicht verkneifen. »Es wird gemunkelt, dass er die Hundert erreichen könnte, wenn er sein Fitnessprogramm weiterhin so konsequent durchzieht.«
Auf einmal lag eine so herzzerreißende Enttäuschung in Abuelas dunklen Augen, dass sie mir beinahe leidgetan hätte – wäre nicht ein eigennütziger Todeswunsch der Grund für ihre Emotion.
»Und wenn ich ihm ein Bein stellen muss, damit er sich beim Joggen das Genick bricht! Dafür würde ich mich sogar einbuchten lassen.« Sie tippte auf die leere Seite neben Marias mehr oder weniger schmeichelhaftem Abbild. »Das Plätzchen reserviere ich für ihn.« Ihr Blick glitt zu meiner neu begonnenen Skizze. »Nebenbei bemerkt ist Marias Nase viel zu groß. Sieht aus wie ein Rhino. Deine Skizzen werden auch immer schlampiger, de Jesús.«
»Ich liebe dich auch, Abu–«
Ich schaffte es gerade noch rechtzeitig, mich zu ducken und so vor der Krücke der Dorfältesten in Sicherheit zu bringen. Grinsend entwendete ich ihr meinen Block.
»Erinnerst du dich noch daran, was du mir damals versprochen hast?«, fragte Marisol plötzlich.
Ich hatte die Kohle gerade wieder auf dem Papier angesetzt, hielt nun jedoch inne. Obwohl beinahe vier Jahre verstrichen waren, seitdem sie mir jenes Versprechen abgenommen hatte, hafteten ihre Worte noch frisch in meinem Gedächtnis. Als ich antwortete, mied ich ihren Blick. »Natürlich.«
Einen Moment lang war es still, dann legte sie ihre Finger unter mein Kinn und zwang mich so, sie anzusehen. Ihr Gesicht war von zahllosen Falten durchzogen, die die Geschichten ihres langen Lebens erzählten. Von einer Frau, die beständiger war als jeder Fels, der die ungezähmte Küste der Isla Mujeres säumte.
»Das Leben hat noch mehr zu bieten, als sich bloß um die Toten zu kümmern, Elena.«
Erst, als Marisol meine linke Hand genommen hatte, fiel mir auf, dass ich mein Handgelenk geistesabwesend massiert hatte.
»Du überarbeitest dich.« Sie ließ mein Kinn los und begann mit zittrigen Fingern, mein notdürftig bandagiertes Handgelenk zu massieren. Meine Kehle zog sich zusammen. Ich musste dem Drang widerstehen, den Blick zu senken, damit sie nicht sah, wie sehr mich ihre kleinen Gesten berührten. »Und das für Menschen, die nie ein gutes Wort für dich übrig hatten.« Die Dorfälteste hielt inne, hob ihre freie Hand und presste sie auf meine Brust, dorthin, wo mein Herz schlug. Ihre Fingerspitzen streiften das runde roséfarbene Medaillon, dessen Inhalt nur sie kannte. »Warum?«
Nun wandte ich doch den Blick ab, damit sie nicht sah, wie sehr die Wahrheit in ihren Worten schmerzte.
»Im Tod sind wir alle gleich«, antwortete ich und versuchte, meine Stimme dabei möglichst ruhig klingen zu lassen. Den wahren Grund für meine Verbundenheit mit den Toten konnte ich selbst ihr nicht verraten. Schließlich sah ich sie wieder an. »Zumindest sagt Mateo das immer.«
Marisol musterte mich noch einige Sekunden lang schweigend, mit zusammengezogenen Augenbrauen und verhärteten Zügen. Ein letztes Mal strich sie sanft über mein verbundenes Handgelenk, dann kramte sie etwas aus dem bunten, von mir gehäkelten Beutel, den sie um ihre Schulter geschlungen hatte. Ich hatte das Symbol der Rebellen von Star Wars in das Muster mit eingearbeitet, eine Leidenschaft, die ich mit der Dorfältesten seit jeher teilte. Der Beutel harmonierte mit ihrem langen, farbenprächtigen Rock und der ebenso bunt bestickten Bluse. Zum Vorschein kam ein Stück Pan dulce.
Obwohl ich das süße Gebäck liebte, hatte ich gerade keinen wirklichen Appetit. Die Bilder von Marias leblosem Körper waren noch zu frisch. Trotzdem nahm ich es an, weil mein Bruder nicht genug von Marisols Pan dulce bekommen konnte. Ich würde es Mateo vorbeibringen, nachdem ich mit meiner Zeichnung fertig war.
»Wehe, du vergräbst noch eine dieser Kröten, bevor du nicht wenigstens ein Pan dulce gegessen hast. Mit vollem Magen brechen dir die schlaffen Körper schwerer das Kreuz.«
Ich verzog das Gesicht, während ich das Gebäck in meinem schwarzen, noch aus meinen Teenagertagen stammenden Darth Vader-Rucksack verstaute. »Dein Respekt für die Toten sucht seinesgleichen.«
»Oh, ich habe sehr viel Respekt vor den Toten. Aber nur, wenn sie sich zu Lebzeiten meinen Respekt verdient haben.« Marisol warf einen angewiderten Blick auf die niedrigen schneeweißen Häuser, die sich in einem Halbkreis an den Rand der sonnenüberfluteten Plaza Eterna schmiegten. Sie musterte das Dorf, dessen Oberhaupt sie seit mehr als vierzig Jahren war. »Unter uns gesagt: Die Welt wäre ohne dieses Drecksloch ein ganzes Stückchen heller, de Jesús.«
»Vermutlich«, antwortete ich. »Aber ohne das sonnige Gemüt unserer Dorfältesten wäre die Welt noch ein Stückchen dunkler.« Ich nickte in Richtung des einst goldfarbenen Brunnens in der Mitte der Plaza Eterna, wo sich eine Handvoll Kinder versammelt hatte. Sie tobten zwischen den zahllosen Sonnen und Monden umher, die auf den steinernen Boden des Marktplatzes eingraviert waren. »Dein Fanclub wartet übrigens schon seit einer halben Stunde auf dich.«
Marisol schnaubte. »Willst mir mit deinen Schmeicheleien wohl noch etwas Pan dulce aus den Rippen leiern, hm? Typisch de Jesús. Bist dir für nichts zu schade.« Grummelnd händigte sie mir ein weiteres Gebäckstück aus. »Verflucht sei meine verdammte Großherzigkeit.«
Hastig verstaute ich auch diese Süßigkeit, dann half ich Marisol, sich von der Bank hochzustemmen. Bevor sie sich zum Gehen wandte, tippte sie auf meinen Block, den ich aufgeschlagen neben mich gelegt hatte.
»Wenn ich das nächste Mal wieder keine gelungene Zeichnung von Alberto vorfinde, nehme ich die Sache selbst in die Hand.« Als wollte sie ihre Drohung untermauern, schwang sie ihre Krücke im hohen Bogen nach oben. Ich war mir nicht sicher, ob sie mich oder Alberto mit ihrer Gehhilfe ins Reich der Toten schicken wollte. Ich würde es nicht darauf anlegen, es herauszufinden.
»Seine Skizze wird sogar koloriert, nur für dich«, versprach ich also.
Ein aufgeregtes Funkeln stahl sich in die pechschwarzen Augen der alten Frau. Albertos Schutzengel sollte in den nächsten Tagen besser Überstunden schieben.
Schließlich wandte sich Marisol um und schritt zu den Kindern, die darauf warteten, von der Dorfältesten in Welten entführt zu werden, die jenseits der Grenzen unseres Dorfes, des Pueblo del sol y la luna, lagen. An Orte, die nie gewesen waren und die gerade deshalb einen Reiz innehatten, den die Realität niemals besitzen würde. Zumindest nicht auf dieser gottverdammten Insel.
Eine sanfte Berührung an meinem Arm ließ mich herumfahren. Mir gegenüber stand ein kleines Mädchen, das mir gerade einmal bis zur Taille reichte. Ihr dunkles, lockiges Haar war zu einem Zopf geflochten, und sie trug ein luftiges weißes Kleid. Strahlend hielt sie mir ein Körbchen entgegen.
Ich schenkte ihr ein warmes Lächeln. Mit ausgestrecktem Zeige-, Mittelfinger und Daumen führte ich meine linke Hand an meine Schläfe. Danach formte ich eine Faust, streckte den kleinen Finger ab, um dann wieder zur Faust zurückzukehren und abschließend den Daumen im rechten Winkel fortzustrecken.
Hola, Isa. Ich deutete auf den Korb. Was hast du da Schönes?
Das Mädchen stellte den Korb ab, griff hinein und zog einen kleinen, grün-roten, gehäkelten Vogel hervor. Sie legte den Quetzal in meinen Schoß, nahm meine Hand und streichelte ihn mit meinen Fingern. Jemand hat ihn mir letzte Nacht gebracht. Sie grinste mich an, während sie mir mit ihrer Hand hektisch von ihrem Fund berichtete. Warst du das, Elena?
Ich zwinkerte ihr zu. Natürlich nicht. Du weißt doch, dass ich zwei rechte Hände habe, wenn es um Handarbeit geht. Aufmunternd nickte ich in die Richtung von Marisol und den Kindern. Möchtest du dich zu ihnen setzen?
Isa schüttelte den Kopf. Das Mädchen hatte etwas an sich, das mir jedes Mal mein Herz wärmte, egal, wie kalt meine Finger von der Friedhofserde auch sein mochten. Im Vergleich zu den anderen Kindern des Dorfes, die mich mieden und Angst vor mir hatten, war Isabel anders. Sie hielt keinen Abstand zu der Frau, die die meiste Zeit zwischen Gräbern verbrachte und stets in Erde und den Geruch des Todes eingehüllt war. Des Öfteren leistete sie mir Gesellschaft, während ich zeichnete. Manchmal versuchte sie sich auch selbst an der Kohle. Es hat Jahre gedauert, bis ich mir eingestanden hatte, dass sich das Mädchen in mein Herz gestohlen hatte.
Auch jetzt beobachtete sie mich eine Weile dabei, wie ich an Marias Porträt feilte. Schließlich vertraute sie mir an, dass sie hoffte, nächsten Sonntag ein weißes Häschen-Kuscheltier in ihrem Korb vorzufinden, bevor sie davoneilte, den Vogel stolz an die Brust gepresst.
Ich konzentrierte mich erneut auf meine Zeichnung, ertappte mich aber dabei, wie mein Blick immer wieder zu den Kindern glitt, die gebannt an Marisols Lippen hingen. Die Dorfälteste erzählte gerade von jenem Sonnengott, der unsere Gemeinde gemeinsam mit dem Mondgott gegründet haben sollte. Unwillkürlich stahl sich ein Lächeln auf meine Lippen, als ich den Legenden lauschte, mit denen auch mein Bruder und ich aufgewachsen waren.
Bevor wir erfahren hatten, wer ich war. Bevor wir verstanden hatten, dass es kein Segen war, im Dorf eines Gottes zu leben.
Unwillkürlich hatte ich eine neue Seite in meinem Block aufgeschlagen und begann, den Gott anhand von Marisols Beschreibungen zu skizzieren. Es tat gut, wenigstens ab und an keine Toten zu zeichnen, sondern jemanden, den ich mehr als alles andere verachtete.
»Der Sonnengott Nanahuatl war angeblich der attraktivste aller Götter«, schwärmte Abuela, während sie sich mit einer Hand Luft zufächelte. »Und der selbstloseste. Als er sich dazu bereit erklärte, sich zu opfern, um den Menschen eine Sonne zu schenken, soll seine Haut kurz vor seinem Opfer sichelförmige Narben davongetragen haben. Diese machten ihn nur noch schöner. Sein Name wird auf alle Ewigkeit hin fortbestehen. Genauso wie der seines Bruders Metztli, der sich nach ihm geopfert hat, um den Menschen den Mond zu schenken.«
Dafür, dass es für Lebende beinahe unmöglich schien, sich Marisols Respekt zu verdienen, hatten Unsterbliche es anscheinend viel leichter. Sie wusste nichts von meiner Abneigung gegen die Götter, würde es nicht verstehen. Es sei denn, ich offenbarte ihr etwas, von dem ich geschworen hatte, es stets für mich zu behalten.
»Hat er unser Dorf dann gegründet, als er schon die Sonne war?«, fragte ein wild gelockter Junge namens Esteban.
»Die Frage meinst du nicht ernst, oder, Mijo?«, gab Marisol zurück. »Seit wann gründen Sonnen Dörfer?«
»Aber wenn er es davor gegründet hat, gab es doch noch keine Sonne. Dann muss unser Dorf ja uralt sein.«
»So sieht es doch auch aus, oder nicht? Ein klapprigeres Dorf wirst du nirgendwo finden«, erwiderte die Dorfälteste trocken.
Auf dem Block versah ich das Gesicht mit halbmondförmigen Narben, die meinen eigenen ähnelten. Machte die Augenbrauen buschiger, die Nase breiter. Nun glich es zwar immer noch dem Göttergesicht, das Marisol mit ihren schwärmerischen Worten skizziert hatte, aber hier und da war es menschlicher, weniger perfekt. Ich seufzte und blätterte zurück zu Marias Porträt. Zu menschlich für einen verdammten Gott.
Als ich noch einmal zum Brunnen sah, fiel mir eine Frau mit langem schwarzem Haar auf. Sie stand etwas abseits von den Kindern und lauschte scheinbar ebenfalls Marisols Geschichten. Der fließende Stoff ihres dunkelroten, mit gelben Blumen bestickten ärmellosen Huipil reichte bis zum Boden. In ihrem Blick, der starr auf die Gruppe gerichtet war, lag etwas Sehnsüchtiges. In ihren Zügen etwas Gebrochenes.
Ich wolle mich gerade abwenden, weil ich ungern Menschen beobachtete, die ihre Gefühle so deutlich zur Schau stellten, als ihr Blick den meinen fand.
Mein Atem stockte. Ungläubig musterte ich die Frau, die zu schön war, um sie auf Papier einzufangen. Ich sah hinunter zu der Zeichnung auf meinem Schoß, während mein Herz schmerzhaft gegen meine Brust pochte. Schließlich hatte ich es versucht.
Zögernd erhob ich mich und ging auf die Frau zu, die schweißnassen Finger um meinen Block gekrampft.
Ich musste mich irren, musste sie verwechseln. Eine andere Erklärung konnte es nicht geben. Aber je näher ich der Frau kam, desto leiser wurden meine Zweifel, bis sie schließlich völlig verstummten.
»Maria?«, flüsterte ich, in der Hoffnung, dass mich niemand außer ihr hörte. Nicht, dass es etwas ändern würde. Das ganze Dorf hielt mich für verrückt, viele spotteten über mich und nannten mich eine Hexe. Wenn sie nur wüssten, dass sie recht hatten. Wenn sie wüssten, dass in ihrer Mitte eine Admiradora de la muerte lebte, eine Frau, die die Toten sehen konnte, würden sie mich nicht nur verachten. Sie würden mich töten.
»Du bist zu früh«, sagte ich, meine Stimme brüchig.
Maria neigte den Kopf leicht zur Seite und musterte mich neugierig, doch von ihrem Lächeln, das ich so lieb gewonnen hatte, war keine Spur zu finden.
»Es ist noch nicht so weit«, fügte ich hinzu, als sie nichts erwiderte. Immer wieder huschte mein Blick hinüber zu Abuela und den Kindern. Bisher schien noch niemand bemerkt zu haben, dass ich verloren am Rande der Plaza stand. Weil der Großteil des Pueblo zu dieser Tageszeit seine Mittagsruhe hielt, um den gnadenlosen Sonnenstrahlen zu entgehen, beobachtete mich auch sonst niemand. Halt suchend lehnte ich mich an die Steinfassade eines Hauses, während ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen.
Plötzlich streckte Maria eine Hand aus. Verdammt. Reflexartig fasste ich an den geflochtenen Gürtel meines gelben, knöchellangen Kleides und tastete nach dem Bund Flor de muerto. Doch dann fiel mir schlagartig ein, dass ich die Blumen, die die Toten abschreckten, noch nicht bei mir trug. Ich befestigte sie immer erst am Morgen des letzten Oktobertages an meiner Kleidung, um für den Beginn des Día de los muertos gewappnet zu sein. Und gerade war es erst Anfang September.
Hastig wollte ich ausweichen, doch ich reagierte zu spät. Meinen Arm schoss ein stechender Schmerz hinauf, der dort seinen Ausgang nahm, wo Marias Finger meine Hand berührten. Sie richtete ihre Augen auf die Skizze ihres Gesichts, wobei ihre engelsgleichen Züge schmerzhaft verzerrt waren.
Ich kannte diesen Blick, hatte oft beobachtet, wie die herzzerreißende Erkenntnis darüber einsetzte, wer man einst gewesen war und was man durch den Tod verloren hatte. Denn auch wenn der Tod Körper raubte und Herzen brach – Erinnerungen stahl er nicht.
Ich biss die Zähne zusammen, hielt den Schmerz aus und wappnete mich gegen das, was tiefer brannte als jede Berührung, jeder Stich. Ein letztes Mal versuchte ich, meine Hand wegzuziehen. Aber es war zwecklos. Stattdessen blieb mir nichts anderes übrig, als die Augen zusammenzukneifen, zu hoffen, dass es schnell gehen würde. Dass die Tote nicht lange würde leiden müssen.
Als das Stechen in meiner Hand nachließ, öffnete ich vorsichtig ein Auge. Ein kleiner, naiver Teil von mir hatte gehofft, dass es diesmal anders sein würde, dass die Berührung von Leben und Tod keine Folgen haben würde. Gleichzeitig wusste ich, dass Hoffnung keinen Platz dort hatte, wo nur der Tod siegen konnte.
Ich hatte recht. Maria war fort. Ihre Seele würde nicht nach Mictlan, ins Reich der Toten, zurückkehren. Sie würde ihre eigentlich vierjährige Reise durch die Unterwelt auf der Suche nach ewigem Frieden nicht beenden. Denn Marias Seele gab es nicht länger. Admiradoras nannten es la Segunda muerte, denn die Toten starben in gewisser Weise ein zweites Mal, sobald sie einen Lebenden berührten. Während der erste Tod den Körper zu sich nahm, verschlang der zweite Tod die Seele.
Schwer atmend lehnte ich mich erneut gegen die Hauswand, spürte die raue, kühle Oberfläche der Steine an meinem Rücken. Schließlich fiel mein Blick dorthin, wo sich ein neuer, halbmondförmiger blutroter Strich auf meiner olivfarbenen Haut abzeichnete. Er gesellte sich zu zahllosen anderen Narben, die meinen Körper zierten. Vor allem an meinen Armen, wenige an den Händen. Früher hatte ich mich für diese Narben geschämt, hatte sie für eine Schwäche gehalten, die es zu verbergen galt. Mittlerweile versteckte ich sie noch immer, aber gleichzeitig dienten sie auch als Erinnerung an die Bürde, die die Götter mir auferlegt hatten. Als Beweis dafür, dass der Tod mich nicht hatte in die Knie zwingen können. Noch nicht.
»Sie sind fort, Mija.«
Marisols geflüsterte Worte holten mich aus meiner Starre. Mein Blick schnellte zu der Dorfältesten, die plötzlich vor mir stand. Sie hielt ein Stück Papier in der Hand, ihr Gesicht auf einmal totenblass, der Himmel über uns dunkler als zuvor. »Sie sind alle fort.«
2. Kapitel
»Es ist letzte Nacht passiert«, flüsterte Marisol, während wir den verlassenen, von der Nachmittagssonne erhitzten Marktplatz des Pueblo del agua betraten. Das Dorf lag nur wenige Minuten von unserem entfernt. Die Dörfer waren durch eine schmale Gasse zwischen Marisols Haus und unserem Rathaus miteinander verbunden. Das Pueblo del agua war für seine tiefblauen, überraschend modernen Häuser bekannt, die ebenfalls halbmondförmig um die Plaza angeordnet waren. Meine Zähne gruben sich unaufhörlich in meine Unterlippe, bis ich Blut schmeckte. Jedes dieser Häuser war nun verwaist. Und die Stille, die hier herrschte, war unheimlicher, als es ein Friedhof jemals sein könnte. »Der Tod hat sie letzte Nacht alle auf einmal zu sich geholt.«
Obwohl ich nicht überrascht sein sollte, fiel es mir immer noch schwer, die Wahrheit zu akzeptieren.
Mit zögerlichen Schritten näherte ich mich dem schlanken steinernen Torbogen, der an der gegenüberliegenden Seite der runden Plaza in die Höhe ragte. Doch es waren nicht die kunstvollen, wellenförmigen Eingravierungen, die meine Aufmerksamkeit auf sich zogen, sondern eine kleine, rechteckige Bronzetafel, die den Bogen zierte. Sie trug die Namen aller Dörfer, die unsere Insel ihr Zuhause nannten.
Ich presste mir die Hand auf den Mund, während ich die Tafel studierte, immer und immer wieder. Dabei spürte ich Marisols Präsenz hinter mir, aber ich wandte mich nicht um. Stattdessen streckte ich eine Hand aus und berührte den obersten Namen.
Pueblo de la noche, Tezcatlipoca.
Erst jetzt merkte ich, dass Blut von meinen Lippen auf meine Finger gelangt war. Blut, mit dem ich gerade den Namen des Dorfes samt den des Gottes, der jenes gegründet haben sollte, durchgestrichen hatte. Mit der Hand fuhr ich auch die restlichen Namen entlang, beschmierte sie mit Blut, ertränkte sie.
Pueblo de la vida, Quetzalcoatl.
Pueblo del cocodrilo, Cipactli.
Pueblo del agua, Tlaloc.
Mit den Fingern hielt ich inne, als ich den untersten Namen erreicht hatte. Diesen versah ich als einzigen nicht mit Blut.
Pueblo del sol y la luna, Nanahuatl y Metztli.
Einst beherbergte die Isla Mujeres fünf Dörfer. Zu der Zeit hatten wir Nachbarinnen und Nachbarn, waren eine große Gemeinde.
Ich ballte meine Hand zu einer Faust und schlug auf die Tafel ein, bis sich Schmerz in meine Knöchel fraß. Bis ich in die Knie gehen musste, weil ich es nicht verstand, es nicht verstehen wollte.
Seit dem heutigen Tage gab es auf der Insel nur noch ein einziges Dorf.
Ein Dorf, das nun ebenfalls im Sterben lag wie einst seine Brüder und Schwestern.
Ich kehrte jedes Mal an den Totenaltar meines Bruders zurück, nachdem jemand gestorben war. Die Zeiten, in denen die Toten unseres Dorfes geehrt worden waren, gehörten längst der Vergangenheit an. Selbst Abuela konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass es zu ihren Lebzeiten je Altäre für jeden Verstorbenen gegeben hatte. Aber ich musste einfach eine Ofrenda für Mateo errichten. Auch wenn die meisten Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner Halloween feierten und die Tradition des Día de los muertos größtenteils begraben hatten. Der Tod war etwas, was unser Dorf gern verdrängte. Vor allem jetzt, da er so nah war wie noch nie zuvor. Augenblicklich stahlen sich die Bilder der letzten Monate an die Oberfläche. Erinnerungen an unsere benachbarten Dörfer, die eines nach dem anderen gefallen waren. Es gab keinerlei Anzeichen für eine Seuche, aber mittlerweile schien das die logischste Begründung zu sein. Wie sonst sollte man erklären, dass vier Dörfer innerhalb eines Jahres komplett ausgestorben waren?
Mein Blick fiel auf den frischen Schnitt und die blutverschmierte Haut an meiner Hand. Zu der Sorge um die zahllosen, unerklärlichen Todesfälle mischte sich nun eine neue. Noch immer verstand ich nicht, warum Marias Seele so früh im Reich der Lebenden erschienen war. Sie war erst vor Kurzem gestorben. Ihre Seele hätte eigentlich die nächsten vier Jahre mit der Durchquerung der Unterwelt beschäftigt sein sollen, um ewigen Frieden zu finden. Erst danach war es ihr gestattet, das Reich der Lebenden wieder zu betreten, und das auch nur am Día de los muertos. Niemals davor, niemals danach. Ich presste meine blutige Hand dorthin, wo mein Herz viel zu schnell schlug. Und sie hatte auch nicht die typischen Spuren aufgewiesen, die ich von den Seelen Verstorbener kannte. Allen voran hatte das klaffende Loch in ihrer Brust gefehlt.
Hastig überquerte ich unsere menschenleere Plaza, hielt jedoch kurz inne, als ich den Torbogen erreicht hatte, der den Eingang zum Pueblo del sol y la luna markierte. Jedes Mal, wenn ich unter dem Bogen hindurchschritt, las ich die darin eingravierte Inschrift oberhalb unserer Bronzetafel, in der Hoffnung, sie endlich zu verstehen.
Mientras exista el pueblo del sol y la luna, habrá dioses. Links und rechts der Inschrift prangten eine Sonne und ein Halbmond.
»Solange das Pueblo del sol y la luna besteht, so lange werden die Götter fortbestehen.« Ich schüttelte den Kopf. Als ob sich die Götter für unser Dorf interessierten. Als ob sie sich für irgendjemanden außer sich selbst interessierten.
Schließlich kehrte ich dem Bogen den Rücken zu und eilte weiter.
Kaum, dass ich das Dorf verlassen hatte, breitete sich eine Ruhe in mir aus, die mich stets einhüllte, sobald ich fort von allem war. Sobald ich allein war. Allein mit den Seelen, die vergessen worden waren.
Ich hatte Mateos Ofrenda nahe der felsigen Klippe errichtet, die wenige Hundert Meter vom Dorf entfernt lag. Weil mein Bruder den Ausblick von hier so sehr genossen hatte.
Weil er davon geträumt hatte, die Insel eines Tages zu verlassen.
Und weil er hier gestorben war.
Ich krallte meine Finger um die Träger meines Rucksacks und versuchte, ruhig zu atmen. Mein Blick huschte zum Zentrum des Altars, zu dem leeren Holzrahmen, den ich mit Flor de muerto verziert hatte und der von Orangen und Bananen umringt war. Die Zeichnung, die dort hineingehörte, war immer noch nicht fertig. In mir gab es eine Blockade, sobald ich versuchte, das Gesicht meines Bruders auf dem feinkörnigen Papier zu verewigen. Vielleicht, weil es vollenden würde, was ich selbst nach fast vier Jahren noch nicht wirklich begreifen wollte. Weil es Mateos Tod eine Endgültigkeit verleihen würde, von der ich fürchtete, dass sie mich schließlich doch zerbrechen würde.
Ich kniete mich in den Schatten einer nahen Palme und vor den Totenaltar, klaubte etwas Flor de muerto zusammen und schob es in den Gürtel meines Kleides, direkt neben Mateos Taschenmesser. Die Toten hatten eine besondere Beziehung zu den orangefarbenen Blüten, fürchteten und liebten sie gleichermaßen. Wenn sie sie berührten, kehrten sie automatisch nach Mictlan zurück. Deshalb schmückte man Ofrendas und den Friedhof am Día de los muertos mit diesen Blüten. So gelangten die Toten nach Hause.
Als ich mich aufrichtete und einen Schritt nach hinten trat, glitt mein Blick hinunter, dorthin, wo die tiefblauen Wellen gegen die Klippe schlugen. Fast augenblicklich verschnellerte sich mein Atem. Ich schloss die Augen, versuchte, gleichmäßig Luft zu holen, aber scheiterte kläglich. Erinnerungen drängten sich in mein Bewusstsein, Stimmen, die Lügen erzählt hatten.
Er hatte keine Chance, Elena. Niemand überlebt einen Sturz aus dieser Höhe.
Es war ein Unfall, Mija.
Unwillkürlich war ich mit meinen zittrigen Fingern meine Brust hinaufgefahren, bis ich fand, wonach ich jede Nacht tastete. Wenn der Schlaf sich wieder einmal weigerte, mich zu betäuben.
Seit Mateos Tod suchte ich unaufhörlich nach Hinweisen, hielt nach einer Erklärung dafür Ausschau, wer meinen Bruder diese Klippe hinabgestoßen hatte.
Die Jahre waren seitdem quälend langsam vergangen, das Stechen in meiner Brust jedoch war geblieben. Ebenso wie das weiße, von Gold durchzogene Haar, das sich in meinem Medaillon befand. Auch wenn niemand daran glaubte, wusste ich, wem dieses Haar gehören musste. Ein Haar, das am Leichnam meines Bruders gefunden worden war. Ein Haar, das von demjenigen stammte, der Mateo de Jesús vor fast vier Jahren von dieser Klippe gestoßen hatte. Und weil die Toten aus irgendeinem Grund viel zu früh erwacht waren, war ich der Antwort so nah wie nie zuvor. Mateo würde mir meine Frage beantworten können, wenn er mir erschien, da war ich mir sicher. Und vielleicht würde ich ihn dann endlich loslassen können. Würde mein Versprechen Abuela gegenüber einlösen und dieses gottverdammte Dorf verlassen. Oder vielleicht würde ich losziehen und Rache nehmen, den Schmerz durch Hass betäuben. Vielleicht –
Plötzlich legte sich etwas Warmes um meine Taille und riss mich zurück.
Ich stieß einen erschrockenen Laut aus, während ich zurückgezerrt wurde, fort von der Klippe.
»Alles in Ordnung?«, murmelte eine dunkle, raue Stimme in mein Ohr. Ich sah hinunter und entdeckte eine Hand, die sich, verborgen in einem dunklen Lederhandschuh, auf meinen Bauch presste. Ohne nachzudenken, krallte ich meine Fingernägel in den schwarz gekleideten Arm und versuchte, mich aus dem eisernen Griff zu befreien.
»Lass mich los!«, schrie ich panisch und trat nach hinten. Ich hatte offenbar ein Schienbein erwischt, denn der Griff des Fremden lockerte sich, bis er schließlich ganz von mir abließ. Aber nicht, ohne mich von der Klippe fortgezerrt zu haben.
Ich stolperte ein paar Schritte nach vorn und wartete, bis sich mein Atem etwas beruhigt hatte. Dann wandte ich mich um, eine Hand an Mateos Messer. Niemand berührte mich ohne meine Erlaubnis.
Ich hatte erwartet, einem betrunkenen Dorfbewohner gegenüberzustehen, irgendjemandem, der keinerlei Hemmungen verspürte, von hinten über einsame Frauen herzufallen. Was ich nicht erwartet hatte, war echte Besorgnis, die das Gesicht des hochgewachsenen jungen Mannes zeichnete, der vor mir stand.
Er schien ein paar Jahre älter zu sein als ich, ich schätzte ihn auf etwa Ende zwanzig. Er war in eine schlichte schwarze Guayabera gekleidet, wobei das dünne Leinenhemd die breiten Schultern und den trainierten Oberkörper nicht verbarg. Dazu trug er eine einfache helle Stoffhose. Das dunkle, vom Wind zerzauste Haar reichte ihm bis knapp zur Schulter und verlieh ihm gemeinsam mit dem Dreitagebart etwas Wildes, Ungebändigtes. Aber es war nicht sein Haar, das mich einen Schritt zurückweichen ließ, sondern etwas in seinen beinahe schwarzen Augen. In ihnen stand die Aufforderung, ihm nicht zu nahe zu kommen. Trotz der Besorgnis in seinen Zügen.
»Atme«, sagte der Mann plötzlich.
Ich starrte ihn verwirrt an. Er ging etwas in die Knie, bis wir auf Augenhöhe waren, wahrte aber die Distanz, die ich zu ihm geschaffen hatte. Erst jetzt fielen mir die kleinen, halbmondförmigen Narben auf, die, kaum sichtbar, seine Stirn und Wangen zierten. Sofort musste ich an meine eigenen Narben denken, die eine ähnliche Form besaßen. Konnte es sein, dass dieser Mann auch von Toten berührt worden war?
»Atme«, wiederholte er. Dann tat er etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Er begann, geräuschvoll Luft ein- und auszustoßen, und bedeutete mir mit einer einladenden Handbewegung, es ihm gleichzutun.
Auf einmal wurde mir bewusst, dass mein Atem noch immer viel zu schnell ging, und auch mein Herz pochte hektisch gegen meine Brust.
Ich senkte den Blick auf meine Hände, die nach wie vor das Messer umklammert hielten, dann holte ich zitternd Luft und stieß sie langsam wieder aus. Dieses Prozedere wiederholte ich, bis ich in den Rhythmus des Fremden gefunden hatte. Bis wir im Einklang Luft einsogen und ausstießen.
Als ich den Blick hob, ertappte ich ihn dabei, wie er mit seinen Augen mein Gesicht entlangfuhr. Normalerweise hätte ich ihn darum gebeten, mich nicht anzustarren, aber es lag nichts Aufdringliches in seinem Blick, nichts, das Unbehagen in mir auslöste.
»Gracias«, sagte ich, als sich mein Atem einigermaßen beruhigt hatte.
Ein Mundwinkel des Mannes hob sich und deutete ein Lächeln an, das seine Augen nicht erreichte. »Nicht dafür, Señorita.«
Er richtete sich auf und trat einen Schritt zurück, dann lehnte er sich an den Stamm einer nahen Palme, die Arme vor der Brust verschränkt. Sein durchdringender Blick hatte von mir abgelassen und war nun stattdessen auf die Ofrenda gerichtet.
Ich begutachtete den Fremden, während ich mein Messer wieder an meinem Gürtel befestigte. In meinen Erinnerungen kramte ich nach seinem Gesicht, doch ich konnte mich nicht daran erinnern, ihn jemals zuvor in meinem oder einem der anderen Dörfer gesehen zu haben. Obwohl ich mich an alle Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner erinnerte, die toten und die lebenden. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass er kein völlig Fremder war. Irgendetwas regte sich in meinem Gedächtnis, aber ich konnte es nicht greifen, fand keinen Namen zu seinem Gesicht.
»Es ist nicht einfach, nicht wahr?«, fragte der Mann auf einmal, seine dunkle Stimme kaum mehr als ein Flüstern.
Ich hob eine Augenbraue. »Was ist nicht einfach?«
Sein Blick war nach wie vor auf den Altar gerichtet. »Die Toten loszulassen.«
Schweigend musterte ich das strahlend orangefarbene Flor de muerto, das ich jeden Tag erneuerte. In der Hoffnung, dass das Stechen in meiner Brust irgendwann nachlassen würde.
»Nein«, antwortete ich schließlich. »Das ist es nicht.«
»Besonders nicht für eine Totengräberin.«
Ich war gerade dabei, Marisols Pan dulce aus meinem Rucksack zu kramen, um es zwischen das Obst auf den Altar zu legen, hielt jedoch mitten in der Bewegung inne.
»Ich bin keine Totengräberin.« Ich wusste selbst nicht genau, warum ich log. Vielleicht, weil ich die Scham über meine Arbeit doch noch nicht hatte ersticken können.
Der Fremde hatte seinen Blick von den Opfergaben gelöst und musterte mich wieder, eindringlicher als zuvor. »Das ist sehr schade. Es ist ein sehr ehrenvoller Beruf, sich um die Toten zu kümmern.«
»Was möchtest du von einem Totengräber?«, fragte ich hastig, bevor er weitere Vermutungen anstellen konnte, die möglicherweise ebenfalls der Wahrheit entsprachen. War er vom Festland? Aber warum sollte er dann auf einer abgelegenen Insel wie der unsrigen nach einem Totengräber suchen? Oder hatte es einen weiteren Todesfall in meinem Dorf gegeben? Dann hätte Marisol mir sicherlich längst Bescheid gegeben.
»Das wird er erfahren, wenn er sich bei mir melden sollte.«
Bildete ich es mir ein oder waren seine Augen einen Hauch dunkler als noch vor einem Moment?
Meine Finger krampften sich ein letztes Mal um das Gebäck, dann legte ich es neben eine Orange. »Ich kenne ihn. Wenn du möchtest, werde ich ihm ausrichten, dass seine Dienste benötigt werden.« Ich nickte in Richtung des Friedhofes, dessen Umrisse sich gegen die langsam untergehende Blutsonne abzeichneten. Er war etwas abseits des Dorfes errichtet worden, damit die Toten in Frieden ruhen konnten. »Meine … Ich meine, seine Preise findest du am Eingangstor.« Ich nahm nicht viel, meistens gar nichts. Unser Dorf lebte von Touristen, angelockt von den malerischen Stränden. Doch sie waren in letzter Zeit ausgeblieben, weshalb die finanziellen Mittel vieler Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner begrenzt waren. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass die Todesfälle etwas mit dem schwindenden Interesse an der Isla Mujeres zu tun hatten. Mittlerweile musste es sich auch auf dem Festland herumgesprochen haben, dass wir wohl oder übel verflucht waren.
Ein wissendes Lächeln umspielte die Lippen des Fremden. »Ich benötige seine Dienste nicht, Señorita. Ich habe nur eine Frage an ihn.« Sein durchdringender Blick glitt an mir herunter und auf einmal war mir bewusst, wie viel Erde noch an meiner Kleidung klebte. »Oder sie.«
Er glaubte mir kein Wort. Ich konnte es ihm nicht verübeln. So sauber die Gräber waren, die ich aushob, so miserabel waren meine Lügen. Aber bei den Göttern, warum musste er mich so anstarren?
Der Mann stieß sich schließlich vom Stamm der Palme ab und deutete eine knappe Verbeugung an.
»Darf ich dich um etwas bitten?«
Meine Finger streiften den Schaft meines Messers. »Es kommt darauf an, um was.«
»Halte dich von der Klippe fern.«
Das war eine Bitte, die ich nicht einmal Abuela erfüllen würde. Auch wenn mir an diesem Ort mein Bruder genommen worden war, auch wenn der Anblick der fernen Wasseroberfläche meinen Atem erschwerte, fühlte ich mich ihm hier näher als sonst irgendwo. Meine Ängste lauerten jenseits der Klippe, unter ihr. Nicht hier oben. »Das kann ich nicht versprechen.«
Der Abendwind blies mir eine Strähne in die Stirn, die sich aus dem langen Zopf gelöst hatte, den Marisol mir nach unserem bedrückenden Besuch des Pueblo del agua geflochten hatte. Der Fremde trat einen Schritt näher und streckte eine Hand aus, als wollte er die Strähne zurückstreichen. Unwillkürlich zuckte ich zusammen, noch ehe er mich berührt hatte. Hastig strich ich mir das lose Haar selbst hinters Ohr.
»Du bist nicht von –« Der Rest der Frage blieb mir im Hals stecken, als ich den starren Blick des Mannes bemerkte, der nicht auf mich, sondern auf etwas hinter mir gerichtet war.
Noch bevor ich mich umdrehte, ahnte ich, was ich dort vorfinden würde. Und hoffte, dass es mein Bruder war.
Aber es war nicht Mateo.
Ich konnte mich nicht mehr an seinen Namen erinnern, doch das eingefallene Gesicht des Toten, der etwas abseits an der Klippe entlangstrich, war mir im Gedächtnis geblieben. Er war letztes Jahr gestorben. Ich schluckte schwer. Maria war also keine Ausnahme gewesen. Die Seelen waren viel zu früh zurückgekehrt und wiesen nicht die typischen Spuren ihrer Reise durch die Unterwelt auf. Und ich wusste immer noch nicht, wieso.
Als ich einen Blick über die Schulter warf, war der Fremde verschwunden. Doch die Erinnerung an seinen starren Gesichtsausdruck blieb. Er hatte einen Toten gesehen, den außer mir niemand sehen dürfte.
Auf einmal spürte ich, wie etwas Warmes meine Finger hinunterlief. Leise fluchend musterte ich den sichelförmigen Schnitt auf meinem Handrücken, der wieder angefangen hatte, zu bluten. Hastig kramte ich den Block aus meinem Rucksack, riss ein Blatt heraus und wischte damit über meine Haut, weil meine Kleidung zu schmutzig war. Ich beobachtete das Blut dabei, wie es sich durch die Papierfasern fraß, das reine Weiß durchtränkte. Aber es war nicht mein Blut, das meine Aufmerksamkeit auf sich zog, sondern etwas, was sich in der Mitte des Papiers befand. Sofort glättete ich das Blatt, so gut es ging. Meine Finger zitterten, während ich die Zeichnung musterte, die trotz des Blutes immer noch gut zu erkennen war.
Mir stockte der Atem. Deshalb war mir das Gesicht des Mannes bekannt vorgekommen, obwohl ich ihn noch nie zuvor getroffen hatte. Und doch hatte ich es. In Abuelas Geschichten.
Mein Blick glitt zu der Palme, an der der Fremde bis vor wenigen Augenblicken noch gelehnt hatte. Dann betrachtete ich die Zeichnung erneut, die Nanahuatl zeigen sollte. Jenen Unsterblichen, der sich einst geopfert hatte, um den Menschen die Sonne zu schenken.
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, dass ich gerade die Bekanntschaft eines Gottes gemacht hatte.
Eines Gottes, der nicht mehr existieren dürfte.
3. Kapitel
»Litt sie an irgendeiner Krankheit?« Ich nahm die bereits erkaltete Hand der Bäckerstochter. Sie war nur ein paar Jahre älter als ich gewesen. Das schmale blasse Gesicht zeugte von langen Arbeitsstunden in der Bäckerei. »Körperlich oder seelisch?«
Der Bäcker, ein schlanker Amerikaner, der noch nicht lange hier lebte, schüttelte den Kopf. Er war sichtlich darum bemüht, die Tränen zurückzuhalten. Ich wünschte, er würde weinen und sich nicht dafür schämen, zu trauern.
Er trat auf mich zu und hielt mir eine Handvoll Pesos entgegen. »Das Geschäft läuft nicht gut«, sagte er entschuldigend.
Ich schüttelte den Kopf. »Behalten Sie Ihr Geld.« Bisher hatte ich für keinen der plötzlichen Todesfälle Geld angenommen, und ich würde jetzt nicht damit anfangen. Für das kleine Häuschen, das jedem Totengräber und jeder Totengräberin für die Dauer des Dienstes als Unterkunft diente, zahlte ich keine Miete. Marisol und ich aßen außerdem meist gemeinsam, weshalb ich nicht viele Pesos benötigte, um zu überleben.
»So kann es nicht weitergehen.« Marisols Stimme klang brüchiger als gewöhnlich. Ein flüchtiger Blick in ihre Richtung verriet, dass auch sie mit den Tränen kämpfte. Die Dorfälteste saß auf einem niedrigen Stuhl im dürftig beleuchteten Hinterzimmer der Inselpraxis. »Es muss doch etwas geben, was diese Todesfälle erklärt. Eine Seuche, ein irrer Serienkiller, irgendetwas.«
Miguel schüttelte seufzend den Kopf. Erst letztes Jahr hatte er als jüngster Arzt in der Geschichte der Isla Mujeres die Dorfpraxis übernommen. Die dunklen Ringe unter seinen kupferfarbenen Augen und die zerzausten dunkelbraunen Locken zeugten von zahllosen schlaflosen Nächten.
»So etwas habe ich noch nie gesehen.« Miguel kniete sich neben mich und strich der Toten eine dunkle Strähne aus der Stirn, so vorsichtig, als fürchtete er, sie aufzuwecken. »Keiner von ihnen weist äußerliche Verletzungen auf, und auch auf andere Krankheiten gibt es keine Hinweise, weder bei unseren Toten noch bei denen der anderen Dörfer. Meine Vermutung ist, dass sie alle an einem plötzlichen Herzstillstand gestorben sind.«
»Aber sie sind alle noch so jung«, flüsterte ich, den Blick auf das reglose Gesicht der jungen Frau gerichtet. »Und so … so gesund.«
Das gedämpfte Schluchzen des Bäckers brach mir das Herz.
Zögerlich wandte ich mich an Miguel. »Könnten sich die Verstorbenen selbst etwas angetan haben?« Ich brachte die Frage kaum über die Lippen.
Er schwieg einen Moment und musterte die Leiche wie eine Gleichung, die keine Lösung besaß. »Möglich wäre es, aber das halte ich eher für unwahrscheinlich bei der Masse an Todesfällen. Ich habe in den letzten Wochen weder Schmerz- noch Schlafmittel verschrieben. Außerdem weisen die Blutproben, die ich bisher entnommen habe, keinerlei Substanzen auf, die einen umbringen könnten.«
Miguel schien noch etwas sagen zu wollen, doch im nächsten Moment ertönte ein kehliges Husten, das mich herumfahren ließ. Mein Blick schnellte zu Abuela, die eine Hand auf den Mund gepresst hatte. Mit der anderen hielt sie ihren Inhalator. Verdammt. Sie hatte mir erst neulich erklärt, dass ihre Hustenattacken viel seltener geworden seien. Sofort erhob ich mich und eilte zu ihr, doch bevor ich sie erreicht hatte, spürte ich, wie sich meine Brust zusammenzog. Mein Atem wurde schwerer, wie er es seit Mateos Tod häufig tat, nachdem ich dem Wasser nahe gewesen war. Manchmal kam die Atemnot jedoch auch ganz plötzlich, ohne Vorwarnung. Und mit ihr eine Panik, die mich gefangen nahm.
Nicht jetzt. Bitte nicht jetzt.
Marisol packte meinen Arm und zog mich herunter, bis wir auf Augenhöhe waren. »Gib mir deine Schlüssel, de Jesús«, knurrte sie. »Du gehst mir heute früh ins Bett.« Getrocknete Tränen zeichneten ihre Wangen, und ich hatte Mühe, dem Drang zu widerstehen, an ihrer Schulter zusammenzusinken. Aber ich musste raus, brauchte frische Luft. »Du siehst aus, als hättest du seit Tagen nicht mehr anständig geschlafen.«
»Ich –«
»Keine Widerworte. Gib mir deine Schlüssel. Ich kümmere mich heute Abend um die Toten.«
Nach kurzem Zögern zog ich den Schlüssel zum Friedhofstor aus der Vordertasche meiner Jeans und übergab ihn der Dorfältesten.
»Ist dein Husten schlimmer geworden?« Ich deutete auf den Inhalator in ihrer Hand und bemühte mich darum, mir meine eigene Atemnot nicht anmerken zu lassen. Doch Marisol konnte ich nicht täuschen.
Sie winkte ab und gab mir einen Schubs Richtung Tür.
Hastig verabschiedete ich mich von dem Bäcker und Miguel, warf einen letzten, wehmütigen Blick auf die junge Frau, die niemals mehr Atem holen durfte. Dann stolperte ich durch das angrenzende Behandlungszimmer hinaus auf die sonnengetränkte Terrasse der Praxis. Mit zitternden Händen suchte ich am Geländer Halt und klammerte mich daran fest, während Schweiß meine Stirn hinabtropfte und mein Herz raste, als hätte ich einen Marathon hinter mir. Die Angst ließ als Erstes nach, der Schweiß trocknete, doch die Schwere meines Atems blieb.
Unwillkürlich musste ich an jene seltsame Begegnung mit dem Fremden vor wenigen Tagen zurückdenken, der mit mir geatmet hatte. Mittlerweile war ich mir sicher, dass ich mir die Ähnlichkeit zu Marisols Götterbeschreibung nur eingebildet hatte. Eine andere Erklärung konnte es schließlich nicht geben. Ich schloss die Augen und versuchte, meinen Atem weiter zu beruhigen, während die Nachmittagssonne meine von der Arbeit steifen Glieder wärmte. Es dauerte etwas länger als letztes Mal, aber schließlich normalisierte sich mein Atem.
»Elena?«
Als ich die Augen öffnete und zur Seite sah, entdeckte ich Miguels besorgtes Gesicht, das er zu mir herunterneigte.
»Ist alles in Ordnung?«
Ich zwang mich zu einem Lächeln und nickte.
Als ich mich an ihm vorbeischieben wollte, fand seine Hand meine und zog mich in eine Umarmung. Ich war so erschrocken, dass ich nur steif dastand, bis meine Muskeln sich irgendwann entspannten und ich die Berührung zuließ. Wir hatten früher oft mit Mateo zusammengesessen, zusammen gelacht, waren gute Freunde gewesen. Seitdem er fort war, half Miguel mir gelegentlich beim Ausheben, Richten und Pflegen der Gräber, während ich ihn in seiner Praxis unterstützte. Erst hatte ich geglaubt, dass Mateos Tod auch unsere Freundschaft zerrissen hatte. Aber nach einer Weile wurde mir klar, dass der Verlust uns beide nur noch enger zusammengeschweißt hatte.
Weil ein Arzt ihm einst das Leben gerettet hatte, hatte Miguel es sich zur Aufgabe gemacht, dasselbe für andere zu tun. In der Art, wie er die Leichen der vergangenen Wochen gemustert hatte, konnte ich sehen, dass er sich Vorwürfe machte. Dass er glaubte, sie hätte retten zu können.
Die Toten waren unser beider Bürde.
Als sich eine seiner Hände in mein offenes Haar verirrte, lehnte ich mich automatisch tiefer in seine Umarmung, atmete den intensiven Duft nach Kräutern ein, den ich bisher nie wahrgenommen hatte. Nur für einen kurzen Moment wollte ich vergessen, wollte Abstand vom Tod, wollte leben.
Plötzlich beschlich mich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich spähte über Miguels Schulter – und entdeckte die hochgewachsene Silhouette eines Mannes, die einige Schritte entfernt an einer Hauswand lehnte, beinahe verschluckt vom Schatten der Fassade.
Hastig löste ich mich aus Miguels Armen, doch als ich noch einmal nach dem Mann suchte, war er verschwunden. Das Gefühl, beobachtet zu werden, verschwand jedoch nicht.
Während die kupferfarbene Abendsonne die Isla Mujeres mit ihren letzten Strahlen erwärmte, grub ich meine Hände in die Friedhofserde und genoss die kühle Linderung, die sie mir verschaffte. Mein Blick glitt über die vorderste Reihe steinerner, farbenfroher Särge, die die Toten der vergangenen Woche beherbergten. Der Vorrat an Grabsteinen wurde spärlicher, und die Anlieferung neuer Steine vom Festland, die Marisol beauftragt hatte, verzögerte sich aus unerklärlichen Gründen immer weiter. Ich musterte den nahen pastellblauen Grabstein, der wie ein kleines Häuschen geformt war. Hastig hatte ich ihn mit Malereien und dem Namen der Bäckerstochter verziert, ehe Miguel und ich ihn in der Erde platziert hatten. In Anlehnung an die vier Jahre, die die Reise durch die Unterwelt Mictlan währte, wartete ich stets vier Tage, bis ich die Toten bestattete, begleitet von einer einsamen Totenwache, der höchstens die engsten Familienmitglieder beiwohnten. Der Rest des Dorfes interessierte sich nicht für die Toten anderer Familien. Auch das traditionelle Novenario, die neuntägige Trauerzeit nach dem Tag der Beerdigung, wurde auf unserer Insel nie zelebriert. Ich hatte es anfangs getan, aber mittlerweile fehlte mir dazu die Kraft. Marisol zog mich manchmal damit auf, dass ich mich an Traditionen klammerte, die schon lange vergessen waren. Dass ich der Toten gedachte, die nicht mein eigen Fleisch und Blut waren.
Seit Monaten zerbrach ich mir den Kopf über eine mögliche Erklärung für all das hier. Versuchte, mir einen Reim darauf zu machen, warum sich der Tod die Isla Mujeres, die von Einheimischen auch gerne die Isla Eterna genannt wurde, als Opfer ausgewählt hatte. Eine Insel, die dem Namen nach ewig bestehen sollte, genau wie die Götter, die die Dörfer auf ihr angeblich einst gegründet hatten.
Verdammt, warum dachte ich schon wieder an Götter? Leise fluchend zog ich meine Hände aus der kühlen Erde und wischte sie an meiner Jeans ab. Ich hatte in den letzten Tagen noch nicht einmal die Zeit gefunden, weiter Ausschau nach Mateo zu halten. Nach wie vor begegnete ich Toten, die viel zu früh in unserer Welt erschienen waren, aber ich nahm sie kaum noch wahr. Erschöpfung drückte mich nieder. Obwohl ich versuchte, meine Arbeit nicht zu sehr an mich herankommen zu lassen, zerbrach sie mich mit jedem Körper, den ich begrub, ein Stück mehr.
Seufzend richtete ich mich schließlich auf und entdeckte Isabel, die ein Stück von mir entfernt auf der Erde kauerte. Vor dem Grab, das ich vor wenigen Tagen für ihren Vater hatte ausheben müssen. Ich hatte ihn kaum gekannt, trotzdem traf mich sein Ableben. Vor allem für seine fünfjährige Tochter, die nun niemanden mehr hatte. Camillo Flores hatte viel zu früh gehen müssen. Wieder jemand, dessen Tod nicht hätte sein dürfen.
Als ich mich neben das Mädchen kniete, zuckte es zusammen und sah mich erschrocken an. Isas dunkle Augen waren geweitet und gerötet, ihre schwarzen, schulterlangen Locken vom abendlichen Wind zerzaust. In den Händen hielt sie ein Handy, dessen Display zerbrochen war und das einst Camillo gehört haben musste. Mit ihren sanften Zügen war sie ein Ebenbild des Mannes, den ich gezeichnet hatte, so wie ich es mit allen Toten unseres Dorfes zu tun pflegte. Ich wusste selbst nicht genau, warum ich es tat. Vor vielen Jahren hatte ich damit begonnen und nicht mehr aufgehört. Vielleicht war es meine Art, ihnen die letzte Ehre zu erweisen. Vielleicht verarbeitete ich damit für mich die Tode, die so viel mehr waren als nur mein Beruf.
Möchtest du deinem Papá ein paar Blumen schenken?, fragte ich lächelnd.
Die Kleine nickte eifrig und legte das Handy beiseite. Vorsichtig entfernte ich eine Handvoll Flor de muerto von meinem Gürtel und half ihr dabei, das Grab damit zu verzieren.
Ich vermisse Papá, flüsterten Isas Hände.
Behutsam streckte ich eine Hand aus und fuhr ihr damit übers Haar. Er vermisst dich sicherlich auch, Isa.
Er kann mich nicht vermissen, widersprach sie. Er ist tot.
Das ändert nichts daran, dass er dich noch immer liebt. Meine Hände verharrten kurz in der Luft, während sie nach Worten suchten, die Isas Schmerz lindern könnten. Der Tod ist nicht das Ende, Mija.
Das Mädchen schwieg für einen Moment und krallte die Finger wieder um das Handy.
Wird es immer so wehtun?
Das Gleiche hatte ich Marisol vor vier Jahren gefragt, kurz nach Mateos Tod. Ich hatte nichts mehr gegessen, war nicht zur Arbeit erschienen. Es hatte alles so wehgetan, gleichzeitig war ich wie taub gewesen, hatte befürchtet, nie wieder etwas fühlen und wirklich leben zu können. Ich wiederholte die Worte, die Abuela mir damals zugeflüstert hatte, gab sie weiter an das Mädchen, in der Hoffnung, dass es sich an ihnen festhalten konnte.
Das wird es. Ich schluckte die Tränen hinunter, die einen Kloß in meinem Hals bildeten. Manchmal weiß man nicht mehr, wie man weitermachen soll, wenn jemand Geliebtes gegangen ist. Oft existiert man nur noch und lebt nicht mehr.
Das hatte ich selbst schmerzlich erfahren müssen. Ich existierte, um die Toten zu ehren, um das Schicksal meines Bruders aufzuklären. Um auf Marisol aufzupassen, sie nicht auch noch zu verlieren. Mein Wille, zu leben, war mit Mateos Tod gebrochen worden.
Der Schmerz wird immer da sein, aber aus seiner Asche wird irgendwann wieder etwas Wunderschönes wachsen. Du musst der Sache nur Zeit geben. Ich beugte mich nach vorn und pflückte eine orangefarbene Blüte von der Erde, die ich in die Locken des Mädchens steckte. Dann nahm ich ihm vorsichtig das Handy aus der Hand. Erst jetzt sah ich, dass es sich an dem zersplitterten Displayglas geschnitten hatte. Hastig legte ich das Handy neben mich, kramte ein sauberes Taschentuch aus meiner Jeans und begann, die blutigen Kinderfinger zu säubern. Mir entging nicht, dass Isa die Narben auf meinen Handrücken anstarrte, obwohl sie sie schon längst kannte. Die tieferen Narben wurden von den langen Ärmeln meiner Bluse verdeckt. Trotz des warmen Wetters trug ich immer langärmlige Kleider und Blusen. Wahrscheinlich schämte ich mich mehr für meine Narben, als ich mir eingestehen wollte.
Kannst du einen Altar für Papá bauen, Elena?, fragte Isa, als ich ihre Hände losgelassen hatte. Ihr Blick wanderte zu dem Grab ihres Vaters. Ich will nicht, dass er glaubt, ich hätte ihn vergessen.
Gerade als ich etwas erwidern wollte, hörte ich schlurfende Schritte hinter mir und wandte mich um.
Ein Mann mittleren Alters streifte zwischen den Grabsteinen umher. Es passierte sehr selten, dass ich jemandem außer Marisol oder Miguel auf dem Friedhof begegnete, und selbst wenn, dann gingen mir die Besuchenden meist aus dem Weg.
Ich hob eine Hand zur Begrüßung. Ich redete nicht viel mit dem Mann, kannte noch nicht einmal seinen Namen, wusste aber, dass er hier des Öfteren Zuflucht suchte. Er besaß aus unerfindlichen Gründen keinen festen Wohnsitz, deshalb ließ ich ihn in dem kleinen Wärterhäuschen übernachten, wann immer er mich darum bat. Manchmal saßen wir schweigend nebeneinander, nachdem ich ein Grab ausgehoben hatte, und hingen unseren Gedanken nach. Ab und an steckte ich ihm etwas von Marisols Pan dulce zu, für das er sich stets mit einem strahlenden Lächeln bedankte. Wir waren weder Freunde noch Feinde, sondern etwas dazwischen, für das es keinen Namen gab.
Aber es war nicht der Namenlose, der mich plötzlich erstarren ließ, sondern das Auftauchen der schlanken Gestalt, die wenige Schritte hinter dem Mann ging. Ein Ebenbild der Zeichnung, die ich für ihn angefertigt hatte: Camillo Flores.
Das konnte nicht sein. Bitte nicht.
Ich wollte etwas rufen, irgendetwas, aber mir blieben die Worte im Hals stecken. Keine Sekunde später streckte Camillo eine Hand aus und legte sie in den Nacken des Namenlosen.
Verzweifelt wappnete ich mich dafür, gleich mit ansehen zu müssen, wie sich Camillo auflösen würde, wie sich seine Seele in Anwesenheit seiner Tochter für immer verlieren würde. Doch das geschah nicht. Camillo verschwand nicht.
Als der namenlose Mann plötzlich zu Boden ging und zu den Füßen des Toten bewegungslos liegen blieb, dachte ich, er würde gleich wieder aufstehen. Schließlich war die Berührung der Toten für Lebende nicht gefährlich.
Doch das tat er nicht.
Ich presste mir eine Hand auf den Mund, biss in meine Haut, als ich verstand, was geschehen war.
Camillos starrer Blick fuhr über die Grabsteine, bis er an mir hängen blieb. Er war blasser als die anderen Toten, die Haut beinahe durchsichtig. Seine Lippen verzogen sich zu einem grausamen Lächeln, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er warf einen letzten Blick auf den reglosen Mann zu seinen Füßen, dessen glasige Augen ins Leere starrten. Ich musste nicht nach seinem Puls tasten, um zu wissen, dass er tot war.
Getötet durch unsichtbare Hand. Zumindest sah es so aus – für jene, die nicht wie ich dazu imstande waren, die Toten zu sehen. Für gewöhnliche Menschen gab es an dieser Leiche keine Wunde, keinen Hinweis auf die Todesursache.
Für mich war er jedoch ermordet worden. Von einer Seele, die Mictlan viel zu früh verlassen hatte. Von der Berührung eines Toten, obwohl das keinen Sinn ergab.
Meine Zähne gruben sich tiefer in meine Hand, bis sich ein metallischer Geschmack in meinem Mund ausbreitete. Wenn mich nicht alles täuschte, hatte ich gerade herausgefunden, wer für die unerklärlichen Todesfälle auf der Isla Mujeres verantwortlich war.
Camillo bückte sich und hob eine orangefarbene Blüte auf, die sich wohl aus der Hemdtasche des Mannes gelöst hatte. Dann warf er sie wieder zu Boden. Mein Herz setzte einen Schlag aus.
Er war immun gegen Flor de muerto. Es schickte ihn nicht zurück nach Mictlan wie die übrigen Toten, die mir bisher begegnet waren.
Was ist mit dem Mann passiert?, wollte Isa wissen, als ich ihr einen schnellen Blick zuwarf.
Auf einmal wurde mir klar, wie viel angsteinflößender das alles für sie sein musste. Sie konnte ihn nicht sehen, war ihm schutzlos ausgeliefert. Ihrem eigenen Papá. Sollte er sie berühren, würde sie aus irgendeinem Grund auf der Stelle tot sein, und niemand würde erfahren, wieso. Niemand außer mir.
Hastig nahm ich meine Hand herunter, wischte das Blut notdürftig an meiner Jeans ab und ergriff den Arm des Mädchens, ohne den Blick von Camillo zu lösen.
Komm mit. Das Zittern meiner Hand war unübersehbar. Ich zog Isa auf die Beine, schob sie hinter mich und bewegte mich rückwärts auf das Friedhofstor zu. So würde ich den Toten nicht aus den Augen verlieren und konnte das Mädchen hinter meinem Rücken verbergen. Ich streckte einen Arm zur Seite aus, damit ich weiter mit Isa sprechen konnte. Dem Mann geht es nicht gut. Wir müssen Hilfe holen.
Glaubte sie mir? Ich wusste es nicht, und es war auch egal. Erst musste ich sie fort von ihrem Vater bringen, dann konnte ich mir Gedanken darüber machen, was hier vor sich ging. Es musste eine Erklärung für all das geben, und ich würde sie finden.
Erzähl mir von deinem Papá, bat ich mit meiner Hand, meine Aufmerksamkeit auf Camillo geheftet, der gerade über den toten Mann stieg und langsam in unsere Richtung kam. Er glich einem Raubtier, das seine Beute ins Visier nahm. Ich wollte glauben, dass er seiner Tochter nichts zuleide tun würde, aber meine Zweifel waren lauter. Viel lauter. Ich holte zitternd Luft, dann warf ich einen raschen Blick über meine Schulter. Wir hatten das Eingangstor beinahe erreicht.
Wie war noch mal sein Name? Schnell trat ich einen Schritt zur Seite, damit der Tote seine Tochter sehen konnte. Wie heißt dein Papá?
Camillo, antwortete Isa.
»Camillo«, wiederholte ich, so laut ich konnte.
Ich wartete darauf, dass sich etwas bei dem Toten regte, dass er seine Tochter oder seinen Namen erkannte, aber nichts dergleichen geschah. Kein Erkennen überzog seine Miene wie bei Maria vor wenigen Tagen. Eigentlich durfte das nicht sein. Selbst der Tod konnte niemandem seine Erinnerungen nehmen.
Meine Finger stießen endlich hinter mir gegen die eisernen Stäbe des Friedhofstors, das in eine steinerne Mauer eingelassen war. Hastig drehte ich mich um, trat neben das Mädchen und presste meinen Körper gegen das Tor, um es aufzudrücken.
Es war verschlossen.
Panisch kramte ich nach meinem Schlüssel, bis mir einfiel, dass ich ihn Marisol gegeben hatte. Verdammt.
Verzweifelt rüttelte ich am Tor, begann zu rufen, irgendwann zu schreien, doch es hatte keinen Zweck. Der Friedhof befand sich abseits des Dorfes, niemand konnte mich hören.
Komm her. Hastig hob ich Isa hoch und hievte sie auf meine Schultern, während ich immer wieder in Richtung der Gräber blickte. Camillo kam näher, das seltsame Lächeln war mittlerweile zu einer Grimasse verzerrt.
Klettere auf die andere Seite, dann lauf zu Marisol und sag ihr, dass sie das Tor aufschließen soll.
Isa schlang ihre Arme um meinen Hals, so fest, dass ich kaum noch Luft bekam. Sie machte keinerlei Anstalten, meiner Bitte zu folgen. Angst klebte an ihr, schien sie zu betäuben.
Mit letzter Kraft holte ich sie wieder herunter, dann umklammerte ich ihren kleinen Körper und presste sie an mich. Mein Fluchtinstinkt befahl mir, zu rennen, aber gleichzeitig wusste ich, dass es zwecklos war. Das Tor war der einzige Ausweg. Wäre Mateo hier, wäre er enttäuscht davon, wie schnell ich aufgegeben hatte. Schließlich drängte ich das Mädchen wieder hinter meinen Rücken und wandte mich Camillo zu. Nur noch wenige Schritte trennten uns von dem Toten.
Obwohl ich wusste, dass Waffen gegen die Seelen Verstorbener nichts ausrichten konnten, tastete ich mit meiner zitternden Hand nach dem Griff des Taschenmessers, das einst Mateo gehört hatte und nun stets in meinem Gürtel steckte. Ich kniff die Augen zusammen, während sich meine Finger um den Schaft des Messers krampften und ich Isas hektischen Herzschlag an meinem Rücken spürte. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich jemals solche Angst gehabt hatte.
Plötzlich schob sich etwas vor mich, und im nächsten Moment wurden ich und das Mädchen gegen die Gitterstäbe des Tors gepresst.
»Es wird anscheinend zur Gewohnheit, dich zu retten.«
Sofort öffnete ich die Augen – und starrte in das Gesicht des Fremden, dem ich an der Klippe begegnet war.
Er drängte Isa und mich gegen das Tor, seine Hände stützten sich links und rechts von meinem Kopf gegen das Gitter.
»Du wirst sterben«, stieß ich hervor, während ich den Griff um das Mädchen verstärkte.
Ein Lächeln stahl sich auf seine Lippen. Ein echtes Lächeln, das überhaupt nicht jenem glich, das er mir an Mateos Ofrenda geschenkt hatte.
Ehe ich noch etwas sagen konnte, tauchte der Tote hinter ihm auf, und ich sah die blasse Hand, die sich auf die Schulter des Mannes legte.
Ich wollte ihn warnen, bevor Camillo seine bloße Haut berühren konnte, aber stattdessen grub ich meine Finger bloß tiefer in Isas Schultern, weil Angst meine Kehle zuschnürte. Ihre Tränen hatten den Rücken meiner Bluse bereits völlig durchnässt.
Auf einmal ertönte ein markerschütternder Schmerzensschrei, aber er kam nicht von dem Fremden. Vorsichtig spähte ich über seine Schulter – und erstarrte.
Camillo war fort. Dort, wo seine Hand die Schulter des Mannes berührt hatte, klaffte ein etwa faustgroßes Loch in dem schwarzen Mantel.