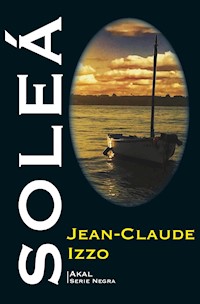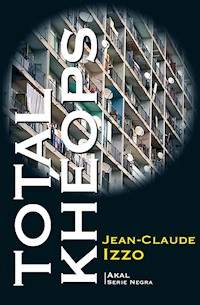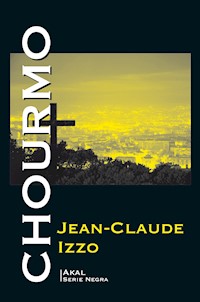8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Fabio Montale will nicht mehr länger Polizist sein. Und die Polizei von Marseille hält ihn nach den Skandalen von Total Cheops auch nicht mehr für unverzichtbar. Er möchte lieber gut essen und trinken, mit seinen Freunden reden und mit seinem Boot die Küste entlangschippern. Aber seine Cousine Gélou, die aussieht wie Claudia Cardinale, ist verzweifelt: Ihr Sohn Guitou ist mit seiner arabischen Freundin verschwunden. Fabio soll ihn finden. Dass Guitou schon lange tot ist, dämmert Montale erst nach und nach. Plötzlich hat Kommissar Loubet von der Polizei gar nicht mehr so viel dagegen, dass Montale sich um Aufklärung bemüht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Fabio Montale will nicht mehr länger Polizist sein. Aber seine Cousine bittet ihn verzweifelt um Hilfe: Ihr Sohn Guitou ist mit seiner arabischen Freundin verschwunden. Fabio soll ihn finden. Dass Guitou schon lange tot ist, dämmert Montale erst nach und nach. Und plötzlich ist auch der Polizei wieder recht, dass Montale sich um Aufklärung bemüht.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Jean-Claude Izzo (1945–2000) war lange Journalist. Sein erster Roman Total Cheops, 1995 veröffentlicht, wurde sofort zum Bestseller, seine Marseille-Trilogie zählt inzwischen zu den großen Werken der internationalen Kriminalliteratur.
Zur Webseite von Jean-Claude Izzo.
Katarina Grän (*1960) studierte Romanistik und Slawistik. Sie unternahm längere Reisen durch die USA und die Sowjetunion und absolvierte eine Ausbildung zur Rundfunkjournalistin. Sie ist als Krimiautorin und Übersetzerin tätig.
Zur Webseite von Katarina Grän.
Ronald Voullié (*1952) ist seit vielen Jahren Übersetzer »postmoderner« Philosophen wie Baudrillard, Deleuze, Guattari, Lyotard oder Klossowski. In den letzten Jahren kamen auch Übersetzungen von Kriminalromanen hinzu.
Zur Webseite von Ronald Voullié.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Jean-Claude Izzo
Chourmo
Marseille-Trilogie II
Kriminalroman
Aus dem Französischen von Katarina Grän und Ronald Voullié
Die Marseille-Trilogie II
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 1996 unter dem Titel Chourmo bei Éditions Gallimard, Paris.
Die Übersetzung aus dem Französischen wurde unterstützt durch das Centre national du livre des Französischen Kulturministeriums.
Originaltitel: Chourmo
© by Éditions Gallimard 1996
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Prisma/Age
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30402-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.05.2024, 02:18h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
CHOURMO
Vorbemerkung des AutorsProlog — Endstation, Marseille, Bahnhof Saint-Charles1 — In dem mit Blick aufs Meer das Glück eine klare Sache ist2 — In dem man immer zu viel sagt, wenn man redet3 — In dem dort Leben ist, wo Wut ist4 — In dem unweigerlich die Leute sich treffen5 — In dem ein Körnchen Wahrheit niemandem wehtut6 — In dem du dir das Leben nicht aussuchen kannst7 — In dem empfohlen wird, den schwarzen und den weißen Faden zu entwirren8 — In dem die Geschichte nicht die einzige Form des Schicksals ist9 — In dem es keine unschuldige Lüge gibt10 — In dem es schwer fällt, an Zufälle zu glauben11 — In dem es nichts Nettes zu sehen gibt12 — In dem man nachts Geisterschiffen begegnet13 — In dem wir alle davon geträumt haben, wie ein Fürst zu leben14 — In dem nicht sicher ist, dass es woanders weniger schlimm ist15 — In dem zum Glück auch Bedauern gehört16 — In dem wir mit der kalten Asche des Unglücks in Berührung kommen17 — In dem weniger manchmal mehr ist18 — In dem sich die Wahrheit nicht erzwingen lässt19 — In dem es zu spät ist, wenn der Tod uns erst einmal eingeholt hat20 — In dem ein beschränktes Weltbild vorgeschlagen wird21 — In dem angewidert und völlig erschöpft in die Luft gespuckt wirdEpilog — Die Nacht ist die gleiche, doch der Schatten im Wasser ist der Schatten eines verbrauchten MannesWorterklärungenMehr über dieses Buch
Stephan Güss: Fabio Montales Musik
Über Jean-Claude Izzo
Jean-Claude Izzo: Einige Zitate über über Izzo, Marseille, Schreiben und Essen
Alexandra Schwartzbrod: Begegnung am Ende der Trilogie
Über Katarina Grän
Über Ronald Voullié
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Jean-Claude Izzo
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Für Isabelle und Gennaro,ganz einfach meine Mutter und mein Vater
In Gedenken an Ibrahim Ali,
ermordet von Plakatklebern
des Front National
am 24. Februar 1995
in den nördlichen Vorstädten
von Marseille.
Es sind schmutzige Zeiten, das ist alles.
Rudolph Wurlitzer
Vorbemerkung des Autors
Nichts von dem, was folgt, hat jemals stattgefunden. Natürlich außer dem, was wahr ist und was man in der Zeitung lesen oder im Fernsehen sehen kann. Wenig, alles in allem. Und ich hoffe aufrichtig, dass die hier berichtete Geschichte an ihrem Platz bleibt: auf den Seiten dieses Buches. So weit, so gut. Aber Marseille ist sehr wirklich. So wirklich, dass ich Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen auf jeden Fall vermeiden möchte. Sogar mit dem Helden. Was ich von meiner Stadt Marseille berichte, ist einfach nur und immer wieder Widerhall und Erinnerung. Das heißt, was Marseille einem zwischen den Zeilen zu erkennen gibt.
Jean-Claude Izzo
Prolog
Endstation, Marseille, Bahnhof Saint-Charles
Guitou – wie seine Mutter ihn immer noch nannte – stand oben an der Treppe vor dem Bahnhof Saint-Charles und betrachtete Marseille. »Die große Stadt«. Seine Mutter war hier zur Welt gekommen, aber sie war nie mit ihm hergefahren. Dabei hatte sie es versprochen. Jetzt war er hier. Allein. Wie ein Großer.
In zwei Stunden würde er Naïma wiedersehen.
Deshalb war er hier.
Die Hände in den Taschen seiner Jeans vergraben und eine Camel zwischen den Lippen, stieg er langsam die Stufen hinunter. Der Stadt entgegen.
»Wenn du die Treppen runtergehst, kommst du auf den Boulevard d’Athènes«, hatte Naïma gesagt. »Du folgst ihm bis zur Canebière. Dort gehst du rechts. Richtung Alter Hafen. Wenn du da bist, findest du etwa zweihundert Meter weiter, wiederum rechts, eine große Eckkneipe. Sie heißt La Samaritaine. Dort treffen wir uns. Um sechs. Du kannst sie nicht verfehlen.«
Diese zwei Stunden, die vor ihm lagen, beruhigten ihn. Er würde die Kneipe ausfindig machen. Pünktlich sein. Naïma wollte er nicht warten lassen. Er hatte es eilig, sie wieder zu sehen. Ihre Hand zu nehmen, sie in seine Arme zu schließen, sie zu küssen. Heute Abend würden sie miteinander schlafen. Zum ersten Mal. Das erste Mal für sie und für ihn. Mathias, ein Klassenkamerad Naïmas, hatte ihnen sein Appartement überlassen. Sie würden ganz allein sein. Endlich.
Bei dem Gedanken musste er lächeln. Schüchtern, wie bei seiner ersten Begegnung mit Naïma.
Dann zog er ein Gesicht, als ihm seine Mutter einfiel. Wenn er zurückkäme, würde er mit Sicherheit eine unangenehme Viertelstunde über sich ergehen lassen müssen. Nicht nur, dass er ohne Erlaubnis drei Tage vor Schulbeginn abgehauen war, vorher hatte er auch noch tausend Francs aus der Ladenkasse stibitzt. Einer Boutique für Konfektionskleidung im Ortszentrum von Gap, alles hochmodisch und elegant.
Er zuckte mit den Schultern. Es waren nicht die tausend Francs, die den Familienfrieden gefährdeten. Mit seiner Mutter würde er schon klarkommen. Wie immer. Aber der andere machte ihm Kopfschmerzen. Der Obertrottel, der sich für seinen Vater hielt. Er hatte ihn schon einmal wegen Naïma geschlagen.
Als er die Allée de Meilhan überquerte, sah er eine Telefonzelle. Er sagte sich, dass er seine Mutter doch besser anrufen sollte, damit sie sich keine Sorgen machte.
Er stellte seinen kleinen Rucksack ab und griff in die Gesäßtasche seiner Jeans. Verdammt! Da war keine Brieftasche mehr! Entsetzt fühlte er auf der anderen Seite und sogar in der Innentasche seiner Jacke nach, obwohl er sie dort nie aufbewahrte. Nichts. Wie hatte er sie nur verlieren können? Als er aus dem Bahnhof trat, hatte er sie noch. Er hatte seine Fahrkarte hineingesteckt.
Dann erinnerte er sich. Auf der Bahnhofstreppe hatte ihn ein Beur um Feuer gebeten. Er hatte sein Zippo gezückt. Im selben Moment hatte ihn ein anderer Beur, der die Stufen hinunterrannte, von hinten angerempelt, beinahe gestoßen. Wie ein Dieb, hatte er noch gedacht. Um ein Haar wäre er die Treppe runtergefallen, hätte der andere ihn nicht aufgefangen. Er hatte sich prächtig leimen lassen.
Schwindel packte ihn. Wut, und Besorgnis. Keine Papiere mehr, keine Telefonkarte, keine Fahrkarte und vor allem fast kein Geld. Ihm blieb nur das Wechselgeld von der Fahrkarte und der Schachtel Camel. Dreihundertzehn Francs. »Scheiße!«, fluchte er laut.
»Alles in Ordnung?«, fragte eine alte Dame.
»Jemand hat mir die Brieftasche geklaut.«
»Oh! Armer Junge! So ein Pech! Da kann man gar nichts machen! So was kommt jeden Tag vor.« Sie sah ihn voller Mitgefühl an. »Aber besser nicht zur Polizei gehen. Hören Sie! Besser nicht! Die machen Ihnen nur noch mehr Ärger!«
Und sie ging weiter, ihre kleine Handtasche fest an die Brust gepresst. Guitou sah ihr nach. Sie verschwand in der bunten Menge von Passanten, größtenteils Schwarze und Araber.
Marseille fing ja gut an!
Um das Unheil zu vertreiben, küsste er die Goldmedaille mit der Jungfrau Maria, die er auf seiner vom Sommer in den Bergen noch gebräunten Brust trug. Seine Mutter hatte sie ihm zur Kommunion geschenkt. An jenem Morgen hatte sie die Kette von ihrem Hals gelöst und sie ihm umgelegt. »Sie kommt von weit her«, hatte sie gesagt, »sie wird dich beschützen.«
Er glaubte nicht an Gott, aber wie alle Söhne aus italienischen Familien war er abergläubisch. Und außerdem – die Jungfrau zu küssen, war, als küsse er seine Mutter. Als er noch klein war, hatte seine Mutter ihm immer einen Gutenachtkuss auf die Stirn gegeben. Dabei war die Medaille von ihren vollen Brüsten bis auf seine Lippen herabgeglitten.
Er verscheuchte dieses Bild, das ihn immer noch erregte. Und dachte an Naïma. Ihre Brüste, wenn auch kleiner, waren ebenso schön wie die seiner Mutter. Ebenso dunkel. Eines Abends, als er Naïma hinter der Scheune der Rebouls küsste, hatte er seine Hand unter ihren Pullover gleiten lassen und sie gestreichelt. Sie hatte es geduldet. Langsam hatte er den Pulli hochgeschoben, um sie zu bewundern. Mit zitternden Händen. »Gefallen sie dir?«, hatte sie leise gefragt. Er hatte nicht geantwortet, nur den Mund geöffnet, um sie mit den Lippen zu umschließen, erst die eine, dann die andere. Er bekam eine Erektion. Er würde Naïma wieder sehen, alles andere war nicht so wichtig.
Er würde schon zurechtkommen.
Naïma wachte ruckartig auf. Ein Geräusch im Stockwerk über ihnen. Ein ungewöhnliches Geräusch. Dumpf. Ihr Herz schlug schneller. Sie horchte mit angehaltenem Atem. Nichts. Stille. Durch die Fensterläden drang schwaches Licht. Wie spät mochte es sein? Sie hatte keine Uhr dabei. Guitou schlief friedlich. Auf dem Bauch. Mit dem Gesicht zu ihr. Sie konnte kaum seinen Atem hören. Das beruhigte sie, dieses regelmäßige Atmen. Sie streckte sich wieder aus und kuschelte sich mit offenen Augen an ihn. Sie hätte gern eine geraucht, zur Beruhigung. Um wieder einzuschlafen.
Sanft legte sie ihre Hand auf seine Schultern und strich ihm zärtlich über den Rücken. Er hatte eine seidige Haut. Weich. Wie seine Augen, sein Lächeln, seine Stimme, die Worte, die er ihr sagte. Wie seine Hände auf ihrem Körper. Fast weiblich. Die anderen Jungs, die sie kennen gelernt hatte, und sogar Mathias, mit dem sie geflirtet hatte, waren rauer in ihrer Art. Guitou hatte sie nur einmal angelächelt, und schon sehnte sie sich danach, in seine Arme zu kommen und den Kopf an seine Brust zu schmiegen.
Sie hätte ihn gern geweckt. Damit er sie streichelte, wie eben. Das hatte ihr gefallen. Seine Finger auf ihrem Körper, sein bewundernder Blick, der sie schön machte. Und verliebt. Mit ihm zu schlafen, war ihr ganz natürlich vorgekommen. Auch das hatte ihr gefallen. Würde es beim zweiten Mal noch genauso schön sein? War es immer so? Bei der Erinnerung durchlief sie ein wohliger Schauer. Sie lächelte, drückte einen Kuss auf Guitous Schulter und kuschelte sich noch enger an ihn. Er war sehr warm.
Er bewegte sich. Sein Bein glitt zwischen die ihren. Er öffnete die Augen.
»Du bist wach?«, murmelte er und strich ihr übers Haar.
»Ein Geräusch. Ich hab ein Geräusch gehört.«
»Hast du Angst?«
Hocine schlief in der Etage über ihnen. Sie hatten sich vorhin ein wenig mit ihm unterhalten. Als sie die Schlüssel geholt hatten, bevor sie eine Pizza essen gegangen waren. Er war ein algerischer Historiker. Ein Historiker für die Geschichte der Antike. Er interessierte sich für die archäologischen Ausgrabungen in Marseille. »Von unglaublichem Reichtum«, hatte er zu erklären begonnen. Er schien leidenschaftlich bei der Sache zu sein. Aber sie hatten ihm nur mit halbem Ohr zugehört. Sie hatten es eilig, allein zu sein. Sich zu sagen, dass sie sich liebten. Und sich danach zu lieben.
Mathias’ Eltern hatten Hocine seit über einem Monat aufgenommen. Sie waren übers Wochenende zu ihrem Landhaus in Sanary im Departement Var gefahren. Und Mathias hatte ihnen sein Appartement im Erdgeschoss zur Verfügung stellen können.
Es war eines dieser prachtvollen renovierten Häuser im Panier-Viertel, an der Ecke der Straßen Belles-Écuelles und Puits-Saint-Antoine, in der Nähe der Place Lorette. Der Vater von Mathias, ein Architekt, hatte die Innenräume neu gestaltet. Drei Etagen. Bis hinauf zur Dachterrasse à l’italienne, von wo man die ganze Reede überblicken konnte, von L’Estaque bis Madrague-de-Montredon. Großartig.
Naïma hatte zu Guitou gesagt: »Morgen früh gehe ich Brot holen. Wir frühstücken auf der Terrasse. Du wirst sehen, wie herrlich das ist.« Sie wollte, dass er Marseille liebte. Ihre Stadt. Sie hatte ihm so viel von ihr erzählt. Guitou war ein bisschen eifersüchtig auf Mathias gewesen. »Bist du mit ihm ausgegangen?« Sie hatte gelacht, ihm aber nicht geantwortet. Später, als sie ihm anvertraut hatte: »Weißt du, es stimmt, es ist das erste Mal«, hatte er Mathias vergessen. Das versprochene Frühstück. Die Terrasse. Und Marseille.
»Angst? Wovor denn?«
Sie ließ ihr Bein über seinen Körper gleiten und zog es an den Bauch. Ihr Knie streifte seinen Penis, und sie spürte, wie er steif wurde. Sie legte ihre Wange auf seine jungenhafte Brust. Guitou nahm sie fest in die Arme. Er streichelte ihren Rücken. Naïma erschauerte wohlig.
Er spürte schon wieder ein unbändiges Verlangen nach ihr, wusste aber nicht, ob er ihm nachgeben durfte. Ob es das war, was sie wollte. Er hatte keine Ahnung von Mädchen oder der Liebe. Aber er begehrte sie wahnsinnig. Sie sah zu ihm auf. Und ihre Lippen begegneten sich. Er zog sie an sich, und sie schob sich auf ihn. Da hörten sie ihn schreien: Hocine.
Der Schrei ließ ihnen das Blut in den Adern gefrieren.
»Mein Gott«, sagte sie tonlos.
Guitou stieß Naïma beiseite und sprang aus dem Bett. Er schlüpfte in seine Unterhose.
»Wo gehst du hin?«, fragte sie starr vor Angst.
Er wusste es nicht. Er hatte selber Angst. Aber er konnte nicht einfach so liegen bleiben. Zeigen, dass er Angst hatte. Er war jetzt ein Mann. Und Naïma sah ihn an.
Sie hatte sich im Bett aufgesetzt.
»Zieh dich an«, sagte er.
»Warum?«
»Weiß nicht.«
»Was ist los?«
»Weiß nicht.«
Im Treppenhaus hallten Schritte.
Naïma flüchtete ins Badezimmer. Auf dem Weg sammelte sie ihre verstreuten Sachen ein. Guitou lauschte mit dem Ohr an der Tür. Weitere Schritte im Treppenhaus. Geflüster. Er öffnete die Tür, ohne wirklich zu wissen, was er tat. Wie von seiner Angst überwältigt. Zuerst sah er die Waffe. Dann den Blick des Mannes. Brutal, so brutal. Er begann am ganzen Körper zu zittern. Den Knall hörte er nicht. Er fühlte nur, wie sich ein brennender Schmerz in seinem Bauch ausbreitete, und dachte an seine Mutter. Er stürzte. Sein Kopf schlug heftig auf die Steintreppe. Eine Augenbraue platzte. Er bemerkte den Geschmack von Blut im Mund. Es schmeckte scheußlich.
»Wir hauen ab«, war das Letzte, was er hörte. Und er spürte, wie jemand über ihn hinwegstieg. Wie über eine Leiche.
1
In dem mit Blick aufs Meer das Glück eine klare Sache ist
Es gibt nichts Angenehmeres, als morgens am Meer zu frühstücken, wenn man nichts zu tun hat.
Fonfon hatte dafür ein Anchovispüree zubereitet, das er gerade aus dem Ofen holte. Ich kam vom Fischen zurück, glücklich. Der Fang bestand aus einem kapitalen Seewolf, vier Goldbrassen und einem Dutzend Meeräschen. Das Anchovispüree machte mein Glück perfekt. Für mich war das Glück sowieso immer einfach gewesen.
Ich öffnete eine Flasche Rosé aus Saint-Cannat. Die Qualität der Roséweine aus der Provence begeisterte mich von Jahr zu Jahr mehr. Wir stießen an, um auf den Geschmack zu kommen. Dieser Wein aus der alten Komturei Bargemone war ein besonders edler Tropfen. Man schmeckte die sonnenüberfluteten, flachen Rebhänge der Gebirgskette Trévaresse förmlich unter der Zunge. Fonfon zwinkerte mir zu, dann machten wir uns daran, unsere Brotscheiben in das mit Pfeffer und gehacktem Knoblauch angemachte Anchovispüree zu tunken. Mein Magen erwachte beim ersten Bissen.
»Teufel, tut das gut!«
»Du sagst es.«
Mehr gab es nicht zu sagen. Jedes weitere Wort wäre zu viel gewesen. Wir aßen schweigend. Den Blick über dem Meer verloren. Ein schönes, tiefblaues, fast samtenes Herbstmeer. Ich konnte mich nicht satt daran sehen. Es überraschte mich jedes Mal, mit welcher Kraft es mich anzog. Der Ruf des Meeres. Aber ich war weder Seemann noch Reisender. Ich hatte Träume dort in der Ferne, hinter dem Horizont. Träume eines Jugendlichen. Aber ich hatte mich nie so weit vorgewagt. Nur einmal. Bis zum Roten Meer. Das war vor langer Zeit.
Ich ging auf die fünfundvierzig zu, und wie viele Marseiller hörte ich lieber Reiseberichte, als selber loszuziehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, in ein Flugzeug nach Mexico City, Saigon oder Buenos Aires zu steigen. In meiner Generation hatten Reisen noch einen Sinn. Das Zeitalter der Überseedampfer und Frachter. Die Seefahrt. Wo das Meer die Zeit bestimmt. Die Häfen. Die aufs Kai ausgebrachte Gangway und der Rausch neuer Gerüche, unbekannter Gesichter.
Ich begnügte mich damit, mein flaches Fischerboot, das Trémolino, hinter der Insel Maïre und der Inselgruppe Riou aufs offene Meer hinauszufahren und ein paar Stunden, umgeben von der Stille des Meeres, zu fischen. Etwas anderes hatte ich nicht mehr zu tun. Als fischen zu gehen, wenn es mich überkam. Und zwischen drei und vier Uhr nachmittags Karten zu spielen. Beim Pétanque die Aperitifs ausspielen.
Ein wohlgeordnetes Leben.
Manchmal machte ich einen Ausflug in die Calanques, die Buchten vor Marseille: Sormiou, Morgiou, Sugiton, En-Vau … Ich wanderte stundenlang, den Rucksack auf dem Buckel. Schwitzend und keuchend. Das hielt mich in Form. Es besänftigte meine Zweifel und Befürchtungen, meine Ängste. Ihre Schönheit brachte mich wieder in Einklang mit der Welt. Jedes Mal. Sie sind wirklich schön, die Calanques. Sie zu beschreiben, ist müßig, man muss sie gesehen haben. Aber man erreicht sie nur zu Fuß oder im Boot. Die Touristen überlegen es sich zweimal, und das ist gut so.
Fonfon stand mindestens ein Dutzend Mal auf, um seine Gäste zu bedienen. Typen wie ich, die regelmäßig kamen. Vor allem alte Leute. Sein Dickschädel hatte sie nicht vertreiben können. Nicht einmal, dass er die rechte Zeitung Le Méridional aus seiner Kneipe verbannt hatte. Nur Le Provençal und La Marseillaise waren zugelassen. Fonfon war früher aktives Mitglied der SFIO, der französischen Sozialisten, gewesen. Er war ein toleranter Mensch, aber so weit, Parolen des Front National zu akzeptieren, ging er nicht. Schon gar nicht bei ihm, in seiner Kneipe, in der nicht wenige politische Zusammenkünfte stattgefunden hatten. Einmal war »Gastounet«, wie sie den ehemaligen Bürgermeister Gaston Defferre unter sich nannten, sogar in Begleitung von Milou gekommen, um den radikalen Sozialisten die Hand zu schütteln. Das war 1981. Dann kam die Zeit der Desillusionen. Und der Verbitterung.
Eines Morgens hatte Fonfon das Porträt des Präsidenten der Republik, das über der Kaffeemaschine thronte, von der Wand gerissen und in seine große rote Plastikmülltonne gestopft. Man konnte das Geräusch von zerbrochenem Glas hören. Fonfon hatte hinter seiner Theke gestanden und uns einen nach dem anderen angesehen, aber keiner hatte aufgemuckt.
Dennoch hatte Fonfon sein Banner nicht niedergelegt. Er bekannte weiterhin Farbe. Fifi-mit-den-großen-Ohren, einer unserer Partner beim Kartenspiel, hatte letzte Woche versucht, ihm einzureden, dass der Méridional sich gewandelt habe. Immer noch eine Zeitung der Rechten, einverstanden, aber doch liberal. Außerdem seien die Lokalseiten im Provençal und im Méridional außerhalb Marseilles im ganzen Departement gleich. Also, was soll das Gerede …
Fast wären sie sich an die Kehle gegangen.
»He, eine Zeitung, deren Erfolg auf tödlicher Hetze gegen die Araber basiert – also mir kommt da die Galle hoch. Wenn ich so was nur sehe, möchte ich denen am liebsten den Hals umdrehen.«
»Großer Gott! Es hat ja keinen Sinn, mit dir zu reden.«
»Weil du Unsinn redest, mein Bester. He, ich hab nicht gegen die Boches gekämpft, um mir deinen Schwachsinn anzuhören.«
»Boing! Es geht wieder los«, bemerkte Momo und knallte eine Karo-Acht auf Fonfons Kreuz-Ass.
»Du bist nicht gefragt! Du hast mit dem Pack von Mussolini gekämpft! Sei froh, dass du mit uns an einem Tisch sitzen darfst!«
»Ich habe gewonnen«, sagte ich.
Aber es war zu spät. Momo hatte seine Karten hingeschmissen. »He! Ich kann auch woanders spielen.«
»Genau. Geh zu Lucien. Bei ihm sind die Karten blau-weiß-rot, wie die Nationalfahne. Und der Pik-König trägt ein schwarzes Faschistenhemd.«
Momo war gegangen und hatte nie wieder einen Fuß in die Kneipe gesetzt. Aber er ging auch nicht zu Lucien. Er spielte nicht mehr mit uns Karten, und damit basta. Das war schade, denn wir mochten Momo gern. Aber Fonfon hatte Recht. Bloß weil man älter wurde, brauchte man nicht die Klappe zu halten. Mein Vater wäre genauso gewesen. Vielleicht noch schlimmer, denn er war Kommunist gewesen, und der Kommunismus war heute nur noch ein Haufen kalter Asche.
Fonfon kam mit einem Teller Brote zurück, die erst mit Knoblauch und dann mit frischen Tomaten eingerieben worden waren. Nur um den Gaumen zu besänftigen. Dazu fand der Rosé eine neue Daseinsberechtigung in unseren Gläsern.
Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen erwachte der Hafen langsam zum Leben. Es herrschte nicht so ein lärmendes Durcheinander wie auf der Canebière. Nein, nur ein Gemurmel. Hier und da Stimmen oder Musik. Losfahrende Autos. Bootsmotoren, die angeworfen wurden. Und der erste Bus, der kam und die Schüler einsammelte.
Les Goudes, knapp eine halbe Stunde vom Stadtzentrum entfernt, war nach dem Sommer nur ein Dorf von sechshundert Einwohnern. Seit ich vor gut zehn Jahren nach Marseille zurückgekehrt war, hatte ich mich nicht entscheiden können, irgendwo anders zu wohnen als hier, in Les Goudes. In einer kleinen Hütte – zwei Zimmer, Küche –, die ich von meinen Eltern geerbt hatte. Während meiner müßigen Stunden hatte ich sie mehr schlecht als recht wieder instand gesetzt. Es war alles andere als luxuriös, aber acht Stufen unter meiner Terrasse lagen das Meer und mein Boot. Und das war bestimmt besser als jede Hoffnung auf das Paradies im Jenseits.
Kaum zu glauben für jemanden, der noch nie hier draußen war, dass dieser kleine, sonnenverbrannte Hafen ein Stadtteil von Marseille ist. Der zweitgrößten Stadt Frankreichs. Hier ist man am Ende der Welt. Die Straße geht einen Kilometer vorher, bei Callelongue, in einen steinigen Pfad über, der durch sonnengebleichtes, karg bewachsenes Gelände führt. Hier begann ich meine Wanderungen. Durch das Tal der Mounine und die Cailles-Ebene, von der man zu den Pässen von Cortiou und Sormiou hinaufsteigen kann.
Das Boot der Taucherschule verließ die Fahrrinne und nahm Kurs auf die Frioul-Inseln. Fonfon sah ihm nach, dann schaute er mich an und sagte ernst: »Nun, was hältst du davon?«
»Ich glaube, wir werden beschissen.«
Ich hatte keine Ahnung, worauf er hinauswollte. Er konnte alles Mögliche meinen: den Innenminister, die Islamische Heilsfront, Clinton. Den neuen Trainer von Olympique Marseille. Oder sogar den Papst.
Aber meine Antwort stimmte in jedem Fall. Weil wir mit Sicherheit beschissen wurden. Je mehr sie uns die Ohren voll quatschten von Sozialstaat, Demokratie, Freiheit, Menschenrechten und dem ganzen Blabla, desto gründlicher wurden wir beschissen. So sicher, wie zwei und zwei gleich vier ist.
»Ja«, sagte er, »das glaube ich auch. Es ist wie beim Roulette. Du setzt und setzt, und es ist doch nur ein Loch da, und du bist immer der Verlierer. Immer der Dumme.«
»Aber solange du setzt, lebst du noch.«
»Schon wahr! Nur, heutzutage muss man hoch pokern. Was mich betrifft, mein Freund, mir gehen die Chips aus.«
Ich trank den letzten Schluck Rosé und sah ihn an. Sein Blick ruhte auf mir. Er hatte dicke, fast lilafarbene Augenringe. Sie betonten die Magerkeit seines Gesichts. Ich hatte Fonfon nicht altern sehen, wusste nicht einmal, wie alt er war. Fünfundsiebzig, sechsundsiebzig. So alt war das nun auch wieder nicht.
»Ich fang gleich an zu heulen«, sagte ich im Spaß.
Aber ich wusste, dass er nicht scherzte. Es kostete ihn jeden Morgen große Überwindung, die Kneipe aufzumachen. Er ertrug die Gäste nicht mehr. Er ertrug die Einsamkeit nicht mehr. Vielleicht würde er eines Tages auch mich nicht mehr ertragen können, und das musste ihn beunruhigen.
»Ich höre auf, Fabio.«
Er deutete mit einer allumfassenden Geste in den Raum. Der große Saal mit seinen zwanzig Tischen, der Babystuhl in der Ecke – eine Rarität aus den Sechzigerjahren –, hinten die Theke aus Holz und Zink, die Fonfon jeden Morgen sorgfältig blank putzte. Und die Gäste. Zwei Gestalten an der Theke. Der erste in die Lektüre von L’Équipe vertieft und der zweite, der über seine Schulter auf die Sportergebnisse schielte. Zwei Alte, die sich fast gegenübersaßen. Der eine mit dem Provençal, der andere mit La Marseillaise. Drei Schüler, die sich ihre Ferienerlebnisse erzählten, während sie auf den Bus warteten.
Fonfons Welt.
»Erzähl keine Geschichten!«
»Ich hab mein ganzes Leben hinter einer Theke gestanden. Seit ich mit meinem armen Bruder Luigi nach Marseille gekommen bin. Du hast ihn nicht kennen gelernt. Mit sechzehn haben wir angefangen. In der Bar de Lenche. Er ist Hafenarbeiter geworden. Ich hab im Zanzi gearbeitet, im Jeannot an den Cinq-Avenues und im Wagram am Alten Hafen. Als ich nach dem Krieg ein bisschen Geld hatte, hab ich mich hier niedergelassen, in Les Goudes. Es ging uns gut, oh ja. Das ist vierzig Jahre her.
Früher kannten wir uns alle. Den einen Tag halfst du Marius, seine Kneipe neu zu streichen. Den anderen war er es, der dir beim Aufmöbeln deiner Terrasse zur Hand gegangen ist. Wir sind zusammen zum Fischen rausgefahren. Mit der alten Tartane, einem Segelboot. Damals lebte der arme Toinou noch, Honorines Mann. Und was für Fänge wir machten! Wir haben sie nie aufgeteilt. Nein, wir kochten riesige Töpfe Bouillabaisse, mal beim einen, mal beim anderen. Mit Frauen und Kindern. Zwanzig, dreißig Leute waren wir manchmal. Und lustig war es! Ja, deine Eltern, wo immer sie jetzt sein mögen – Gott hab sie selig –, erinnern sich sicher noch daran.«
»Ich weiß es noch, Fonfon.«
»Ja, du wolltest nur Suppe mit Croutons. Keinen Fisch. Du hast vor deiner armen Mutter einen Riesenzirkus veranstaltet.«
Er schwieg, verloren in den Erinnerungen an die »gute, alte Zeit«. Dreckspatz, der ich war, spielte ich am Hafen seine Tochter Magali ertränken. Wir waren gleich alt. Alle sahen uns schon als verheiratetes Paar, uns beide. Magali war meine erste Liebe. Die Erste, mit der ich geschlafen habe. Im Bunker über der Disko La Maronnaise. Am nächsten Morgen wurden wir kräftig zusammengestaucht, weil wir nach Mitternacht nach Hause gekommen waren.
Wir waren sechzehn.
»All das ist lange her.«
»Das ist es ja, was ich sagen will. Wir hatten jeder unseren eigenen Kopf, verstehst du. Wir beschimpften uns schlimmer als die Fischweiber. Und du kennst mich, ich war nicht der Letzte. Ich hatte immer eine große Klappe. Aber wir respektierten uns. Heute spuckt man dir ins Gesicht, wenn du Leute, die ärmer als du sind, nicht mit Füßen trittst.«
»Was wirst du tun?«
»Ich mache zu.«
»Hast du mit Magali und Fredo darüber gesprochen?«
»Tu nicht dümmer, als du bist! Wann hast du Magali zum letzten Mal hier gesehen? Und die Kinder? Sie kehren seit Jahren die Pariser raus. Mit dem ganzen Krempel, der dazugehört, und dem entsprechenden Auto. Im Sommer ziehen sie es vor, sich den Hintern bei den Türken, in Benidorm oder auf was weiß ich für Inseln braun brennen zu lassen. Das hier ist nur ein Ort für Versager wie wir. Und Fredo, nun, vielleicht ist er längst tot. Als er mir letztes Mal geschrieben hat, wollte er ein ristorante in Dakar aufmachen. Inzwischen haben ihn die Neger wahrscheinlich bei lebendigem Leibe verspeist! Willst du einen Kaffee?«
»Gern.«
Er stand auf. Er legte eine Hand auf meine Schulter und beugte sich zu mir herab, seine Wange streifte die meine.
»Fabio, du brauchst nur einen Franc auf den Tisch zu legen, und die Kneipe gehört dir. Ich hab immer wieder darüber nachgedacht. Du willst doch nicht ewig so weitermachen, ohne was zu tun, oder? Geld kommt und geht, aber es bleibt nie lange. Also, ich behalte mein Häuschen, und du musst mir nur versprechen, mich neben meiner Louisette zu begraben, wenn ich sterbe.«
»Verdammt! Aber du bist doch noch nicht tot!«
»Ich weiß. Das gibt dir etwas Zeit, darüber nachzudenken.«
Und er verschwand Richtung Theke, ohne dass ich noch ein Wort hinzufügen konnte. Um ehrlich zu sein, ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte. Sein Vorschlag machte mich sprachlos. Vor allem seine Großzügigkeit. Denn ich, ich sah mich nicht hinter seiner Theke. Ich sah mich nirgends.
Ich wartete ab. Kommt Zeit, kommt Rat, wie man so sagt.
Was sofort kam, war Honorine. Meine Nachbarin. Mit ihrem Korb unter dem Arm schritt sie munter aus. Die Energie der guten Frau von zweiundsiebzig überraschte mich immer wieder.
Ich las die Zeitung bei meiner zweiten Tasse Kaffee. Die Sonne wärmte mir wohlig den Rücken. Das half mir, nicht allzu sehr an der Welt zu verzweifeln. Der Krieg in Ex-Jugoslawien ging weiter. In Afrika war ein neuer ausgebrochen. An den Grenzen Kambodschas brodelte es. Und ohne Zweifel würde es in Kuba jeden Moment losgehen. Oder irgendwo da unten in Mittelamerika.
Bei uns in der Nähe war es kein bisschen erfreulicher.
»Blutiger Einbruch im Panier-Viertel«, machte der Provençal die Lokalseite auf. Ein knapper Bericht kurz vor Redaktionsschluss. Zwei Personen waren ermordet worden. Die Eigentümer hatten erst gestern Abend bei ihrer Rückkehr aus dem Wochenende in Sanary die Leichen von Freunden gefunden, die bei ihnen wohnten. Alles, was sich verscherbeln ließ, war ausgeräumt: Fernseher, Videorecorder, Stereoanlage, CD … Nach den Angaben der Polizei waren die Opfer in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen drei Uhr morgens ermordet worden.
Honorine kam direkt auf mich zu. »Ich hab mir gedacht, dass ich Sie hier finde«, sagte sie und stellte ihren Korb auf die Erde.
Fonfon erschien prompt, ein Lächeln auf den Lippen. Sie mochten sich gern, die beiden. »Hallo, Honorine.«
»Machen Sie mir ein Tässchen Kaffee, Fonfon. Aber nicht zu stark, hören Sie, ich hab schon zu viel getrunken.« Sie setzte sich und zog ihren Stuhl zu mir heran. »Sie haben Besuch.« Sie sah mich an, gespannt auf meine Reaktion.
»Wo denn das? Bei mir?«
»Aber ja, bei Ihnen. Nicht bei mir. Wer sollte mich schon besuchen?« Sie wartete auf meine Frage, aber der Klatsch brannte ihr auf der Zunge. »Sie raten nicht, wer es ist!«
»Nein, sicher nicht.« Ich konnte mir nicht vorstellen, wer mich besuchen sollte. Einfach so, an einem Montagmorgen um halb zehn. Die Frau meines Lebens war bei ihrer Familie zwischen Sevilla, Córdoba und Cádiz, und ich wusste nicht, wann sie wiederkam. Ich wusste nicht einmal, ob Lole überhaupt jemals wiederkommen würde.
»Na, das wird eine Überraschung sein.« Sie sah mich schelmisch an. Sie konnte nicht mehr an sich halten. »Es ist Ihre Cousine. Ihre Cousine Angèle.«
Gélou. Meine schöne Cousine. Die Überraschung war gelungen. Ich hatte Gélou seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Seit der Beerdigung ihres Mannes. Gino wurde eines Nachts umgelegt, als er sein Restaurant in Bandol schloss. Da er kein Ganove war, dachten alle an eine böse Erpressergeschichte. Die Ermittlungen verliefen im Sand, wie so viele andere. Gélou verkaufte das Restaurant, klemmte ihre drei Kinder unter den Arm und fing woanders ein neues Leben an. Ich hatte nie wieder etwas von ihr gehört.
Honorine neigte sich zu mir und sagte in vertraulichem Ton: »Die Arme, ach, sie scheint mir nicht gut auf dem Posten zu sein. Ich könnte schwören, dass sie Ärger hat.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Nicht, dass sie nicht freundlich gewesen wäre, nein. Sie hat mich zur Begrüßung geküsst und gelächelt. Wir haben beim Kaffee unsere Neuigkeiten ausgetauscht. Aber ich hab wohl gemerkt, dass sie unter der Fassade ganz verrückt vor Sorgen ist.«
»Vielleicht ist sie einfach müde.«
»Ich denke, sie hat Ärger. Und deshalb ist sie zu Ihnen gekommen.«
Fonfon kam mit drei Kaffees wieder. Er setzte sich uns gegenüber. »Du nimmst sicher auch noch einen, dachte ich mir. Alles klar?«, fragte er und sah uns an.
»Es ist Gélou«, sagte Honorine. »Erinnern Sie sich?« Er nickte. »Sie ist gerade angekommen.«
»Na und?«
»Sie hat Ärger, sag ich.«
Honorines Einschätzungen waren unfehlbar. Ich sah auf das Meer und sagte mir, dass es mit der Ruhe zweifellos vorbei war. Ich hatte in einem Jahr zwei Kilo zugenommen. Der Müßiggang begann auf mir zu lasten. Also, Ärger oder nicht, Gélou war willkommen. Ich leerte meine Tasse und stand auf.
»Ich gehe.«
»Wie wärs mit Fougasse, mit gefülltem Fladenbrot, zum Mittag?«, meinte Honorine. »Sie wird doch zum Essen bleiben, oder?«
2
In dem man immer zu viel sagt, wenn man redet
Gélou drehte sich um, und meine ganze Jugend sprang mir entgegen. Sie war die Schönste aus dem Viertel. Sie hatte mehr als einem den Kopf verdreht, und mir allen voran. Sie hatte meine Kindheit begleitet, die Träume meiner Jugend genährt. Sie war meine heimliche Liebe gewesen. Unerreichbar. Gélou war eine Erwachsene. Sie war fast drei Jahre älter als ich.
Sie lächelte mich an, und zwei Grübchen erhellten ihr Gesicht. Das Lächeln von Claudia Cardinale. Gélou wusste das. Und auch, dass sie ihr ähnlich sah. Frappierend ähnlich. Sie hatte oft damit kokettiert, war so weit gegangen, sich wie der italienische Star zu kleiden und zu frisieren. Wir verpassten keinen ihrer Filme. Mein Glück war, dass Gélous Brüder Kino nicht mochten. Sie zogen Fußball vor. Sonntagnachmittag holte Gélou mich ab, damit ich sie begleitete. Bei uns ging ein siebzehnjähriges Mädchen nie allein aus. Nicht mal, um sich mit ihren Freundinnen zu treffen. Es musste immer ein Junge aus der Familie dabei sein. Und Gélou hatte mich gern.
Ich liebte es abgöttisch, mit ihr zusammen zu sein. Wenn sie mich auf der Straße unterhakte, ging ich auf Wolken! Im Kino, bei Viscontis Leopard, wäre ich beinahe wahnsinnig geworden. Gélou hatte sich zu mir geneigt und mir ins Ohr geraunt: »Schau doch, wie schön sie ist!«
Alain Delon nahm sie in die Arme. Ich hatte meine Hand auf Gélous gelegt und ihr fast lautlos geantwortet: »Wie du!«
Ich hielt ihre Hand die ganze Vorstellung hindurch. Von dem Film bekam ich überhaupt nichts mit, so erregt war ich. Ich war vierzehn. Aber ich sah Alain Delon nicht im Geringsten ähnlich, und Gélou war meine Cousine. Als das Licht anging, nahm das Leben wieder seinen Lauf, und mir wurde klar, dass es hochgradig ungerecht war.
Es war ein flüchtiges Lächeln. Das Aufblitzen von Erinnerungen. Gélou kam auf mich zu. Kaum bemerkte ich, dass ihre Augen sich mit Tränen füllten, lag sie auch schon in meinen Armen.
»Es ist schön, dich zu sehen«, sagte ich und drückte sie an mich.
»Ich brauche deine Hilfe, Fabio.«
Die gleiche gebrochene Stimme wie die Schauspielerin. Aber das war keine Antwort aus einem Film. Wir waren nicht mehr im Kino. Claudia Cardinale hatte geheiratet, Kinder bekommen und führte ein glückliches Leben. Alain Delon hatte Fett angesetzt und verdiente viel Geld. Wir waren älter geworden. Wie vorauszusehen, hatte das Schicksal uns ziemlich ungerecht behandelt. Und tat es immer noch. Gélou hatte Probleme.
»Na, dann schieß mal los.«
Guitou, der Jüngste ihrer drei Jungen, war abgehauen. Freitag früh. Ohne eine Nachricht zu hinterlassen, kein Wort. Er hatte nur tausend Francs aus der Ladenkasse mitgehen lassen. Seitdem: Funkstille. Sie hatte gehofft, dass er anrufen würde. So wie er es immer machte, wenn er in den Ferien zu seinen Cousins nach Neapel fuhr. Sie hatte gedacht, er würde Samstag zurückkommen. Sie hatte den ganzen Tag gewartet. Dann den ganzen Sonntag. Letzte Nacht war sie zusammengebrochen.
»Was glaubst du, wo er hingegangen ist?«
»Hierher. Nach Marseille.«
Sie hatte nicht einen Moment gezögert. Unsere Blicke kreuzten sich. Gélous Augen verloren sich in der Ferne, dort, wo es bestimmt nicht einfach war, Mutter zu sein.
»Lass es mich erklären.«
»Nur zu!«
Ich setzte zum zweiten Mal Kaffee auf. Ich hatte eine Platte von Bob Dylan aufgelegt. Das Album Nashville Skyline. Mein Lieblingsalbum. Mit Girl from the North Country im Duo mit Johnny Cash. Ein wahrer Schatz.
»Das ist aber eine alte Platte. Die hab ich schon ewig nicht mehr gehört. Du hörst so was immer noch?« Die letzten Worte klangen beinahe angewidert.
»Das und andere Sachen. Mein Geschmack hat sich kaum geändert. Aber ich kann Antonio Machin für dich auflegen, wenn dir das lieber ist. Dos gardenias por amor …«, summte ich und deutete ein paar Schritte Bolero an.
Es brachte sie nicht zum Lachen. Vielleicht bevorzugte sie Julio Iglesias! Ich vermied es, sie danach zu fragen, und verschwand Richtung Küche.
Wir hatten uns auf der Terrasse niedergelassen, mit Blick aufs Meer. Gélou saß in einem Korbstuhl – meinem Lieblingssessel. Sie rauchte nachdenklich, mit übergeschlagenen Beinen. Ich beobachtete sie aus dem Augenwinkel von der Küche her, während ich auf den Kaffee wartete. Irgendwo in einem meiner Schränke habe ich eine hervorragende elektrische Kaffeemaschine, aber ich benutze weiterhin meine alte italienische Kaffeekanne. Geschmacksfrage.
Die Zeit schien spurlos an Gélou vorbeigegangen zu sein. Obgleich sie auf die fünfzig zuging, war sie nach wie vor eine schöne, begehrenswerte Frau. Feine Fältchen in den Augenwinkeln, ihre einzigen Falten, machten sie noch verführerischer. Aber irgendetwas ging von ihr aus, das mich störte. Seit dem Moment, als sie sich aus meinen Armen befreit hatte. Sie schien einer Welt anzugehören, in die ich nie einen Fuß gesetzt hatte. Eine ehrbare Welt. Wo es mitten auf dem Golfplatz nach Chanel Nr. 5 riecht. Wo ohne Ende Kommunion, Verlobung, Hochzeit, Taufe gefeiert wird. Wo alles voller Harmonie ist, bis hin zu den Daunendecken, Nachthemden und Puschen. Und die Freunde, Menschen von Welt, die man einmal im Monat zum Essen einlädt und die sich auf gleiche Weise revanchieren. Ich hatte einen schwarzen Saab vor meiner Tür parken sehen und war bereit, zu wetten, dass Gélous graues Kostüm nicht von der Stange kam.
Seit Ginos Tod hatte ich wohl einige Phasen im Leben meiner schönen Cousine verpasst. Ich brannte darauf, mehr von ihr zu erfahren, aber das war nicht der richtige Weg für den Anfang.
»Guitou hat seit dem Sommer eine Freundin. Einen Flirt halt. Sie hatte mit ein paar Freunden am Stausee von Serre-Ponçon gezeltet. Er hat sie auf einem Dorffest kennen gelernt. In Manse, glaube ich. Solche Feste mit Tanz und allem finden auf den Dörfern den ganzen Sommer über statt. Von dem Tag an waren sie unzertrennlich.«
»Das ist das Alter.«
»Schon. Aber er ist erst sechzehneinhalb. Und sie achtzehn, verstehst du.«
»Nun, dein Guitou muss ein hübscher Junge sein«, sagte ich im Scherz.
Immer noch kein Lächeln. Sie war nicht aufzuheitern. Die Angst schnürte ihr die Kehle zu. Es gelang mir nicht, sie zu beruhigen. Sie griff nach der Tasche zu ihren Füßen. Eine teure Tasche. Sie nahm eine Brieftasche heraus, öffnete sie und reichte mir ein Foto. »Das war beim Skilaufen, letzten Winter. In Serre-Chevalier.«
Sie und Guitou. Dünn wie eine Bohnenstange, war er gut einen Kopf größer als sie. Lange, wirre Haare fielen ihm ins Gesicht. Ein fast weibliches Gesicht. Gélous Gesicht. Und das gleiche Lächeln. Neben ihr wirkte er verlegen. Während sie Selbstsicherheit und Entschlossenheit ausstrahlte, wirkte er nicht zart, sondern zerbrechlich. Ich sagte mir, dass er ein Nachzügler war, das Nesthäkchen, das sie und Gino nicht mehr erwartet hatten, und dass sie ihn noch und noch verwöhnt haben musste. Was mich überraschte, war, dass nur sein Mund lächelte, nicht seine Augen. Sein im Nirgendwo verlorener Blick war traurig. So wie er die Skier hielt, schien er sich maßlos zu langweilen. Das sagte ich Gélou aber nicht.
»Ich bin sicher, dass er dir mit achtzehn auch das Herz gebrochen hätte.«
»Findest du, dass er Gino ähnlich sieht?«
»Er hat dein Lächeln. Schwer zu widerstehen. Du kennst das …«
Sie ging nicht auf die Andeutung ein. Vielleicht wollte sie nicht. Sie zuckte die Schultern und steckte das Foto wieder weg. »Guitou setzt sich schnell etwas in den Kopf, verstehst du. Er ist ein Träumer. Ich weiß nicht, von wem er das hat. Er kann stundenlang lesen. Von Sport hält er gar nichts. Die kleinste Anstrengung scheint ihn Mühe zu kosten. Marc und Patrice sind nicht so. Sie sind … praktischer. Stehen mit beiden Beinen auf der Erde.«
Das konnte ich mir vorstellen. Realistisch, sagt man heute.
»Wohnen Marc und Patrice bei dir?«
»Patrice ist verheiratet. Seit drei Jahren. Er leitet eins meiner Geschäfte in Sisteron. Mit seiner Frau. Es geht ihnen wirklich gut. Marc ist seit einem Jahr in den Vereinigten Staaten. Er studiert Tourismus. Vor zehn Tagen ist er zurückgeflogen.« Sie hielt nachdenklich inne. »Sie ist Guitous erste Freundin. Jedenfalls die erste, von der ich weiß.«
»Hat er dir von ihr erzählt?«
»Nach ihrer Abfahrt am 15. August haben sie andauernd telefoniert. Von morgens bis abends. Abends dauerte es stundenlang. Das fing an, ins Geld zu gehen! Wir mussten wohl oder übel darüber reden.«
»Was hast du denn gedacht? Dass es einfach so aufhört? Ein letzter Kuss und tschüs, auf Wiedersehen?«
»Nein, aber …«
»Du glaubst, dass er hergekommen ist, um sie zu sehen. Hab ich Recht?«
»Ich glaube es nicht, ich weiß es. Erst wollte er, dass ich seine Freundin übers Wochenende zu uns einlade, und ich habe mich geweigert. Dann wollte er meine Erlaubnis, sie in Marseille zu besuchen, und ich habe Nein gesagt. Er ist zu jung. Außerdem fand ich das so kurz vor Schulbeginn nicht gut.«
»Findest du es jetzt besser?«, fragte ich und stand auf.
Das Gespräch ging mir auf die Nerven. Die Angst davor, den Kleinen an eine andere Frau zu verlieren, konnte ich verstehen. Besonders den Jüngsten.
Die italienischen Mütter beherrschen dieses Spiel sehr gut. Aber da war noch etwas anderes. Gélou sagte mir nicht alles, das spürte ich.
»Ich will keinen Rat, Fabio, sondern deine Hilfe.«
»Wenn du glaubst, dich an einen Polizisten zu wenden, hast du dich in der Adresse geirrt«, sagte ich kühl.
»Ich weiß. Ich habe bei der Polizei angerufen. Du bist seit über einem Jahr nicht mehr dabei.«
»Ich habe gekündigt. Eine lange Geschichte. Wie dem auch sei, ich war sowieso nur ein kleiner Vorstadtbulle. In den nördlichen Stadtteilen!«
»Ich bin zu dir gekommen, nicht zu dem Polizisten. Ich will, dass du ihn suchst. Ich habe die Adresse von dem Mädchen.«
Jetzt verstand ich gar nichts mehr.
»Warte, Gélou. Erklär mir das. Warum bist du nicht direkt hingegangen, wenn du die Adresse hast? Warum hast du nicht wenigstens angerufen?«
»Ich habe angerufen. Gestern. Zweimal. Ihre Mutter war am Apparat. Sie hat gesagt, sie kenne keinen Guitou. Sie habe ihn nie gesehen. Und ihre Tochter sei nicht da. Sie sei bei ihrem Großvater, und der habe kein Telefon. Irgend so was.«
»Vielleicht stimmt das.« Ich dachte nach, versuchte, Ordnung in das ganze Durcheinander zu bringen. Aber mir fehlten noch einige Fakten, da war ich sicher.
»Woran denkst du?«
»Was für einen Eindruck hat sie auf dich gemacht, die Kleine?«
»Ich hab sie nur einmal gesehen. Am Tag ihrer Abreise. Sie hat Guitou zu Hause abgeholt, damit er sie zum Bahnhof begleitete.«
»Wie ist sie?«
»So lala.«
»Wie so lala? Ist sie hübsch?«
Sie zuckte die Schultern. »Mhm.«
»Ja oder nein? Verdammt! Was hat sie? Ist sie hässlich? Behindert?«
»Nein. Sie ist … Nein, sie ist hübsch.«
»Na, man könnte denken, das tut dir weh. Meinst du, sie hat es nicht ernst gemeint?«
Sie zuckte wieder mit den Schultern, und das Ganze begann mir langsam auf den Geist zu gehen.