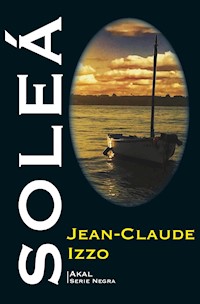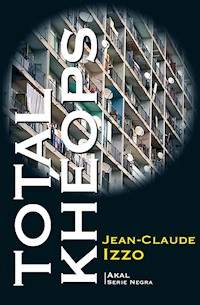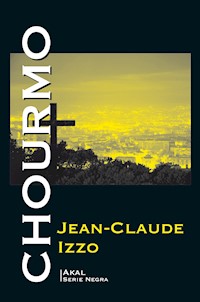9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als man den Leichnam des Clochards Titi unter der Bank einer Pariser Metrostation findet, zieht dessen einziger Kumpel Rico Bilanz: Sein Leben ist verpfuscht, er ist geschieden, seinen Sohn darf er nicht mehr sehen, die Wohnung hat er verloren. Rico beschließt, aus dem eisigen Pariser Winter abzuhauen, in den Süden. Die Menschen, denen er auf dieser Reise begegnet, sind vom Leben besiegt worden: Felix, der ständig einen Fußball mit sich herumschleppt und jeden Zeitbegriff verloren hat. Oder die junge Mirjana aus Bosnien, die völlig abgebrannt in einem alten Haus untergeschlüpft ist und ihren Körper verkauft. In Marseille versucht Rico, Lea wiederzufinden, seine erste Liebe - und schöpft zum ersten Mal wieder Hoffnung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Als man den Leichnam des Clochards Titi unter der Bank einer Pariser Metrostation findet, zieht dessen einziger Kumpel Rico Bilanz: Sein Leben ist verpfuscht. Rico beschließt, aus dem eisigen Pariser Winter abzuhauen, in den Süden. In Marseille versucht er, Lea wiederzufinden, seine erste Liebe - und schöpft zum ersten Mal wieder Hoffnung.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Jean-Claude Izzo (1945–2000) war lange Journalist. Sein erster Roman Total Cheops, 1995 veröffentlicht, wurde sofort zum Bestseller, seine Marseille-Trilogie zählt inzwischen zu den großen Werken der internationalen Kriminalliteratur.
Zur Webseite von Jean-Claude Izzo.
Ronald Voullié (*1952) ist seit vielen Jahren Übersetzer »postmoderner« Philosophen wie Baudrillard, Deleuze, Guattari, Lyotard oder Klossowski. In den letzten Jahren kamen auch Übersetzungen von Kriminalromanen hinzu.
Zur Webseite von Ronald Voullié.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Jean-Claude Izzo
Die Sonne der Sterbenden
Roman
Aus dem Französischen von Ronald Voullié
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel Le soleil des mourants bei Flammarion, Paris.
Originaltitel: Le soleil des mourants (1999)
© by Flammarion 1999
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30403-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.05.2024, 03:15h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE SONNE DER STERBENDEN
PrologErster Teil1 — »On the road again, und das für immer«, sagte Titi2 — Erinnerungen, für nichts und wieder nichts3 — Wo die Bitterkeit und die Größe von Träumen zum Durchbruch kommen4 — Seltsam, dass man hassen und immer noch lieben kann5 — In einer Kakofonie von Schmerzen und Tränen6 — Eine Nacht, in der sich keiner um den anderen kümmert7 — Was an einem Tag wahr ist, kann an einem anderen Tag nicht mehr wahr sein8 — So ist das Leben, die Liebe kommt abhanden9 — Eidechsenkopf, Eidechsenschwanz10 — Augenblicke des Nichts, der vergehenden Zeit gestohlen11 — Sonne, Sonne … aber auch Bedauern12 — Selbst die Liebe ist manchmal keine Lösung13 — Tage mit und Tage ohne, hier bleibt die Zukunft stehen14 — Nach dem Schnee der Mistral, und die Kälte, wie immer15 — Wie Bruder und Schwester, rein gefühlsmäßig16 — Man kann nicht mehr vor Glück weinen17 — Die Ewigkeit dauert nur eine Nacht18 — Für den, der zuletzt stirbt, wird alles leichterZweiter Teil19 — Wie wäre es, wenn wir uns das Meer ansehen?20 — Das Böse ist wie die Hölle, unvorstellbar21 — Eines Tages vielleicht Freunde finden22 — Stundenlang aufs Meer schauen23 — Eine kleine Autotour, Rue Sainte-Françoise24 — Manchmal ist das Leben schöner als die Träume25 — Ein letztes Lied, und warten, warten …WorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Jean-Claude Izzo
Jean-Claude Izzo: Einige Zitate über über Izzo, Marseille, Schreiben und Essen
Alexandra Schwartzbrod: Begegnung am Ende der Trilogie
Über Ronald Voullié
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Jean-Claude Izzo
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Paris
Den verletzten Männern,und den Frauen, die sie überleben,wenngleich nur recht und schlecht.
Für Catherine,für diese Liebe.
Man muss die Farbe seiner Verletzung im Gedächtnis behalten, um sie den Sonnenstrahlen auszusetzen.
Juliet Berto
Es wäre falsch zu sagen, dass dieser Roman frei erfunden ist. Ich habe nur die Logik des Realen auf die Spitze getrieben und für einige Menschen, wie man sie jeden Tag auf der Straße treffen kann, Namen und Geschichten erfunden. Für Menschen, deren Blick uns allein schon unerträglich ist. Beim Lesen dieser Seiten kann sich also jeder wiedererkennen. Die Lebenden und die Sterbenden.
Jean-Claude Izzo
Prolog
Titi trug den Winter in sich. Jetzt gerade schien ihm sogar, die Kälte in seinem Körper sei noch beißender als auf der Straße. Wahrscheinlich deshalb hatte er aufgehört, vor Kälte zu zittern, sagte er sich. Weil er nur noch ein einziger Eisblock war, wie das Wasser im Rinnstein.
Eine Leuchttafel über dem Eingang der Apotheke zeigte die Temperatur an: – 8 °C. Und die Zeit: 20.01. Titi, kaum geschützt unter dem Vorbau eines Wohnhauses, hatte seit einer halben Stunde beobachtet, wie die Minuten verstrichen. Dann hatte die eisige Luft seinen Blick getrübt. Dennoch war ihm klar geworden, dass es nutzlos war, noch länger zu warten. Der weiße Lieferwagen von der Obdachlosenküche kam nicht. Die Stationen seiner Route konnten alle Hungerleider an den Fingern abzählen: Place de la Nation, Place de la République, Place des Invalides, Porte d’Orléans. Aber nie, absolut niemals kam er an der Place de l’Hôtel de Ville vorbei, dieser verfluchte Wagen! Und genau dort befand er sich, an der Place de l’Hôtel de Ville …
»Verdammte Scheiße!«, tobte er innerlich. »Du machst dich ja völlig verrückt, Titi!« Sein Blick kehrte zur Leuchttafel zurück, aber noch immer konnte er nur verschwommen sehen. »Reg dich nicht so auf, das lohnt sich nicht, du Blödmann!«, sagte er sich. »Ganz ruhig, ganz ruhig …«
Ja, Tag für Tag verlor er immer mehr den Boden unter den Füßen. Das hatte auch Rico zu ihm gesagt, als der erste Frost kam. Und dass er ins Krankenhaus gehen solle, sich versorgen lassen. Aber Titi wollte einfach nicht ins Krankenhaus.
»Du wirst krepieren«, hatte Rico gesagt.
»Na und, was solls! Krankenhaus ist dasselbe wie krepieren. Du gehst da rein, und du kommst mit den Füßen voran wieder raus. Würdest du da hingehen? Würdest du?«
»Du gehst mir auf den Geist, Titi!«
»Du mir auch, verdammt!«
Seitdem sprach Titi nicht mehr. Mit niemandem. Mit fast niemandem. Er konnte kaum mehr sprechen. Er hatte nicht mehr die Kraft dazu.
Die Ampel vor ihm sprang zum zweiten Mal auf Rot um. »Scheißwinter«, murmelte er. Er musste sich Mut machen, um über die Straße zu gehen. Furcht hatte ihn befallen. Titi sah seine Knochen brechen wie dünnes Glas. Trotzdem musste er rübergehen, um in den Metroeingang zu kommen.
Seine letzte Chance an diesem Abend bestand darin, Rico und die anderen in der Station Ménilmontant zu treffen. Sie fragten sich bestimmt schon, wo er sich seit dem Morgen herumgetrieben hatte. Vielleicht hatten sie etwas zu essen. Und einen Schluck Wein. Wein hielt den Körper am längsten warm und war besser als Kaffee, Milch, Schokolade und all dies Zeugs.
Ein kräftiger Schluck Wein, eine Kippe, und dann würde er sich umschauen, für die Nacht. Er musste unbedingt dort sein, bevor sie sich ins Heim oder in ihre Bude aufmachten. Vor allem hoffte er, dass Rico noch da war. Denn Rico war trotz allem sein Kumpel, schon seit zwei Jahren.
Titi machte vorsichtig einen Schritt. Dann zwei. Er schlurfte mit den Füßen über den vereisten Asphalt. An einer Ampel ließ ein Autofahrer, der sich über Titis unbeholfenen Gang amüsierte, die Scheinwerfer aufblitzen und den Motor aufheulen.
»Arschloch«, fluchte Titi vor sich hin, ohne zu dem Wagen aufzusehen, da er sich fürchtete, auszurutschen, hinzufallen und sich etwas zu brechen.
Erleichtert verschwand er im Metroeingang. Aber er war überrascht, dass ihm nicht wie üblich die Wärme entgegenschlug. Die Kälte schien auch die U-Bahn-Gänge fest im Griff zu haben. Er begann zu zittern, zog den Mantel vor seiner Brust zusammen und hockte sich hin.
»Habt ihr mal ’ne Kippe?«, fragte er ein junges Paar.
Aber er hatte wohl zu leise gesprochen. Vielleicht hatte er auch gar nicht richtig gesprochen, sondern nur in seinem Kopf. Das Paar ging auf dem Bahnsteig weiter, ohne einen Blick auf ihn zu verschwenden. Er sah, wie sie sich umarmten und lachten.
Endlich kam ein Zug.
»Wo zum Teufel bist du gewesen?«, fragte Dede.
Von den sechs Kumpanen in Ménilmontant war nur Dede übrig geblieben.
»Rico hat bis eben auf dich gewartet. Dann ist er losgegangen, um dich im Heim zu suchen. Ich mach mich gleich auch vom Acker.«
Titi schüttelte den Kopf. Von seinen Lippen kam kein Ton.
»Was ist los, Titi?«
Titi machte mit den Fingern die Gebärde des Essens.
»Ich hab auch nichts, Titi. Verdammt, ich hab auch nichts. Nich mal ’nen Schluck zu trinken.«
Titis Augen erloschen. Seine Lider fielen herab, und er nickte ein. Das Umsteigen in Belleville hatte ihn erschöpft. Mehrere Male wär er fast die Treppe runtergefallen.
»He, Titi! Bist du wirklich in Ordnung?«
Titi nickte.
»Ich muss los. Also …« Dede zog eine zerknitterte Kippe aus der Tasche, glättete sie zwischen den Fingern, zündete sie an und steckte sie Titi zwischen die Lippen. »Ich werd ihm oben sagen, dass du noch da bist, Titi. Hörst du mich? Mach dir keine Sorgen, sie werden schon nach dir sehen.« Dede klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter und verschwand.
Der Bahnsteig war menschenleer. Titi rauchte vor sich hin, die Kippe zwischen den Lippen, die Augen geschlossen. Wieder nickte er ein.
Die Ankunft eines Zuges schreckte ihn auf. Mehrere Leute stiegen aus, die meisten in der Mitte des Bahnsteigs, aber niemand nahm Notiz von ihm. Titi zog am Rest der Kippe und warf sie fort. Er zitterte immer stärker.
Langsam stand er auf und ging bis zum Ende des Bahnsteigs. Dort schlich er sich hinter die Reihe mit den Plastikstühlen und legte sich mit dem Gesicht zur Wand nieder. Dann schlug er den Mantelkragen über den Kopf und schloss die Augen.
Der Winter, der in ihm steckte, trug ihn fort.
Erster Teil
1
»On the road again, und das für immer«, sagte Titi
Rico weigerte sich, die Fragen der Journalisten zu beantworten. Als Erster ihrer kleinen Gruppe von armen Teufeln war er am frühen Nachmittag zur Station Ménilmontant zurückgekehrt. Der Bahnsteig in Richtung Nation, auf dem sie sich gewöhnlich trafen, war abgeriegelt. Daher ging er auf den gegenüberliegenden Bahnsteig.
Der Zugverkehr war stillgelegt. Es wimmelte von Menschen. Zunächst die Rettungsdienste mit ihren Wiederbelebungsgerätschaften, dann die Polizisten und jede Menge Bahnbeamte. Als Rico sah, wie sie Titi forttrugen, wurde ihm klar, dass er tot war.
Ein Fernsehteam rückte an. Von den Lokalnachrichten. Die Journalistin, eine junge Frau mit strenger Miene und kurzen, fast kahl geschorenen Haaren, bemerkte ihn, und er wurde einige Minuten lang aufgenommen. Rico hatte nicht die Kraft, sich zu bewegen. Er war viel zu traurig.
Der Tod von Titi.
»Der Tod von Titi«, wiederholte die Journalistin. »So wurde er genannt, nicht wahr?«
Mit gesenktem Blick rauchte er weiter, ohne zu antworten. Er hatte nichts zu sagen. Was hätte er sagen sollen? Nichts. Der Sicherheitsbeauftragte der Bahngesellschaft hatte es der Journalistin bereits erklärt: »Die Obdachlosen sterben in den Metrogängen; solche Vorkommnisse gibt es diesen Winter fast jeden Tag, zumeist Herzversagen …«
Für die Abendnachrichten ging Rico wie üblich zu Abdel, einer kleinen Araberkneipe in der Rue de Charonne. Er trank ein Bier, rauchte eine Kippe, sah Fernsehen, und keiner machte eine Bemerkung, dass er störe. Abdel gab ihm manchmal sogar einen Teller Couscous.
»Hast du den gekannt, von dem sie da gerade reden?«, erkundigte sich Abdel.
»Das war mein Kumpel.«
»Scheiße! Ruhe er in Frieden.«
Zu Ricos Überraschung stimmte der Bericht der Journalistin ziemlich genau. »Jean-Louis Lebrun, 45 Jahre alt, starb auf dem Bahnsteig der Metrostation Ménilmontant am Freitag gegen 22 Uhr. Am Samstag um 14.30 Uhr wurde er abtransportiert. Hunderte von Parisern gingen vorbei, ohne etwas zu bemerken. Ebenso wenig wie die Bahngesellschaft.«
»Was für eine Sauerei«, kommentierte Abdel.
»Bei Millionen von Fahrgästen ist das nicht verwunderlich …«, äußerte sich der Sprecher der Bahn.
»Willst du noch ein Bier?«
»Ja, gern.«
Dann erschien Dede auf dem Bildschirm und schimpfte auf die Bahngesellschaft, dass sie Titi habe krepieren lassen. »Ja, ja … als ich wegging, hab ich den Schalterbeamten gewarnt. Ich hab ihm gesagt, dass Titi nicht gut aussah. Eher wie ein Kranker. Ich hab gedacht, die würden den Rettungswagen rufen, und …«
Der Stationschef behauptete natürlich, dass der Nachtdienst nicht informiert worden sei.
»Normalerweise«, schloss der Sicherheitsverantwortliche, »darf nachts niemand in den Metrostationen bleiben. Aber es kommt vor, dass unsere Überwachungsteams Mitleid haben und ein Auge zudrücken. Und das ist gestern Nacht zweifellos geschehen.«
Rico hörte nicht mehr hin. Mit kleinen Schlucken trank er sein Bier.
Sie hatten sich vor dem Gemeindesaal der Kirche Saint-Charles im Stadtteil Monceau kennen gelernt, als sie mit etwa zwanzig anderen auf dem Trottoir in der Schlange standen. Was das Essen betraf, war das der beste Ort in Paris. Dazu kam, dass die Leiterin der Anstalt, Madame Mercier, es verstand, mit raffinierten Namen den Wohlgeschmack ihrer Speisen zu erhöhen. So wurde zum Beispiel ein Schlag Nudeln mit Wurstfleisch, serviert in einer flachen Plastikschale, zu einem »Kessel Buntes mit Fleischpastete«!
Seitdem Rico diese Örtlichkeit entdeckt hatte, ging er manchmal dorthin, wie normale Leute ins Restaurant gehen. Allerdings nicht zu oft, denn vor dem Essen musste man sich zwei Minuten Andacht reinziehen und hinterher auch noch beten. Immer das Vaterunser, gefolgt von idiotischen Segenswünschen für den Heiligen-Vinzenz-von-Paul, »Freund der Armen«, für Unsere-Mutter-vom-Guten-Rat sowie für eine ganze Reihe von Heiligen, die jedesmal wechselten und Rico piepegal waren.
Aber dieser Schwachsinn war nicht das Schlimmste. Die Gemeinheit bestand darin, dass man seine Essenskarte anderthalb Stunden im Voraus beziehen musste. Der Gemeindepfarrer, Vater Xavier, schlug danach vor, in der Zwischenzeit einige Lektionen aus dem Katechismus durchzunehmen – »natürlich nur denjenigen, die das wünschen«. Natürlich waren die dann auch die Ersten, die sich zu Tisch begeben und das Tagesmenu von Madame Mercier entdecken durften.
Eines Abends hatte Rico sich darauf eingelassen, dem Pfarrer zu folgen. Eine Predigt, ein Kirchenlied, das war immerhin besser, als auf der Straße rumzustehen. Auf der Karte stand Kabeljau auf provenzalische Art, und Rico konnte sich nicht erinnern, wann er zum letzten Mal Kabeljau gegessen hatte. Das war eine höllische Stunde, die ihn deprimierend an seine Kindheit und die obligatorischen Religionsstunden erinnerte. Vater Xavier hatte seine Lektion mit folgenden Worten beendet: »Ja, meine Brüder, Christus hätte sich gern an den Schalen gelabt, die man den Schweinen vorwarf, aber niemand hat ihm welche gegeben.« Rico hätte um ein Haar laut in die Runde gefurzt und mied seither, auch wenn er den Kabeljau von Madame Mercier sehr gern mochte, den Katechismus.
Der Tag, an dem Rico und Titi sich kennen lernten, war der Karsamstag gewesen. Die Schlange hinter ihnen bestand aus etwa dreißig Männern und Frauen. Die Tür des Gemeindesaals war geschlossen, niemand konnte seinen Essensgutschein einlösen.
Sie warteten über eine Stunde, bis schließlich Vater Xavier kam und eine Erklärung abgab. Der Saal war an den heiligen Feiertagen geschlossen.
»Für diejenigen, die an Jesus Christus glauben, und ich weiß, dass das nicht bei allen der Fall ist, was aber nicht schlimm ist, muss daran erinnert werden, dass unser Herrgott an diesem Osterwochenende für uns gestorben ist.«
Alle hatten den Kopf gesenkt und sich gesagt, gut, gehen wir also zur Osterpredigt.
Nach einem Räuspern war der Pfarrer fortgefahren: »Wir werden weder heute noch morgen Essen ausgeben. Wir Christen feiern die letzte Mahlzeit, die Christus mit seinen Jüngern eingenommen hat …«
»Sieh an, er stopft sich ein letztes Mal voll, und wir gucken in die Röhre!«, hatte Titi geflüstert.
»Amen, mein Bruder, und schnalle deinen Gürtel enger«, hatte Rico grinsend geantwortet.
Sie hatten sich angesehen und waren fortgegangen, ohne sich das Ende der Ansprache anzuhören. Auf der Suche nach einem anderen Ort, wo es etwas zu futtern gab.
»Rue Serrurier«, hatte Rico unsicher vorgeschlagen.
»Zu viele Leute. Außerdem ist das für heute Abend zu weit weg.«
»Dann Rue de l’Orillon …«
»Mann, willst du mich verarschen! Da fängt man sich Durchfall ein. In den sechs Jahren, die ich auf der Straße lebe, hab ich mir alle Orte gemerkt, an denen ich mir etwas eingefangen habe. So weit es geht, meide ich die. Nein, lass uns zur Trinité gehen. Das ist zwar kein Drei-Sterne-Lokal, aber die Menge machts auch … Und es gibt jede Menge hübsche Studentinnen. Wirst schon sehen, ein Minirock hilft durchaus, den zusammengepappten Reis zu verdauen!«
Sie mussten lachen, und seither waren sie unzertrennlich.
Titi und Rico hatten niemals viel Worte darüber verloren, warum sie sich so gefunden hatten. Klar, trotz einiger Unterschiede waren ihre Lebenswege gleich. Aber während sie ihre Zigaretten rauchten, zogen sie es vor, über Wesentlicheres zu reden. Vor allem Titi.
Nach Ricos Meinung hätte Titi Professor oder Lehrer werden müssen. Irgendwas in der Art. Er hatte einen Haufen Bücher gelesen, und in ihren Gesprächen machte er oft Anspielungen darauf. An einem Nachmittag saßen sie am Square des Batignolles – an dem sie sich gern trafen – in der Sonne auf einer Bank und Titi sagte:
»Weißt du, in meiner Jugend habe ich Bücher von Burroughs, Ferlinghetti und Kerouac gelesen …«
Da Rico ihn ausdruckslos anstarrte, hatte er hinzugefügt: »Hast du niemals Unterwegs gelesen?«
Rico hatte seit der Schule überhaupt nichts mehr gelesen. Außer einigen Krimis und Groschenromanen. Dabei hatte er zu Hause eine regelrechte Bibliothek. Prachtausgaben mit illustrierten Umschlägen, die jeden Monat mit der Post kamen. Sophie hatte all das abonniert. Sie fand es toll, Bücher im Haus zu haben. Elegant, sagte sie. Aber auch sie las nicht. Sie zog Frauenmagazine vor.
»Ach, weißt du, ich und Bücher …«
»Schon gut. Das waren Beatniks. Hast du schon mal davon gehört?«
Für Rico waren Beatniks bloß Typen mit langen Haaren, Blumenhemden und umgehängter Gitarre. Er erinnerte sich an den Sänger Antoine. Auch an Joan Baez. Love and Peace und all das. Aber das war nie sein Ding gewesen. Mit sechzehn war er geschniegelt und gebügelt, wie aus dem Ei gepellt. Und er glaubte an ein Leben in Höchstgeschwindigkeit, wie in einem roten Ferrari.
»Diese Typen, die amerikanischen Beatniks, ich meine die echten, die machten per Anhalter Spritztouren durch die gesamten Vereinigten Staaten. Vagabundieren, das freie Leben … Kerouac, dieser Schwachkopf, hat sogar etwas über ihre aberwitzigen Abenteuer geschrieben. Gammler, Zen und hohe Berge …!« Titi versank in Schweigen.
»Ja … On the road again, das war ihr Glaubensbekenntnis.«
Sein Blick war völlig in sich gekehrt.
»On the road again«, hatte er nachdenklich wiederholt. »Was für ein Schwachsinn!«
Beiden war klar: Ihr Weg war kein Weg mehr. Höchstens ein Sumpf, in dem sie Tag für Tag mehr versanken. Unweigerlich. Und selbst wenn jemand käme und sie bei der Hand nehmen würde, es war zu spät. Wer ihnen jetzt noch die Hand entgegenstreckte, war kein Freund mehr. Allenfalls wollte er helfen. Ein Plastikbecher mit heißem Kaffee. Eine Dose Corned-Beef. Ein Stück Schmelzkäse.
»On the road again, und das für immer, Rico, verstehst du …«
»Arschlöcher«, murmelte Rico und trank sein Bier aus.
Die Ansagerin auf dem Bildschirm berichtete jetzt vom Drama Hunderter Autofahrer, die vom Skiurlaub zurückkehrten und auf den Straßen von schweren Schneefällen blockiert wurden. Sämtliche Hilfsdienste in den Alpen wurden mobilisiert, um diesen unglücklichen, in Not geratenen Familien zu helfen.
Rico lächelte und stellte sich vor, dass Sophie vielleicht auch im Schnee feststeckte. Sophie und Alain, Eric und Annie …
»Arschlöcher«, murmelte er wieder und stand auf.
Abdel weigerte sich, Geld für die Biere anzunehmen. »Komm wieder, wann immer du willst.«
Rico zog den Kragen seines Lastwagenfahrerpullovers bis zum Mund hoch, schloss seinen Soldatenmantel, setzte seine Mütze auf und zog sie über die Ohren. Dann stürzte er sich mit den Händen in den Taschen in die Kälte. Laut Wetterbericht sollte die Temperatur in der Nacht unter minus zehn Grad fallen.
Die eisige Luft schlug auf ihn ein, genauso fahl wie das Licht der Straßenlaternen. Das war ein Abend, um bei der Heilsarmee zu essen, sagte er sich. Sie hatte ihren Sitz im Palais de la Femme an der Ecke der Rue Faidherbe. Für zehn Francs würde er dort seine tausendvierhundert Kalorien bekommen.
Plötzlich schnürte es ihm die Kehle zu. Titi!, schrie er innerlich auf. Er sah wieder, wie man seinen Leichnam forttrug. Titi, er, die anderen, sie waren nichts. Nichts. Das war die verdammte Wahrheit. Er beschleunigte seine Schritte.
2
Erinnerungen, für nichts und wieder nichts
An diesem Abend beschloss Rico, Paris zu verlassen. Wenn schon krepieren, dann lieber in der Sonne, sagte er sich.
Alles, was ihm im Kopf umherschwirrte, seitdem er gesehen hatte, wie die Rettungsmannschaft Titis Leichnam wegschaffte, machte ihm klar: Er würde enden wie Titi. Es war eine Illusion zu glauben, dass er dem jemals entkommen und noch lange ein solches Scheinleben auf der Straße führen könnte.
Im Gegensatz zu anderen brauchte er sich allerdings nicht zu beklagen. Er hatte einen guten Schlafplatz und wurde in einigen Bars und von ein paar Händlern auf dem Aligre-Markt freundlich aufgenommen. Und wenn morgens das Postamt in der Rue des Boulets seine Tore öffnete, fand er Mitleid bei den Kunden. Aber das würde nicht immer so bleiben. Eines Tages wird er untergehen, wird ihm die Kraft ausgehen. Schon jetzt brachte er nichts Entscheidendes mehr zustande. Nur die Mechanismen der Gewohnheit funktionierten noch, nicht sein Wille.
Er streckte sich auf dem Rücken aus und rauchte eine Zigarette. Sein Magen krampfte sich zusammen. Es musste fünf Uhr sein. Hunger war der zuverlässigste Wecker. Er erinnerte sich an eine Bemerkung von Titi: »Als Kind dachte ich, dass Hunger so etwas wie Zahnschmerz ist, nur schlimmer. Inzwischen weiß ich, dass Hunger nichts Besonderes ist. Damit kommt man besser zurecht als mit Zahnschmerzen!« Rico lächelte. Titi und seine Zähne … schon längst hatte er einen nach dem anderen verloren!
Er griff nach der Wodkaflasche hinter sich und gönnte sich einen großen Schluck. Diese Flasche hatte er für fünfundsiebzig Francs bei einem arabischen Lebensmittelhändler im Faubourg Saint-Antoine erstanden, der die ganze Nacht geöffnet hatte. Einen Smirnoff. Das Bedürfnis nach starkem Alkohol war aufgekommen, als er den Palais de la Femme verlassen hatte. Das Linsengericht mit gepökeltem Schweinefleisch hatte seinen Magen besänftigt, aber weder seinen Schmerz noch seine Angst gelindert. Titis Tod hatte alle Schutzmauern durchbrochen, die er nach und nach zwischen seinem gegenwärtigen und seinem vergangenen Leben aufgebaut hatte.
Rico verzog das Gesicht. Die Flüssigkeit rann klebrig durch seine Kehle. Er hustete, kam wieder zu Atem und nahm einen weiteren Schluck. Mit geschlossenen Augen wartete er, bis sich die Wärme des Wodkas in seinem Körper ausbreitete, dann zog er an seiner Kippe und versuchte, wieder ein bisschen nachzudenken. Schon die ganze Nacht hatte er die Dinge in seinem Kopf hin und her gewälzt.
Ricos Schlupfwinkel lag an der Ecke Rue de la Roquette und Rue Keller. In einem Gebäude, das sich im Bau befand. In diesem Stadtteil riss man – wie in allen Arbeitervierteln – mit Volldampf die alten Wohnhäuser ab, um Luxusappartements zu bauen. Im Rathaus von Paris nannte man das »renovieren«.
Immer Ausschau haltend, hatte sich Rico an einem späten Nachmittag auf der Baustelle herumgetrieben. Das war vor sechs Monaten gewesen. Die Bauarbeiten schienen eingestellt worden zu sein, nachdem der sechs Etagen hohe Rohbau fertig war. Im Untergeschoss entdeckte er Garagen. Einzelstellplätze. In einer dieser Garagen richtete er sich für die Nacht ein. Eine sorgfältig zusammengefaltete Baufolie erwies sich als ausgezeichnete Matratze. Zum ersten Mal seit langer Zeit schlief er selig ein.
Um sechs Uhr überraschte ihn ein Wächter. Ein muskelbepackter Schwarzer in einer tadellosen blauen Uniform. Paris Security stand auf dem Wappen, das auf der linken Brusttasche aufgenäht war.
»Was zum Teufel machst du da?«
»Ich habe geschlafen.«
»Baustelle betreten verboten. Kannst du nicht lesen, Mann?«
»Betreten verboten, aber nicht schlafen«, scherzte Rico und raffte sein Zeug zusammen.
»Wo willst du hin?«
»Ich verzieh mich, oder?«
Der Wächter gab ihm eine Kippe und dann Feuer.
»Donnerwetter, eine Dunhill! So was hab ich schon lange nicht mehr gesehen.«
»Keine Eile. Du kannst hier bleiben.«
Sie musterten sich und zogen genüsslich an ihren Zigaretten.
»Ich hab nichts dagegen. Einverstanden.«
Der Wächter, er hieß Hyacinthe und war ein Madagasse, erklärte ihm, dass der Bauunternehmer Pleite gemacht hatte. Ein Firmenaufkäufer stand bereit, aber bis die Arbeiten wieder aufgenommen würden, könnte es noch dauern.
Rico richtete sich dort ein. Er holte all seine Sachen vom Gare de Lyon, die er dort auf zwei Schließfächer verteilt hatte: Rucksack, Schlafsack, Klamotten, einen kleinen Camping-Gaskocher, Kerzen, eine Porzellantasse und einige weitere Kleinigkeiten, die er hier und da aufgelesen hatte. Beim Aufstehen stopfte er alles unter die Folie, die ihm nachts als Matratze diente.
Jeden Morgen lud Hyacinthe Rico auf einen Kaffee und ein Croissant bei Bébert ein, einem Bistro weiter oben an der Straße, das sich störrisch weigerte, sich in diesem neuen Pariser Schickeriaviertel der neuesten Mode anzupassen.
»Ich war Wächter in einem Supermarkt am Stadtrand«, vertraute Hyacinthe ihm an. »Eines Nachmittags stieß ich auf einen Typ wie du …« Er nahm einen Schluck Kaffee. »Reg dich nicht auf Rico, das ist doch bloß eine Redensart, und es war mein Job, den Laden zu überwachen.«
»Ich weiß.«
»Der Typ schob einen Einkaufswagen mit ein paar Dosen Bier und einem Baguette vor sich hin. Ich sah, wie er in der Wurstabteilung stehen blieb. Er ließ sich eine Scheibe Schinken und ein Stück Pastete abschneiden und zog weiter durch die Regale …«
»Und begann zu essen!«
»Verdammt noch mal, so war es!«
»Das hab ich auch schon gemacht.«
»Als ich ihn wieder sah, trieb er sich bei den Fernsehern rum. In der Hand Brote mit Pastete und Schinken … Ich ließ ihn laufen. Er ging in aller Ruhe zur Kasse und bezahlte sein Bier, und … am Abend wurde ich gefeuert. Der Leiter der Wurstabteilung hatte mich verpfiffen.«
»Arschloch!«
»Arschlöcher gibt es jede Menge. Das sind dieselben, die keine Neger oder Araber ertragen können.«
»Warum bist du Wächter geworden?«
»Ich kann nichts anderes. Ich kann ja kaum lesen und schreiben. Und mein Job ist auch nicht schlimmer, als den Rambo in der Metro zu spielen!«
Als im Herbst die Arbeiten wieder aufgenommen wurden, beruhigte er Rico. Es gab keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Die Garagen würden erst zum Schluss drankommen. Rico musste sich nur vor der Ankunft der Arbeiter vom Acker machen, damit Hyacinthe keinen Ärger kriegte. Aber noch immer kam es Rico so vor, als ob er bis in die Puppen schlafen konnte.
Er konnte seine Gedanken schon lange nicht mehr in den Griff kriegen. Sie kamen in Schüben, völlig ungeordnet, und er hatte Schwierigkeiten, sich auf eine Sache zu konzentrieren.
Seine Zigarette begann ihm die Finger zu verbrennen, und er klammerte sich an die Erinnerung an seinen letzten festen Wohnsitz. Das war schon drei Jahre her. Er lebte mit Malika zusammen. Aber es war nicht die Begierde nach Malika, die ihm jetzt nicht aus dem Sinn ging. Sie erregte ihn nicht mehr. Ebenso wenig wie Julie oder Sophie, in die er wahnsinnig verliebt war. Frauen gehörten jetzt zu einer anderen Welt. Sie waren genauso unerreichbar wie ein Festessen in einem Edelrestaurant.
»Wie machen sie das?«, hatte Titi gefragt, während er einer hübschen Brünetten nachschielte, die auf und ab ging, während sie auf die Metro wartete.
Sie trug einen Minirock unter einem offenen Mantel.
»Wie machen sie was?«
»Dass sie mit halb nacktem Hintern rumlaufen können, ohne zu erfrieren.«
»Wahrscheinlich heizt es ihre Möse auf, dass sie uns erregen«, hatte Rico gescherzt.
»Wahrscheinlich …«
Aber Rico erregte das überhaupt nicht. Selbst die Vorstellung, seine Hand zwischen die Schenkel des Mädchens zu schieben, ließ seinen Schwanz völlig ungerührt. Er wichste seit langem nicht mehr. Sein Schwanz war schlapp, und kein Frauenbild brachte ihn dazu, sich zu verhärten und aufzurichten. Auch nicht das Bild von Sophie, wie sie sich umdrehte, damit er sie von hinten nehmen konnte. Nach einem kurzen Moment widerte ihn dieses Stück Fleisch, das zwischen seinen Fingern hin und her baumelte, an. Er ekelte sich.
»Ja«, nahm Titi den Faden wieder auf, ohne die Brünette aus den Augen zu lassen, »wir müssen uns wohl mindestens zehn blutige Steaks einverleiben, bis wir so eine Frau vögeln können.«
Sie war langsam an ihnen vorbeigegangen.
»Ham Sie vielleicht ’ne Kippe für mich und meinen Kumpel?«, hatte Titi gefragt.
Sie hatte gleichgültig mit den Schultern gezuckt.
»Wir sind nicht ihr Typ, mein Alter.«
So saßen sie da. Unfähig zu leben.
Rico drückte seine Zigarette aus und gönnte sich noch einen Schluck Wodka. Es wurde langsam warm in seinem Körper. Zum Nachdenken gab es nichts Besseres.
Er hatte Malika nichts nachgetragen. So war das Leben. Jedem das seine. Und in einem bestimmten Moment muss man seine Haut retten. Das hatte sie getan. Zwei Jahre hatten sie zusammengewohnt. In der Rue Lepic. Eine kleine Zweizimmerwohnung, die auf den Hof hinausging, in der sechsten Etage. Malika arbeitete in der Telefonzentrale einer Firma in Issy-les-Moulineaux. Wie diese Firma hieß, wusste er nicht. Er hatte einen Job als Bote bei einem Händler mit Pornovideos gefunden und lieferte Kassetten in den schicken Pariser Stadtteilen aus, zweifellos Hardcore.
Mit Malika und ihm lief es einigermaßen. Es war nicht das große Glück, aber es ging. Ein Leben, das dem normalen Leben anderer, die er auf der Straße traf, ähnelte. Nicht so wie vorher, als er mit Sophie zusammenlebte, aber gerade normal genug, um glauben zu können, dass man wieder auf die Beine kommen würde. Dass es einen Neuanfang geben würde.
Eines Tages wurde ihm sein Mofa geklaut. Sein Chef weigerte sich, ihm ein anderes zur Verfügung zu stellen.
»Du musst dich ranhalten. Kein Mofa, kein Job. Ich kann nicht für alle Schwachköpfe wie dich Mofas kaufen. Der Nächste, den ich einstelle, muss ein Fortbewegungsmittel mitbringen. Das ist meine Bedingung. Entweder du treibst bis morgen ein Mofa auf, oder du bist gefeuert.«
»Sie können mich mal am Arsch lecken!«
Rico wurde halsstarrig. Und er fand keinen anderen Job. Die Beziehung zu Malika wurde gespannt. Denn es wurde schwierig, zu zweit vom Mindestlohn und vom ergänzenden Arbeitslosengeld zu leben.
Die Zeit verging. Ein Jahr. Rico verplemperte das Arbeitslosengeld, indem er sich von Bar zu Bar soff. Malikas Geduld war zu Ende. Als er eines Abends volltrunken, wie so oft, nach Hause kam, war die Wohnung leer. Malika war ausgezogen und hatte fast alles mitgenommen, was ihnen gehörte. Sie hatte ihm nicht einmal ein Wort hinterlassen. »Na denn«, sagte er sich bloß, »das ist nicht das Ende der Welt.« Dann war er wieder runtergegangen und hatte an der Place Blanche noch ein paar Gläser getrunken.
Rico behielt die Wohnung. Die Mietschulden häuften sich. Die Einschreiben. Die Benachrichtigungen des Gerichtsvollziehers. Am Abend vor der Räumung machte er sich davon und nahm nur Klamotten und einige Kleinigkeiten mit, die sich auf der Straße als nutzlos erwiesen. Das Wenige, das Malika dagelassen hatte, hatte er schon lange verhökert. Darunter auch das, was dem Vermieter gehörte. Den kleinen Kühlschrank und die Herdplatte aus der Kochnische.
Es war Ende Mai. Frühlingsduft lag in der Luft. Rico schlief unter freiem Himmel, am Square Henri IV. Den ersten Morgen erlebte er als einen Morgen des Glücks und der Freiheit. Er hatte einen Schlussstrich gezogen und war zur Erforschung des Unbekannten aufgebrochen. Nach diesen erbärmlichen Jahren mit Malika fühlte er sich von allen Fesseln befreit.
Mit einem Rucksack auf dem Rücken begann er ein anderes Leben, wie ein Tourist in Paris. Er verjubelte sechzig Francs bei einem herrlichen Frühstück an der Place du Châtelet, mit frisch gepresstem Orangensaft, Kaffee, Croissants und gebuttertem Brot. Als er die Bar verließ, sagte er sich, dass das Leben auf der Straße schon nicht allzu hart werden würde. Schließlich war er ja gut in Form, oder? Die Stadt gehörte ihm.
Als Titi ihm die Geschichte von den Beatniks erzählte, musste Rico wieder an diesen ersten Morgen denken, ohne allerdings etwas davon zu sagen. On the road again, man stelle sich das mal vor, was für ein Schwachsinn! Denn sechs Monate später war klar, es gab keinen Weg mehr zurück. Was er mitgenommen hatte, nützte ihm nichts. Ans Wichtigste – gute Schuhe, ein Taschenmesser, eine Nagelschere, einen Schlafsack – hatte er nicht gedacht, so überzeugt war er gewesen, dass diese Situation nicht von Dauer sein würde.
Dafür hatte er allerlei Erinnerungsstücke.
»Nutzloser Plunder«, hatte Titi gesagt. »Du schleppst Briefe und Fotos mit dir rum. Das bringt dich nur zum Heulen und untergräbt die Moral. Wenn du alle Brücken hinter dir abbrechen willst, musst du sie zerreißen. Du musst dich entscheiden.«
Er hatte alles weggeschmissen. Sophies Briefe, ihre Fotos. Nur ein Bild von Julien hatte er aufgehoben. Ein Passfoto. Alles konnte er vergessen, aber nicht seinen Sohn.
Hyacinthe weckte ihn. »Verdammt, Rico, bist du verrückt! Weißt du, wie spät es ist? Es ist Arbeitsbeginn.«
Rico fühlte sich unwohl.
»Pack schleunigst deinen Kram zusammen.« Hyacinthe war stinksauer. Rico hatte zum ersten Mal ihre Vereinbarung gebrochen.
»Tut mir Leid«, sagte er und stand auf.
»Beeil dich!«
Rico räumte nichts auf. Er schob den ganzen Haufen unter die Folie. In diesem Moment war ihm alles egal, selbst Hyacinthe. Er wusste endlich, wohin er gehen wollte. Ein Ort zum Sterben.
»Ich verschwinde, Hyacinthe. Ich mach mich hier vom Acker.«
»Fang nicht an zu heulen. Ich hab nichts gesagt.«
»Das ist es nicht. Spätestens in zwei Tagen haue ich ab. Schluss, aus. Du wirst mich nicht wieder sehen. Ich gehe in den Süden. Nach Marseille. Marseille«, wiederholte er voller Freude.
Dort habe ich Rico getroffen. In Marseille. Und dort habe ich alles erfahren, was ich von ihm und diesem verdammten Leben weiß, mit dem jeder allein ist und jeder ein Verlierer.
3
Wo die Bitterkeit und die Größe von Träumen zum Durchbruch kommen
Marseille. In Ricos unruhigem, qualvollem und schlechtem Schlaf waren die Klischees von Marseille aufgetaucht. Zuerst langsam. Dann in Schüben. Straßen, Plätze, Bars. Und das Meer, die Strände, der weiße Felsen …
Diese Erinnerungen tauchten in seinem Kopf auf wie Postkarten aus der Vergangenheit. Als ob man endlich seine Adresse wieder gefunden hätte und ihm einen seit fünfzehn Jahren verschollenen Brief zustellte. Die Erinnerung an Marseille. Gute Bilder waren das.
»Ich liebe dich, Lea.«
»Ich liebe dich auch.«
Lea.