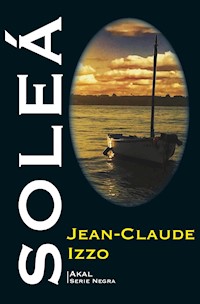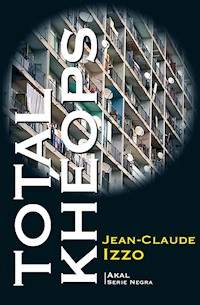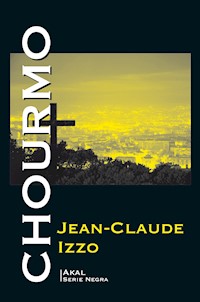8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Total Cheops kämpft Fabio Montale noch mit den Widersprüchen seiner Arbeit als Polizist, in Chourmo steigt er aus. In Solea, dem dritten Band der Marseille-Trilogie, kommt er wider Willen einer befreundeten Journalistin zu Hilfe, die monatelang über die südfranzösische Mafia recherchiert hat und jetzt von Killern verfolgt wird. In einem atemberaubenden Finale stößt er an seine Grenzen und geht den Weg, der ihm schon so lange vorgezeichnet ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
In Solea, dem dritten Band der Marseille-Trilogie, kommt Fabio Montale wider Willen einer befreundeten Journalistin zu Hilfe, die über die südfranzösische Mafia recherchiert hat und jetzt von Killern verfolgt wird. In einem atemberaubenden Finale stößt er an seine Grenzen und geht den Weg, der ihm schon so lange vorgezeichnet ist.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Jean-Claude Izzo (1945–2000) war lange Journalist. Sein erster Roman Total Cheops, 1995 veröffentlicht, wurde sofort zum Bestseller, seine Marseille-Trilogie zählt inzwischen zu den großen Werken der internationalen Kriminalliteratur.
Zur Webseite von Jean-Claude Izzo.
Katarina Grän (*1960) studierte Romanistik und Slawistik. Sie unternahm längere Reisen durch die USA und die Sowjetunion und absolvierte eine Ausbildung zur Rundfunkjournalistin. Sie ist als Krimiautorin und Übersetzerin tätig.
Zur Webseite von Katarina Grän.
Ronald Voullié (*1952) ist seit vielen Jahren Übersetzer »postmoderner« Philosophen wie Baudrillard, Deleuze, Guattari, Lyotard oder Klossowski. In den letzten Jahren kamen auch Übersetzungen von Kriminalromanen hinzu.
Zur Webseite von Ronald Voullié.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Jean-Claude Izzo
Solea
Marseille-Trilogie III
Kriminalroman
Aus dem Französischen von Katarina Grän und Ronald Voullié
Die Marseille-Trilogie III
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 1998 unter dem Titel Soléa bei Éditions Gallimard, Paris.
Die Übersetzung aus dem Französischen wurde unterstützt durch das Centre national du livre des Französischen Kulturministeriums.
Originaltitel: Solea
© by Éditions Gallimard, 1998
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Ogando, Köln
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30406-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.05.2024, 02:29h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
SOLEA
Anmerkung des AutorsProlog — Fern den Augen, nah dem Herzen, Marseille, immer1 — In dem das Herz manchmal deutlicher spricht als die Zunge2 — In dem Gewöhnung an das Leben noch keine Existenzberechtigung ist3 — In dem ein paar Illusionen im Leben nichts schaden4 — In dem Tränen das einzige Mittel gegen Hass sind5 — In dem selbst Nutzloses gut zu sagen und zu hören sein kann6 — In dem es oft die heimlichen Lieben sind, die man mit einer Stadt teilt7 — In dem es Fehler gibt, die nicht wieder gutzumachen sind8 — In dem man das, was man verstehen kann, auch verzeihen kann9 — In dem man lernt, dass es schwierig ist, die Toten zu überleben10 — In dem von einer Leichtigkeit die Rede ist, die jede menschliche Trauer wie auf den Schwingen einer Lachmöwe davonzutragen vermag11 — In dem es ums nackte Leben geht, bis zum letzten Atemzug12 — In dem die Frage nach dem Lebensglück in einer Gesellschaft ohne Moral gestellt wird13 — In dem es einfacher ist, anderen zu erklären, als selbst zu verstehen14 — In dem man auf den buchstäblichen Sinn des Ausdrucks tödliches Schweigen stößt15 — In dem durch das unmittelbare Bevorstehen eines Ereignisses eine Art von anziehender Leere entsteht16 — In dem die Partie ganz ungewollt auf dem Schachbrett des Bösen ausgetragen wird17 — In dem dargelegt wird, dass Rache zu nichts führt und Pessimismus auch nicht18 — In dem man dem Tod umso näher kommt, je weniger man dem Leben zugesteht19 — In dem es nötig ist, zu wissen, wie die Dinge gesehen werden20 — In dem es keine Wahrheit ohne bitteren Kern gibt21 — In dem es offensichtlich zu sein scheint, dass das Verderben blind istWorterklärungenMehr über dieses Buch
Stephan Güss: Fabio Montales Musik
Über Jean-Claude Izzo
Jean-Claude Izzo: Einige Zitate über über Izzo, Marseille, Schreiben und Essen
Alexandra Schwartzbrod: Begegnung am Ende der Trilogie
Über Katarina Grän
Über Ronald Voullié
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Jean-Claude Izzo
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Für Thomas,wenn er einmal groß ist.
Aber etwas sagte mir, dass es normal war, dass wir in bestimmten Momenten unseres Lebens Leichen küssen müssen.
Patrícia Melo
Anmerkung des Autors
Es muss wieder einmal gesagt werden. Dies ist ein Roman. Nichts von dem, was Sie lesen werden, hat existiert. Aber weil es mir unmöglich ist, der täglichen Zeitungslektüre gegenüber gleichgültig zu bleiben, wandelt meine Geschichte zwangsläufig auf den Pfaden des Realen. Denn dort spielt sich tatsächlich alles ab, in der Realität. Und der Schrecken in der Realität übertrifft bei weitem alle erdenklichen Fiktionen. Was Marseille angeht, meine Stadt, immer auf halbem Weg zwischen Licht und Dunkel, so wird es, wie es sein muss, zum Echo all dessen, was uns bedroht.
Prolog
Fern den Augen, nah dem Herzen, Marseille, immer
Ihr Leben war dort, in Marseille. Dort drüben hinter den Bergen, die heute Abend im glühenden Rot der untergehenden Sonne leuchteten. Morgen wird Wind aufkommen, dachte Babette.
Seit sie vor vierzehn Tagen nach Le Castellas, in ein kleines Nest in den Cevennen, gekommen war, stieg sie jeden Abend zum Bergkamm hinauf. Auf Brunos Ziegenpfad.
Hier bleibt alles gleich, hatte sie am Morgen ihrer Ankunft gedacht. Alles stirbt und erwacht zu neuem Leben. Auch wenn mehr Dörfer absterben als wiederaufleben. Früher oder später erfindet ein Mensch die alten Gepflogenheiten wieder. Und alles beginnt von neuem. Überwucherte Pfade bekommen erneut ihre Daseinsberechtigung.
»Die Berge bewahren unsere Erinnerung«, meinte Bruno und reichte ihr einen Becher schwarzen Kaffee.
Babette hatte Bruno 1988 kennen gelernt. Während ihrer ersten großen Reportage für die Zeitung: Zwanzig Jahre nach dem Mai 68: Was ist aus den Aufständischen geworden?
Bruno war als junger Philosoph und Anarchist im Quartier Latin in Paris auf die Barrikaden gegangen. Lauf, Genosse, die alte Ordnung ist hinter dir her. Das war seine einzige Parole gewesen. Er war gelaufen, hatte Pflastersteine und Molotowcocktails auf die Bereitschaftspolizei geworfen. Er war gerannt, mit Tränengas in den Augen und den Ordnungshütern im Nacken. Den ganzen Mai und Juni war er kreuz und quer gelaufen, nur um der Biederkeit, den Hirngespinsten, der Moral der alten Ordnung zu entkommen. Ihrer Verbohrtheit und Verkommenheit.
Als die Gewerkschaften die Übereinkünfte von Grenelle unterschrieben, die Arbeiter in die Fabrik und die Studenten in die Uni zurückkehrten, wusste Bruno, dass er nicht schnell genug gelaufen war. Er nicht und seine ganze Generation nicht. Die alte Ordnung hatte sie eingeholt. Im Mittelpunkt der Träume und der Moral stand wieder die Knete. Das einzige Lebensglück. Die alte Ordnung schuf sich eine neue Ära: das menschliche Elend.
So hatte Bruno Babette die Ereignisse geschildert. Er redet wie Rimbaud, hatte sie gedacht, gerührt und auch hingerissen von diesem gut aussehenden Mann um die vierzig.
Wie viele andere war er damals aus Paris geflohen. Richtung Ariège, Ardèche und Cevennen. In verlassene Dörfer. Lo Païs, das Land, wie sie gern auf Provenzalisch sagten. Aus den Scherben ihrer Illusionen entstand eine neue Welt. Naturverbunden und brüderlich. Gemeinschaftlich. Sie erfanden für sich ein neues Land. La France sauvage, das wilde Frankreich. Viele gingen nach ein oder zwei Jahren wieder zurück. Die Ausdauernderen hielten fünf oder sechs Jahre durch. Bruno hing an diesem Nest, das er wieder aufgebaut hatte. Allein, mit seiner Ziegenherde.
An jenem Abend hatte Babette nach dem Interview mit Bruno geschlafen.
»Bleib«, hatte er sie gebeten.
Aber sie war nicht geblieben. Das war nicht ihr Leben.
Im Laufe der Jahre hatte sie ihn immer wieder besucht. Jedes Mal, wenn sie in die Nähe kam. Bruno hatte mittlerweile eine Lebensgefährtin und zwei Kinder, Strom, Fernsehen, einen Computer und stellte Ziegenkäse und Honig her.
»Wenn du mal Probleme hast«, hatte er zu Babette gesagt, »komm her. Mach dir keine Sorgen. Bis da unten ins Tal leben nur Leute von uns.«
Heute Abend vermisste Babette Marseille besonders. Aber sie wusste nicht, wann sie dorthin zurückkehren konnte. Und selbst dann. Wenn sie eines Tages zurückkehrte, würde nichts, aber auch gar nichts mehr so sein wie früher. Was Babette quälte, waren keine Probleme, es war weit schlimmer. Der blanke Horror hatte sich in ihrem Kopf festgesetzt. Wenn sie die Augen schloss, sah sie Giannis Leichnam wieder vor sich. Und dahinter die toten Körper von Francesco und Beppe, die sie zwar nicht gesehen hatte, sich aber vorstellen konnte. Gefolterte, verstümmelte Leichen. In einer Lache aus schwarzem, geronnenem Blut. Und noch mehr Leichen. Hinter ihr. Vor ihr, überall. Zwangsläufig.
Als sie Rom Hals über Kopf und mit Angst im Nacken verlassen hatte, wusste sie nicht, wohin. Wo sie sicher wäre. Um in aller Ruhe über all das nachzudenken. Um ihre Papiere in Ordnung zu bringen, auszumisten, Informationen einzuordnen, aufeinander abzustimmen, zu sortieren, zu überprüfen. Die Reportage ihres Lebens abzuschließen. Über die Mafia in Frankreich und im Süden. Noch nie war jemand so weit gegangen. Zu weit, wie sie jetzt erkannte. Da hatte sie sich an Brunos Worte erinnert.
»Ich stecke in Schwierigkeiten. Bis zum Hals.«
Sie rief ihn aus einer Telefonzelle in La Spezia an. Es war fast ein Uhr morgens. Bruno schlief bereits. Er stand früh auf, wegen der Tiere. Babette zitterte. Wie vom Wahnsinn getrieben war sie in einem Rutsch von Orvieto nach Manarola gefahren. Vor zwei Stunden war sie in dem kleinen, auf einem Felsvorsprung gelegenen Dorf in Cinque Terre angekommen. Beppe, ein alter Freund von Gianni, lebte hier. Sie hatte ihn vorsichtshalber erst mal angerufen, wie er ihr geraten hatte. Das ist sicherer, hatte er noch am selben Morgen hinzugefügt.
»Pronto.«
Babette hatte aufgelegt. Das war nicht Beppes Stimme. Dann hatte sie die beiden Wagen der Carabinieri auf der Hauptstraße stehen sehen. Sie zweifelte nicht eine Sekunde. Die Killer waren ihr zuvorgekommen.
Sie war die ganze Strecke zurückgefahren, eine schmale, kurvenreiche Gebirgsstraße. Erschöpft klammerte sie sich ans Lenkrad, achtete jedoch aufmerksam auf die wenigen entgegenkommenden oder überholenden Wagen.
»Komm«, hatte Bruno gesagt.
Sie hatte ein armseliges Zimmer im Albergo Firenze e Continentale nicht weit vom Bahnhof gefunden. In der Nacht hatte sie kein Auge zugetan. Die Züge. Die greifbare Nähe des Todes. Alles kam ihr in Erinnerung, bis ins kleinste Detail. Ein Taxi hatte sie an der Piazza Campo dei Fiori abgesetzt. Gianni war aus Palermo zurückgekehrt. Er erwartete sie bei sich zu Haus. »Zehn Tage sind eine lange Zeit«, hatte er am Telefon gesagt. Auch für sie war es eine lange Zeit gewesen. Sie wusste nicht, ob sie Gianni liebte, aber ihr ganzer Körper sehnte sich nach ihm.
»Gianni! Gianni!«
Die Tür stand offen, aber sie hatte sich keine Gedanken darüber gemacht.
»Gianni!«
Er war da. An einen Stuhl gefesselt. Nackt. Tot. Sie schloss die Augen, aber zu spät. Sie wusste, dass sie von nun an mit diesem Bild leben musste.
Als sie die Augen wieder aufschlug, sah sie die Brandwunden an seinem Oberkörper, auf dem Bauch und an den Schenkeln. Nein, sie wollte nicht mehr sehen. Sie wandte den Blick ab von Giannis verstümmeltem Glied. Sie schrie. Sie sah sich schreiend, stocksteif mit hängenden Armen und weit aufgerissenem Mund. Ihr Schrei erstickte im Gestank von Blut, Scheiße und Pisse, der den Raum erfüllte. Die Luft blieb ihr weg, und sie musste kotzen. Zu Giannis Füßen. Dort, wo mit Kreide auf das Parkett geschrieben stand: »Geschenk für Mademoiselle Bellini. Bis später.«
Francesco, Giannis älterer Bruder, war am Morgen ihrer Abreise aus Orvieto ermordet worden. Beppe vor ihrer Ankunft.
Die Treibjagd hatte begonnen.
Bruno hatte sie an der Bushaltestelle in Saint-Jean-du-Gard abgeholt. Sie hatte nach jeder Etappe das Verkehrsmittel gewechselt: im Zug von La Spezia nach Ventimiglia, mit dem Leihwagen über den kleinen Grenzposten bei Menton, per Bahn bis Nîmes und schließlich mit dem Bus. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Denn sie glaubte nicht, dass sie ihr folgten. Sie würden bei ihr zu Hause in Marseille auf sie warten. Das war logisch. Und die Logik der Mafia war unerbittlich. In den zwei Jahren ihrer Recherche hatte sie das immer wieder feststellen können.
Kurz vor Le Castellas, dort wo die Straße am oberen Rand des Tals verlief, hatte Bruno seinen alten Jeep angehalten.
»Komm, gehen wir ein Stück.«
Sie waren zum Gipfel hinaufgestiegen. Le Castellas war kaum zu erkennen, drei Kilometer weiter am Ende eines Feldwegs. Weiter ging es nicht.
»Hier bist du sicher. Wenn jemand hochkommt, ruft Michel, der Förster, mich an. Und wenn es jemand über einen der Bergkämme versuchen sollte, sagt Daniel uns Bescheid. Wir haben unsere Gewohnheiten nicht geändert, ich rufe viermal täglich an, er ruft viermal an. Wenn einer von uns sich nicht zur verabredeten Zeit meldet, ist was passiert. Als Daniel mit seinem Traktor umgekippt war, haben wir es auf die Weise erfahren.«
Babette hatte ihn sprachlos angesehen. Sie brachte nicht einmal ein »Danke« heraus.
»Und: Du brauchst mir nichts zu erklären.«
Bruno hatte sie in die Arme genommen, und sie hatte losgeheult.
Babette fröstelte. Die Sonne war untergegangen, und die Berge vor ihr stachen lila vom Himmel ab. Sie drückte ihre Kippe sorgfältig mit der Fußspitze aus, stand auf und stieg wieder nach Le Castellas hinunter. Beruhigt durch das täglich wiederkehrende Wunder des Sonnenuntergangs.
In ihrem Zimmer las sie noch einmal den langen Brief an Fabio durch. Sie berichtete alles seit ihrer Ankunft in Rom vor zwei Jahren. Bis zum grausamen Ende. Ihre Verzweiflung. Aber auch ihre Entschlossenheit. Sie würde nicht aufgeben. Sie würde ihre Nachforschungen veröffentlichen. In einer Zeitung oder in einem Buch. »Das muss alles bekannt werden«, bekräftigte sie.
Sie hatte noch die Schönheit des Sonnenuntergangs vor Augen und wollte den Brief in diesem Sinne beenden. Fabio einfach nur sagen, dass die Sonne über dem Meer immer noch schöner ist, nein, nicht schöner, aber wahrer, nein, auch nicht, dass sie gern mit ihm in seinem Boot draußen auf dem Meer vor der Insel Riou gesessen und zugesehen hätte, wie die Sonne im Meer versank.
Sie zerriss den Brief. Auf ein leeres Blatt schrieb sie: »Ich liebe dich immer noch.« Und darunter: »Heb mir das gut auf.« Sie steckte fünf Disketten in einen wattierten Umschlag, klebte ihn zu und ging zum Abendessen mit Bruno und seiner Familie.
1
In dem das Herz manchmal deutlicher spricht als die Zunge
Das Leben stank nach Tod.
Das ging mir gestern Abend durch den Kopf, als ich Hassans Bar des Maraîchers betrat. Es war nicht nur so ein Gedanke, wie sie einem manchmal in den Sinn kommen, nein, ich roch den Tod wirklich um mich herum. Seinen Fäulnisgeruch. Widerlich. Ich hatte an meinem Arm gerochen. Es war abstoßend, derselbe Geruch. Auch ich stank nach Tod. Ich hatte mir gesagt: »Fabio, reg dich nicht auf. Du gehst jetzt nach Hause, nimmst schön eine Dusche und holst ganz ruhig dein Boot heraus. Etwas Frischluft vom Meer, und alles renkt sich wieder ein, du wirst schon sehen.«
Es war wirklich heiß. Mindestens dreißig Grad bei einer drückenden Mischung aus Feuchtigkeit und Luftverschmutzung. Marseille erstickte. Und das machte Durst. So war ich, statt den direkten Weg über den Alten Hafen und die Corniche zu nehmen – der kürzeste Weg zu mir nach Hause in Les Goudes –, in die schmale Rue Curiol am Ende der Canebière eingebogen. Die Bar des Maraîchers lag ganz oben, nur wenige Schritte von der Place Jean-Jaurès entfernt.
Bei Hassan fühlte ich mich wohl. Die Stammgäste verkehrten unabhängig von Alter, Geschlecht, Hautfarbe oder gesellschaftlicher Stellung miteinander. Dort war man unter Freunden. Wer hier seinen Pastis trank – da konnte man sicher sein –, wählte nicht Front National und hatte es nie getan. Kein einziges Mal in seinem Leben, wie manch anderer, den ich kannte. Hier in dieser Bar wusste jeder sehr genau, warum er nach Marseille und nirgendwo anders hin gehörte und warum er in Marseille lebte und nirgendwo sonst. In den Anisschwaden lag eine Vertrautheit, die schon in einem Blickwechsel Antwort fand: das Exil unserer Väter. Und das war beruhigend. Wir hatten nichts zu verlieren, weil wir schon alles verloren hatten.
Als ich hereinkam, sang Ferré:
Ich spüre Züge kommen,
beladen mit Brownings,
Berettas und schwarzen Blumen,
und Blumenhändler bereiten Blutbäder
für die Nachrichten in Farbe …
Ich hatte einen Pastis an der Theke genommen, dann hatte Hassan nachgeschenkt, wie üblich. Ich zählte sie sowieso nicht, die Gläser. Irgendwann, vielleicht beim vierten, hatte Hassan sich zu mir geneigt: »Findest du nicht, dass die Arbeiterklasse im Arsch ist?«
Genau genommen war das keine Frage. Eher eine Feststellung. Eine klare Aussage. Hassan war nicht von der geschwätzigen Art. Aber von Zeit zu Zeit warf er seinem Gegenüber gern einen kurzen Satz hin. Etwas zum Nachdenken.
»Was soll ich dazu sagen«, hatte ich geantwortet.
»Nichts. Es gibt nichts zu sagen. Alles geht seinen Gang. So ist das. Na, trink schon aus.«
Allmählich füllte sich die Bar, die Temperatur stieg noch ein paar Grad. Aber draußen, wo manche ein paar Gläschen zwitscherten, war es keinen Deut besser. Die Nacht hatte nicht die geringste Abkühlung gebracht. Die Haut klebte vor Feuchtigkeit.
Ich war hinausgegangen, um auf dem Bürgersteig mit Didier Perez zu reden. Er war zu Hassan hereingekommen und, kaum hatte er mich gesehen, direkt auf mich zugesteuert.
»Dich hab ich gesucht.«
»Du hast Glück, eigentlich wollte ich fischen gehen.«
»Gehen wir raus?«
Es war Hassan, der mir Perez eines späten Abends vorgestellt hatte. Perez war Maler. Fasziniert von der Magie der Zeichen. Wir waren etwa gleich alt. Seine Eltern stammten aus Almería und waren nach Francos Sieg nach Algerien ausgewandert. Er selbst war dort geboren. Als Algerien unabhängig wurde, hatten weder er noch seine Eltern Zweifel, was ihre Staatszugehörigkeit betraf: Sie waren Algerier.
Perez hatte Algier 1993 verlassen. Als Lehrer an der Kunsthochschule war er einer der Führer der Föderation algerischer Künstler, Intellektueller und Wissenschaftler. Als die Morddrohungen sich zuspitzten, rieten Freunde ihm, sich für eine Weile abzusetzen. Er war gerade mal eine Woche in Marseille, als er hörte, dass der Direktor und sein Sohn innerhalb der Schulmauern ermordet worden waren. Er beschloss, mit seiner Frau und seinen Kindern in Marseille zu bleiben.
Es war seine Begeisterung für die Tuareg, die mich auf Anhieb für ihn einnahm. Die Wüste kannte ich nicht, aber das Meer. Es schien mir das Gleiche zu sein. Wir hatten lange darüber gesprochen. Über Erde und Wasser, Staub und Sterne. Eines Abends schenkte er mir einen Silberring, der mit Punkten und Strichen versehen war.
»Er kommt von dort. Die Zusammensetzung der Punkte und Linien ist das Khaten, verstehst du. Es sagt, was aus den Menschen wird, die du liebst und die fortgegangen sind, und was die Zukunft dir bringt.«
Perez hatte mir den Ring in die hohle Hand gelegt.
»Ich weiß nicht, ob ich das wirklich wissen will.«
Er hatte gelacht.
»Keine Sorge, Fabio. Du müsstest die Zeichen lesen können. Das Khat el R’mel. Und ich denke nicht, dass morgen schon aller Tage Abend ist! Aber was geschrieben steht, steht geschrieben, wie dem auch sei.«
Ich hatte noch nie im Leben einen Ring getragen. Nicht mal den meines Vaters, nach seinem Tod. Ich hatte einen Moment gezögert, dann hatte ich den Ring auf meinen linken Ringfinger gestreift. Wie um mein Leben endgültig mit meinem Schicksal zu verknüpfen. An jenem Abend hatte ich das Gefühl, endlich alt genug dafür zu sein.
Auf dem Bürgersteig tauschten wir, die Gläser in der Hand, einige Banalitäten aus, dann legte Perez mir den Arm um die Schulter.
»Ich hab eine Bitte.«
»Schieß los.«
»Ich erwarte jemanden, einen Freund aus meiner Heimat. Es wäre schön, wenn du ihn aufnehmen könntest. Nur für eine Woche. Bei mir ist es zu eng, du weißt ja.«
Er starrte mich mit seinen schwarzen Augen an. Ich hatte auch nicht mehr Platz. Die Hütte, die ich von meinen Eltern geerbt hatte, bestand nur aus zwei Zimmern. Ein kleines Schlafzimmer und eine große Wohnküche. Ich hatte die Hütte so gut ich konnte zusammengeflickt, schlicht und ohne sie mit Möbeln voll zu stopfen. Ich fühlte mich wohl dort. Die Terrasse ging aufs Meer hinaus. Acht Stufen tiefer lag mein Boot, ein Fischerboot, das ich meiner Nachbarin Honorine abgekauft hatte. Perez wusste das. Ich hatte ihn mehrfach mit seiner Frau und ein paar Freunden zum Essen eingeladen.
»Ich wäre ruhiger, wenn er bei dir ist«, fügte er hinzu.
Jetzt sah ich ihn an.
»Einverstanden, Didier. Wann kommt er?«
»Ich weiß noch nicht. Morgen, übermorgen, in einer Woche. Keine Ahnung. Es ist nicht leicht, du weißt ja. Ich ruf dich an.«
Als er gegangen war, setzte ich mich wieder an die Bar. Trank mit dem einen oder anderen und natürlich mit Hassan, der keine Runde ausließ. Ich lauschte den Gesprächen. Und der Musik. Nach der offiziellen Stunde für den Aperitif spielte Hassan jetzt Jazz statt Ferré. Er suchte die Stücke sorgfältig aus. Als ob er den richtigen Ton für die jeweilige Stimmung treffen wollte. Der Tod zog sich zurück, sein Geruch. Und kein Zweifel, ich bevorzugte den Anisgeruch.
»Ich ziehe den Anisgeruch vor«, hatte ich Hassan zugerufen.
Ich begann, langsam betrunken zu werden.
»Klar.«
Er hatte mir zugezwinkert. Ganz Komplize. Und Miles Davis hatte Solea angestimmt. Das Stück verehrte ich. Seit Lole mich verlassen hatte, hörte ich es nachts pausenlos.
»Die soleá«, hatte sie eines Abends erklärt, »ist das Rückgrat des gesungenen Flamenco.«
»Warum singst du eigentlich nicht? Flamenco, Jazz …«
Sie hatte eine wunderschöne Stimme, das wusste ich. Pedro, einer ihrer Cousins, hatte es mir anvertraut. Aber Lole hatte sich immer geweigert, außerhalb des Familienkreises zu singen.
»Ich habe noch nicht gefunden, was ich suche«, hatte sie nach langem Schweigen geantwortet.
Genau dieses Schweigen fand sich bei intensivem Zuhören im Spannungsbogen der soleá wieder.
»Du verstehst überhaupt nichts, Fabio.«
»Was sollte ich denn verstehen?«
Sie hatte mich traurig angelächelt.
Das war während der letzten Wochen unseres gemeinsamen Lebens. Eine dieser Nächte, in der wir endlos diskutierten bis zur Erschöpfung, eine Kippe nach der anderen rauchten und in großen Zügen Lagavulin tranken.
»Sag es mir, Lole, was sollte ich verstehen?«
Sie hatte sich von mir entfernt, das spürte ich. Jeden Monat etwas weiter. Sogar ihr Körper hatte sich verschlossen. Die Leidenschaft hatte sich aus ihm zurückgezogen. Unser Begehren war nicht mehr erfinderisch. Wir hielten nur noch eine alte Liebesgeschichte aufrecht. Die Sehnsucht nach einer Liebe, die es eines Tages hätte geben können.
»Das ist nicht zu erklären, Fabio. Es geht um die Tragik des Lebens. Du hörst seit Jahren Flamenco und fragst dich immer noch, was es zu verstehen gibt.«
Es war ein Brief, ein Brief von Babette, der all das ausgelöst hatte. Ich hatte Babette kennen gelernt, als ich zum Leiter der Brigade sicherheitsgefährdeter Gebiete in den nördlichen Vierteln Marseilles ernannt worden war. Sie stand am Anfang ihrer journalistischen Karriere. Ihre Zeitung, La Marseillaise, hatte sie eher zufällig für das Interview mit dem seltenen Vogel ausgesucht, den die Polizei an die Front geschickt hatte, und wir waren im Bett gelandet. »Liebhaber in Transit« nannte Babette uns gern. Eines Tages waren wir dann Freunde geworden. Ohne uns jemals unsere Liebe gestanden zu haben.
Vor zwei Jahren hatte sie einen italienischen Rechtsanwalt kennen gelernt. Gianni Simeone. Die Liebe schlug ein wie der Blitz. Sie war ihm nach Rom gefolgt. So, wie ich sie kannte, nicht nur aus Liebe. Ich hatte mich nicht geirrt. Ihr geliebter Rechtsanwalt war auf Mafiaprozesse spezialisiert. Und das war seit Jahren ihr Traum, seit sie als freie Reporterin groß rausgekommen war: die bislang gründlichste Untersuchung über die Verbindungen und den Einfluss der Mafia in Südfrankreich zu schreiben.
Babette hatte mir das alles erzählt, wie weit sie mit ihrer Arbeit war und was noch zu tun blieb, als sie wegen einiger lokaler wirtschaftlicher und politischer Hintergrundinformationen noch einmal nach Marseille gekommen war. Wir trafen uns drei- oder viermal zu gegrilltem Seewolf mit Fenchel bei Paul in der Rue Saint-Saëns und unterhielten uns über dies und jenes. Eins der wenigen Restaurants am Hafen, außer dem Oursin, in dem wir nicht wie Touristen abgefertigt wurden. Die gespielte Verliebtheit bei unseren Wiedersehen war mir angenehm. Aber ich konnte nicht sagen, warum. Ich konnte es mir nicht erklären. Und Lole natürlich erst recht nicht.
Als Lole dann aus Sevilla zurückkam, wo sie ihre Mutter besucht hatte, sagte ich ihr nichts von Babette und unseren Treffen. Lole kannte ich seit meiner Jugend. Sie hatte Ugo geliebt. Danach Manu. Schließlich mich. Den letzten Überlebenden unserer Träume. Mein Leben barg keine Geheimnisse für sie. Auch nicht die Frauen, die ich geliebt und verloren hatte. Aber von Babette hatte ich ihr nie erzählt. Was zwischen uns gewesen war, schien mir zu kompliziert. Was noch zwischen uns war.
»Wer ist das, diese Babette, der du sagst, dass du sie liebst?«
Sie hatte einen Brief von Babette geöffnet. Versehentlich oder aus Eifersucht, was macht das schon für einen Unterschied. »Warum hat das Wort Liebe nur so viele verschiedene Bedeutungen«, hatte Babette geschrieben. »Wir haben uns gesagt, dass wir uns lieben …«
»›Ich liebe dich‹ heißt nicht gleich ›Ich liebe dich‹«, hatte ich später gestammelt.
»Sag das noch mal.«
»Wie soll ich sagen: Ich liebe dich aus Treue zu einer Liebesgeschichte, die es nie gegeben hat, und ich liebe dich wegen einer wahren Liebesgeschichte, die sich jeden Tag aus tausend kleinen Glücksmomenten zusammensetzt.«
Ich war nicht offen genug gewesen. Nicht ehrlich genug. Ich hatte mich in falschen Erklärungen verheddert. Wirr und immer wirrer. So hatte ich Lole am Ende einer schönen Sommernacht verloren. Wir saßen beim Rest einer Flasche Weißwein aus Cinque Terre auf meiner Terrasse. Ein Vernazza, ein Mitbringsel von Freunden.
»Wusstest du das?«, hatte sie gefragt. »Wenn man nicht mehr leben kann, hat man das Recht zu sterben und mit seinem Tod noch ein letztes Mal die Funken sprühen zu lassen.«
Seit Lole gegangen war, hatte ich mir ihre Worte zu Eigen gemacht. Und ich suchte den Funken. Verzweifelt.
»Was hast du gesagt?«, fragte Hassan.
»Hab ich was gesagt?«
»Ich dachte.«
Er hatte eine neue Runde eingeschenkt, sich zu mir herübergeneigt und hinzugefügt: »Manchmal spricht das Herz deutlicher als die Zunge.«
Ich hätte es dabei belassen, austrinken und nach Hause fahren sollen. Das Boot rausholen, hinter den Riou-Inseln aufs Meer hinausfahren und den Sonnenaufgang beobachten. Was mir im Kopf herumging, machte mir Angst. Der Geruch des Todes drängte sich wieder auf. Ich hatte den Ring von Perez mit den Fingerspitzen gestreift, ohne mir sicher zu sein, ob das ein gutes oder schlechtes Omen war.
Hinter mir hatte sich ein seltsamer Streit zwischen einem jungen Mann und einer Frau um die vierzig entfacht.
»Verdammt!«, hatte der junge Mann sich aufgeregt. »Du spielst dich auf wie die Merteuil!«
»Wer ist denn das?«
»Madame de Merteuil. Aus einem Roman. Gefährliche Liebschaften.«
»Kenn ich nicht. Ist das eine Beleidigung?«
Darüber musste ich lächeln, und ich hatte Hassan gebeten, mir noch einen einzuschenken. In dem Moment kam Sonia herein. Das heißt, da wusste ich noch nicht, dass sie Sonia hieß. Ich war dieser Frau in letzter Zeit öfter begegnet. Das letzte Mal im Juni beim Sardinenfest in L’Estaque. Wir hatten nie miteinander gesprochen.
Nachdem sie sich einen Weg zur Bar gebahnt hatte, zwängte Sonia sich zwischen einen Gast und mich. Eng an mich.
»Sagen Sie nicht, dass Sie mich gesucht haben.«
»Warum?«
»Weil mich damit heute Abend schon ein Freund überrascht hat.«
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht.
»Ich habe Sie nicht gesucht. Aber ich freue mich, Sie hier zu finden.«
»Nun, ich auch. Hassan, gib der Dame was zu trinken.«
»Sie heißt Sonia, die Dame«, hatte er gesagt.
Er brachte ihr einen Whisky auf Eis. Ohne zu fragen. Wie einem Stammgast.
»Auf uns, Sonia.«
In dem Moment geriet die Nacht aus den Fugen. Als wir mit unseren Gläsern anstießen. Und Sonias graublaue Augen in meine blickten. Ich bekam einen Steifen. So heftig, dass es fast wehtat. Die Monate hatte ich nicht gezählt, aber es war Ewigkeiten her, seit ich mit einer Frau geschlafen hatte. Ich glaube, ich hatte beinahe vergessen, dass man einen Steifen bekommen kann.
Weitere Runden folgten. Erst an der Bar, dann an einem kleinen Tisch, der gerade frei geworden war. Sonias Schenkel klebte an meinem. Brennend. Ich kann mich erinnern, dass ich mich fragte, warum die Dinge immer so schnell passieren. Liebesgeschichten. Man wünscht immer, es würde zu einem anderen Zeitpunkt geschehen, wenn man in Hochform ist, wenn man für den anderen bereit ist. Eine andere. Einen anderen. Ich dachte, dass wir letztendlich gar keine Kontrolle über unser Leben haben. Und noch vieles mehr. Aber ich konnte mich nicht daran erinnern. Auch nicht an alles, was Sonia mir erzählt haben mochte.
An das Ende der Nacht erinnere ich mich überhaupt nicht.
Und das Telefon klingelte.
Das Telefon klingelte und stach mir in die Schläfen. In meinem Schädel tobte ein Orkan. Mit übermenschlicher Anstrengung öffnete ich die Augen. Ich lag nackt auf meinem Bett.
Das Telefon klingelte immer noch. Scheiße! Warum vergaß ich immer, den verdammten Anrufbeantworter einzuschalten!
Ich rollte mich auf die Seite und streckte den Arm aus.
»Ja.«
»Montale.«
»Falsch verbunden.«
Ich legte auf.
Keine Minute später klingelte es wieder. Dieselbe unsympathische Stimme. Mit einem Anflug von italienischem Akzent.
»Du siehst, die Nummer stimmt. Sollen wir lieber vorbeikommen?«
Das war nicht die Art Weckruf, die ich mir erträumt hatte. Aber die Stimme des Typen versetzte mir Stiche wie eine eiskalte Dusche. Sie ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Diesen Stimmen konnte ich ein Gesicht zuordnen, einen Körper, und ich konnte sogar sagen, wo ihre Knarre steckte.
Ich befahl Ruhe im Innern meines Kopfes.
»Ich höre.«
»Nur eine Frage. Weißt du, wo Babette Bellini ist?«
Das war keine eiskalte Dusche mehr in meinen Adern. Sondern Polarkälte. Ich begann zu zittern. Ich zog an der Decke und wickelte mich darin ein.
»Wer ist da?«
»Stell dich nicht dumm, Montale. Deine kleine Freundin, Babette, diese Dreckschleuder. Weißt du, wo wir sie finden können?«
»Sie war in Rom«, stieß ich hervor, weil ich mir dachte, wenn sie sie hier suchen, kann sie da nicht mehr sein.
»Da ist sie nicht mehr.«
»Sie muss vergessen haben, mir Bescheid zu sagen.«
»Interessant«, lachte der Typ hämisch.
Es folgte Schweigen. So schwer, dass mir die Ohren summten. »Ist das alles?«
»Du wirst Folgendes tun, Montale. Wie du es anstellst, ist mir egal, aber du wirst versuchen, deine Freundin für uns zu finden. Sie hat ein paar Sachen, die wir gern wieder hätten, verstehst du. Da du ja eh nichts Vernünftiges zu tun hast, müsste das ziemlich schnell gehen, nicht wahr?«
»Fahr zur Hölle!«
»Wenn ich wieder anruf, reißt du das Maul nicht mehr so weit auf, Montale.«
Er legte auf.
Das Leben stank nach Tod, ich hatte mich nicht geirrt.
2
In dem Gewöhnung an das Leben noch keine Existenzberechtigung ist
Sonia hatte eine Notiz neben den Autoschlüsseln auf dem Tisch hinterlassen. »Du warst zu voll. Schade. Ruf mich heute Abend an. Gegen sieben. Kuss.« Ihre Telefonnummer folgte. Die entscheidenden zehn Ziffern einer Einladung zum Glück.
Sonia. Ich lächelte bei der Erinnerung an ihre grau-blauen Augen, ihren heißen Schenkel an meinem. Und auch an ihr Lächeln, wenn es ihr Gesicht erhellte. Meine einzigen Erinnerungen an sie. Aber doch schöne Erinnerungen. Ich konnte den Abend kaum erwarten. Mein Glied auch nicht, es regte sich schon in meinen Shorts, wenn ich nur an sie dachte.
Mein Kopf war schwer wie ein Gebirge. Ich zögerte zwischen Dusche und Kaffee. Der Kaffee gewann. Und eine Zigarette. Der erste Zug zerriss mir die Eingeweide. Ich dachte, sie würden mir hochkommen. »Sauerei!«, fluchte ich und nahm noch einen Zug, aus Prinzip. Der zweite Anfall von Übelkeit war noch heftiger. Er übertraf die Hammerschläge in meinem Schädel um Längen.
Ich krümmte mich über der Küchenspüle zusammen. Aber ich hatte nichts zu erbrechen. Nicht einmal meine Lungen. Noch nicht! Wo war die Zeit geblieben, in der ich mit dem ersten Zug aus der ersten Zigarette sämtliche Lebensgeister in mir weckte? Lang, lang vergangen. Die Dämonen, Gefangene meiner Brust, hatten nicht mehr viel zu fressen. Weil Gewöhnung an das Leben noch keine Existenzberechtigung ist. Das Würgegefühl in meinem Hals erinnerte mich jeden Morgen daran.
Ich hielt den Kopf unter den Kaltwasserstrahl und stöhnte laut auf, dann reckte ich mich und holte tief Luft, ohne die Kippe loszulassen, die mir die Finger verbrannte. Ich trieb in letzter Zeit nicht mehr genug Sport. Ging auch nicht mehr oft genug in den Buchten wandern. Oder trainierte regelmäßig in Mavros’ Boxstudio. Gutes Essen, Alkohol, Zigaretten. »In zehn Jahren bist du tot, Montale«, sagte ich mir. »Tu was, verdammt noch mal!« Sonia fiel mir wieder ein. Mit mehr und mehr Lust. Dann schob sich Babettes Bild über Sonias.
Wo steckte Babette? Worauf hatte sie sich da eingelassen? Der Kerl am Telefon hatte keine leeren Drohungen ausgestoßen. Jedes Wort wog zentnerschwer, das hatte ich gespürt. Sein schneidender Ton. Ich drückte die abgebrannte Zigarette aus und zündete eine neue an, während ich mir Kaffee einschenkte. Ich nahm einen großen Schluck, sog den Rauch tief ein und ging auf die Terrasse hinaus.
Die sengende Sonne schlug mir brutal entgegen. Flimmerte vor den Augen. Schweiß floss aus allen Poren. Mir wurde schwindlig. Einen Augenblick dachte ich, ich würde umkippen. Aber nein. Der Boden meiner Terrasse fand sein Gleichgewicht wieder. Ich machte die Augen wieder auf. Dort vor mir lag das einzige Geschenk des Lebens, das ich jeden Tag bekam. Unversehrt. Das Meer. Der Himmel. Bis zum Horizont. In diesem unvergleichlichen Lichtspiel zwischen beiden. Oft dachte ich, dass mit einer Frau zu schlafen etwas von diesem grenzenlosen Glück festhielt, das vom Himmel auf das Meer hinabsteigt.
Hatte ich Sonias Körper in jener Nacht an mich gedrückt? Wenn Sonia mich nach Hause begleitet hatte, wie war sie dann zurückgekommen? Hatte sie mich ausgezogen? Hatte sie hier geschlafen? Mit mir? Hatten wir uns geliebt? Nein. Nein, du warst zu besoffen. Sie hat es dir geschrieben.
Honorines Stimme riss mich aus meinen Gedanken.
»Sagen Sie mal, haben Sie gesehen, wie spät es ist!«