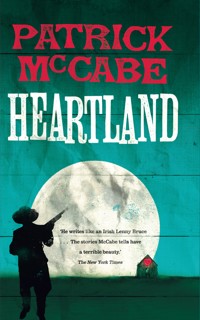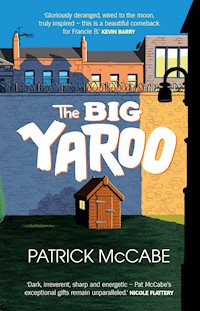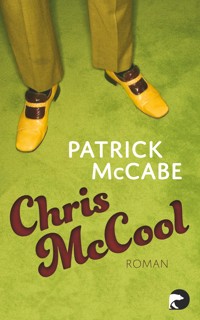
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Chris McCool ist siebenundsechzig Jahre alt und so richtig zufrieden. Seine Freunde sagen, er sehe aus wie Roger Moore, und seine halb so alte, attraktive Freundin liest ihm jeden Wunsch von den Lippen ab. Sicher, als verstoßener, unehelicher Bastard einer Protestantin aus besserem Hause und einem katholischen Bauernlümmel war er für die Protestanten Katholik und für die Katholiken Protestant. Das ist durchaus ein Problem in Irland. Aber wenn er in seinem Ford Cortina durch die Straßen kreuzte, waren ihm alle Blicke sicher, die begehrlichen wie die neidischen. Doch dann waren da dieser Zwischenfall mit Ethel Baid, die geschändete katholische Kirche, die Missverständnisse mit Marcus Otoyo und die unangenehmen Geschichten aus der Irrenanstalt. In Die heilige Stadt präsentiert uns Patrick McCabe einen Erzähler, dessen Geschichte mit jeder Seite fadenscheiniger und löchriger wird. Es sind wohl kultivierte Löcher in der Erinnerung eines Mannes, der gegen die Wut, die Trauer und den Wahn anredet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Berlin Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-8270-7538-3
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »The Holy« bei Bloomsbury Publishing plc, London
© 2009 Patrick McCabe
Für die deutsche Ausgabe
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin 2009
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München, unter Verwendung einer Illustration von ©FinePic®, München
Datenkonvertierung: Greiner & Reichel, Köln
1
C. J. Pops, internationaler Star
Nun, da man in sein siebenundsechzigstes Lebensjahr eintritt, kann man sich kaum daran erinnern, je zuvor ein so seliges Maß an Zufriedenheit erfahren zu haben. Willkommen im Happy Club, wo unser Glück und Wohlbefinden stetig zunimmt. Und sich die Verbindung zwischen der reizenden Vesna und ihrem pflichtbewussten, ehrerbietigen, stets verständnisvollen Ehemann weiter vertieft: meiner Wenigkeit, Chris J. McCool – stets zu Diensten, nennen Sie mich einfach Pops.
Mir ist nicht entgangen, dass kürzlich darauf hingewiesen wurde, wie gut ich für mein Alter aussehe – und das, wie ich hinzufügen möchte, trotz einer Hüftoperation, der ich mich jüngst unterziehen musste und die den Gebrauch eines Gehstocks erforderlich macht. Nicht selten wird in diesem Zusammenhang großzügig und spontan das Wort schneidig verwendet. Eine so gutmütige Anerkennung meiner Verfassung animiert mich täglich dazu, mich wie in alten Tagen herauszuputzen: der eleganteste aller schmucken blauen Blazer mit blank polierten Messingknöpfen, weiße Slipper und graue Hose mit messerscharfen Bügelfalten, lässig eine Peter-Stuyvesant-King-Size-Zigarette (Der Duft der großen weiten Welt!) zwischen den Lippen. Um das Bild abzurunden, ein winziger Hauch Monte Carlo Man, das teuerste Rasierwasser auf dem Markt – spleenig, Pops, wenn so was dein Fall ist! Spaß beiseite – einen solchen Duft gibt’s natürlich gar nicht. Old Spice reicht vollkommen aus, ein großzügiger Spritzer auf das markante Kinn von Christopher J. McCool, »Geschäftsmann im Ruhestand«, »Bürger von Cullymore« und eleganter Lebemann von gewisser lokaler Bedeutung.
Beiläufige, vielleicht flapsige, aber durchaus schmeichelhafte Andeutungen unterstellen mir, der ich als groß und stattlich gelte, eine mehr als flüchtige Ähnlichkeit mit einem gewissen Roger Moore, dem lässigen, weltmännischen, durch nichts aus der Fassung zu bringenden Film- und Bühnenstar. Der uns vielleicht am besten dank seiner Verkörperung Simon Templars, des Heiligen, in Erinnerung ist, eines selbsternannten »Weltenbummlers und Country-Club-Schwätzers«, einer Fernsehberühmtheit der mittleren und späten Sechziger. Und in späteren Jahren natürlich dank seiner Verkörperung einer weiteren Nachkriegs-Ikone, des außerordentlich kultivierten James Bond (»Lizenz zum Töten«), Ian Flemings ebenso unvergesslicher Schöpfung. Wäre er mit dieser Information vertraut gewesen – sie hätte meinem allerliebsten alten Papa zweifellos die größte Freude bereitet. Denn Dr. Thornton war selbst ein durchaus kultivierter Gentleman, der dem edelsten, nachweislich protestantischen Geschlecht entstammte.
Sein im Stil des Palladianismus erbautes, von üppigen, sorgfältig gepflegten Gärten umgebenes Herrenhaus aus dem achtzehnten Jahrhundert verfügte über eine Kunstsammlung von unschätzbarem Wert, »königliche« Stallungen sowie eine absurde Anzahl geräumiger, luxuriös ausgestatteter Zimmer. Ganz zu schweigen von der umfangreichen getäfelten Bibliothek, wo eine Unzahl von in Leder gebundenen Buchrücken im bernsteingelben Feuerschein glänzte, denn Vater war Literaturkritiker und Essayist. Unter seinen erlesenen Schätzen befanden sich einige der kostbarsten Werke der Weltliteratur. Vor allem jene von James Joyce, darunter Dubliner und Ein Porträt des Künstlers als junger Mann. Ein Band, den ich in späteren Jahren aus vielerlei Gründen übermäßig, zugegebenermaßen geradezu zwanghaft, lieb gewinnen sollte. Wie stolz wäre er auf meine künstlerischen Neigungen gewesen!
Wer weiß, vielleicht hätten sie ihn umstimmen können? In dem Maße, dass er sich dazu durchgerungen hätte, mich als vollkommen vernünftigen und wertvollen Menschen zu betrachten. Noch dazu als seinen Sohn und Erben. Obwohl ich im hintersten Winkel einer Scheune gezeugt worden bin, von einem Vertreter jener allerabscheulichsten Gattung, die er von ganzem Herzen verachtete und die er routinemäßig als »katholischen Abschaum« bezeichnete.
2
Bleib bei mir
Belebt durch die bescheidene Ruhe des Happy Club, habe ich es mir in jüngster Zeit zur Aufgabe gemacht, die Neuausstattung unserer hübschen Wohnung in der vierten Etage gewissenhaft voranzutreiben. Zu meinen jüngsten Anschaffungen zählen ein wunderbar reich verzierter marokkanischer Teppich, den ich im Internet bestellt, und ein Peter-Blake-Poster der Sängerin Alma Cogan, das ich – ob Sie’s glauben oder nicht – tatsächlich hier in Cullymore East aufgespürt habe, in einem kleinen Antiquitätenladen an der Plaza. Außerdem ein reizender Mahagonicouchtisch samt poliertem eingelassenem Schachbrett, das mir lange Stunden der Unterhaltung beschert, wenn ich nicht gerade Andy Williams höre oder die Carpenters, besonders einen ihrer Songs, der den perfekten Soundtrack für unser neues Leben bereitzustellen scheint.
– We’ve only just begun, singt Karen mit ihrer warmen, hypnotisierenden Stimme, einer Stimme wie geschmolzenes Karamell, während ich den Kopf an den tröstenden Busen meiner geliebten Vesna schmiege, genüsslich an meiner Peter Stuyvesant ziehe und verträumt zu den Sternen aufblicke.
– Can’t take my eyes off you, flötet Andy, während Vesna lächelt und ich ihr mit den Fingern durchs Haar fahre, ihre zierlichen Schultern und ihren blassen, sommersprossigen Arm küsse und ihr ins Ohr flüstere:
– In der Heiligen Stadt der Liebe umschlingen wir zwei einander für immer.
In der Regel gehen wir jetzt früh zu Bett, und ich kann mir nichts Gemütlicheres vorstellen, als in dieser behaglichen Stille, die wir eindeutig zu unserer gemacht haben, einfach so neben ihr zu liegen. Vesna sieht wie immer bezaubernd aus, und im Licht schimmert der Helm ihres Haares wie Platin. Mit ihrem Dreamland-Nachthemd und dem Max-Factor-Make-up gibt sie das perfekte Model ab. Genauso umwerfend wie, sagen wir, Grace Kelly oder wie die unnahbare, aber elegante Kim Novak in Hitchcocks Vertigo. Das war immer schon einer meiner Lieblingsfilme. Wir gehen kaum noch aus. Eheglück – unser ureigenster Club.
– To Sir With Love, singt Lulu – ebenfalls einer unserer Lieblingssongs »für ruhige Stunden«.
Dann lösche ich in unserem Happy-Club-Zuhause die Lichter, knabbere zärtlich an ihrem Ohrläppchen, beuge mich zu ihr und flüstere:
– Nacht, Vesna.
– Nacht, Nacht, Christopher. Chris, mein liebster, charmanter Kavalier.
Obwohl sie das Wort »Kavalier« natürlich nicht benutzt. Denn Vesna, das arme Ding, spricht ja kaum Englisch. Liebevoll lasse ich meine Hände durch ihr blondes Haar gleiten:
– Je t’aime, seufze ich mit meinem Serge-Gainsbourg-Akzent, während wir aufs Neue ein Fleisch werden – ein heilsames, trotziges Fest der Liebe, jener eigensinnig dauerhaften, nahezu unbezwinglichen Stadt. Dem heiligsten Ort auf Gott Jesu grüner Erde. Und ich muss es wissen, schließlich habe ich dort Nacht für Nacht meinen Wohnsitz.
– Die Heilige Stadt, wispere ich abermals.
Und drücke meine Lippen begierig auf die ihren.
Wenn ich mich dann doch dazu entschließe, in den Pub zu gehen, der sich gleich hinter der Plaza befindet, bemühe ich mich immer, so gut wie möglich auszusehen, als stehe alles zum Besten und es liege nichts Außergewöhnliches vor – denn ich möchte nicht, dass man einen falschen Eindruck bekommt. Und falls sich tatsächlich jemand nach Vesna und ihrem Wohlergehen erkundigt, habe ich immer die gleiche Ausrede parat: dass sie ihre Mutter in Dubrovnik besucht.
In der Zeit vor ihrem entsetzlichen Fehltritt – leider muss ich gestehen, dass sie Ehebruch beging – sind wir gelegentlich, nein: mindestens drei Mal in der Woche, ausgegangen.
– Chris, Lieblink, ich in Minute fertik, hörte man sie dann sagen.
– Tsss, oder – Wird auch langsam Zeit!, antwortete ich dann, und Hand in Hand schlenderten wir über die Plaza, um wieder mal ein bisschen zu »swingen« und uns den »duften« Mood-Indigo-Beat »reinzuziehen«.
Der natürlich auf uns als Zielgruppe zugeschnitten ist, auf die sogenannten »Babyboomer«. Mit unserem Überhang an Knete und unserer hartnäckigen Weigerung, das Verrinnen der Zeit hinzunehmen, sind wir die idealen Kunden. Wir schnippen mit den Fingern und schwofen bis zum Umfallen, unsere Haare silbergrau wie das unseres Helden Burt Bacharach. Ja, so sind wir: die »groovy Typen«, die »Bussi-Bussis« von früher. Ja, da kommen sie, mit ihren Glasperlen und Bluejeans – Pops und die ganze Bande –, tanzen unter Sternen den Watusi.
Nicht, dass in dem Städtchen, wo ich aufgewachsen bin, allzu viele Watusis stattfanden. Um ehrlich zu sein, gab es in dem kleinen und nicht gerade bemerkenswerten Dorf namens Cullymore nur einen, der auch nur annähernd den Status eines Trendsetters erreichte, einen wilden Schlingel, den ich aus der Schule kannte: ein exzentrischer Freigeist, der auf den Namen Teddy »der Hippie« Maher hörte. Teddy hatte eine Zeit lang in Amerika gelebt und war besessen von Kalifornien und dem »Summer of Love«.
– Mann, Christy, ich sag’s dir, pflegte er loszulegen, da draußen ist echt was los. Eine Revolution, Kumpel – und nichts anderes. Total verrückt, Chris! Sobald ich meinen Scheiß hier geregelt hab, fahr ich zurück – zurück nach Haight-Ashbury und zum Groove!
Etwa um die Zeit, als Teddy tatsächlich zurückfuhr, erstand ich meine erste »Ausstattung« im Carnaby-Street-Stil: ein blousonartiges Hemd, ein psychedelisches Paisley-Ensemble mit passendem Schlips und Kragen in wirbelndem Pink. »Yeah, crazy, groove – Thangs!«, leierte ich mit einem breiten amerikanischen Akzent, den ich für modisch hielt, und stolzierte großspurig vor dem Schlafzimmerspiegel auf und ab.
Doch bevor ich abschweife, möchte ich lieber auf das eigentliche Thema zurückkommen und Ihnen ein paar Fakten über den Mood Indigo Club an die Hand geben, diesen verglasten, blau beleuchteten Tempel musikalischer Wonnen, den ich wiederholt beifällig erwähnen werde. In seiner Blütezeit gab es wahrhaftig nichts Vergleichbares. Er war einfach fantastisch, ja, das war er – kein Wunder, dass wir uns immer darauf freuten. Damals tat ich nichts lieber, als mich zurechtzumachen und an der Hand meiner »exotischen« Freundin (denken Sie an Elke Sommer, denken Sie an Daliah Lavi!), der kultivierten, majestätischen, atemberaubend schönen Vesna, zur Tür hinauszugehen.
Wie ich mich immer darauf freute, ihr beim Schönmachen zuzusehen! Da sie so viel Wert auf ihr Äußeres legte, konnte sie eine halbe Ewigkeit damit zubringen – sich aufzumotzen und aufzubrezeln, an ihrem Häkel-Mini zu zupfen, in ein kariertes A-Line-Kleid zu schlüpfen. Das Haar trug sie immer (eigentlich mehr Kim als Elke oder Daliah) zu einer fixierten, fantastisch hohen blonden Turmfrisur.
Manchmal vollführte sie dabei – nur so zum Spaß – ein kleines Tänzchen, das sie sich ausgedacht hatte, und wackelte mit den Fingern, während sie Lulu oder vielleicht auch Clodagh Rodgers vor sich hinsäuselte. Zu denen tanzten wir auf der bunten, blinkenden Tanzfläche des Mood Indigo immer gern Twist. Nach einem Daiquiri oder ein paar Manhattans.
– Come back and shake me, take me in your arms!, sang ich dann. Während Vesna ihrerseits das Beste tat, die winzige rothaarige Soulröhre aus Glasgow zu imitieren, ziemlich hysterisch mit den Hüften wackelte und sang:
– My heart goes boom bank a bank when you is near!
Ungefähr so weit entfernt von Lulus Stimme, dachte ich damals, wie das Dorf Cullymore von den kriegsgebeutelten Straßen des leidgeprüften alten Kroatien.
Eines Abends kamen wir in den Club, Pops der Groover mit seiner »Mieze« am Arm. Der MC, mein alter Kumpel Mike, hatte schon mehr als die Hälfte seines Programms abgespult. Kaum sah er uns durch die Tür kommen, setzte er natürlich gleich zu seiner absurd albernen Version eines wahllosen Beatles-Medleys an. I Am the Walrus brachte er wie immer auf seine ganz eigene, unnachahmliche Art. Mit seiner Hasenscharte – es war wirklich zum Schießen:
– I am the Eggmah!, grölte er, entlockte der Gitarre noch ein paar Noten und zog eine Grimasse. I am the Walnut!
– Was für eine Type, sagte ich zu Vesna, als wir unseren Stammplatz am Fenster einnahmen.
– Whisky mit Soda, verlangte ich fingerschnippend, und für die Dame wohl eine Margarita.
– Gewiss, Sir, aber natürlich, Sir. Schön, Sie wiederzusehen, Mr McCool.
– Nennen Sie mich einfach Pops, strahlte ich, C. J. Pops, internationaler Playboy, ha ha.
Ich muss schon sagen, damals in St. Catherine’s war Mike Corcoran ein regelrechter Rettungsanker für mich gewesen. Er war einfach zum Totlachen: Witze, verrückte Pointen und dumme Sprüche ohne Ende. Jetzt nennt er sich Mike Martinez, und sein Bühnenoutfit muss man gesehen haben.
– Du musst der Kundschaft immer einen Schritt voraus sein, Pops, sagt er immer zu mir.
Direkt aus Vegas steht auf seinem Poster, und bei seiner lächerlichen Solariumsbräune passt das genau zu ihm. Er trieft nur so vor Gold, der Schweiß rinnt an ihm herab, und noch am ehesten sieht er aus wie ein unehelicher Sprössling von Julio Iglesias und Engelbert Humperdinck. Aber das stört ihn nicht. Im Ernst, was den alten Mike Martinez angeht, kann ihm und seiner Combo niemand im Showbusiness das Wasser reichen. Der alte Mike ist nicht zu stoppen, Nacht für Nacht schüttelt er die Rumbakugeln und tanzt zu den hellen, flotten Klängen des Xylophons den Cha-Cha-Cha, als gäb’s kein Morgen mehr. Wiegt sich in den Hüften und macht den Bossa Nova. Und immer ein paar lockere Sprüche für die Damen auf Lager.
– Ja, das ist Lounge! Das ist Hi-Fi! Es ist sanft, es ist sinnlich, aber am wichtigsten ist – es strömt, wir sind die Chordettes, Ladies and Gentlemen. Welcome tonight to the world of Mood Indigo. Viel Spaß!
Lachen ist gesund, wie Mike zu sagen pflegte: eine Krücke, die einem dabei hilft, allen Widrigkeiten zu trotzen. Toll, dass es das gibt, wirklich spitze. Denn ich möchte auf keinen Fall verbittert klingen, was meine Herkunft angeht. Welchen Nutzen könnte das haben? Und ich möchte nicht damit enden, dass ich dem guten alten Henry Thornton die Schuld gebe.
Aber seine Einstellung – immer diese protestantische Art. Am allermeisten bildete sich Henry Thornton auf seine aristokratische Abstammung ein, auf das Erbe der protestantischen Oberschicht. Auf die ehrwürdigen Charakterstärken, die ihm eingetrichtert worden waren. Und die er in seinen Büchern als »freie, autonome, souveräne Stärkung des Ichs gegen alle Ein- und Übergriffe, ob endogener oder exogener Art«, beschrieben hatte. Der robuste protestantische Charakter, mahnte er, müsse gegen die eigenen Leidenschaften ebenso gewappnet sein wie gegen die Übergriffe anderer. Henry Thornton zufolge diente das Ethos eines kompromisslosen, nüchternen, rationalen Selbstinteresses lediglich dazu, diesen Imperativ zu befolgen. Katholiken galten ihm daher allesamt sowohl als unvernünftig wie auch als geradezu hysterisch – als Geschöpfe ihrer eigenen weibischen Fantasie, als Banshees.
Wie er darauf reagiert haben musste, dass »einer von denen« seine Frau penetriert hatte, mag man sich kaum vorstellen. Ganz zu schweigen davon, dass jene üble nächtliche Zusammenkunft in der Scheune einen Nachkommen zur Folge hatte. In letzter Konsequenz teilte er ihr mit, sollte sie auch nur einen Blick in meine Richtung werfen oder meine verachtungswürdige Existenz »in irgendeiner Weise« mit dem Herrenhaus in Verbindung bringen, wäre sie ein für allemal geächtet und würde auf der Straße verrecken wie ihre bäuerlichen Fenierfreunde während der Großen Hungersnot.
Was die heimlichen nächtlichen Besuche meiner Mutter in dem kleinen Bauernhaus angeht, in dem ich aufwuchs, so kann ich nicht behaupten, mich allzu genau daran erinnern zu können. Außer, dass sie willkommen, angenehm und von einer geheimnisvollen exotischen Aura umgeben waren. Dem kleinen Jungen, der ich damals war, schien es, als kämen sie und ihre Begleiterin aus einer völlig fremden, wenngleich durchaus schönen Welt. Aus einer duftenden Welt, die ganz allein ihnen gehörte. Aus einer Welt, in der Eleganz und eine »damenhafte Haltung« höher als alles andere geschätzt wurden.
Sie trugen Handschuhe und Tweed-Röcke und blütenweiße Perlenketten. Sie sprachen einen Akzent mit glasklaren Vokalen, der offensichtlich nicht aus Cullymore stammte, sondern von weit her, vielleicht aus London oder den englischen Home Counties. Ihre sanftmütige Begleiterin, die Ethel Baird hieß, wirkte ein wenig unnahbar in ihrer exzentrischen Kleidung – sie trug einen Pillbox-Hut mit Schleier und Schuhe, die sie gewöhnlich als »Überschuhe« bezeichnete und die sie eigens für ihre Besuche im Nook erstanden hatte, denn so nannten sie das Bauernhaus, das am äußersten Ende des Gutes hinter drei schlammigen, unebenen Feldern voller Disteln lag. Dort, wo Klein-Dimpie McCool, mein Vormund, den Platz meiner Mutter eingenommen hatte – und, soweit ich mich erinnere, bei ihrem Abschied oft weinte.
Ethel Baird war diejenige gewesen, die mir das Buch geschenkt hatte – meinen Versschatz, einen Gedichtband von Robert Louis Stevenson. An einem Tag vor langer Zeit, im Jahre 1950.
– Das ist für dich, höre ich heute noch ihre sanfte Stimme sagen, als sie behutsam, geduldig und sorgfältig die Seiten umblätterte, um mir die feinfühligen Illustrationen der Sternbilder zu zeigen: jener fächergleichen Spritzer glitzernder Diamanten, die den glänzenden nachtblauen Einband zierten.
Ethel und meine biologische Mutter waren ihr ganzes Leben lang miteinander befreundet gewesen. Sie mochten Klein-Dimpie gut leiden, hätten jedoch niemals gesellschaftlich mit ihr verkehrt – sie konnten einfach nicht.
Strenggläubige protestantische Damen – vornehm und diskret.
Natürlich wäre es besser gewesen, eine richtige Mutter zu haben wie alle anderen auch, aber ich muss sagen, unter den gegebenen Umständen war Klein-Dimpie wie ein Fels in der Brandung. Über diese Frau lässt sich nichts Böses sagen. Und nie hat sie versucht, mir etwas zu verhehlen oder etwas vorzumachen.
– Ach, die war’s, pflegte ich zu sagen, als ich älter wurde, also die war’s – die »geheimnisvolle« Dame! Mit ihrem vornehmen Getue, ihren Geschenken und ihrem Essen. Wer hätte das gedacht! Meine eigene Mutter!
Nein, keine »Mammy« auf Erden hätte besser für mich sorgen können als Dimpie. Allein ihr Frühstück hätte für eine ganze Armee gereicht.
– Chrischty, mein alter Junge!, sagte sie immer zu mir. Der nach dem beschten alten Heiligen von allen benannt ist!
– Meine Mutter ist Lady Thornton, nicht wahr? Die Frau von Henry Thornton, dem Gutsbesitzer. Nicht wahr, Dimpie? Bitte sag mir die Wahrheit!
– Ja, antwortete sie dann, schlurfte mit dem Eimer in der Hand davon, kratzte sich am Hintern, und wenn sie sich den Mund abwischte und »Putt putt putt!« rief, stob gackernd ein Häufchen roter Hennen über den Hof.
Ich muss schon sagen, dass Dympna McCool auch mich lieb gewonnen hatte, auf eine zweckmäßige, pflichtbewusste Art: Um die Wahrheit zu sagen, schenkte sie mir nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Meist war sie zu sehr damit beschäftigt, zur Kirche zu rennen. Leider war die kleine Dimpie nämlich eine religiöse Fanatikerin, und so verpasste sie mir die Namen ihrer beiden Lieblingsheiligen Christophorus, dem sie, wie sie erklärte, eine »besondere Verehrung« entgegenbrachte, und Johannes vom Kreuz – Letzteren aus dem einzigen mir einsichtigen Grund, dass sein fliegenfleckiges Bild die Wand schmückte. Aber diese Namen taugten wohl genauso gut wie jeder andere auch. Alles in allem erfüllte Dimpie ihre Aufgabe also gut. Auf ausdruckslose, desinteressierte Weise war sie großherzig und freundlich.
Für eines jedoch bin ich ihr für immer zu Dank verpflichtet – sie brachte mir alles bei, was man über das Landleben wissen muss. Infolgedessen gab es nur sehr wenig, was C. J. Pops nicht bereits im Alter von zwölf Jahren über Hühner und Kuhdung wusste – zu komisch, wenn man bedenkt, welch kosmopolitischen Lebensstil ich später pflegen sollte! Gemeinsam droschen wir auf die fetten Ärsche der Friesenrinder ein und wateten pfeifend durch den aufgewühlten Schlamm des Gutes. Dann befingerte Dimpie ihren Rosenkranz, um Gott um einen weiteren Strauß von Gefälligkeiten zu bitten, ehe sie ihren Eschenstock schwang und die Tiere anschnauzte:
– Werdet ihr da wohl rauskommen, ihr vertrottelten Mistviecher!
Im Nook war es angenehm warm und gemütlich, das Arrangement hätte weitaus ungünstiger ausfallen können. Ein Arrangement, das, ohne Zweifel überraschenderweise, Henry Thornton in einem außergewöhnlichen, uncharakteristischen Anfall von Großmut selbst getroffen hatte. In erster Linie natürlich, um den drohenden Nervenzusammenbruch meiner Mutter zu verhindern. Die von ihm gestellten Bedingungen lauteten folgendermaßen:
– McCool kann sich unten im Nook um sich selbst kümmern. Achte du nur darauf, dass er sich nie in unserem Haus blicken lässt, nie auch nur einen Fuß über unsere Schwelle setzt. Wage es ja nicht, ihn auch nur durchs Tor mitzubringen. Denn wenn du das tust oder auch nur mit dem Gedanken daran spielst, meine Liebe, kann ich dir eines versichern: Du wirst alles verlieren, alle deine Rechte, alles, was dir zustehen mag. Ich werde dafür sorgen, dass du wegen der Schande, die dieser Dreckskerl Carberry über mich gebracht hat, in der Gosse landest.
Nach dem Dahinscheiden Klein-Dimpies, Gott hab sie selig – sie starb an Krebs, als ich noch ein Teenager war –, wurde mir von einem Anwalt mitgeteilt, dass mein Mietverhältnis fortdauern würde, bis ich das einundzwanzigste Lebensjahr erreicht hätte. Danach erwartete man, dass ich das Grundstück räumen würde, damit es in den Besitz der Familie Thornton zurückfallen könne. Aber wie der Zufall es wollte, schied der arme alte Henry selbst dahin, nicht sehr lange nach meiner Mutter nämlich, und löste damit ganz plötzlich komplizierte Erbstreitigkeiten innerhalb der Familie aus. Im Zuge dessen wurde ich zu meiner Verwunderung und großen Freude nie dazu aufgefordert, das Nook zu räumen. Und schließlich wurde mir, wie man so schön sagt, »hinter vorgehaltener Hand« mitgeteilt, mein Mietverhältnis sei garantiert, vorausgesetzt, ich würde eine nominelle Miete entrichten. Und siehe da – so war ich, als ich volljährig wurde, nach wie vor Herr meines bescheidenen Hauses, König über mein Cottage und drei Morgen Buschland, meine Garde ein Dutzend munterer bronzefarbener Hühner.
Wie gesagt, es war vor allem der Vormundschaft Klein-Dimpies zu verdanken, dass ich mich in der Welt rustikaler Authentizität keineswegs blamierte. Tatsächlich gab ich einen ebenso fähigen Bauerntölpel ab wie alle anderen auch. Ich gehörte dazu und eröffnete eine Molkerei. Schaffte mir einen hübschen kleinen Traktor mit Anhänger an, den man jetzt mit Näpfen und Kannen dahinpoltern sieht, wenn ich die Durstigen der Provinz mit meiner Milch versorge.
– Da kommt er ja, Cullymores ureigenster Eiermann! Der junge McCool. Wie läuft’s denn? Lassen Sie mir ’n Dutzend Rüben da? Und ich glaub, ich nehm ’n Näpfchen Sahne!, riefen sie gutmütig, wenn ich in meinem robusten Massey Ferguson 35 nebst Anhänger vorbeigetuckert kam.
– Da kommt er ja!, riefen sie. Cullymores bester Eiermann!
Die meisten meiner Nachbarn waren freundliche Kerle, das muss ich ihnen lassen. Lebten ihr Leben wie ihre Väter und Mütter.
– Tach auch, Eiermann! Schönes Wetterchen heute! Dafür muss man dem Herrgott danken!, riefen sie gutmütig meinem Traktor hinterher, wenn ich vorüberfuhr.
Doch im Grunde meines Herzens wusste ich, dass ich nie so sein könnte wie sie, selbst wenn ich es gewollt hätte. Wusste von den heimlichen nächtlichen Besuchen vor langer Zeit, von Dimpies versteckten Andeutungen und ihrem allgemeinen Verhalten mir gegenüber intuitiv, dass ich »anders« war. Und dass ein Teil von mir für immer protestantisch sein würde. Deshalb war ich nach wie vor von Thornton Manor fasziniert. Von jenem einstmals atemberaubenden, efeubewachsenen und von herrlichen Wäldern umgebenen Bauwerk aus dem achtzehnten Jahrhundert, das jetzt nach und nach verfiel. Unzählige Besuche stattete ich der Ruine ab, nur um einen zärtlichen Blick auf die zerbröckelnden Türmchen zu werfen, auf die düster-verdrießliche Neogotik, die schon bald der Vergangenheit angehören würde, so wie die hegemoniale, herrschaftliche Welt des angesehenen Literaturkritikers, Grundbesitzers und Verfechters der überlieferten »Werte des Empire«, Dr. Henry Thornton.
Dann stand ich in vollkommener Stille da, starrte wie hypnotisiert durch die hohe Verandatür und dachte über die »Protestanten«, ihre Traditionen und Werte nach. Und darüber, dass ich, wenn die Dinge anders verlaufen wären, einmal einer von ihnen hätte werden können. Jetzt dagegen war ich nicht mehr als ein ohnmächtiger Zeuge einer rasch verfallenden, wenn nicht längst untergangenen Welt.
Dazu würde es wohl jetzt also nicht mehr kommen, oder?
Fast die ganze Zeit dachte ich darüber nach – nicht nur gelegentlich oder hin und wieder. Um ehrlich zu sein, konnte ich gar nicht aufhören, daran zu denken. An die duftende, geheimnisvolle Dame der Nacht, die Fresspakete für Dimpie mitbrachte und mit ihrer Begleiterin Ethel Baird wie eine seltsame Gestalt aus einem Buch angereist kam. Aber wie wundervoll mir dieses Buch erschien: wie ein Märchenbuch voller Träume, in denen man sich wohlfühlte!
Dann sah ich mich vor der hohen Verandatür des Herrenhauses stehen – drinnen eine leicht verschwommene Lady Thornton, die All People That on Earth Do Dwell sang, während sie die Seiten des Traumbuches umblätterte, das sie in der Hand hielt. Dann glättete sie ihr Haar, legte das Buch aus der Hand, trat zur Seite, um zu mir hinauszublicken, und sagte:
– Dich werde ich immer am allermeisten lieben, nicht Tristram. Nicht Klein-Tristram, C. J.
Klein-Tristram hatte ich mir ausgedacht – natürlich gab es gar keinen Sohn namens Tristram Thornton, weder einen »kleinen« noch sonst einen.
Doch wenn ich dort stand und über ihn nachdachte, kam er mir immer so wirklich vor, dass ich es manchmal kaum noch ertragen konnte, durch die Fenster zu schauen, so lebhaft sah ich ihn vor mir – den kleinen daumenlutschenden Tristram hinter der regenbesprenkelten Glasscheibe, dem seine Mutter sanft die wunderschönen Worte des »Nächtlichen Ausflugs« aus Robert Louis Stevensons Versgarten eines Kindes ins Ohr flüsterte:
Aus der Küche brach noch schwaches Licht
durch die Fenster und Jalousien,
und vom Himmel leuchteten mir ins Gesicht
tausend Sterne und Galaxien.
Dr. Thorntons Werke waren allesamt in der örtlichen Bücherei erhältlich. Er war Kommentator, Historiker, Literaturkritiker und Essayist: Seine intellektuellen Fähigkeiten kannten keine Grenzen. Eines seiner Werke handelte von den kulturellen Gegensätzen zwischen Katholiken und Protestanten. Darin bewies er unverblümt und entschlossen, wie es seine Art war, dass Katholiken die weitaus schwächere Spezies waren und Protestanten von Natur aus überlegen. Und blieb dabei allezeit unvoreingenommen und neutral, selbstbeherrscht und würdevoll.
Ich dachte daran, wie sie sich abends im Salon des Herrenhauses zusammenfanden und mit offenen Gesangbüchern im Kreis um den Kamin standen und wie die von allen geliebte und geschätzte Stimme Klein-Tristrams einer Lerche gleich alle anderen übertönte:
Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein.
Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein.
Wo fänd ich Trost, wärst du mein Gott nicht hier?
Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir!
Und das abendliche Kaminfeuer warf seine tröstlichen Schatten.
– Der protestantische Geist ist gleichmütig, hörte ich dann den guten Doktor in beherrschtem, nüchternem Tonfall sagen. Er ist besonnen und ausgeglichen und neigt zur Abstinenz. Das katholische Temperament hingegen ist das genaue Gegenteil. Ausschweifend, lasterhaft und ganz und gar würdelos. Ich fürchte, von Grund auf minderwertig.
Sogar jetzt noch, als Erwachsener, sehe ich mich fröstelnd und zitternd unter den triefenden Weiden vor der beschlagenen hohen Verandatür stehen – Regen läuft mir übers Gesicht, tonlos spreche ich ihnen nach und scheuere mir dabei erbarmungslos mit dem Traktorschlüssel die Handfläche wund:
– Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir.
3
Jerusalem
Das Schicksal wollte es, dass ich im Spätsommer des Jahres 1969 selbst einen ziemlich ungewöhnlichen Fehltritt beging. Das war auch der Grund, weshalb ich mich an jenem Abend allein am Tresen von Bernie’s Bar wiederfand – unter den drohenden Blicken einer Phalanx empörter Gesichter.
– Gotteslästerer, hörte ich einen von ihnen sagen, Schänder.
– Klar, das ist Thorntons Bastard – kein Wunder. Am Ende ist der Protestant in ihm zum Vorschein gekommen. Da hat er sich als der kaltherzige Dreckskerl entpuppt, der er ist.
– Die Hölle ist nicht heiß genug für ihn. Nicht für einen Dreckskerl, der so was tut. Scheiß auf Jerusalem und scheiß auf alle Nigger.
– Scheiß auf alle Nigger.
– Warum er das wohl geschrieben hat.
– Wo er doch selber schwarz ist – der schwarze Protestantenarsch. Da sieht man’s wieder mal. Am Ende sind sie alle gleich.
Ich war mir sicher, dass sie etwas über meinen Besuch bei Ethel sagen würden. Ich war überzeugt, dass mich jemand auf dem Weg zu ihr gesehen hatte. Aber sie erwähnten es mit keinem Wort, und allmählich stellte sich heraus, dass sie gar nichts davon wussten. Jedenfalls noch nicht. Dann kamen sie auf die kleine Evelyn Dooris zu sprechen. Machten düstere Anspielungen, ich hätte sie bedroht – was überhaupt nicht zutraf. Ich hatte Besseres zu tun, als dreizehnjährige Mädchen zu belästigen. Und ich gab Evelyn keine Schuld daran, was geschehen war, nicht die geringste. Ich bewunderte sie sogar – ihre kindlich freche Art, ihre eigenwilligen Gewohnheiten.