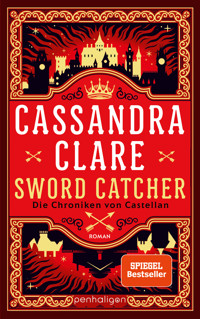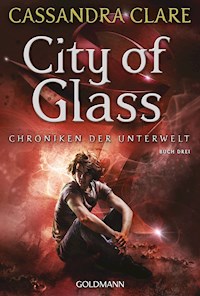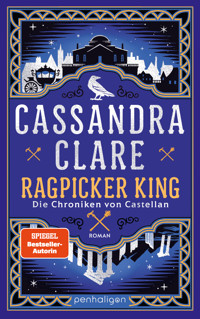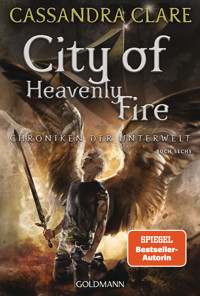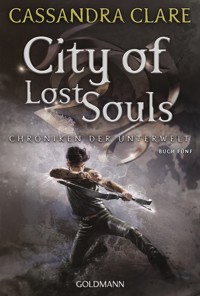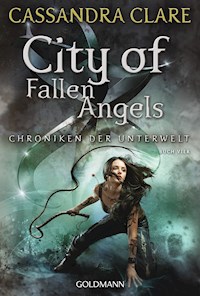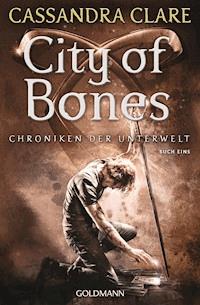
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Chroniken der Unterwelt
- Sprache: Deutsch
Die fünfzehnjährige Clary lebt mit ihrer Mutter Jocelyn in New York. Als diese unter höchst merkwürdigen Umständen entführt wird, offenbart sich Clary ein wohlgehütetes Familiengeheimnis: Ihre Mutter war einst eine Schattenjägerin, Mitglied einer Bruderschaft, die seit über tausend Jahren Dämonen jagt. Als Clary selbst von düsteren Gestalten angegriffen wird, rettet der ebenso attraktive wie geheimnisvolle Jace ihr das Leben. Er nimmt sie mit ins New Yorker Institut der Gruppe, und nach und nach wird Clary immer tiefer in diese faszinierende Welt hineingezogen. Doch ein tödlicher Machtkampf zwischen Gut und Böse droht die Gemeinschaft der Dämonenjäger zu zerreißen. Werden Clary und Jace es schaffen, Jocelyn zu retten und die Welt der Schattenjäger vor dem Untergang zu bewahren?
Neuausgabe des bereits 2008 erschienenen Romans.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 779
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Als die fünfzehnjährige Clary Fray den Pandemonium Club in New York City betritt, will sie eigentlich nur ein bisschen Spaß haben – stattdessen wird sie Zeugin eines Mordes. Doch niemand außer ihr scheint etwas zu bemerken, die ebenfalls jugendlichen Täter tragen äußerst seltsame Tattoos und noch viel seltsamere Waffen, und die Leiche des Opfers löst sich einfach in Luft auf …
Wenig später erfährt Clary, wem sie in dieser Nacht zum allerersten Mal begegnet ist: Schattenjägern, Mitgliedern einer geheimen Bruderschaft, deren Lebensaufgabe der Kampf gegen die Dämonen der Stadt ist. Ein Kampf, in den Clary unaufhaltsam hineingezogen wird. Denn innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach den Geschehnissen im Pandemonium Club wird nicht nur Clarys Mutter Jocelyn entführt, auch Clary selbst gerät in tödliche Gefahr. Erst in letzter Minute bringt der ebenso attraktive wie geheimnisvolle Schattenjäger Jace sie in Sicherheit. Durch ihn findet Clary auch Zuflucht im örtlichen Schattenjägerinstitut. Und muss dort erkennen, dass sie weit mehr ist als eine einfache Sterbliche …
Weitere Informationen zu Cassandra Clare
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Cassandra Clare
City of Bones
Chroniken der Unterwelt
BUCH EINS
Roman
Deutsch von Franca Fritz und Heinrich Koop
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel »The Mortal Instruments. Book One. City of Bones« bei Margaret K. McElderry Books, an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division, New York.
Erstmals auf Deutsch erschienen im Jahr 2008.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Neuausgabe November 2017
Copyright © der Originalausgabe 2007, 2017 by Cassandra Clare LLC
Copyright © dieser Ausgabe 2017
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Übersetzung aus dem Englischen von Franca Fritz und
Heinrich Koop © 2008 Arena Verlag GmbH, Würzburg.
www.arena-verlag.de
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Entwurfs von Russell Gordon
Umschlagmotiv: © Cliff Nielsen
Illustration Buchrücken: © 2015 by Nicolas Delort (Landschaft),
Pat Kinsella (Figur)
Karte: Drew Willis
TH · Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-20901-8V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
h
Seit Cassius mich spornte gegen Cäsar,
Schlief ich nicht mehr. Bis zur Vollführung
einer furchtbar’n Tat Vom ersten Antrieb,
ist die Zwischenzeit Wie ein Phantom,
ein grauenvoller Traum. Der Genius und
die sterblichen Organe Sind dann im Rat vereint;
und die Verfassung Des Menschen,
wie ein kleines Königreich, Erleidet
dann den Zustand der Empörung.
William Shakespeare, Julius Cäsar
h
Dunkler Abstieg
h
Als ich von Nacht und Chaos sang
Mit anderer als Orpheus’ Leier: denn
Des Himmels Muse hatte mich gelehrt,
Hinab- und wieder aufzuschwingen mich …
John Milton, Das verlorene Paradies
1
Pandemonium
»Du willst mich wohl verarschen«, sagte der Türsteher und verschränkte die Arme vor seiner breiten Brust. Er schaute auf den Jungen in der roten Reißverschlussjacke hinab und schüttelte den kahl rasierten Schädel. »Du kannst das Ding da nicht mit reinnehmen.« Die fünfzig Teenager, die vor dem Pandemonium Schlange standen, spitzten die Ohren. Die Wartezeit am Eingang des Clubs, der auch Jugendlichen Eintritt gewährte, war lang – vor allem sonntags – und normalerweise ziemlich öde. Die Türsteher waren gnadenlos und erteilten jedem, der auch nur entfernt so aussah, als könnte er Ärger machen, eine Abfuhr. Die fünfzehnjährige Clary Fray, die zusammen mit ihrem besten Freund Simon in der Schlange wartete, beugte sich wie alle anderen in der Hoffnung auf etwas Abwechslung ein wenig vor.
»Ach, komm schon.« Der Junge hielt den Gegenstand hoch; er sah aus wie ein an einer Seite zugespitzter Holzbalken. »Das gehört zu meinem Kostüm.«
Der Türsteher zog fragend eine Augenbraue hoch. »Und das wäre?«
Der Junge grinste. Fürs Pandemonium sah er ziemlich normal aus, fand Clary. Seine stahlblau gefärbten Haare standen zwar vom Kopf ab wie die Tentakel eines aufgeschreckten Tintenfischs, aber er besaß weder kunstvolle Gesichtstattoos noch gepiercte Lippen oder Ohren. »Ich bin Vampirjäger.« Er stützte sich auf den Holzpfahl, der sich unter seinem Gewicht so widerstandslos durchbog wie ein Grashalm. »Das ist Schaumgummi, alles nur Fake. Okay?«
Die geweiteten Augen des Jungen leuchteten viel zu grün, dachte Clary – wie eine Mischung aus Frostschutzmittel und Frühlingsgras. Wahrscheinlich trug er getönte Kontaktlinsen.
Plötzlich gelangweilt zuckte der Türsteher die Achseln. »Von mir aus. Geh schon.«
Der Junge glitt blitzschnell an ihm vorbei. Clary gefiel, wie er die Schultern schwang, wie er das dunkle Haar beim Gehen zurückwarf. Ihre Mutter hätte das sicher als provokante Lässigkeit bezeichnet.
»Du findest ihn süß«, bemerkte Simon resigniert, »stimmt’s?«
Clary verpasste ihm einen freundschaftlichen Knuff mit dem Ellbogen, blieb aber die Antwort schuldig.
Über dem gesamten Club hingen Schwaden von Trockeneisnebel. Das Spiel der Farbspots verwandelte die Tanzfläche in eine irisierende Märchenwelt aus Blau und Neongrün, sattem Pink und Gold.
Der Junge mit der roten Jacke streichelte die lange rasiermesserscharfe Klinge in seiner Hand; ein hintergründiges Lächeln umspielte seine Lippen. Es war so einfach – ein bisschen Zauberglanz auf die Klinge, und schon sah sie harmlos aus. Dann etwas Glanz in die Augen, und kaum dass der Türsteher ihn wahrgenommen hatte, war er auch schon drinnen. Natürlich hätte er auch ohne all diese Mühen hineinkommen können, aber das war schließlich Teil des Vergnügens – die Mundies, diese dummen Irdischen, unverhohlen zum Narren zu halten, direkt unter ihrer Nase, und die verdutzten Blicke auf ihren einfältigen Gesichtern auszukosten.
Dabei war es keineswegs so, als wären Menschen zu nichts zu gebrauchen, dachte er. Seine grünen Augen suchten die Tanzfläche ab; schlanke Gliedmaßen tanzender Mundies in Leder und Seide leuchteten in rotierenden Trockennebelsäulen auf und verschwanden wieder im Dämmerlicht. Mädchen schwangen ihr langes Haar hin und her, Jungs ließen die lederbekleideten Hüften kreisen, nackte, schweißglitzernde Haut. Ihre Körper versprühten pure Lebendigkeit – Wellen von Energie, die ihn mit einer trunkenen Vorfreude erfüllten. Er grinste hämisch. Sie wussten nicht, wie gut sie es hatten oder was es hieß, vor sich hin zu vegetieren in einer toten Welt, in der die Sonne matt wie ausgeglühte Kohle am Himmel hing. Ihr Lebenslicht flackerte so hell wie eine Kerzenflamme – und war genauso leicht auszulöschen.
Seine Finger schlossen sich um die Klinge. Gerade wollte er die Tanzfläche betreten, als sich ein Mädchen aus der pulsierenden Menge löste und auf ihn zukam. Er starrte sie an. Für ein menschliches Wesen war sie unglaublich schön – langes, fast rabenschwarzes Haar, die Augen mit schwarzem Kajal geschminkt, dazu ein bodenlanges weißes Kleid, wie es die Frauen getragen hatten, als diese Welt noch jünger gewesen war. Spitzenärmel umhüllten ihre schlanken Arme. Um den Hals trug sie eine dicke Silberkette mit einem dunkelroten Anhänger von der Größe einer Babyfaust. Er kniff die Augen zusammen – was er sah, war echt, echt und kostbar. Das Wasser lief ihm im Mund zusammen, während sie näher kam. Lebensenergie strömte aus ihr wie Blut aus einer Wunde. Als sie an ihm vorüberkam, lächelte sie ihn an und bedeutete ihm mit Blicken, ihr zu folgen. Schon während er sich umwandte, um ihr nachzugehen, kostete er den Geschmack ihres baldigen Todes auf seinen Lippen.
Es war so einfach. Er spürte bereits die Kraft ihres verlöschenden Lebens wie Feuer durch seine Adern pulsieren. Die Menschen waren so dumm. Sie besaßen ein solch kostbares Gut, doch sie schützten es fast gar nicht. Sie warfen ihr Leben für Geld fort, für ein Päckchen voll Pulver, für das berückende Lächeln eines Fremden. Wie ein bleicher Geist entfernte sich das Mädchen durch den bunten Nebel. An der gegenüberliegenden Wand angekommen drehte sie sich um, raffte ihr Kleid mit den Händen und grinste ihn an. Die hohen Stiefel, die darunter zum Vorschein kamen, reichten ihr bis zu den Schenkeln.
Langsam schlenderte er zu ihr hinüber; ihre Gegenwart prickelte auf seiner Haut. Aus der Nähe wirkte sie weniger perfekt: Die Wimperntusche war leicht verwischt, und das Haar klebte im verschwitzten Nacken. Er witterte ihre Sterblichkeit, den süßlichen Geruch der Verwesung. Bingo, schoss es ihm durch den Kopf.
Ein raffiniertes Lächeln umspielte ihre Lippen. Als sie einen Schritt zur Seite machte, sah er, dass sie an einer Tür lehnte. »Lager – Zutritt verboten« hatte jemand in Rot daraufgeschmiert. Sie griff nach dem Türknauf hinter sich, drehte ihn und schlüpfte durch die Tür. Sein Blick fiel auf Kistenstapel, Kabelgewirr. Ein ganz normaler Lagerraum. Er sah sich kurz um – niemand schaute zu ihnen herüber. Okay, wenn sie es gerne etwas intimer wollte, umso besser.
Dass ihm jemand folgte, als er den Raum betrat, fiel ihm gar nicht auf.
»Nicht schlecht, die Musik, oder?«, sagte Simon.
Clary antwortete nicht. Sie tanzten oder taten zumindest so – heftiges Hin- und Herschwanken mit gelegentlichen Hechtsprüngen Richtung Boden, als gälte es, verlorene Kontaktlinsen aufzufischen. Das Ganze zwischen einer Meute Teenagern in Metallkorsetts und einem heftig fummelnden asiatischen Pärchen, dessen bunte Haarextensions sich wie Ranken ineinander verschlungen hatten. Ein junger Kerl mit Teddyrucksack und Lippen-Piercing, dessen Fallschirmspringerhose im Luftzug der Windmaschine flatterte, verteilte gratis Ecstasy auf Kräuterbasis. Clary achtete allerdings weniger auf ihre unmittelbare Umgebung – ihre Augen folgten dem Blauhaarigen, der vorhin den Türsteher bequatscht hatte. Er schlich durch die Menge, als suchte er etwas. Die Art und Weise, wie er sich bewegte, erinnerte sie an irgendetwas …
»Ich«, fuhr Simon fort, »amüsiere mich jedenfalls wahnsinnig.«
Besonders glaubwürdig klang das nicht. Simon wirkte hier im Club wie immer denkbar deplatziert, in seiner Jeans und dem alten T-Shirt mit dem Made-in-Brooklyn-Schriftzug auf der Brust. Seine frisch gewaschenen Haare schimmerten dunkelbraun statt grün oder pink, und die Brille thronte schief auf seiner Nasenspitze. Er machte den Eindruck, als wäre er auf dem Weg zum Schachclub, statt sich von dunklen Mächten inspirieren zu lassen.
»Hm.« Clary wusste genau, dass er sie nur ins Pandemonium begleitete, weil es ihr hier gefiel, und dass ihn das Ganze eigentlich langweilte. Sie war sich nicht einmal sicher, was sie an dem Club mochte – vielleicht lag es an der Kleidung? Oder an der Musik, die alles wie einen Traum erscheinen ließ, wie ein anderes Leben, das sich radikal von ihrem eigenen Langweilerdasein unterschied? Aber sie war jedes Mal zu schüchtern, um mit jemand anders als Simon ins Gespräch zu kommen.
Der Blauschopf verließ gerade die Tanzfläche. Er wirkte verloren, als hätte er nicht gefunden, wonach er suchte. Clary fragte sich, was wohl passieren würde, wenn sie hinübergehen, sich vorstellen und ihm anbieten würde, ihn herumzuführen. Vielleicht würde er sie nur stumm anstarren. Vielleicht war er ja auch schüchtern. Vielleicht würde er sich einfach freuen, aber versuchen, es zu verbergen, wie Jungs es nun mal taten – doch sie würde es trotzdem merken. Vielleicht …
Plötzlich ging ein Ruck durch den Jungen. Er wirkte nun hellwach und aufmerksam wie ein Jagdhund, der eine Fährte aufnimmt. Clary folgte seinem Blick und sah das Mädchen in dem weißen Kleid.
Okay, dachte sie und versuchte, sich ihre Enttäuschung nicht anmerken zu lassen, das war’s dann wohl. Das Mädchen war umwerfend, der Typ, den Clary gern gezeichnet hätte – hochgewachsen, gertenschlank, mit langen schwarzen Haaren. Sogar aus dieser Entfernung konnte Clary die Kette mit dem roten Anhänger erkennen, den die Lichtreflexe der Tanzfläche pulsieren ließen wie ein lebendiges, körperloses Herz.
»DJ Bat liefert heute Abend aber echt ganze Arbeit, oder?«, versuchte Simon es erneut.
Clary verdrehte wortlos die Augen, denn Simon hasste Trance. Und Clary war mehr an dem Mädchen in dem weißen Kleid interessiert, dessen helle Gestalt durch Dämmerlicht, Rauch und Trockennebel strahlte wie ein Leuchtfeuer. Kein Wunder, dass ihr der Blauhaarige wie gebannt nachlief und nichts mehr um sich herum wahrnahm – nicht einmal die beiden dunklen Schatten an seinen Fersen, die sich dicht hinter ihm durchs Gedränge schlängelten.
Clary tanzte langsamer, unfähig wegzuschauen. Sie konnte nicht viel erkennen, nur dass die Schatten zwei große, schwarz gekleidete Jungs waren. Woher sie wusste, dass sie dem Blauschopf folgten, vermochte sie nicht zu sagen, doch sie war sich sicher. Vielleicht erkannte sie es an der Art, wie sie sein Tempo hielten, an ihrer gespannten Wachsamkeit und der schlangengleichen Anmut ihrer Bewegungen. Eine dunkle Ahnung beschlich sie.
»Ach übrigens«, fuhr Simon unbeirrt fort, »ich trag neuerdings manchmal Frauenkleider – und ich schlaf mit deiner Mutter! Ich dachte, das solltest du wissen.«
Das Mädchen hatte die Wand erreicht und öffnete nun eine Tür, auf der »Zutritt verboten« stand. Sie bedeutete dem Blauhaarigen, ihr zu folgen, und dann schlüpften sie durch die Tür. Natürlich war es nicht das erste Mal, dass Clary ein Pärchen sah, das sich in eine dunkle Ecke zurückzog; aber das machte die Tatsache, dass die beiden verfolgt wurden, nur umso bizarrer.
Clary stellte sich auf die Zehenspitzen, um besser über die Menge hinwegschauen zu können. Die beiden Jungs standen vor der Tür und berieten sich offenbar. Einer von ihnen war blond, der andere dunkelhaarig. Der Blonde griff in seine Jacke und holte etwas Langes, Spitzes hervor, das im Stroboskoplicht aufblitzte – ein Messer. »Simon!«, schrie Clary und packte ihn am Arm.
»Was ist?« Simon fuhr verschreckt herum. »Keine Sorge, Clary, ich schlaf gar nicht mit deiner Mutter. Ich wollte dich nur dazu bringen zuzuhören. Nicht dass sie nicht sehr attraktiv wäre für ihr Alter.«
»Siehst du die Typen da drüben?« Sie fuchtelte mit dem Arm herum und erwischte fast ein üppiges schwarzes Mädchen, das in der Nähe tanzte und ihr daraufhin einen finsteren Blick zuwarf. »’tschuldigung!«, rief Clary und wandte sich wieder Simon zu. »Siehst du die beiden? Bei der Tür da?«
Simon blinzelte und zuckte die Achseln. »Ich seh überhaupt nichts!«
»Zwei Kerle. Sie folgen dem Typ mit den blauen Haaren …«
»Den du so süß fandest?«
»Ja, aber darum geht’s nicht. Der Blonde hat ein Messer gezogen.«
»Bist du sicher?« Simon schaute nochmals hin und schüttelte den Kopf. »Ich seh niemanden.«
»Todsicher.«
Simon straffte die Schultern, dann meinte er nüchtern: »Ich geh mal die Security-Leute holen. Bleib du solange hier.« Im nächsten Moment bahnte er sich mit langen Schritten einen Weg durch die Menge.
Als Clary sich wieder umdrehte, sah sie gerade noch, wie der Blonde durch die »Zutritt verboten«-Tür glitt, dicht gefolgt von seinem Freund. Sie schaute sich um; Simon kämpfte sich immer noch durch die Tanzenden, kam aber kaum vorwärts. Selbst wenn sie jetzt laut schrie, würde niemand sie hören, und bis Simon zurück wäre, konnte längst etwas Schlimmes passiert sein. Clary biss sich auf die Lippe und begann, sich durch die Menge zu zwängen.
»Wie heißt du?«
Sie drehte sich um und lächelte ihn an. Durch die hohen schmutzigen Gitterfenster drang nur wenig Licht. Der Boden des Lagerraums war übersät mit Kabelsträngen, Spiegelstückchen von Disco-Kugeln und leeren Farbdosen.
»Isabelle.«
»Hübscher Name.« Er ging auf sie zu, vorsichtig für den Fall, dass eines der Kabel noch Strom führte. Im Dämmerlicht wirkte sie durchsichtig, fast farblos, in Weiß gehüllt wie ein Engel. Sie zu Fall zu bringen würde ein wahres Vergnügen sein … »Ich hab dich hier noch nie gesehen.«
»Du meinst, ob ich öfter hierherkomme?« Sie kicherte hinter vorgehaltener Hand. An ihrem Handgelenk, unter dem Ärmelaufschlag, schimmerte eine Art Armband – beim Näherkommen sah er jedoch, dass es eine Tätowierung war, ein kunstvolles Muster aus spiralförmigen Linien.
Er erstarrte. »Du …«
Doch er kam nicht dazu, den Satz zu beenden. Blitzschnell holte sie aus und schlug ihm mit der offenen Hand so kräftig vor die Brust, dass ein menschliches Wesen normalerweise nach Luft schnappend zu Boden gegangen wäre. Er stolperte rückwärts. Jetzt sah man etwas in ihrer Hand golden glänzen, eine zuckende Peitsche, die sie mit einer weit ausholenden Bewegung schwang und dann auf ihn herabsausen ließ. Der dünne Schwanz der Peitsche wand sich um seine Knöchel und riss ihn von den Füßen. Er schlug auf dem Boden auf und krümmte sich; das verhasste Metall fraß sich tief in seine Haut. Lachend stand sie über ihm, und benommen dachte er, dass er es eigentlich hätte wissen müssen. Keine Irdische würde sich wie Isabelle kleiden. Sie hatte das lange Kleid angezogen, um ihre Haut zu bedecken – jeden Zentimeter ihrer Haut!
Mit einem energischen Zug der Peitsche sicherte Isabelle ihren Fang. Ein triumphierendes Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. »Er gehört euch, Jungs.«
Hinter sich hörte er leises Lachen. Dann wurde er gepackt, hochgerissen und gegen einen der Pfeiler gestoßen. Er spürte feuchtkalten Beton im Rücken, seine Hände wurden nach hinten gezogen und an den Gelenken mit Draht gefesselt. Während er dagegen ankämpfte, spazierte jemand um den Pfeiler herum in sein Gesichtsfeld – ein blonder Junge, kaum älter als Isabelle und genauso gut aussehend. Die goldbraunen Augen funkelten wie Bernsteinsplitter. »Soso«, stellte er fest. »Sind noch mehr von deiner Sorte hier?«
Der Blauhaarige spürte, wie unter dem zu straff gezogenen Metalldraht Blut hervorquoll und seine Handgelenke glitschig wurden. »Noch mehr wovon?«
»Jetzt tu nicht so.« Der Blonde hob die Hände, sodass die dunklen Ärmel seines Hemdes nach unten rutschten und runenbedeckte Handgelenke, Handrücken und Handflächen freigaben. »Du weißt genau, was ich bin.«
Der Gefesselte fühlte, wie weit hinten in seinem Schädel die zweite Zahnreihe zu knirschen begann.
»Ein Schattenjäger«, zischte er.
Der blonde Junge grinste übers ganze Gesicht. »Bingo.«
Clary stieß die Tür zum Lager auf und schlüpfte hinein. Zuerst dachte sie, der Raum sei leer. Es gab nur wenige Fenster, doch die befanden sich hoch unter der Decke und waren verschlossen; von draußen drangen gedämpfter Straßenlärm, Autohupen und quietschende Reifen an ihr Ohr. Es roch nach alter Farbe, und eine dicke Staubschicht voll verwischter Schuhabdrücke bedeckte den Boden.
Es ist niemand hier, stellte Clary verwundert fest und schaute sich um. Trotz der Augusthitze war der Raum kühl. Ihr verschwitzter Rücken fühlte sich eiskalt an. Gleich beim ersten Schritt verfing sich ihr Fuß in einem Elektrokabel. Sie bückte sich, um den Schuh zu befreien, als sie plötzlich Stimmen hörte. Das Lachen eines Mädchens, dann eine scharf reagierende Jungenstimme. Als Clary sich aufrichtete, sah sie sie.
Es schien, als wären sie aus dem Nichts vor ihr aufgetaucht. Da war das Mädchen mit dem langen weißen Kleid; das schwarze Haar floss über ihre Schultern und ihren Rücken wie feuchter Seetang. Neben ihr sah sie die beiden Jungen – ein lang aufgeschossener Kerl mit ebenso dunklen Haaren wie das Mädchen und ein kaum kleinerer Blonder, dessen Haar im dämmrigen Zwielicht wie Messing glänzte. Der Blonde stand mit den Händen in den Taschen vor dem blauhaarigen Punker, dessen Arme und Füße offenbar mit Klavierdraht an den Pfeiler gefesselt waren. Angst und Schmerz hatten seine Züge zu einer Fratze verzogen.
Clarys Herz hämmerte wie wild. Sie duckte sich hinter den nächsten Betonpfeiler, spähte um die Ecke und beobachtete, wie der blonde Junge mit vor der Brust verschränkten Armen hin und her stolzierte. »Du hast mir noch immer nicht gesagt, ob noch mehr von deiner Sorte hier sind.«
Von deiner Sorte? Clary überlegte, was er damit meinen konnte. Vielleicht war sie ja in eine Art Bandenkrieg geraten.
»Ich weiß nicht, wovon du redest«, ächzte der Blauschopf unter Schmerzen, doch mit fester Stimme.
»Er meint andere Dämonen«, meldete sich jetzt der Dunkelhaarige zum ersten Mal zu Wort. »Was ein Dämon ist, brauch ich dir ja nicht zu erklären, oder?«
Der Gefesselte wandte das Gesicht ab; sein Kiefer zuckte.
»Dämonen«, dozierte der Blonde und malte das Wort mit dem Finger in die Luft. »Die Religion definiert sie als Höllenbewohner, als Diener Satans, aber hier, im Sinne des Rats, versteht man darunter jeden bösen Geist, der nicht unserer eigenen Dimension entstammt …«
»Komm, Jace, es reicht«, unterbrach das Mädchen.
»Isabelle hat recht«, erklärte der Dunkelhaarige. »Wir brauchen keine Lektionen in Bedeutungslehre und Dämonologie.«
Die sind verrückt, dachte Clary, völlig verrückt.
Jace hob lächelnd den Kopf. Diese Geste hatte etwas Entschlossenes an sich; sie erinnerte Clary an einen Dokumentarfilm über Löwen, den sie im Discovery Channel gesehen hatte. Genauso hoben die Großkatzen ihren Kopf, wenn sie Beute witterten. »Isabelle und Alec meinen, ich würde zu viel reden«, sagte er Vertraulichkeit vortäuschend. »Was meinst du?«
Der Blauhaarige antwortete zuerst nicht; seine Kiefer malmten noch immer. »Ich kann euch Informationen geben«, sagte er schließlich. »Ich weiß, wo Valentin ist.«
Jace blickte zu Alec hinüber, der die Achseln zuckte. »Valentin ist unter der Erde«, brummte Jace. »Der Typ da will uns bloß hochnehmen.«
Isabelle warf ihr Haar nach hinten. »Komm, Jace, schaff ihn aus der Welt. Er wird uns eh nichts Vernünftiges sagen.«
Jace hob den Arm, und Clary sah das Messer im Zwielicht aufblitzen. Es wirkte merkwürdig transparent – die Klinge schimmerte kristallklar und scharf wie eine Glasscherbe. Das Heft war mit roten Steinen besetzt.
»Valentin ist zurück!«, stieß der Gefesselte atemlos hervor und zerrte an den Drähten, die seine Hände festhielten. »Das weiß die ganze Schattenwelt – und ich auch. Ich kann euch sagen, wo er steckt …«
Plötzliche Wut flackerte in Jace’ eiskalten Augen auf. »Beim Erzengel! Jedes Mal, wenn wir einen von euch Dreckskerlen schnappen, behauptet ihr, ihr wüsstet, wo Valentin steckt. Wir wissen es übrigens auch. In der Hölle. Und du …« Jace drehte das Messer in seiner Hand, sodass die Schneide blitzte wie eine Spur aus Feuer, »du wirst ihm gleich dorthin folgen.«
Clary konnte es nicht länger mit anhören und schoss hinter ihrem Pfeiler hervor. »Hört auf!«, brüllte sie. »Das könnt ihr nicht machen!«
Jace wirbelte herum, so verdutzt, dass ihm das Messer aus der Hand flog und über den Betonboden schlitterte. Auch Isabelle und Alec drehten sich zu ihr um, ähnlich verblüfft wie Jace. Der blauhaarige Junge hing in seinen Fesseln, den Mund ungläubig aufgesperrt.
Alec brachte als Erster ein Wort heraus. »Was ist das denn?« Fragend schaute er von Clary zu seinen Freunden, als müssten sie wissen, was Clary dort zu suchen hatte.
»Ein Mädchen«, sagte Jace, der sich rasch wieder gefasst hatte, »du weißt doch, was Mädchen sind, Alec. Deine Schwester Isabelle ist eins.« Er ging einen Schritt auf Clary zu und blinzelte, als könnte er nicht ganz glauben, was er da sah. »Eine Irdische«, sagte er mehr zu sich selbst, »aber sie kann uns sehen.«
»Natürlich kann ich euch sehen«, erwiderte Clary, »ich bin doch nicht blind.«
»Doch. Du weißt es nur nicht«, meinte Jace und bückte sich, um sein Messer aufzuheben. Er richtete sich wieder auf. »Aber jetzt verschwindest du besser – in deinem eigenen Interesse.«
»Ich werde auf keinen Fall gehen«, sagte Clary, »weil ihr ihn sonst umbringt.« Sie zeigte auf den Jungen mit den blauen Haaren.
»Wohl wahr«, räumte Jace ein, wobei er das Messer zwischen den Fingern herumwirbelte, »aber was kümmert es dich, ob ich ihn töte oder nicht?«
»W-w-weil …« Clary stotterte vor Entrüstung. »Weil ihr nicht einfach in der Gegend rumlaufen und Leute umbringen könnt.«
»Auch richtig«, stimmte Jace zu, »man darf nicht einfach herumlaufen und Menschen umbringen.« Er zeigte auf den Blauhaarigen, der die Augen zu Schlitzen zusammengekniffen hatte. Clary fragte sich, ob er ohnmächtig war. »Aber das da ist kein Mensch, Kleine. Er sieht zwar so aus und redet auch so, und möglicherweise blutet er sogar so. Aber er ist ein Monster.«
»Jace«, zischte Isabelle warnend, »es reicht.«
»Du bist verrückt«, sagte Clary und wich vor ihm zurück. »Ich hab die Polizei gerufen, damit du’s weißt. Die wird jeden Moment hier sein.«
»Sie lügt«, sagte Alec, allerdings mit Zweifel in der Stimme. »Jace, mach …«
Er konnte seinen Satz nicht beenden, denn in diesem Moment stieß der blauhaarige Junge ein schrilles Geheul aus, riss sich vom Pfeiler los und stürzte sich auf Jace.
Sie fielen und rollten über den Boden – fast schien es, als besäßen die Hände des Blauhaarigen, die an Jace’ Körper zerrten, metallene Klauen. Clary wich zurück und wollte wegrennen, doch ihre Füße verfingen sich erneut in einer Kabelschlaufe, und sie ging so heftig zu Boden, dass ihr die Luft wegblieb. Sie hörte Isabelle schreien. Als sie sich herumrollte, sah sie, dass der Blauhaarige auf Jace’ Brust saß und Blut an den Spitzen seiner rasiermesserscharfen Klauen glitzerte.
Alec rannte auf die Kämpfenden zu, dicht gefolgt von Isabelle, die ihre Peitsche schwang. Der Blauschopf hieb seine ausgefahrenen Klauen in Jace’ Körper. Jace versuchte, sich mit dem Arm zu schützen, doch die Krallen durchfurchten seine Haut und seine Muskeln. Blut spritzte. Wieder holte der Blauhaarige aus – da traf ihn Isabelles Peitsche am Rücken. Er brüllte auf und fiel auf die Seite.
Im nächsten Moment war Jace wieder auf den Beinen. In seiner Hand blitzte eine Klinge auf, die er dem blauhaarigen Jungen tief in die Brust stieß. Um das Heft des Dolchs schoss schwarze Flüssigkeit in die Höhe. Der Junge wälzte sich windend und gurgelnd am Boden. Jace stand auf und verzog das Gesicht. Sein schwarzes Hemd war jetzt an den Stellen, wo das Blut es getränkt hatte, noch dunkler. Er schaute auf die zuckende Gestalt zu seinen Füßen und zerrte das Messer aus ihr heraus. Das Heft glänzte von der schwarzen Flüssigkeit.
Der Blauschopf starrte Jace mit glühenden Augen an. Zwischen zusammengebissenen Zähnen zischte er: »So sei es. Die Forsaken werden euch alle holen.«
Jace’ Antwort war ein Knurren. Der Blauschopf verdrehte die Augen. Dann begann sein Körper, wild zu zucken – und plötzlich schrumpfte er und fiel immer weiter in sich zusammen, bis er kleiner und kleiner wurde und schließlich ganz verschwand.
Clary rappelte sich auf und kickte das Kabel weg. Langsam machte sie ein paar Schritte rückwärts; niemand beachtete sie. Alec kümmerte sich um Jace und rollte dessen Hemdsärmel hoch, um die Verletzung genauer zu untersuchen. Clary drehte sich um, bereit wegzurennen – da stand plötzlich Isabelle vor ihr, die Peitsche in der Hand. Die goldene Schnur war auf ganzer Länge mit dunkler Flüssigkeit getränkt. Isabelle ließ die Peitsche schnalzen; das Ende wickelte sich um Clarys Handgelenk und zog sich fest zu. Vor Schmerz und Überraschung schnappte Clary keuchend nach Luft.
»Du dämliche Mundie«, zischte Isabelle wütend, »Jace hätte sterben können.«
»Er ist verrückt«, stieß Clary hervor und versuchte, ihr Handgelenk zurückzuziehen, doch die Schnur schnitt nur noch tiefer in ihre Haut. »Ihr seid alle vollkommen durchgeknallt. Für wen haltet ihr euch eigentlich? Für eine bewaffnete Bürgerwehr? Die Polizei …«
»Interessiert sich normalerweise nicht für Fälle ohne Leiche«, sagte Jace. Er hielt sich den Arm und bahnte sich zwischen den Kabelhaufen einen Weg zu Clary. Alec folgte mit finsterer Miene.
Clary schaute auf die Stelle, an der der Blauhaarige sich aufgelöst hatte, und schwieg. Nicht einmal ein Tropfen Blut war zu sehen – nichts deutete darauf hin, dass der Junge je existiert hatte.
»Falls du dich fragen solltest, wo er ist: Sie kehren in ihre eigene Dimension zurück, wenn sie sterben«, erklärte Jace.
»Jace«, zischte Alec und packte ihn am Arm, »halt dich zurück.«
Jace entzog ihm den Arm. Sein blutverschmiertes Gesicht sah gespenstisch aus. Mit den bernsteinfarbenen Augen und dem goldbraunen Haar erinnerte er Clary mehr denn je an einen Löwen. »Sie kann uns sehen, Alec«, sagte er. »Sie weiß sowieso schon zu viel.«
»Und was soll ich jetzt mit ihr machen?«, fragte Isabelle.
»Lass sie laufen«, erwiderte Jace ruhig. Isabelle warf ihm einen überraschten, fast wütenden Blick zu, sagte aber nichts. Die Peitschenschnur glitt zu Boden und gab Clarys Arm frei. Clary rieb sich das schmerzende Handgelenk und fragte sich, wie sie sich möglichst schnell aus dem Staub machen konnte.
»Vielleicht sollten wir sie besser mitnehmen«, überlegte Alec. »Hodge würde bestimmt gern mit ihr reden.«
»Wir können sie auf keinen Fall ins Institut bringen«, konterte Isabelle, »sie ist eine Mundie.«
»Ach tatsächlich?«, fragte Jace leise; sein ruhiger Ton wirkte bedrohlicher als Isabelles bissige Art oder Alecs Wut. »Hast du dich mit Dämonen eingelassen, Kleine? Hast mit Hexenmeistern gemeinsame Sache gemacht, mit den Kindern der Nacht gewacht? Hast du …«
»Erstens heiß ich nicht ›Kleine‹«, unterbrach Clary ihn, »und zweitens weiß ich nicht, wovon du überhaupt redest.« Wirklich nicht?, dröhnte eine Stimme tief in ihrem Inneren. Du hast doch gesehen, wie sich der Junge in Luft aufgelöst hat. Jace ist nicht verrückt, das hättest du nur gern. »Ich glaub nicht an … an Dämonen oder was du da …«
»Clary?« Das war Simons Stimme. Clary wirbelte herum. Dort stand er in der Tür des Lagerraums, einen der kräftigen Türsteher im Schlepptau. »Alles in Ordnung mit dir?« Er blinzelte, um seine Augen an das Dämmerlicht zu gewöhnen, und sah sich um. »Was treibst du hier eigentlich allein? Und was ist mit den Typen mit den Messern?«
Clary starrte ihn an und blickte dann über ihre Schulter zu Jace, Isabelle und Alec zurück. Jace stand noch immer mit blutverschmiertem Hemd und dem Messer in der Hand da. Grinsend zuckte er halb entschuldigend, halb amüsiert die Achseln. Es schien ihn nicht zu überraschen, dass weder Simon noch der Türsteher ihn sehen konnten.
Und Clary wunderte es irgendwie auch nicht. Langsam wandte sie sich wieder Simon zu. Ihr war bewusst, wie sie auf ihn wirken musste – allein in dem feuchtkalten Lagerraum, die Füße in bunten Stromkabeln verheddert. »Ich dachte, sie wären hier reingegangen«, murmelte sie, »aber ich hab mich wohl getäuscht. Tut mir leid.« Sie blickte von Simon, dessen besorgte Miene nun vor Verlegenheit rot anlief, zum Türsteher, der einen genervten Eindruck machte. »War wohl ein Irrtum.«
Hinter sich hörte sie Isabelle kichern.
»Ich kann’s einfach nicht glauben«, knurrte Simon ungläubig. Clary stand an der Bordsteinkante und versuchte vergebens, ein Taxi heranzuwinken. Während ihres Aufenthalts im Club war die Orchard Street gereinigt worden, und die Straße schimmerte nun schwarz vom ölverschmierten Wasser.
»Genau, man sollte doch annehmen, dass zumindest ein paar Taxen hier langfahren. Wo sind die um die Uhrzeit denn alle hin?« Clary drehte sich zu Simon um und fragte achselzuckend: »Meinst du, auf der Houston Street haben wir mehr Glück?«
»Ich rede nicht von irgendwelchen Taxen«, erwiderte Simon, »sondern von dir. Ich glaub dir nicht. Es kann doch nicht sein, dass deine Messerschwinger einfach verschwunden sind.«
Clary seufzte. »Vielleicht waren da ja gar keine Messerschwinger, Simon. Vielleicht hab ich mir das alles nur eingebildet.«
»Quatsch.« Simon hob mehrmals die Hand, doch die Taxen rasten an ihm vorbei, Schmutzwasser aufwirbelnd. »Ich hab dein Gesicht gesehen, als ich in das Lager kam. Du hast total entsetzt gewirkt, als wäre dir gerade ein Geist begegnet.«
Clary dachte an Jace und seine Löwenaugen. Dann schaute sie kurz auf ihr Handgelenk, an dem Isabelles Peitsche eine dünne rote Linie hinterlassen hatte. Nein, keine Geister, dachte sie, sondern etwas viel Unglaublicheres.
»Ich hab mich einfach geirrt«, erwiderte sie lahm und fragte sich, warum sie ihm nicht die Wahrheit sagte. Weil er sie für verrückt halten würde. Außerdem hatte dieser ganze Vorfall etwas an sich – das schwarze hochspritzende Blut an Jace’ Messer und seine Stimme, als er fragte: Hast du mit den Kindern der Nacht gewacht? –, dass sie lieber nicht darüber reden wollte.
»Ein ziemlich peinlicher Irrtum«, brummte Simon und warf einen Blick zurück in Richtung des Clubs, vor dessen Eingang noch immer eine lange Schlange stand. »Ich bezweifle, dass sie uns noch mal ins Pandemonium reinlassen.«
»Na und? Das kann dir doch egal sein. Du findest den Laden ja sowieso blöd.« Clary hob erneut die Hand, als ein gelbes Fahrzeug auf sie zusauste. Glücklicherweise stoppte der Fahrer sein Taxi quietschend an der Ecke des Blocks. Er hupte sogar, als müsste er sie erst noch auf sich aufmerksam machen.
»Na endlich.« Simon riss die Wagentür auf und rutschte auf die kunststoffbezogene Rückbank. Clary folgte ihm und sog den vertrauten Geruch der New Yorker Taxis ein – eine Mischung aus kaltem Rauch, Leder und Haarspray. »Nach Brooklyn«, instruierte Simon den Fahrer. Dann wandte er sich Clary zu. »Du weißt doch, dass du mir alles erzählen kannst, oder?«
Clary zögerte einen Moment und nickte dann. »Das weiß ich, Simon.«
Sie schlug die Tür zu, und das Taxi schoss in die Nacht.
2
Geheimnisse und Lügen
Rittlings saß der dunkle Prinz im Sattel seines schwarzen Streitrosses; ein dunkler Umhang umspielte seine Schultern. Ein goldener Reif bändigte die blonden Locken, sein attraktives Antlitz glühte vom Schlachtengetümmel …
»Und sein Arm sah aus wie eine Aubergine«, murmelte Clary entnervt. Die Zeichnung wollte ihr einfach nicht gelingen. Seufzend riss sie auch dieses Blatt vom Skizzenblock, knüllte es zusammen und pfefferte es gegen die orangefarbene Wand ihres Zimmers. Der Boden war bereits mit zerknüllten Papierbällchen übersät – ein deutliches Zeichen dafür, dass sie den Inspirationsfluss nicht so umsetzen konnte, wie sie es sich vorgestellt hatte. Sie wünschte sich zum tausendsten Mal, mehr wie ihre Mutter zu sein. Alles, was Jocelyn Fray zeichnete, skizzierte oder malte, ging ihr perfekt und scheinbar mühelos von der Hand.
Clary setzte abrupt die Kopfhörer ab, mitten in einem Song von Stepping Razor, und rieb sich die pochenden Schläfen. Erst jetzt hörte sie das laute Schrillen des Telefons durch die Wohnung hallen. Sie warf den Zeichenblock aufs Bett, sprang auf und rannte ins Wohnzimmer, wo das rote Retrodesign-Telefon auf dem Tischchen am Eingang thronte.
»Ist da Clarissa Fray?« Die Stimme am anderen Ende der Leitung kam ihr irgendwie bekannt vor, doch sie konnte sie nicht direkt einordnen.
Clary wickelte das Kabel des Telefonhörers nervös um einen Finger. »Jaaa?«
»Hi, ich bin einer von den messerschwingenden Hooligans, die du gestern im Pandemonium getroffen hast. Ich fürchte, ich hab keinen besonders guten Eindruck bei dir hinterlassen, und wollte dich bitten, mir noch eine Chance zu geben und …«
»Simon!« Clary hielt den Hörer vom Ohr weg, als er in schallendes Gelächter ausbrach. »Ich finde das überhaupt nicht witzig!«
»Witzig ist es schon; du verstehst nur die Pointe nicht.«
»Idiot.« Clary seufzte und lehnte sich an die Wand. »Du hättest sicher nicht gelacht, wenn du gestern Abend noch mit zu mir raufgekommen wärst.«
»Wieso?«
»Meine Mutter. Sie war nicht gerade begeistert, dass wir erst so spät aufgekreuzt sind. Sie ist regelrecht ausgeflippt. Es war echt übel.«
»Was? Der Stau war doch nicht deine Schuld!« Simon war empört; als jüngstes von drei Kindern hatte er ein feines Gespür für familiäre Ungerechtigkeiten.
»Na ja, sie sieht das anders. Ich habe sie enttäuscht, sie hängen lassen, ihr Sorgen bereitet, blablabla. Ich bin der Nagel zu ihrem Sarg«, imitierte sie ihre Mutter wortgetreu, nur von leichten Gewissensbissen geplagt.
»Und, hast du Hausarrest?«, fragte Simon irritierend laut.
Clary hörte halblaute Stimmen im Hintergrund; mehrere Leute redeten durcheinander.
»Ich weiß es noch nicht«, sagte sie. »Meine Mutter ist heute Morgen mit Luke weggefahren, und sie sind noch nicht zurück. Wo steckst du überhaupt? Bei Eric?«
»Ja. Wir sind gerade mit der Probe fertig.« Ein Becken, das genau hinter Simon geschlagen wurde, ließ Clary zusammenzucken. »Eric hat heute Abend eine Lyriklesung drüben im Java Jones«, fuhr Simon fort. Das Java Jones war ein Café nicht weit von Clarys Wohnung, in dem an manchen Abenden Livekonzerte stattfanden. »Die ganze Band läuft zur Unterstützung auf. Kommst du mit?«
»Okay.« Clary hielt inne und zerrte nervös am Hörerkabel. »Warte mal, lieber doch nicht.«
»Seid kurz mal ruhig, Jungs, okay?«, schrie Simon. Clary merkte, dass er den Hörer weit vom Mund weghielt, da sein Gebrüll nur schwach bei ihr ankam. Sekunden später war er wieder am Apparat. »War das jetzt ein Ja oder ein Nein?«, fragte er leicht verunsichert.
»Ich bin nicht ganz sicher.« Clary biss sich auf die Lippe. »Meine Mutter ist noch sauer wegen gestern Abend. Und ich hab keine Lust, sie in ihrer Scheißlaune um etwas zu bitten und deswegen Ärger zu kriegen. Zumindest nicht wegen Erics poetischen Ergüssen.«
»Ach komm schon, so schlecht ist er nun auch wieder nicht.« Eric war Simons Nachbar; die beiden kannten sich schon fast ihr ganzes Leben lang. Mit Eric war Simon zwar nicht so eng befreundet wie mit Clary, aber sie hatten schon im zweiten Highschool-Jahr mit Erics Freunden Matt und Kirk eine Rockband gegründet. Gemeinsam probten sie jede Woche in der Garage von Erics Eltern. »Außerdem bittest du sie ja gar nicht um einen Gefallen«, fuhr Simon fort. »Das ist eine ganz gesittete Poetry-Slam-Veranstaltung gleich um die Ecke; ich schleife dich schließlich nicht zu einer Orgie in Hoboken. Außerdem kann deine Mutter mitkommen, wenn sie will.«
»Orgie in Hoboken!«, hörte Clary jemanden johlen, vermutlich Eric. Ein weiterer krachender Beckenschlag. Allein bei der Vorstellung, dass ihre Mutter gezwungen sein könnte, sich Erics Gedichte anzuhören, lief es ihr kalt über den Rücken.
»Ich weiß nicht. Die flippt aus, wenn ihr alle hier aufkreuzt.«
»Gut, dann komm ich allein vorbei, und wir gehen zu Fuß rüber und treffen die anderen dort. Deine Mutter ist bestimmt einverstanden. Sie mag mich.«
»Was nicht gerade für ihren Geschmack spricht, wenn du mich fragst«, prustete Clary.
»Dich fragt aber keiner.« Simon legte unter wildem Gejohle der Bandkollegen auf.
Clary legte den Hörer zurück auf die Gabel und sah sich im Wohnzimmer um. Es wimmelte nur so von Zeugnissen der künstlerischen Ader ihrer Mutter, angefangen bei den selbst genähten Samtkissen auf dem dunkelroten Sofa bis hin zu Jocelyns sorgsam gerahmten Bildern an den Wänden. Das meiste waren Landschaften: die Straßen von Manhattan im goldenen Sonnenlicht, winterliche Szenen im Prospect Park, graue Teiche mit weißen Eisrändern, die an geklöppelte Spitze erinnerten.
Auf dem Kaminsims stand ein gerahmtes Foto von Clarys Vater. Kleine Lachfalten in den Augenwinkeln straften die ernste Miene des blonden Mannes in Soldatenkleidung Lügen. Er hatte im Ausland gedient und war mehrfach geehrt worden; Jocelyn besaß noch ein paar seiner Militärabzeichen. Doch auch die Medaillen hatten ihm nicht geholfen, als Jonathan Clark mit seinem Wagen kurz vor Albany gegen einen Baum gerast und gestorben war – noch ehe seine Tochter zur Welt kam.
Jocelyn hatte nach seinem Tod wieder ihren Mädchennamen angenommen. Sie sprach nie von Clarys Vater, hatte aber ein Holzkästchen mit den Initialen J. C. neben ihrem Bett stehen, in dem sie die Abzeichen aufbewahrte. Neben den Medaillen enthielt das Kästchen noch zwei Fotos, einen Ehering und eine blonde Haarlocke. Manchmal öffnete Jocelyn es, nahm die Locke heraus und streichelte sie sanft mit den Fingern, ehe sie sie wieder hineinlegte und das Kästchen verschloss.
Das Geräusch eines Schlüssels im Schloss der Eingangstür riss Clary aus ihren Gedanken. Rasch warf sie sich auf die Couch und tat so, als wäre sie in eines der Taschenbücher aus dem Stapel vertieft, den ihre Mutter auf dem Couchtisch deponiert hatte. Für Jocelyn war Lesen eine heilige Tätigkeit; sie unterbrach Clary dabei normalerweise nicht einmal, um mit ihr zu schimpfen.
Polternd flog die Tür auf. Luke schwankte herein, völlig überladen mit etwas, das nach Pappkartons aussah. Als er den Stapel absetzte, erkannte Clary, dass es sich um zusammengefaltete Umzugskisten handelte. Luke richtete sich auf und grinste.
»Hey, On… ich meine, hi, Luke«, begrüßte Clary ihn. Vor etwa einem Jahr hatte er sie gebeten, ihn nicht mehr Onkel zu nennen, weil er sich dann so alt fühlte und immer an Onkel Toms Hütte denken musste. Außerdem hatte er sie sanft daran erinnert, dass er gar nicht ihr richtiger Onkel, sondern nur ein enger Freund ihrer Mutter war, den sie schon ein Leben lang kannte. »Wo ist Mom?«
»Sie parkt gerade den Wagen«, erwiderte er und dehnte ächzend seinen hoch aufgeschossenen, schlaksigen Körper. Er trug sein übliches Outfit: alte Jeans, dickes Holzfällerhemd und eine Brille mit Goldrand auf der Nase. »Kannst du mir noch mal sagen, warum dieses Haus keinen Lastenaufzug hat?«
»Weil es alt ist und Atmosphäre hat«, entgegnete Clary wie aus der Pistole geschossen. Luke musste grinsen. »Wofür sind diese Kartons?«
Sein Grinsen verflog. »Deine Mutter wollte ein paar Sachen zusammenpacken.« Er wich ihrem Blick aus.
»Was für Sachen?«, hakte Clary nach.
Er machte eine unbestimmte Handbewegung. »Irgendwelchen Krempel, der nur im Weg herumliegt. Sie kann ja nichts wegwerfen. Und was machst du da? Lernen?« Er nahm das Buch und las laut: »Noch immer wimmelt es in unserer Welt von all diesen seltsamen Wesen, die die moderne Philosophie verworfen hat. Noch immer treiben Feen und Kobolde, Geister und Dämonen …« Er ließ das Buch sinken und schaute sie über den Brillenrand hinweg an. »Ist das für die Schule?«
»Frazers Der goldene Zweig? Nein, die Schule geht erst in zwei Wochen los.« Clary nahm das Buch wieder an sich. »Das gehört Mom.«
»Ich hatte mir schon so was gedacht …«
Sie legte das Buch zurück auf den Tisch. »Luke?«
»Hm?« Luke hatte das Buch bereits vergessen und wühlte in einer Werkzeugkiste, die vor dem Kamin stand. »Ah, da ist er ja.« Er zog einen orangefarbenen Paketbandabroller heraus und betrachtete ihn zufrieden.
»Was würdest du tun, wenn du etwas siehst, das sonst niemand sehen kann?«
Der Abroller fiel Luke aus der Hand und krachte auf die Fliesen vor dem Kamin. Luke bückte sich und hob ihn auf, ohne Clary dabei anzuschauen. »Du meinst, wenn du als Einzige ein Verbrechen beobachtest oder so etwas?«
»Nein. Ich meine, wenn andere Leute dabei sind, aber du der Einzige bist, der es sehen kann. Als ob es für alle anderen unsichtbar wäre.«
Er hielt inne; seine Hand umklammerte den leicht lädierten Abroller.
»Ich weiß, dass es verrückt klingt«, bohrte Clary nervös weiter, »aber …«
Luke drehte sich zu ihr um. Seine tiefblauen Augen ruhten liebevoll auf ihr. »Clary, du bist eine Künstlernatur, genau wie deine Mutter. Deshalb kannst du diese Welt auf eine andere Weise sehen als andere Leute. Du hast die Gabe, Schönes und Schreckliches in alltäglichen Dingen zu erkennen. Deswegen bist du noch lange nicht verrückt, sondern einfach nur anders. Es ist absolut okay, anders zu sein.«
Clary zog die Beine an und stützte ihr Kinn auf die Knie. Vor ihrem geistigen Auge zogen noch einmal der Lagerraum, Isabelles goldene Peitsche, der sich in Todeskrämpfen windende blauhaarige Junge und Jace’ goldbraune Augen vorbei. Schönes und Schreckliches. »Glaubst du, dass mein Dad ein Künstler wäre, wenn er noch leben würde?«
Luke schaute verblüfft. Doch ehe er antworten konnte, öffnete sich die Tür, und Clarys Mutter kam herein. Die Absätze ihrer Stiefel klapperten über das polierte Parkett. Sie reichte Luke den klirrenden Bund mit den Autoschlüsseln und drehte sich zu ihrer Tochter um.
Jocelyn Fray war eine schlanke, ranke Frau. Ihr langes Haar schimmerte ein paar Nuancen dunkler als Clarys und war zu einem dunkelroten Knoten hochgesteckt, den sie mit einem Bleistift fixiert hatte. Über ihrem lavendelblauen T-Shirt trug sie einen mit Farbe bekleckerten Overall, und auch an den Sohlen ihrer braunen Stiefel klebte Farbe.
Alle sagten, Clary sähe aus wie ihre Mutter – nur sie selbst war anderer Meinung. Die einzige Gemeinsamkeit, die sie erkennen konnte, offenbarte sich in ihrer Figur: Sie waren beide schlank, mit schmächtiger Brust und schmalen Hüften. Doch Clary wusste, dass sie keine Schönheit war wie ihre Mutter; dazu fehlten ihr ein paar Zentimeter. Mit gerade mal ein Meter fünfzig war man süß. Nicht hübsch, auch nicht schön, einfach nur süß. Dazu noch das karottenrote Haar und die unzähligen Sommersprossen … Neben ihrer Mutter sah sie aus wie eine Lumpenpuppe neben einer Barbie.
Außerdem bewegte Jocelyn sich so anmutig, dass die Leute ihre Köpfe verdrehten, wenn sie vorbeiging. Clary dagegen stolperte ständig über die eigenen Füße. Ihr schaute nur jemand nach, wenn sie an ihm vorbei die Treppe hinunterfiel.
»Danke, dass du mir die Kartons hochgebracht hast.« Clarys Mutter schenkte Luke ein Lächeln, das er jedoch nicht erwiderte. Clary spürte, wie sich ihr Magen verkrampfte. Irgendetwas ging hier vor. »Tut mir leid, dass ich so lange zum Parken gebraucht habe. Anscheinend war heute eine Million Leute unterwegs …«
»Mom«, unterbrach Clary sie, »wofür sind diese Kisten?«
Jocelyn biss sich auf die Lippe. Luke rollte die Augen in Clarys Richtung, als wolle er Jocelyn stumm zu etwas drängen. Mit einer nervösen Handbewegung schob sie sich eine Haarsträhne hinters Ohr und setzte sich zu ihrer Tochter auf die Couch.
Aus der Nähe bemerkte Clary, wie müde ihre Mutter aussah. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen, und ihre Augenlider schimmerten durch den Schlafmangel perlmuttgrau.
»Hängt das irgendwie mit gestern Abend zusammen?«, fragte Clary.
»Nein«, erwiderte ihre Mutter rasch und zögerte dann. »Na ja, ein bisschen schon. Das gestern Abend hättest du nicht tun dürfen. Das weißt du ganz genau.«
»Dafür habe ich mich doch schon entschuldigt. Warum fängst du jetzt noch mal damit an? Wenn du mir Hausarrest verpassen willst, dann sag es einfach.«
»Ich will dich nicht einsperren«, sagte ihre Mutter mit angespannter Stimme. Dann schaute sie Luke an, der jedoch den Kopf schüttelte.
»Sag’s ihr einfach, Jocelyn«, meinte er.
»Könntet ihr bitte aufhören, über mich zu reden, als ob ich nicht da wäre?«, protestierte Clary verärgert. »Und was meint ihr mit ›mir sagen‹? Was soll sie mir sagen?«
Jocelyn seufzte schwer. »Wir fahren in Urlaub.«
Lukes Gesichtsausdruck wurde undurchdringlich wie ein Stück Leinwand ohne Farbe.
Clary schüttelte den Kopf. »Was soll das alles? Ihr fahrt in Urlaub?« Sie ließ sich in die Kissen zurückfallen. »Ich kapier es nicht. Wozu dann der ganze Aufstand?«
»Du hast mich nicht richtig verstanden. Ich meinte, dass wir alle in Urlaub fahren, wir drei – du, Luke und ich. Wir fahren ins Landhaus.«
»Oh.« Clary schaute zu Luke hinüber; er hatte die Arme vor der Brust verschränkt und starrte mit verkrampftem Kiefer aus dem Fenster. Sie fragte sich, was ihn so wütend machte. Schließlich liebte er die alte Farm im Norden von New York – er hatte sie selbst vor zehn Jahren gekauft und renoviert und verbrachte so viel Zeit dort, wie er nur konnte. »Wie lange bleiben wir denn?«
»Den Rest des Sommers«, antwortete Jocelyn. »Ich hab diese Kartons gekauft für den Fall, dass du irgendwas einpacken willst, Bücher, Malsachen …«
»Den ganzen Rest des Sommers?« Clary richtete sich empört auf. »Das geht nicht, Mom. Ich habe auch meine Pläne – Simon und ich wollen eine Party zum Schulbeginn machen, ich habe eine Menge Termine mit meiner Kunst-AG und noch zehn Stunden bei Trish …«
»Das mit Trish tut mir leid. Aber alles andere lässt sich absagen. Simon wird das schon verstehen und die Kunst-AG auch.«
Clary bemerkte die Unnachgiebigkeit im Ton ihrer Mutter; anscheinend war es ihr sehr ernst. »Aber ich habe für den Kunstunterricht bezahlt! Ich hab ein ganzes Jahr lang dafür gespart! Du hast es mir versprochen!« Sie fuhr herum und beschwor Luke: »Sag’s ihr! Sag ihr, dass das unfair ist!«
Luke starrte weiter aus dem Fenster; ein Muskel zuckte in seiner Wange. »Sie ist deine Mutter. Es ist ihre Entscheidung.«
»Ich glaub’s einfach nicht.« Clary wandte sich wieder an ihre Mutter. »Warum?«
»Ich muss hier weg, Clary«, sagte Jocelyn, und ihre Mundwinkel zitterten. »Ich brauche Ruhe und Frieden, um malen zu können. Und wir sind gerade knapp bei Kasse …«
»Dann verkauf doch noch ein paar von Dads Aktien«, erwiderte Clary wütend. »Das machst du doch sonst auch immer, oder?«
Jocelyn fuhr hoch. »Werd jetzt bitte nicht unfair!«
»Mom, wenn du fahren willst, dann fahr doch. Es macht mir nichts aus, ohne dich hierzubleiben. Ich kann arbeiten und mir einen Job bei Starbucks oder so besorgen. Simon sagt, die suchen immer Leute. Ich bin alt genug, um selbst auf mich aufzupassen …«
»Nein!« Der schneidende Ton in Jocelyns Stimme ließ Clary zusammenzucken. »Ich geb dir das Geld für den Kunstunterricht zurück, Clary, aber du kommst mit uns. Das steht völlig außer Frage. Du bist zu jung, um allein hierzubleiben. Es könnte etwas passieren.«
»Was soll denn schon passieren?«, gab Clary zurück.
In dem Moment krachte es. Erstaunt schnellte Clary herum und sah, dass Luke eines der gerahmten Bilder umgestoßen hatte, die an der Wand lehnten. Sichtlich verärgert stellte er es wieder auf. Als er sich aufrichtete, bemerkte sie seinen verbissenen Gesichtsausdruck. »Ich werd dann mal gehen.«
Jocelyn biss sich auf die Lippe. »Warte.« Sie hastete ihm bis zur Wohnungstür nach, wo sie ihn einholte, als er den Türknauf schon in der Hand hatte. Clary, die vom Sofa aus spitze Ohren machte, konnte das eindringliche Flüstern ihrer Mutter nur halb verstehen. »... Bane«, wisperte sie, »ich versuche schon seit drei Wochen, ihn zu erreichen. Laut Anrufbeantworter ist er in Tansania. Was soll ich denn machen?«
»Jocelyn«, erwiderte Luke kopfschüttelnd, »du kannst doch nicht bis in alle Ewigkeit ständig zu ihm laufen.«
»Aber Clary …«
» … ist nicht Jonathan«, zischte Luke. »Du hast dich total verändert, seit das passiert ist, bist danach nie mehr dieselbe gewesen, aber Clary ist nun mal nicht Jonathan.«
Was hat mein Vater denn damit zu tun?, dachte Clary verblüfft.
»Ich kann sie nicht ständig im Haus behalten und nicht mehr vor die Tür lassen. Das macht sie nicht mit.«
»Natürlich nicht!« Luke klang nun wirklich aufgebracht. »Sie ist kein Haustier, sondern ein Teenager, fast schon erwachsen.«
»Aber wenn wir aus der Stadt raus wären …«
»Du musst mit ihr reden, Jocelyn.« Luke klang entschlossen. »Ich meine es ernst.« Er griff nach dem Türknauf.
In dem Moment flog die Tür auf. Jocelyn stieß vor Schreck einen kleinen Schrei aus.
»Großer Gott!«, entfuhr es Luke.
»Ich bin’s nur«, erklärte Simon unbekümmert, »obwohl ich oft zu hören bekomme, dass ich ihm verblüffend ähnlich sehe.« Er winkte Clary von der Tür aus zu. »Bist du so weit?«
Jocelyn holte tief Luft, dann fasste sie sich. »Simon, hast du etwa an der Tür gelauscht?«
Simon blinzelte überrascht. »Nein, ich bin gerade erst gekommen.« Er bemerkte Jocelyns bleiche Miene und Lukes angespannten Gesichtsausdruck. »Stimmt was nicht? Soll ich wieder gehen?«
»Keine Sorge, wir sind sowieso gerade fertig.« Luke quetschte sich an Simon vorbei und polterte geräuschvoll die Treppe hinunter. Unten hörte man die Haustür zuschlagen.
Simon drückte sich unsicher im Eingang herum. »Ich kann auch später noch mal wiederkommen. Wirklich. Das macht mir nichts aus.«
»Das wäre vielleicht …«, setzte Jocelyn an, aber Clary war schon aufgesprungen.
»Vergiss es, Simon, wir gehen«, sagte sie schnell, riss ihre Kuriertasche vom Garderobenhaken im Flur und warf sie sich über die Schulter. Ihrer Mutter schenkte sie einen feindseligen Blick. »Bis später, Mom.«
Jocelyn biss sich auf die Unterlippe. »Clary, lass uns noch mal darüber reden.«
»Dafür haben wir im Urlaub ja mehr als genug Zeit«, konterte Clary giftig und sah mit Genugtuung, wie ihre Mutter zusammenzuckte. »Warte nicht auf mich«, fügte sie noch hinzu, dann packte sie Simon am Arm und zerrte ihn förmlich in Richtung Tür.
Er sträubte sich und warf Clarys Mutter, die allein und verloren in der Diele stand und die Hände verkrampft zusammenpresste, über die Schulter einen halb entschuldigenden Blick zu. »Ciao, Mrs Fray«, rief er. »Schönen Abend noch!«
»Ach, halt die Klappe, Simon …«, fauchte Clary und schlug die Tür hinter sich zu, sodass die Antwort ihrer Mutter ungehört verhallte.
»Mann, du reißt mir ja den Arm ab«, protestierte Simon, als Clary ihn hinter sich die Treppe hinunterzog. Ihre grünen Skechers dröhnten mit jedem wütenden Schritt auf den Holzstufen. Sie schaute zurück nach oben und rechnete fast damit, das Gesicht ihrer Mutter am Geländer zu sehen, doch die Wohnungstür blieb verschlossen.
»Tut mir leid«, murmelte Clary und ließ Simons Handgelenk los. Sie blieb kurz am Fuß der Treppe stehen, um ihre Tasche richtig umzuhängen.
Wie die meisten Sandsteinbauten in Park Slope hatte Clarys Haus früher einer reichen Familie gehört. Ein Abglanz seiner einstigen Pracht ließ sich noch an dem geschwungenen Treppenlauf und dem angeschlagenen Marmorboden der Eingangshalle erkennen, deren Oberlicht von einer einzigen Glasscheibe bedeckt wurde. Vor langer Zeit hatte man das Gebäude in mehrere Wohnungen unterteilt. Clary und ihre Mutter bewohnten das dreigeschossige Haus gemeinsam mit einer älteren Dame, die in ihrer Wohnung im Erdgeschoss als Hellseherin arbeitete. Sie verließ ihre Räumlichkeiten fast nie, obwohl sie nur selten Kundschaft empfing. Das goldene Schild an ihrer Tür wies sie als »MADAME DOROTHEA, SEHERIN UND WAHRSAGERIN« aus.
Der süße, schwere Duft nach Räucherstäbchen quoll aus der halb geöffneten Tür in die Eingangshalle. Clary hörte leises Gemurmel.
»Schön, dass ihr Geschäft floriert«, meinte Simon, »in unseren Zeiten findet sich für Seher viel zu selten regelmäßige Arbeit.«
»Kannst du dir deine sarkastischen Sprüche mal sparen?«, fauchte Clary ihn an.
Simon schaute verdutzt, ehrlich betroffen. »Ich dachte, du magst es, wenn ich geistreich und ironisch bin.«
Clary wollte gerade etwas darauf erwidern, als sich Madame Dorotheas Tür ganz öffnete und ein Mann heraustrat. Er war hochgewachsen, hatte goldbraune Haut, katzengleiche goldgrüne Augen und wirres schwarzes Haar. Der Mann schenkte ihr ein blendendes Lächeln, das seine scharfen weißen Zähne zum Vorschein kommen ließ.
Ein Schwindelgefühl überkam sie, ganz so, als ob sie jeden Moment ohnmächtig werden könnte.
Simon starrte sie besorgt an. »Alles in Ordnung? Du siehst aus, als würdest du gleich umfallen.«
Clary blinzelte und setzte eine erstaunte Miene auf. »Äh, was? Nein, nein, mir geht’s gut.«
Doch anscheinend nahm Simon ihr das nicht ab. »Du siehst aus, als hättest du gerade einen Geist gesehen.«
Sie schüttelte den Kopf. Vor ihrem inneren Auge tauchte eine vage Erinnerung auf, die Erinnerung an etwas, das sie gesehen hatte. Aber als sie sich darauf konzentrierte, löste sie sich in Luft auf. »Nein, es ist nichts. Ich dachte, ich hätte Dorotheas Katze gesehen, aber es war wohl bloß eine Lichtspiegelung.« Simon musterte sie ernst. »Außerdem habe ich seit gestern nichts gegessen«, rechtfertigte sie sich. »Wahrscheinlich bin ich deswegen ein bisschen daneben.« Beschützend legte er ihr den Arm um die Schultern. »Komm, ich lad dich zum Essen ein.«
»Ich versteh einfach nicht, wie man so sein kann«, sagte Clary zum vierten Mal und versuchte, mit einem Nacho etwas Guacamole von ihrem Teller zu schaufeln. Sie saßen beim Mexikaner um die Ecke, einem winzigen Laden namens »Nacho Mama«. »Es ist schon schlimm genug, dass sie mir alle zwei Wochen Hausarrest verpasst. Aber jetzt werd ich auch noch für den Rest des Sommers ins Exil geschickt.«
»Du kennst doch deine Mutter. Ab und zu ist sie nun mal so – etwa jede zweite Minute«, grinste Simon sie über seinen vegetarischen Burrito hin an.
»Du hast gut lachen«, erwiderte sie beleidigt. »Du wirst ja auch nicht Gott weiß wie lange in die hinterletzte Pampa verschleppt …«
»Clary.« Simon unterbrach ihre Tirade. »Erstens hab ich dir nichts getan, und zweitens ist es nicht für immer.«
»Und woher willst du das wissen?«
»Weil ich deine Mutter kenne«, erwiderte Simon nach kurzem Zögern. »Ich meine, du und ich, wir sind jetzt schon seit … hm … seit zehn Jahren befreundet. Ich weiß eben, dass sie manchmal so ist. Sie wird sich schon wieder beruhigen.«
Clary spießte eine Chilischote auf und knabberte geistesabwesend an der Spitze. »Ja, aber kennst du sie tatsächlich? Manchmal frage ich mich nämlich, ob überhaupt jemand sie wirklich kennt.«
Simon machte ein ratloses Gesicht. »Was willst du damit sagen?«
Clary atmete tief durch, um das Brennen im Mund zu lindern. »Na ja, sie erzählt nie etwas von sich. Ich weiß nichts über ihre Kindheit, ihre Familie und kaum etwas darüber, wie sie meinen Dad kennengelernt hat. Nicht mal Hochzeitsfotos hat sie. Als ob ihr Leben erst angefangen hätte, als sie mich bekam. Damit redet sie sich nämlich immer raus, wenn ich sie danach frage.«
»Ah, wie romantisch.« Simon zog ein Gesicht.
»Nein, das ist es nicht. Es ist merkwürdig. Es ist einfach seltsam, dass ich nichts über meine Großeltern weiß. Dass die Eltern meines Dads nicht sehr nett zu ihr waren, weiß ich, aber können sie wirklich so schlimm gewesen sein? Ich meine, dass sie nicht einmal ihr eigenes Enkelkind sehen wollten?«
»Vielleicht hasst deine Mutter sie ja. Vielleicht haben sie sie misshandelt oder so«, grübelte Simon. »Sie hat schließlich diese Narben.«
Clary starrte ihn erstaunt an. »Sie hat was?«
Simon schluckte ein Stück Burrito hinunter. »Diese kleinen dünnen Narben – überall auf ihrem Rücken und den Armen. Ich hab deine Mutter doch mal im Badeanzug gesehen.«
»Ich hab nie irgendwelche Narben bemerkt«, erwiderte Clary im Brustton der Überzeugung. »Ich glaube, das bildest du dir nur ein.«
Er starrte sie an und wollte gerade etwas sagen, als tief in der Kuriertasche ihr Mobiltelefon zu schrillen begann. Clary holte es heraus, sah die Nummer im Display und rümpfte die Nase. »Meine Mom.«
»Das sieht man deinem Gesicht an. Willst du mit ihr reden?«
»Jetzt nicht.« Wie so oft verspürte Clary ein schuldbewusstes Nagen im Bauch, als das Klingeln verstummte und sich die Voicemail einschaltete. »Ich will mich jetzt nicht mit ihr streiten.«
»Du kannst auch bei mir übernachten«, bot Simon an, »solange du willst.«
»Erst mal schauen, ob sie sich vielleicht wieder abregt.« Clary drückte die Voicemail-Taste. Die Stimme ihrer Mutter klang angespannt, aber um Unbefangenheit bemüht. »Clary, tut mir leid, dass ich dich mit den Urlaubsplänen überrumpelt habe. Komm nach Hause, dann reden wir drüber.« Clary unterbrach die Verbindung, ehe die Nachricht zu Ende war, wodurch sie sich noch schuldiger fühlte. Aber ihre Wut war noch nicht verraucht. »Sie will mit mir reden.«
»Und, willst du das auch?«
»Keine Ahnung.« Clary rieb sich die Augen. »Gehst du jetzt noch zu der Lesung?«
»Na ja, ich hab es schließlich versprochen.«
Clary stand auf und schob den Stuhl zurück. »Dann komm ich mit. Ich kann sie ja anrufen, wenn es vorbei ist.« Der Gurt der Kuriertasche rutschte von ihrem Arm. Simon schob ihn gedankenverloren zurück, wobei seine Finger einen Moment auf ihrer nackten Schulter verweilten.
Draußen war es schwül wie in einem Treibhaus. Die Feuchtigkeit sorgte dafür, dass Clarys Haar sich kräuselte und Simon das T-Shirt am Rücken klebte. »Und, wie geht’s der Band?«, fragte sie. »Gibt’s was Neues? Als wir vorhin telefoniert haben, war so ein Gejohle im Hintergrund.«
Simons Gesicht hellte sich auf. »Es läuft super. Matt sagt, er kennt jemanden, der uns einen Gig in der Scrap Bar besorgen könnte. Und wir überlegen uns gerade einen neuen Bandnamen.«
»Aha.« Clary musste sich ein Grinsen verkneifen. Simons Band hatte nie wirklich Musik gemacht; meist saßen die Jungs nur bei Simon im Wohnzimmer herum und stritten sich über Namen und Band-Logos. Manchmal fragte sie sich, ob überhaupt irgendeiner von ihnen ein Instrument spielen konnte. »Was steht denn zur Auswahl?«
»Wir überlegen, ob wir uns ›Sea Vegetable Conspiracy‹ nennen sollen oder ›Rock Solid Panda‹.«
»Das ist beides grauenhaft«, erwiderte Clary kopfschüttelnd.
»Eric hat ›Lawn Chair Crisis‹ vorgeschlagen.«
»Eric sollte lieber bei seinen Spielen bleiben.«
»Dann müssten wir uns aber einen neuen Schlagzeuger suchen.«
»Ach, Eric ist euer Drummer? Ich dachte, er schnorrt euch nur an und erzählt allen Mädels in der Schule, er spiele in einer Band, um Eindruck zu schinden.«
»Ach was«, meinte Simon leichthin, »Eric hat sich geändert. Er hat jetzt eine Freundin; sie sind schon seit drei Monaten zusammen.«
»Also so gut wie verheiratet«, sagte Clary und umrundete ein Paar, das einen Kinderwagen schob. Darin saß ein kleines Mädchen mit gelben Plastikspangen im Haar und umklammerte eine Elfenpuppe mit strahlend blauen golddurchwirkten Flügeln. Aus den Augenwinkeln glaubte Clary zu erkennen, wie sie sich bewegten. Hastig wandte sie den Blick ab.
»Das heißt«, fuhr Simon fort, »dass ich jetzt der Einzige in der Band bin, der noch keine Freundin hat. Obwohl genau das der eigentliche Grund ist, überhaupt in einer Band zu spielen – um Mädchen kennenzulernen.«
»Ich dachte, es ginge nur um die Musik.« Ein Mann mit Gehstock kreuzte ihren Weg in Richtung Berkeley Street. Clary schaute zur Seite, besorgt, dass auch ihm Flügel, weitere Arme oder eine lange gespaltene Zunge wachsen könnten, wenn sie ihn zu lange ansah. »Aber wen interessiert denn, ob du eine Freundin hast oder nicht?«
»Mich«, entgegnete Simon düster. »In der Schule bin ich bald der Einzige ohne Freundin – abgesehen von Wendell, dem Hausmeister. Und der stinkt nach Glasreiniger.«
»Na jedenfalls weißt du, dass er noch zu haben ist.«
Simon sah sie giftig an. »Sehr lustig, Fray.«
»Versuch’s doch mal mit Sheila Barbarino, der Stringtanga-Tussi.« Clary hatte in der Neunten in Mathematik hinter ihr gesessen, und jedes Mal, wenn Sheila einen Bleistift aufhob – also etwa alle zwei Minuten –, hatte sie den String unter der ultratief sitzenden Jeans begutachten dürfen.
»Das ist genau die, mit der Eric seit drei Monaten geht«, klärte Simon sie auf. »Sein Tipp war, ich sollte mir einfach die Braut mit dem geilsten Body aussuchen und sie am ersten Schultag zur Herbstfete einladen.«
»Eric ist ein sexistisches Schwein«, erwiderte Clary, die plötzlich gar nicht so genau wissen wollte, welches Mädchen der Schule in Simons Augen die geilste Figur hatte. »Nennt eure Band doch ›The Sexist Pigs‹.«
»Klingt nicht schlecht«, meinte Simon unbekümmert. Clary schnitt ihm eine Grimasse. In der Tasche plärrte erneut ihr Mobiltelefon. Sie fischte es heraus. »Noch mal deine Mom?«, fragte er.
Clary nickte. Sie stellte sich ihre Mutter vor, wie sie allein und verloren in der Diele stand. Schuldgefühle stiegen in ihr auf.