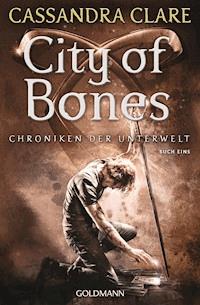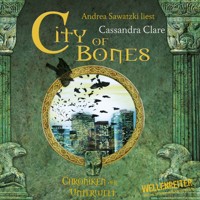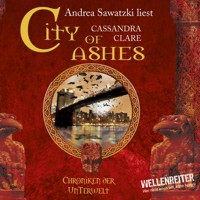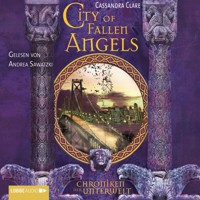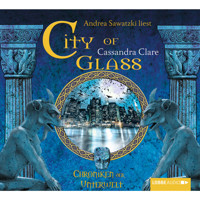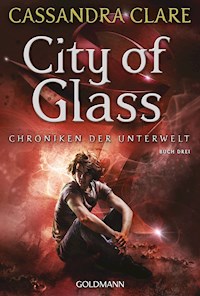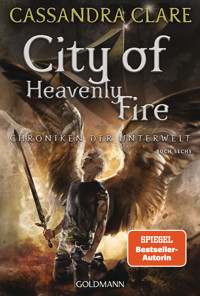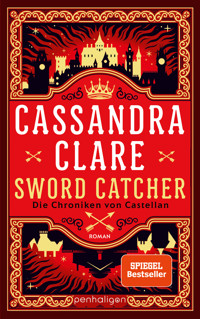
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Sword Catcher
- Sprache: Deutsch
Eine neue epische Saga aus der Feder einer der besten Fantasy-Autorinnen unserer Zeit: Cassandra Clare!
Kel war ein Straßenkind ohne Eltern, ein Niemand ohne Zukunft. Doch dann wurde er zum Schwertfänger – zum Doppelgänger des königlichen Erben von Castellan, Prinz Conor Aurelian. Kel wuchs mit Conor auf, sie sind wie Brüder, doch ein Schwertfänger hat nur einen Zweck: statt des Thronfolgers zu sterben. Ein vereiteltes Attentat führt Kel mit der Heilerin Lin an den Hof des gefürchteten Lumpensammlers, den Herrscher über Castellans Unterwelt. Und dort entdecken Lin und Kel eine Verschwörung, welche ihre Welt ins Chaos zu stürzen vermag. Denn eine Liebe, die nicht sein darf, steht im Begriff das Königreich zu zerstören …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1035
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Ein Schwertfänger hat nur einen Zweck: statt des Thronfolgers zu sterben. Doch Kel hat keine Angst vor diesem Schicksal. Als Doppelgänger von Prinz Conor entkam er als Kind der Gosse und durfte das Leben eines Adligen am Königshof führen – bis jetzt. Denn während das Reich auf die Vermählung des Thronfolgers wartet, entdeckt Kel eine entsetzliche Verschwörung, die sich von der Unterwelt bis in die höchsten Adelskreise zieht. Und die Einzigen, die dem Schwertfänger zur Seite stehen, sind die geheimnisvolle Heilerin Lin und der wahre Herr über Castellan: der Lumpensammlerkönig …
»Fantasy der Meisterklasse! Clares exzellenter Weltenbau, ihre faszinierenden Figuren und ihr Talent, auf jeder Seite neue Wendungen herbeizuführen, sind ungeschlagen.« Leigh Bardugo
Autorin
Cassandra Clare wurde als Tochter amerikanischer Eltern in Teheran geboren und verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit damit, mit ihrer Familie die Welt zu bereisen. Bis zu ihrem zehnten Lebensjahr lebte sie in Frankreich, England und der Schweiz. Ihre Highschool-Jahre verbrachte sie in Los Angeles, wo sie Geschichten schrieb, um ihre Klassenkameraden zu amüsieren. 2004 begann sie mit der Arbeit an ihrem Roman »City of Bones«, inspiriert von der urbanen Landschaft von Manhattan, ihrer Lieblingsstadt. Seitdem ist Clare zu einer Weltbestsellerautorin mit 50 Millionen verkauften Büchern geworden. Ihr neuer Roman »Sword Catcher« ist ihr erster High-Fantasy-Roman.
Cassandra Clare
Sword Catcher
Die Chroniken von Castellan
Roman
Deutsch von Franca Fritz und Heinrich Koop
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Sword Catcher« bei Del Rey, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung.Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2023 by Cassandra Clare, LLC
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Waltraud Horbas
Covergestaltung: Anke Koopmann | designomicon nach einer Originalvorlage von Penguin US
Coverdesign und -illustration: Jim Tierney
BL · Herstellung: mar
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30433-1V003
www.penhaligon.de
Für Josh
Wer Castellan regiert, regiert die Welt.
(Sprichwort)
Prolog
Es begann mit einem Verbrechen. Dem Diebstahl eines Jungen.
Allerdings wurde der Raub nicht als Verbrechen bezeichnet. Denn der Mann, der für das Unternehmen verantwortlich zeichnete, war ein Soldat – der Hauptmann der Pfeilschwadron, die den König von Castellan schützte und dafür sorgte, dass die von ihm erlassenen Gesetze eingehalten wurden.
Und dieser Hauptmann hatte eine enorme Abneigung gegen Kriminelle.
Sein Name war Aristide Jolivet. Als er nun die Hand hob, um kräftig gegen die Tür des Waisenhauses zu klopfen, schimmerte an seiner linken Hand ein großer, quadratischer Amethyst im Mondlicht. Darin war ein Löwe eingraviert, das Symbol der Stadt. Ein brüllender Löwe.
Stille. Jolivet runzelte die Stirn. Er mochte es nicht, wenn man ihn warten ließ, und oft kam es auch nicht vor. Gereizt warf er einen Blick über die Schulter zu dem schmalen, in die Klippen gehauenen Pfad, der steil zum Meer abfiel. Er war schon immer der Ansicht gewesen, dass dies ein seltsamer Ort für ein Waisenhaus war. Die Felsen, die sich über der nördlichen Bucht von Castellan erhoben, waren zerklüftet, mit Narben übersät wie das Gesicht eines Pockenkranken und mit einer dünnen Schicht aus losem Geröll bedeckt. Hier oben konnte man leicht den Halt verlieren, und jedes Jahr stürzten etwa ein Dutzend Menschen von den Klippen ins grüne Meer. Niemand schaffte es danach zurück ans Ufer – denn selbst wenn jemand den Sturz überlebte, wussten die Krokodile, die unter der Wasseroberfläche lauerten, was ein Schrei und das Platschen bedeutete.
Doch irgendwie gelang es dem Waisenhaus von Aigon, die meisten seiner Schützlinge – wenn auch nicht alle – vor dem Gefressenwerden zu bewahren. In Anbetracht des üblichen Schicksals elternloser Kinder in den Straßen der Stadt war das eine ziemlich gute Quote und entsprechend begehrt ein Platz im Orfelinat.
Jolivet runzelte erneut die Stirn und klopfte ein weiteres Mal. Das Geräusch hallte so stark, als würden die Mauern selbst läuten. Die Granitfassade des Waisenhauses, das von einer graugrünen Mauer umgeben war, ragte aus der Felswand heraus – das Orfelinat thronte nicht auf den Klippen, sondern bildete einen Teil davon. Einst hatte es sich dabei um eine Art Festung gehandelt, zu Zeiten des alten Reichs. Und tatsächlich waren in die Tür des Hauses, an die Jolivet jetzt klopfte, verblasste Worte in der alten Sprache von Magna Callatis eingraviert. Allerdings sagten sie ihm nichts. Er hatte nie verstanden, warum man eine Sprache beherrschen sollte, die niemand mehr sprach.
Plötzlich schwang die Tür weit auf und auf ihrer Schwelle erschien eine Frau in der blau-weißen Tracht der Schwesternschaft von Aigon und musterte Jolivet mit argwöhnischem Blick. »Verzeiht, dass Ihr warten musstet, Legat«, sagte sie. »Ich wusste nicht, dass Ihr heute zurückkehren würdet.«
Jolivet neigte höflich den Kopf. »Schwester Bonafilia«, sagte er. »Darf ich eintreten?«
Sie zögerte, obwohl Jolivet wirklich nicht wusste, warum. Seine Frage war eine reine Formalität. Wenn er das Orfelinat betreten wollte, würde weder sie noch eine der anderen Schwestern ihn daran hindern können.
»Ich dachte, Euer vorheriger Besuch würde bedeuten, dass Ihr das Gesuchte nicht gefunden habt«, sagte sie schließlich.
Jolivet betrachtete sie eingehender. Schwester Bonafilia war eine kleine Frau mit knochigen Gesichtszügen und rauen Händen. Ihre Kleidung wirkte schlicht und war eindeutig unzählige Male gewaschen worden.
»Mein erster Besuch diente dazu, das Angebot zu sichten«, antwortete er. »Ich habe meine Erkenntnisse dem Palast mitgeteilt und bin heute auf dessen Befehl zurückgekehrt. Auf Befehl des Königs.«
Schwester Bonafilia zögerte einen weiteren Moment, eine Hand am Türpfosten. Die Sonne ging bereits unter: Schließlich war es Winter, die trockene Jahreszeit. Und die Wolken, die sich am Horizont türmten, schimmerten schon in Rosa- und Goldtönen. Jolivet runzelte erneut die Stirn; er hatte gehofft, diesen Auftrag vor Anbruch der Dunkelheit erledigen zu können.
Nun neigte Schwester Bonafilia den Kopf. »Wie Ihr wünscht.«
Sie trat einen Schritt zurück, um Jolivet hereinzulassen. Im Inneren des Gebäudes befand sich eine Eingangshalle aus unbehauenem Granit, deren Decke mit verblichenen Kacheln in Grün und Gold verziert war – den Farben des alten, inzwischen seit tausend Jahren vergangenen Reichs. Heilige Schwestern in abgetragenen Leinengewändern drängten sich an den Mauern und schauten misstrauisch zu ihm hinüber. Der Steinboden war im Laufe der Jahre mehr als nur glatt geschliffen worden und hob und senkte sich wie die Oberfläche des Ozeans. Eine Steintreppe führte nach oben, zweifellos zu den Schlafsälen der Kinder.
Mehrere Kinder – Mädchen, nicht älter als elf oder zwölf – stiegen gerade die Stufen hinunter. Doch als sie Jolivet in seiner glänzenden rot-goldenen Uniform mit dem Prunkschwert an der Seite sahen, blieben sie abrupt stehen und starrten ihn mit großen Augen an.
Im nächsten Moment huschten sie die Treppe wieder hinauf, lautlos wie Mäuse unter dem interessierten Blick einer Katze. Zum ersten Mal geriet Schwester Bonafilias Gemütsruhe ins Wanken. »Bitte«, flehte sie. »Euer Erscheinen in diesem Aufzug … Ihr erschreckt die Kinder.«
Jolivet lächelte matt. »Ich werde nicht lange bleiben, wenn Ihr die Befehle des Königs befolgt.«
»Und wie lauten diese Befehle?«
Kel und Cas spielten im Freien Piratenschlacht – ein Spiel, das sie erfunden hatten und das nur ein paar Stöcke und einige wertvolle Murmeln erforderte, die Kel beim Kartenspiel von einigen der älteren Jungen gewonnen hatte. Wie üblich schummelte Kel, was Cas aber nicht weiter zu stören schien. Er konzentrierte sich voll und ganz auf das Spiel, und mehrere dunkelblonde Strähnen fielen ihm ins sommersprossige Gesicht, während er stirnrunzelnd den nächsten Zug seines Schiffs plante.
Nur wenige Minuten zuvor hatte Schwester Jenova sie zusammen mit den meisten anderen Jungen aus dem Schlafsaal in den Garten gescheucht. Allerdings hatte sie ihnen keinen Grund dafür genannt und sie lediglich aufgefordert, spielen zu gehen. Und Kel stellte keine Fragen. Normalerweise stand er um diese Zeit am Waschbecken und schrubbte sich Gesicht und Hände mit Kernseife, um sich auf das Abendessen vorzubereiten. »Eine reine Seele in einem reinen Körper«, pflegte Schwester Bonafilia zu sagen. »Gesundheit ist Reichtum, und ich wünsche euch allen, dass ihr reich werdet.«
Jetzt strich sich Kel die Haare aus dem Gesicht. Sie wurden zu lang. Bald würde Schwester Bonafilia es bemerken, ihn packen und seine Locken mit einer Küchenschere abschneiden, leise vor sich hin murmelnd. Kel machte das jedoch nichts aus. Er wusste, dass sie ihn ins Herz geschlossen hatte, da sie ihm oft heimlich Gebäck aus der Küche zusteckte und ihn nur ein kleines bisschen anschrie, wenn er beim Klettern auf den gefährlicheren Felsen erwischt wurde … den Felsen, die ins Meer hinausragten.
»Es wird dunkel«, sagte Cas und schaute zum Himmel hinauf, der sich langsam violett färbte. Kel wünschte, er könnte das Meer von hier aus sehen. Das Meer war das Einzige, was ihn nie langweilte, der Blick hinaus auf die Wellen. Er hatte versucht, es Cas zu erklären – wie die See sich ständig veränderte, jeden Tag eine andere Farbe, ein etwas anderes Licht. Doch Cas hatte nur gutmütig die Schultern gezuckt. Er musste nicht verstehen, warum Kel etwas tat. Kel war sein Freund, also war es in Ordnung. »Was glaubst du, warum die Schwestern wollen, dass wir hier draußen spielen?«
Bevor Kel antworten konnte, traten zwei Gestalten durch den Torbogen, der den ummauerten Garten mit der Hauptfestung verband. (Kel bezeichnete das Bauwerk immer als Festung, nicht als Waisenhaus. Es war viel verwegener, in einer Festung zu leben als an einem Ort, an dem man landete, weil niemand einen wollte.)
Eine der Gestalten war Schwester Bonafilia. Die andere war den meisten Einwohnern von Castellan bekannt: ein hochgewachsener Mann in einem Mantel mit Messingknöpfen, auf dem über der Brust das Siegel zweier gekreuzter Pfeile abgebildet war. Seine Stiefel und Armschienen waren mit Nägeln gespickt, und er ritt stets an der Spitze der Pfeilschwadron, der Elitetruppe des Königs, wenn sie an Festtagen oder bei Feierlichkeiten durch die Stadt zog. Die Stadtbewohner nannten ihn den »Jagenden Adler«, und tatsächlich ähnelte er einer Art Raubvogel: Er war groß und drahtig, und sein hageres Gesicht war von zahlreichen Narben gezeichnet, die sich weiß von seiner olivbraunen Haut abhoben.
Dieser Mann war Legat Aristide Jolivet und Kel sah ihn jetzt bereits zum zweiten Mal im Orfelinat. Was irgendwie seltsam war. Soweit er wusste, besuchten Militärführer keine Waisenhäuser. Aber vor knapp einem Monat hatten die Jungen genau wie heute im Garten gespielt, als Kel zur Festung hinübergeschaut und gesehen hatte, wie eine rot-goldene Uniform aufblitzte.
Er war schon immer von Jolivet fasziniert gewesen; wenn er und Cas spielten, gaben sie ihm oft die Rolle des Bösewichts – ein Pirat und Kopfgeldjäger, der jeden festgenommenen, unschuldigen Verbrecher sofort ins Tully-Gefängnis warf und dann folterte, um Informationen aus ihm herauszuquetschen. Nicht dass Kel oder Cas jemals ihr Schweigen gebrochen hätten: Ein Verräter war das Schlimmste, was sie sich vorstellen konnten.
Trotzdem hatte Kel Jolivet sofort erkannt und sich aufgerappelt. Doch als er zur Festung rannte, war Jolivet bereits verschwunden, und als er Schwester Bonafilia fragte, ob der Legat gerade hier gewesen sei, hatte sie ihm gesagt, er solle sich nicht lächerlich machen und sich nicht dauernd irgendwelche Dinge einbilden.
Jetzt senkte sich Stille über die Jungen im Garten, als Jolivet kerzengerade dastand und die Lage mit seinen blassen Augen sondierte. Sein Blick ruhte einen Moment auf einem Jungen (Jacme, der damit beschäftigt war, Streifen von einem Pulverborkenbaum zu ziehen), dann auf einem anderen (Bertran, mit zehn Jahren der Älteste ihrer Gruppe). Schließlich schweiften Jolivets Augen über Cas hinweg und hefteten sich auf Kel.
Und nach einem langen, nervenaufreibenden Moment lächelte er. »Der da«, sagte er. »Das ist er.«
Kel und Cas tauschten einen verwirrten Blick. Wer von uns?, formulierte Cas stumm mit den Lippen, aber ihnen blieb keine Zeit für lange Diskussionen. Denn gleich darauf legte sich eine Hand auf Kels Arm und zog ihn auf die Beine.
»Du musst mitkommen.« Bonafilia packte ihn mit festem Griff. »Bitte mach keinen Ärger, Kel.«
Ihre Bitte verdross ihn. Er war doch kein Unruhestifter. Okay, da war diese Sache mit dem Schießpulver und dem Nordturm gewesen … und dann noch dieses eine Mal, als er Bertran dazu gebracht hatte, an der Gartenmauer über die Planke zu gehen, und der Idiot sich einen Fußknochen gebrochen hatte. Aber das hätte auch jedem anderen passieren können.
Trotzdem wirkte Schwester Bonafilias Gesicht beunruhigend angespannt. Seufzend reichte Kel seine Murmel an Cas weiter. »Pass darauf auf, bis ich zurück bin.«
Cas nickte und verstaute die Glaskugel mit großem Getue in seiner Westentasche. Offensichtlich ging er nicht davon aus, dass Kel länger als ein paar Minuten fort sein würde. Kel glaubte das zwar auch nicht, aber allmählich begann er sich zu wundern. Die Art und Weise, wie Schwester Bonafilia ihn eilig durch den Garten schob, war irgendwie merkwürdig. Und das Gleiche galt für die Art, wie der Legat ihn beim Näherkommen scharf beobachtete, sich dann zu ihm hinabbeugte und ihn eindringlich musterte, als suchte er die Antwort auf ein Rätsel. Er hob sogar Kels Gesicht an, um ihn genauer zu betrachten – von seinen schwarzen Locken über die blauen Augen bis hin zu seinem störrisch vorgeschobenen Kinn.
Schließlich runzelte er die Stirn. »Der Junge ist schmuddelig.«
»Er hat im Garten gespielt«, erwiderte Schwester Bonafilia. Kel fragte sich, warum es den Erwachsenen anscheinend Spaß machte, Beobachtungen über Dinge auszutauschen, die so offensichtlich waren. »Das tut er oft. Er spielt gern mit Erde und Schlamm.«
Kel spürte die ersten Anzeichen von Beunruhigung. Er war nicht schmutziger als die anderen Jungen; warum wirkte Schwester Bonafilia so seltsam und redete so merkwürdig? Doch er hielt den Mund, als sie den Garten verließen – der Legat ging voran, während Bonafilia Kel hastig durch die alte Festung bugsierte. Dabei murmelte sie leise vor sich hin. Aigon, du, der du die Erde mit Wasser umgibst, der du über schnell segelnde Schiffe herrschst, gewähre deiner Tochter eine Bitte und sorge für die Sicherheit ihres Schützlings.
Sie betete, erkannte Kel plötzlich und spürte wieder diese Unruhe – dieses Mal noch stärker.
Als sie die Eingangshalle erreichten, bemerkte er zu seiner Überraschung, dass die Eingangstüren offen standen. Dahinter sah er, eingefasst wie in einem quadratischen Rahmen, wie die Sonne bereits im Meer versank. Der Himmel warf einen warmen Schein auf das zinnblaue Wasser, und am Horizont konnte Kel die Türme der halb versunkenen Insel Tyndaris ausmachen, die sich weinrot färbten.
Die Szenerie lenkte ihn ab, und er verlor für einen Moment jegliches Zeitgefühl – wie so manches Mal, wenn er schöne Dinge betrachtete. Als ihn die Wirklichkeit wieder einholte, stellte er fest, dass er zwischen den zerklüfteten Felsen vor dem Orfelinat stand, flankiert von Schwester Bonafilia auf der einen und Jolivet auf der anderen Seite, dessen rot-goldene Uniform wie die untergehende Sonne leuchtete.
Außerdem wartete dort auch ein Pferd. Entsetzt starrte Kel das Tier an. Natürlich hatte er schon zuvor Pferde aus der Ferne gesehen, aber noch nie eines aus solcher Nähe. Es schien riesig zu sein und ragte hoch in den Himmel hinauf. Seine Lippen kräuselten sich über harten weißen Zähnen. Außerdem war es schwarz wie die Nacht, mit rollenden schwarzen Augen.
»Ganz recht«, sagte der Legat; er hielt Kels Schweigen offenbar für Bewunderung. »Du bist noch nie auf einem Pferd geritten, stimmt’s? Es wird dir gefallen.«
Das bezweifelte Kel. Und es machte ihm überhaupt nichts aus, dass Schwester Bonafilia ihn an ihre Seite zog, als wäre er ein Kind. (Er hielt sich selbst nicht für ein Kind. Kinder waren etwas vollkommen anderes, sorglos und albern, ganz und gar nicht wie Waisen.)
»Ihr müsst mir versprechen, dass er gut behandelt wird«, forderte Schwester Bonafilia plötzlich in einem Ton, den sie nur selten anschlug und der die Waisenkinder normalerweise in Tränen ausbrechen ließ. »Er ist noch so jung … und dass man ihn einfach so für die Arbeit im Palast heranzieht …« Sie richtete sich kerzengerade auf. »Er ist ein Kind von Aigon und steht unter dem Schutz des Gottes, Legat. Vergesst das nicht.«
Jolivet fletschte die Zähne zu einem Grinsen. »Man wird ihn wie ein Familienmitglied behandeln, Schwester«, sagte er und griff nach Kel.
Kel holte tief Luft. Er wusste, wie man kämpfte, kratzte und trat. Und er hatte den Fuß bereits zurückgezogen, um dem Legaten einen mächtigen Tritt gegen das Schienbein zu verpassen, als er Schwester Bonafilias Miene bemerkte. Zwar konnte er die Mitteilung, die er in ihren Augen las, nicht recht glauben, aber sie war definitiv da – so deutlich wie die Umrisse eines Großseglers am Horizont.
Wehr dich nicht und schrei auch nicht. Lass zu, dass er dich mitnimmt.
Kel ließ seinen Körper erschlaffen, als Jolivet ihn hochhob, und machte sich dadurch extra schwer. Aber das schien den Legaten nicht zu interessieren, denn er schwang Kel mühelos auf den Rücken des monströsen Pferds. Kel drehte sich der Magen um, als die Welt auf den Kopf gestellt wurde; und als sie sich wieder aufrichtete, saß er im Sattel des Tiers, festgehalten von drahtigen Armen. Jolivet hatte sich hinter Kel in den Sattel geschwungen und seine Hände umfassten die Zügel. »Halt dich fest«, sagte er. »Wir reiten zum Palast, um den König zu treffen.«
Möglicherweise wollte er das Ganze wie ein lustiges Abenteuer erscheinen lassen, aber Kel wusste nicht, wovon er redete, und es war ihm auch egal. Denn er hatte sich bereits über die Flanke des Pferds in Richtung Boden gebeugt und sich übergeben.
Danach verließen sie das Orfelinat ziemlich schnell. Jolivet murmelte finster vor sich hin – etwas von dem Erbrochenen war auf seinen Stiefeln gelandet. Aber Kel fühlte sich zu elend und krank, um sich darum zu kümmern. Das Pferd schaukelte hin und her, und Kel war sich bei jeder seiner Kopfbewegungen sicher, dass es ihn gleich beißen würde. Dieser Zustand höchster Alarmbereitschaft hielt die ganze Zeit an, während sie die Felsen zum Kai hinunterritten – die Straße, die an den Docks entlangführte und gegen die das dunkle Wasser des Hafens schwappte.
Kel war fest davon überzeugt, dass er niemals, unter keinen Umständen, Zuneigung zu dem Pferd entwickeln würde, auf dem er gerade saß. Dennoch war die Aussicht von dessen Rücken beeindruckend, während sie durch die Stadt ritten. Bisher hatte er viel Zeit damit verbracht, zu den Menschenmassen hinaufzuschauen, die sich durch die Straßen der Stadt drängten, aber jetzt sah er zum ersten Mal auf sie hinunter. Und alle – ob reiche Kaufmannssöhne in bunten Gewändern, Gastwirte und Hafenarbeiter auf dem Heimweg oder Seeleute aus Hanse und Zipangu, Kaufleute aus Marakand und Geumjoseon – sie alle machten Jolivet Platz, als er an ihnen vorbeiritt.
Was wirklich ziemlich aufregend war. Kel setzte sich aufrechter, als sie in die Ruta Magna einbogen – ein breiter Boulevard, der von der Hafenmündung bis zum Schmalen Pass führte und sich durch die Berge wand, die Castellan von seinem Nachbarkönigreich Sarthe trennten. Inzwischen hatte er fast vergessen, dass er sich kurz zuvor noch elend gefühlt hatte, und seine Aufregung wuchs von Minute zu Minute, während sie sich dem Großen Hügel näherten, der die Stadt überragte.
Klippen und Hügel umgaben die Hafenstadt, und Castellan kauerte in der Talsohle wie ein Igel, der nur ungern die Nase aus seinem sicheren Versteck schob. Aber es handelte sich keineswegs um eine Stadt im Verborgenen. Stattdessen dehnte sie sich aus und das in alle Richtungen. Vom westlichen Meer bis zum Schmalen Pass … jeder Quadratzentimeter überfüllt und laut und schmutzig und lärmend und voller Leben.
Wie die meisten Bürger von Castellan hatte Kel sein ganzes Leben im Schatten des Großen Hügels verbracht. Aber er hatte nicht damit gerechnet, ihn jemals zu betreten – ganz zu schweigen davon, auf den Gipfel zu steigen, wo der Marivent-Palast thronte. Auf diesem Hügel – im Grunde eine Reihe niedriger, mit einem Gestrüpp aus Kiefern und Lavendel bewachsener Kalksteinerhebungen – lebte der Adel, dessen riesige Ländereien sich über die Hänge erstreckten. Die Reichen leben oben und die Armen unten, hatte Kel Schwester Bonafilia einst sagen hören. Und dabei handelte es sich nicht um eine Metapher. Je reicher, desto größer das Haus und desto näher am Palast, der den höchsten Punkt der Stadt einnahm.
Die Adligen liebten ihre Vergnügungen und manchmal drang der Klang ihrer nächtlichen Gelage bis hinunter in die Stadt. Dann zwinkerten sich die Leute auf der Straße zu und sagten Dinge wie: »Sieht ganz so aus, als ob Lord Montfaucon wieder zur Flasche gegriffen hat«, oder: »Lady Alleyne ist also auch ihren dritten Ehemann losgeworden?« Wenn man reich war, dann wussten immer alle über jeden Schritt Bescheid und nahmen mit Begeisterung daran teil, auch wenn sie einen eigentlich gar nicht kannten.
Jetzt bogen sie von der Ruta Magna ab und ritten durch die dunklen Straßen der Stadt, bis sie den Fuß des Hügels erreichten. Hier drängten sich Kastellwächter in roten Uniformen; ihre Aufgabe bestand darin, unerwünschte Personen am Betreten des Hügelpfads zu hindern. Jolivet hielt Kel fest im Sattel, während sie durch den Kontrollpunkt ritten und die Fackeln der Wachen aufloderten, als sie den Jungen neugierig anstarrten. Sie fragten sich wohl, ob die Pfeilschwadron einen sehr kleinen Verbrecher geschnappt hatte, und falls ja, warum man sich die Mühe machte, ihn zum Marivent zu bringen. Den meisten Gesetzesbrechern, egal welchen Alters, war ein kurzer Ritt zum Galgen des Tully-Gefängnisses vorbestimmt.
Einer der Wächter verbeugte sich leicht spöttisch. »Der König erwartet Euch.«
Jolivet knurrte nur. Allmählich hatte Kel den Eindruck, dass er nicht viel redete.
Der Weg zum Palast wand sich steil den Hang hinauf, durch ein Terrain aus Lavendel, Salbei und Süßgras, das den Berg im Sommer tiefgrün färbte. Als sie den Gipfel des Bergs erreichten und das gewaltige Pferd schnaubte, blickte Kel hinunter und sah die Stadt Castellan unter sich liegen – die sichelförmige Bucht des Hafens, die beleuchteten Schiffe im Hafen, wie verstreute Streichholzköpfe. Die Kanäle des Tempelbezirks. Die klaren Linien der Silberstraßen. Die weiße Kuppel des Tully, die leuchtende Uhr an der Spitze des Windturms, der über dem größten Platz der Stadt aufragte. Das ummauerte Gebiet des Sault, wo die Ashkar lebten. Die Ruta Magna, die die Stadt wie eine Duellnarbe durchschnitt.
Er musste wohl eine Weile auf die Stadt hinabgestarrt haben, denn Jolivet schüttelte ihn, als sie das Nordtor des Palastes passierten – das Tor, durch das Gäste das Areal betraten. Die Wimpel am Torbogen zeigten an, welche ausländischen Würdenträger gerade zu Besuch waren. An diesem Abend flatterte die blaue Fahne von Sarthe mit ihrem weißen Adler im salzigen Wind.
Aus dieser Nähe konnte Kel jetzt erkennen, dass die Struktur der weißen Mauern keineswegs glatt, sondern rau war und dass darin Kristallsplitter glitzerten. Ein Junge konnte so eine Mauer erklimmen – wenn er flink und entschlossen war. Raues Gestein bedeutete Haltegriffe und Stützen für die Füße. Und Kel war schon immer gut darin gewesen, über die Felsen im Hafen zu klettern. Er träumte davon, sich eines Tages den Kletten anzuschließen: den Taschendieben des Labyrinths, die angeblich jede noch so glatte Wand hochklettern konnten.
Jolivet schüttelte ihn erneut. »Sitz gerade, Kellian Saren«, sagte er. »Du wirst gleich die königliche Familie kennenlernen.«
»Die was?«
Jolivet lachte leise. »Ganz genau. Der König und die Königin von Castellan warten auf das Vergnügen, dich kennenzulernen.«
Kel war sich nicht sicher, welche Reaktion Jolivet erwartete. Vielleicht Aufregung? Stattdessen rollte sich Kel sofort zusammen wie eine Assel. Doch Jolivet riss ihn hoch, während sie in einen riesigen, quadratischen Innenhof ritten.
Kel bekam einen vagen Eindruck von bogenförmigen Palisaden, hinter denen sich das massive Bauwerk des Palastes erhob. Überall wimmelte es vor Kastellwächtern in rot-goldener Livree, die den Auftrag hatten, den Palast zu schützen. Von ihren Fackeln aus duftendem Holz stiegen aromatischer Rauch und helle Funken in den Himmel hinauf. Diener, deren Tuniken das Löwenwappen der königlichen Familie trugen, eilten mit Tabletts umher, beladen mit Weinkaraffen, Früchten und Pralinen; andere trugen Blumen und Gestecke aus Pfauenfedern, die mit goldfarbenem Zwirn zusammengebunden waren.
Aus dem Inneren des Palastes drang Stimmengewirr und Gelächter. Die Diener hatten zwei große Bronzetüren zum Innenhof aufgestoßen, um die milde Abendluft einzulassen. Unter dem Torbogen stand ein hochgewachsener, nicht in Livree gekleideter Mann und beobachtete Kel und seinen Entführer mit zusammengekniffenen Augen.
Jolivet zerrte Kel aus dem Sattel wie ein Straßenhändler, der einen Sack Zwiebeln von einem Karren warf. Er stellte den Jungen auf die Füße und legte seine großen Hände auf dessen Schultern. Einen kurzen Moment zeichnete sich eine Frage in seinen Augen ab, als er zu Kel hinabsah. »Verstehst du, was hier vor sich geht, Gassenkind? Du bist hier, um dem König von Castellan einen Dienst zu erweisen.«
Kel hustete. Sein Hals schmerzte noch immer, weil er sich übergeben hatte. »Nein«, antwortete er.
»Was meinst du mit Nein?«
Der König von Castellan stellte eine fast mythische Gestalt dar. Im Gegensatz zur Königin verließ er den Palast nur selten, und wenn, dann lediglich zu feierlichen Anlässen: die Vermählung mit dem Meer, die jährliche Unabhängigkeitsansprache auf dem Valerian-Platz. Er erinnerte Kel an den Löwen auf der Flagge von Castellan: golden und überragend. Aber er wirkte definitiv nicht wie jemand, der mit Waisenkindern ohne nennenswerte Beziehungen reden würde.
»Nein danke«, sagte Kel, als er sich an die Manieren erinnerte, die ihm Schwester Bonafilia beizubringen versucht hatte. »Ich möchte lieber nicht mit dem König reden. Ich möchte lieber nach Hause.«
Jolivet schaute genervt zu den Wolken hinauf. »Bei den Göttern im Himmel. Der Junge ist einfältig.«
»Aristide?«
Eine sanfte Stimme. Sanfte Stimmen waren wie sanfte Hände: Sie waren ein Merkmal von Adligen, die nicht schreien mussten, um gehört zu werden. Kel blickte auf und sah den Mann, der eben noch an der Tür gestanden hatte: groß, hager und bärtig, mit dichtem grauem Haar und adlerähnlichen Zügen. Scharf hervortretende Wangenknochen überschatteten die hohlen Wangen.
Plötzlich begriff Kel, warum der Mann keine Livree trug. Stattdessen war er in eine Tunika und einen schlichten grauen Mantel gekleidet: die übliche Kleidung der Ashkar. Um seinen Hals hing ein silbernes Medaillon an einer Kette, mit einem feinen Muster aus Zahlen und Buchstaben.
Kel war sich nicht ganz sicher, was das Dasein als Ashkar bedeutete, aber er wusste, dass sie nicht wie andere Menschen waren. Die Ashkar waren in der Lage, geringe Mengen von Magie anzuwenden – obwohl die meiste Magie nach der Sonderung der Welt verschwunden war –, und die Heilkundigen unter ihnen waren berühmt für ihre Fähigkeiten.
Da sie weder Aigon noch die anderen Götter anerkannten, mussten sie laut Gesetz innerhalb der Tore des Sault leben. Nach Sonnenuntergang durften sie sich nicht mehr frei in Castellan bewegen – was wohl bedeutete, dass dieser Mann die einzige Ausnahme von dieser Regel darstellte: der Berater des Königs. Kel hatte nur vage von ihm gehört – eine schemenhafte Gestalt, die den Hof beriet. Berater waren immer Ashkar, obwohl Kel nicht wusste, warum. Schwester Jenova hatte mal gesagt, es läge daran, dass die Ashkar von Natur aus gerissen wären. Aber sie hatte auch andere, weniger freundliche Dinge gesagt: dass sie gefährlich, verschlagen und andersartig wären. Als Cas jedoch Starkfieber bekommen hatte, war Schwester Jenova sofort zum Sault gelaufen und hatte einen Ashkar-Heilkundigen geweckt – wobei sie offenbar ihre eigenen, oft wiederholten Worte, man könne den Ashkar nicht trauen, vollkommen vergessen hatte.
Der Mann sagte nur kurz angebunden: »Ich werde den Jungen mitnehmen. Lass uns allein, Aristide.«
Jolivet zog eine Augenbraue hoch. »Viel Glück, Bensimon.«
Während Jolivet davonschlenderte, winkte der Ashkar-Mann – Bensimon – Kel mit einem Finger zu sich heran. »Komm mit.«
Und dann führte er Kel in den Palast.
Kels erster Eindruck war, dass alles im Marivent riesig wirkte. Die Korridore des Palastes waren breit wie Zimmer, die Treppenhäuser größer als Großsegler. Und die Gänge verzweigten sich in tausend verschiedene Richtungen wie Korallenäste.
Kel hatte sich das gesamte Innere des Palastes weiß vorgestellt, so wie die Außenmauern. Aber die Wände waren in wunderbaren Schattierungen von Blau und Ocker, Meergrün und Lavendel gestrichen. Die Möbel wirkten zierlich und juwelenartig, als hätte jemand glänzende Käfer in den Räumen verstreut. Selbst die geschnitzten und mit Abbildungen von blühenden Gärten bemalten Fensterläden waren fein gearbeitet. Kel hätte nie gedacht, dass das Innere eines Gebäudes, wie großartig es auch sein mochte, ebenso atemberaubend sein konnte wie ein Sonnenuntergang. Irgendwie beruhigte dieser Anblick seinen rasenden Puls. An einem so schönen Ort konnten doch sicher keine schrecklichen Dinge passieren.
Leider hatte er kaum Gelegenheit, sich eingehender umzuschauen. Bensimon schien sich der Tatsache, dass er ein Kind begleitete, nicht bewusst zu sein und verlangsamte sein Tempo kein bisschen. Stattdessen musste Kel laufen, um mit ihm Schritt zu halten. Was etwas Ironisches an sich hatte, wenn man bedachte, dass nicht er derjenige war, der möglichst schnell ans Ziel wollte – wo auch immer das sein mochte.
Licht strahlte von den Fackeln, die in regelmäßigen Abständen an der Wand befestigt waren – jede einzelne außerhalb von Kels Reichweite. Schließlich erreichten sie eine massive, mit Blattgold verzierte Flügeltür, deren Paneele jeweils eine Szene aus der Geschichte Castellans zeigten: der Sieg der Flotte über die Schiffe des Reichs, der Untergang von Tyndaris, die Übergabe der ersten Chartas durch den König an den Rat, der Bau der Windturmuhr, die Brände der Roten Pest.
Hier hielt Bensimon schließlich inne. »Wir betreten jetzt die Glänzende Galerie«, sagte er. »Dieser Raum ist zwar nicht der Thronsaal, aber dennoch ein zeremonieller Ort. Zeig Respekt.«
Kels erster Eindruck beim Betreten der Glänzenden Galerie war blendendes Weiß. Er hatte noch nie Schnee gesehen, aber von Handelskarawanen gehört, die bei dem Versuch, die eisigen Gipfel nördlich von Hind zu überqueren, in dicken Schneewehen stecken geblieben waren. Weiß, hatten sie gesagt – überall Weiß. Dazu eine Kälte, die einem die Knochen brechen konnte.
Und in der Galerie war auch alles weiß: Wände, Boden, Decke. Alles war aus demselben weißen Stein gefertigt wie die Mauern des Palastes. Am hinteren Ende des Raums, der groß wie eine Höhle wirkte, befand sich ein erhöhtes Podium mit einem langen Tisch aus geschnitztem und vergoldetem Holz, der unter dem Gewicht von Kristallgläsern, Alabastertellern und zarten Porzellantassen zu ächzen schien.
Kel merkte, dass er hungrig war. Verdammt.
Bensimon schloss die Tür hinter ihnen und wandte sich Kel zu. »In einer Stunde«, sagte er, »werden sich in diesem Raum die Adelsfamilien von Castellan drängen.« Er schwieg einen Moment und fuhr dann fort: »Ich nehme an, du kennst den Zwölferrat? Die Charta-Häuser?«
Obwohl Kel sich darüber ärgerte, dass der Mann ihn für unwissend hielt, zögerte er. Denn vielleicht war es besser, Bensimon in dem Glauben zu lassen, er wäre unwissend. Vielleicht schickte man ihn dann wieder nach Hause. Aber Bensimon würde wahrscheinlich ahnen, dass er sich nur verstellte. Jeder in Castellan kannte die Adligen auf dem Hügel, insbesondere die Charta-Familien. Ihre Namen und ihre Stellung waren so bekannt wie die Namen der Straßen der Stadt.
»Cazalet«, sagte er. »Roverge. Alleyne. Ich kann sie nicht alle aufzählen, aber jeder kennt sie. Sie leben auf dem Hügel. Und sie haben Chartas …« Er erinnerte sich an die Lektionen von Schwester Bonafilia und kniff die Augen zusammen, während er nach den richtigen Worten suchte. »Das, äh, sind besondere Genehmigungen des Königs, um den Handel auf den Goldstraßen zu kontrollieren.« (Allerdings verschwieg er Bonafilias Kommentar, die dies als »einen miesen Plan« bezeichnet hatte – ein Plan, »um die Reichen noch reicher zu machen, der aber den einfachen Kaufleuten von Castellan nichts bringt«.)
»Ja, und die Handelswege übers Meer«, bestätigte Bensimon. »Denk daran, dass jedes Haus seine eigene Charta hat – Haus Raspail betreibt den Holzhandel, Alleyne den Seidenhandel. Eine Charta ist ein wertvolles Gut, das vom König verliehen oder nach Belieben widerrufen werden kann.« Er seufzte und strich sich mit den Händen durch seine kurz geschorenen Haare. »Aber wir haben jetzt keine Zeit für eine Lektion. Ich habe gehört, dass dir deine Anwesenheit hier im Palast nicht gefällt. Das ist bedauerlich. Du bist ein Bürger von Castellan, habe ich recht? Aber hast du vielleicht marakandische oder hindische Wurzeln?«
Kel zuckte die Schultern. Das hatte er sich auch schon oft gefragt, denn seine hellbraune Haut schimmerte einen Ton dunkler als der in Castellan übliche Olivton. Aber im Gegensatz zu den anderen Kindern im Orfelinat, die ihre familiären Hintergründe kannten, hatte er keine Antwort auf diese Frage. »Ich wurde hier geboren. Und weiß nichts über meine Eltern. Ich hab sie nie kennengelernt.«
»Wenn du hier geboren bist, dann schuldest du dem König und der Stadt Treue«, sagte Bensimon. »Du bist …«, er runzelte die Stirn, »… zehn Jahre alt, richtig? Da musst du doch von der Existenz des Kronprinzen wissen.«
Irgendwo tief in seinem Hinterkopf kramte Kel den Namen wieder hervor. »Conor«, sagte er.
Bensimons Augenbrauen hoben sich bis zu seinem Haaransatz aus dichten grauen Locken. »Prinz Conor«, korrigierte er. »Heute Abend wird eine Delegation aus Sarthe den Marivent besuchen. Wie du vielleicht weißt, existieren seit geraumer Zeit Spannungen zwischen unseren Königreichen.«
Sarthe und Castellan waren Nachbarn und stritten sich oft um Steuern, Waren und den Zugang zu den Goldstraßen. Die meisten Seeleute an den Docks nannten die Sarther »diese Bastarde an der Grenze«.
Kel vermutete, dass mit »Spannungen« die Unruhen gemeint waren.
»Wie immer bemüht sich der König – der stets das Wohl der Bürger von Castellan im Auge hat – um Frieden mit unseren Nachbarn. Zu den politischen, äh, Schätzen unserer Stadt gehört auch unser Kronprinz Conor. Es ist durchaus möglich, dass der König irgendwann in der Zukunft ein Bündnis zwischen seinem Sohn und einem Mitglied der königlichen Familie von Sarthe eingehen möchte. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Prinz Conor trotz seines jungen Alters an dem heutigen Bankett teilnimmt. Leider ist er unpässlich.« Er sah Kel aufmerksam an. »Kannst du mir folgen?«
»Der Prinz ist krank und kann deshalb nicht auf eine Feier gehen«, sagte Kel. »Aber was hat das mit mir zu tun?«
»Der Prinz muss heute Abend anwesend sein. Deshalb wirst du seinen Platz einnehmen.«
Der Raum schien sich zu drehen. »Ich werde was?«
»Du wirst seinen Platz einnehmen. Man erwartet nicht von ihm, dass er viel redet. Du bist ungefähr so groß wie er, so alt wie er und hast eine ähnliche Hautfarbe. Seine Mutter, die Königin, ist eine Marakandi, wie du sicher weißt. Wir werden dich waschen und so kleiden, wie es sich für einen Prinzen geziemt. Du wirst während des Banketts still dasitzen. Und du wirst weder reden noch die Aufmerksamkeit auf dich lenken. Du darfst so viel essen, wie du willst, solange du dich nicht übergeben musst.« Bensimon verschränkte die Arme vor der Brust. »Wenn du diesen Auftrag zu unserer Zufriedenheit erfüllst, erhältst du am Ende der Veranstaltung einen Beutel mit Goldkronen, den du zu den Schwestern von Aigon bringen kannst. Wenn nicht, wirst du nichts außer Schelte bekommen. Hast du diese Abmachung verstanden?«
Kel verstand Absprachen. Er verstand, dass man ein oder zwei Münzen bekam, wenn man eine Nachricht für die Schwestern überbrachte, oder einen Apfel oder eine Süßigkeit, wenn man ein Paket von einem Großsegler abholte und es zum Haus eines Händlers brachte. Aber das Konzept einer Goldkrone, ganz zu schweigen von einem ganzen Beutel dieser Münzen, lag jenseits seiner Vorstellungskraft.
»Die Leute werden wissen, wie Con… Prinz Conor aussieht«, wandte er ein. »Sie werden sich nicht täuschen lassen.«
Bensimon holte etwas aus seiner Tasche. Es handelte sich um einen länglichen Gegenstand aus gehämmertem Silber an einer Kette – nicht unähnlich der Kette, die der Berater um den eigenen Hals trug. Darin war ein feines Muster aus Zahlen und Buchstaben eingraviert, das vom Schein des Kaminfeuers hervorgehoben wurde. Es handelte sich um Ashkar-Magie. Nur die Ashkar wussten, wie man Buchstaben und Zahlen so manipulieren und kombinieren konnte, dass sie ihnen einen Zauber entlockten. Nur die Ashkar konnten überhaupt irgendeine Art von Magie ausüben. So war es schon seit der Sonderung der Welt.
Ohne viel Federlesens legte Bensimon Kel die Kette um den Hals und ließ den Anhänger unter den Kragen seiner zerlumpten Tunika gleiten.
»Seh ich damit echt aus wie der Prinz?«, fragte Kel und versuchte, in sein eigenes Hemd zu spähen.
»Durchaus nicht. Aber es wird helfen, dass jeder, der dich anschaut und bereits einen Jungen sieht, der unserem Kronprinzen in Hautfarbe und Größe ähnelt, geneigt ist, dich als Prinz Conor zu betrachten. Und seine Stimme zu hören, wenn du den Mund aufmachst. Deine Augen stimmen nicht überein«, fügte er hinzu, eher zu sich selbst, »aber das macht nichts. Die Menschen sehen nur das, was sie zu sehen erwarten, und sie werden den Prinzen erwarten. Der Anhänger wird deine Gesichtszüge nicht physisch verändern, verstehst du das? Er wird lediglich die Sichtweise derjenigen verändern, die dich ansehen. Niemand, der weiß, wer du wirklich bist, wird sich davon täuschen lassen – aber alle anderen sehen nur das, was sie erwarten.«
In gewisser Weise verstand Kel das. Es gab Geschichten, die davon erzählten, wie die Magie vor der Sonderung gewesen war … damals, als ein Zauber einen Berg in die Luft sprengen oder einen Menschen in einen Drachen verwandeln konnte. Die Magie von heute – Ashkar-Magie, Talismane, Anhänger und Umschläge, die auf dem Fleischmarkt verkauft wurden – war nur noch ein Schatten dessen, was sie einst gewesen war. Sie konnte den Blick in eine gewünschte Richtung lenken, konnte überzeugen und steuern, aber sie konnte die wahre Substanz der Dinge nicht verändern.
»Ich würde vorschlagen, dass du dich jetzt einmal dazu äußerst«, sagte Bensimon.
Kel zerrte unbeholfen an der Kette um seinen Hals. »Ich will das nicht machen«, sagte er. »Aber ich hab echt keine andere Wahl, oder?«
Bensimon lächelte matt. »Nein. Und sag nicht immer echt. Dann klingst du wie eine Sumpfratte aus dem Labyrinth.«
»Ich bin eine Sumpfratte aus dem Labyrinth«, erklärte Kel.
»Aber nicht heute Abend«, entgegnete Bensimon.
Kel wurde in das Tepidarium gebracht: ein riesiger Raum mit zwei steingefassten Becken, die in der Mitte des Marmorbodens eingelassen waren. Eine Fensterrose gab den Blick auf das nächtliche Castellan frei. Kel versuchte, die Augen auf den Horizont zu heften, während er mit übertriebener Gründlichkeit gestupst, gestoßen und geschrubbt wurde. Das Waschwasser lief dunkelbraun in den Abfluss.
Kel überlegte, ob er diesem Bensimon trauen sollte, und entschied sich dagegen. Bensimon hatte behauptet, der Prinz wäre krank – unpässlich. Aber Jolivet war schon vor einem Monat in das Orfelinat gekommen. Damals konnte er nicht gewusst haben, dass der Kronprinz heute Abend krank werden würde und eine Vertretung brauchte.
Und auch das Versprechen, dass man ihn am Ende der Feier mit einem Sack Gold nach Hause schicken würde, ergab keinen Sinn. Im Labyrinth kursierte eine altbekannte Geschichte über den Lumpensammlerkönig, den berühmtesten Verbrecher von Castellan. Es hieß, er habe einst drei rivalisierende Verbrecher in seine Villa eingeladen, ihnen ein prächtiges Abendessen serviert und ihnen eine Partnerschaft in seinem illegalen Imperium angeboten. Doch die drei konnten sich auf nichts einigen, und am Ende des Abends hatte der Lumpensammlerkönig seine Gäste zu seinem größten Bedauern vergiften müssen – mit der Begründung, dass sie nun zu viel über seine Geschäfte wüssten. (Allerdings zahlte er für alle drei ein prunkvolles Begräbnis.)
Kel hatte irgendwie das Gefühl, dass man ihm bereits viele Dinge erzählt hatte, die er nicht wissen sollte, und dass er nun noch weitere erfahren würde. Er versuchte, sich vorzustellen, was er tun würde, wenn er jetzt eine Rolle in einem seiner Piratenspiele mit Cas spielte. Aber er konnte sich keine bessere Strategie ausdenken, als den Kopf gesenkt zu halten und zu schweigen.
Nach dem Bad wurde er gepudert, parfümiert, bekam Schuhe an die Füße und einen stahlblauen Satinfrack mit silbernen Knöpfen an Manschetten und Kragen angezogen. Außerdem musste er eine Samthose tragen, die so weich war wie ein Mäusefell. Seine Haare wurden geschnitten und seine Wimpern sorgfältig nach oben gebogen.
Als er sich schließlich in dem Spiegel betrachtete, der die gesamte Westwand einnahm, drängte sich ihm ein Gedanke auf, der ihm ein mulmiges Gefühl bereitete: Wenn er jemals in diesem Zustand die Straßen des Labyrinths betrat, würden ihn die Kletten übel verprügeln und am Fahnenmast vor dem Tully aufknüpfen.
»Hör auf, mit den Füßen zu scharren«, mahnte Bensimon, der die letzte Stunde damit verbracht hatte, das Treiben aus einer schattigen Ecke des Raums zu beobachten – wie ein Falke, der seinen Angriff auf eine Kaninchenfamilie plante. »Komm mal her.«
Kel näherte sich dem Berater, während der Rest der Palastbediensteten sich wie Nebel auflöste. Im nächsten Moment war er mit Bensimon allein im Raum, der ihn am Kinn packte, seinen Kopf hochhob und ihn unverblümt musterte. »Sag mir noch einmal, was du heute Abend tun wirst.«
»Ich spiele Co… Prinz Conor. Sitze am Banketttisch und rede nicht viel.«
Offenbar zufrieden, gab Bensimon Kel frei. »Der König und die Königin wissen natürlich, wer du wirklich bist; also mach dir ihretwegen keine Sorgen. Sie sind es gewohnt, Rollen zu spielen.«
Irgendwie hatte Kels Vorstellungskraft noch nicht so weit gereicht. »Der König wird so tun, als wäre ich sein Sohn?«
Bensimon schnaubte. »An deiner Stelle würde ich mich nicht zu sehr darüber freuen«, sagte er. »Das Ganze hat wenig mit dir zu tun.«
Dieser Gedanke erleichterte Kel. Wenn alle wichtigen Leute ihn ignorierten, konnte er den Abend vielleicht überstehen.
Bensimon schob Kel zurück in das Labyrinth der Gänge, die das Innere des Palastes zu bilden schienen. Sie stiegen eine Reihe von Dienstbotentreppen hinunter, die sie in einen kleinen, aber eleganten Raum mit zahlreichen Büchern führten. Am Ende des Raums befand sich eine hohe goldene Tür, durch die Kel Musik und Gelächter hören konnte.
Zum ersten Mal klopfte sein Herz vor echter Sehnsucht. Bücher. Die einzigen Bücher, die er je besessen hatte, waren ein paar schäbige Romane, die wohltätige Gönner dem Orfelinat geschenkt hatten: aufregende Sagen von Piraten und Phönixen, Zauberern und Seefahrern. Aber die gehörten natürlich nicht ihm. Und die Schulbücher, mit historischen Abhandlungen über untergegangene Reiche und den Bau der Goldstraßen, wurden von den Schwestern unter Verschluss gehalten und nur zum Lesen während des Unterrichts hervorgeholt. Einmal hatte ein Bootsmann ihm ein altes Buch mit Geschichten geschenkt, als Gegenleistung für die Übermittlung einer Nachricht, aber Schwester Jenova hatte es konfisziert. Sie sagte, Seeleute würden nur zwei Dinge lesen: Mordgeschichten und Pornografie.
Diese Bücher hier waren so schön wie die Sonne, die hinter Tyndaris unterging. Kel konnte den Geruch ihrer Ledereinbände wahrnehmen, die Tinte auf den Seiten, das bittere Aroma des Stampfwerks, in dem das Papier hergestellt wurde.
Bensimon beobachtete ihn mit zusammengekniffenen Augen, so wie ein professioneller Spieler ein Opfer begutachtete. »Du kannst also lesen. Und gefällt es dir?«
Kel brauchte nicht zu antworten. Zwei Personen waren in den Raum gerauscht, umringt von Kastellwächtern, und er schwieg benommen.
Als Erstes schoss ihm der Gedanke durch den Kopf, dass diese beiden Personen die schönsten Menschen waren, die er je gesehen hatte. Dann fragte er sich, ob es nur daran lag, dass sie so sorgfältig gepflegt waren und ihre Kleidung so schön. Zwar kannte er die Worte für Seide, Satin und Goldbrokat noch nicht, aber er wusste, wann etwas reich und weich aussah und im Feuerschein schimmerte.
Der König war ihm bekannt: kein Wunder, denn sein Gesicht prangte auf jeder Münze in Castellan. Auf den Münzen war er im Profil abgebildet, den Blick nach rechts gerichtet – in Richtung des unbesiegten Sarthe, so hieß es. Aber die Münzen zeigten nicht, wie breit er war – seinen mächtigen Brustkorb und die Arme eines Ringkämpfers. Seine schiere Größe und Präsenz ließen Kel erbeben. Seine hoch angesetzten Augen waren hell und in seinem blonden Bart und Haar schimmerten erste Silbersträhnen.
Die Königin hatte dunkle, wallende Haare, wie der Fluss Fear bei Anbruch der Dunkelheit, und glatte rostbraune Haut. Sie war schlank und groß und trug schwere Ringe an den Fingern, jeder mit einem anderen funkelnden Edelstein. Um ihren Hals und ihre Handgelenke lagen goldene Bänder und ihr Haar war mit Nadeln in Gestalt von goldenen Lilien geschmückt. Einst war sie eine Marakandi-Prinzessin gewesen, erinnerte sich Kel, und Gold galt in diesem Land als Glückssymbol.
Jetzt betrachtete die Königin Kel mit ihren dunklen Augen, die schon Gegenstand Tausender Gedichte und Balladen waren. Die Bürger von Castellan legten großen Wert auf die Schönheit ihrer Königin; jeder sollte erfahren, dass sie schöner war als die Königinnen von Sarthe oder Hind. Und im Vergleich zu Königin Lilibet von Castellan wirkte die Königin von Hanse, so hatte man Kel erzählt, wie ein Wasservogel, der unter Verstopfung litt.
»Und dieser Junge kann den Prinzen heute Abend vertreten?«, fragte sie nun. Ihre Stimme klang voll und süß, wie gezuckertes Rosenwasser.
»Durchaus«, sagte Bensimon. Er schien eine echte Vorliebe für dieses Wort zu haben. »Seid Ihr bereit, Eure Hoheiten?«
Die Königin nickte; der König zuckte nur die Schultern. Dann öffneten die Kastellwächter die goldene Tür und die Musik auf der Galerie ging über in eine Prozessionsmelodie. Langsam passierte der König die Tür, dicht gefolgt von der Königin. Keiner der beiden blickte zurück.
Kel zögerte. Er spürte, wie seine Haare zerzaust wurden – Bensimon hatte ihm einen goldenen Reif auf den Kopf gesetzt – und wie die Hände des Beraters über seinem Kopf schwebten, fast so, als wollte er ihm seinen Segen erteilen.
Bensimon knurrte, dann gab er Kel einen kleinen Schubs. »Geh ihnen nach«, befahl er, und Kel stolperte durch die goldene Tür in das blendende Licht.
Sofort bemerkte er zwei Dinge. Erstens: Bensimon hatte recht gehabt – in der Galerie wimmelte es jetzt von Adligen. Kel hatte noch nie so viele an einem Ort gesehen. Natürlich war er daran gewöhnt, gelegentlich einen Blick auf eine prachtvolle Kutsche zu erhaschen, die durch die Kopfsteingassen rollte, oder auf eine behandschuhte Hand, die lässig aus einem offenen Fenster hing. Und manchmal sah er einen Adligen in Samt und Juwelen auf einem Großsegler, der mit dem Kapitän darüber diskutierte, ob er Anteile an der nächsten Reise verkaufen wollte oder nicht. Aber das kam nur selten vor, so wie die Sichtung eines Salamanders. Er hatte sich im Leben nicht vorstellen können, eines Tages von ihnen umgeben zu sein – weder von Adligen noch von Salamandern.
Als Zweites fiel ihm der Raum auf. Jetzt verstand er, warum er bei seinem ersten Betreten so weiß gewirkt hatte. Man hatte ihn ganz bewusst leer gelassen – eine unberührte Leinwand, die auf den Pinsel des Malers wartete. Die ehemals kahlen Wände waren nun mit juwelenfarbenen Fresken geschmückt, die Castellans Reichtum darstellten. Kel wusste nicht, wie das möglich war. (Später sollte er herausfinden, dass es sich um transparente Leinwände handelte, die über die Wände gesenkt wurden, und keineswegs um Farbe.) Seht nur, schienen sie zu sagen, seht, wie großartig und prunkvoll unsere Stadt ist.
Die Böden waren mit dicken Marakandi-Teppichen ausgelegt, und an der Ostwand hatte man die Vorhänge zurückgezogen, um den Blick auf einen Säulengang freizugeben. Zwischen den Säulen standen goldfarbene Bäume in großen Kübeln, deren Blätter vergoldet waren und an deren Zweigen Äpfel und Beeren aus Buntglas hingen. Über dem Säulengang spielte ein Orchester – alle Musiker in den Farben des Palastes gekleidet, Rot und Gold. Der riesige, offene Kamin war unverändert, doch jetzt loderte darin ein Feuer, groß genug, um ein Dutzend Kühe zu braten.
Die Bewohner des Hügels hatten sich zu einer Art glänzendem Spalier aufgestellt und lächelten und neigten die Köpfe, während die königliche Familie durch den Raum zur Festtafel schritt. Im Tepidarium hatte Bensimon Kel befohlen, in diesem Moment den Kopf hochzuhalten und weder nach rechts noch nach links zu blicken. Aber Kel konnte nicht anders, als sich umzuschauen.
Die Männer trugen Brokatmäntel und hohe Stiefel aus verziertem Leder; die Frauen wirkten wie Wolken aus Seide und Satin, Schleifen und Spitzen, die Haare hochgesteckt und mit Schmuckstücken aller Art durchsetzt: goldene Rosen, silberne Lilien, vergoldete Sterne, Messingschwerter. Diese Pracht bildete die Vorlage für die Zeichnungen der höheren Gesellschaft, die man bei den Künstlern am Fleischmarkt kaufen konnte - dem Ort, den die Töchter und Söhne der Kaufleute aufsuchten, um von den skandalösen Machenschaften der Adelshäuser zu erfahren und sich dann vorzustellen, sie würden in eine dieser Familien einheiraten.
Bensimon hatte sich zu Kel gesellt, und die Menge der Adligen lichtete sich, als sie die festlich geschmückte Tafel erreichten. Der Tisch wirkte noch genauso wie zuvor, nur mit noch mehr Dekorationen: In Goldfarbe getauchte Pfauenfedern hingen über die Seiten der vergoldeten Tafelaufsätze, und ein Band aus Lilien, mit goldenen Kettchen zusammengebunden, schlängelte sich über die Tischmitte. Ihr Duft – wächsern, zu süßlich – erfüllte den Raum.
Benommen ließ Kel sich von Bensimon zu einem der drei hohen Stühle führen, die in der Mitte des Tischs gruppiert waren. Zu Kels Linker saß die Königin, zu seiner Rechten ein hübsches Mädchen in seinem Alter, das hellgelbe Seide trug und dessen dunkelblondes Haar zu dichten Locken arrangiert war.
Kel warf Bensimon einen Blick zu, der fast an Panik grenzte: Warum hatte man ihn neben ein anderes Kind gesetzt? Ein Erwachsener hätte ihn vielleicht ignoriert, aber das blonde Mädchen betrachtete ihn bereits mit lebhafter Neugierde, die darauf hindeutete, dass sie Prinz Conor ziemlich gut kannte.
Bensimon zog eine Augenbraue hoch und nahm seinen Platz direkt hinter dem Stuhl des Königs ein, während sich das blonde Mädchen über seinen Teller beugte und Kel etwas zuflüsterte.
»Ich habe gehört, dass du krank bist«, sagte sie. »Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen.«
Ihre Worte waren wie eine Rettungsleine und Kel griff danach. »Der König hat darauf bestanden«, sagte er mit gesenkter Stimme. Hoffentlich nannte der Prinz seinen Vater auch so! Kel wusste, dass Bensimons Talisman ihn wie den Prinzen klingen und auch so aussehen ließ. Aber der Anhänger konnte seine Worte doch sicher nicht verändern, oder? Deshalb wählte er sie jetzt mit Bedacht und erinnerte sich dabei an all die Male, in denen Cas und er sich als Abenteurer von edler Herkunft ausgegeben hatten. Und daran, wie sie ihre Sprache an die der Adligen angelehnt hatten, von denen sie in Büchern gelesen hatten. »Man hat mir keine andere Wahl gelassen.«
Das blonde Mädchen warf seine Locken über die Schulter. »Du musst wirklich krank sein«, sagte sie. »Normalerweise hättest du einen Aufstand gemacht oder zumindest Witze über dein Erscheinen gerissen.«
Kel verstaute diese Informationen in seinem Hinterkopf. Dann war der Prinz also jemand, dem es nichts ausmachte, sich künstlich aufzuregen, und außerdem machte er gern Witze. Das hatten sie schon mal gemein – eine nützliche Information.
»Antonetta«, tadelte die Frau, die ihnen gegenübersaß, in leisem Tonfall, den Blick auf das blonde Mädchen gerichtet. »Sitz gerade.«
Antonetta. Das war also der Name des Mädchens und die Frau musste ihre Mutter sein. Sie war sehr schön, hatte blondes Haar und einen großen, bleichen Busen, dessen Rundungen sich über dem Mieder ihres Kleids wölbten. Ein Kleid aus Rohseide in der gleichen Farbe wie das ihrer Tochter. Ihre Aufmerksamkeit galt jedoch nur einen kurzen Moment Antonetta, dann wurde sie in ein Gespräch mit einem schwarzbärtigen Mann mit intelligenten Augen verwickelt.
»Wer ist dieser Mann?«, wandte Kel sich leise an Antonetta, die nun kerzengerade dasaß. »Der, der mit deiner Mutter flirtet?«
Diese Bemerkung war ziemlich gewagt, aber Antonetta grinste, als hätte sie diese Art Kommentar von Conor Aurelian erwartet. »Du erkennst ihn nicht?«, fragte sie ungläubig. Sie breitete ihre Serviette auf dem Schoß aus und Kel ahmte ihre Bewegungen nach. »Das ist Senex Petro d’Ustini, einer der Botschafter von Sarthe. Neben ihm sitzt Sena Anessa Toderino.«
Natürlich! Kel hätte sie sofort erkennen müssen: ein Mann und eine Frau, beide in sarthisches Dunkelblau gekleidet. Senex Petros Saphirohrring glitzerte auf seiner olivfarbenen Haut, während Sena Anessa ihre schweren Haare zu einem Knoten auf dem Kopf aufgetürmt hatte und eine lange, aristokratische Nase besaß.
Ein paar Plätze weiter saß ein anderer Junge in Kels Alter. Er sah aus wie jemand aus Shenzan, mit glatten schwarzen Haaren und einem verschmitzten Gesicht. Jetzt zwinkerte er Kel zu, der ihn daraufhin sofort mochte, obwohl er wusste, dass das Zwinkern nicht ihm, sondern Prinz Conor galt.
»Wie ich sehe, versucht Joss, deine Aufmerksamkeit zu erlangen«, sagte Antonetta und schnitt dem Jungen ein Gesicht – allerdings nicht unfreundlich, sondern eher spöttisch. »Wahrscheinlich ist er betrübt, weil er neben Artal Gremont sitzen muss.«
Antonetta meinte wohl den untersetzten, dickhalsigen Mann zu Joss’ Linken. Seine Haare waren kurz geschnitten, wie die eines Soldaten, und er trug die Armbinde eines Gladiators, die über der Damastseide seiner Tunika ein wenig lächerlich wirkte. Kel hatte seinen Namen schon zuvor gehört. Obwohl Gremont ein Adliger war, vergnügte er sich damit, in der Arena gegen einige der berühmtesten Kämpfer von Castellan zu kämpfen. Aber alle – außer Gremont vielleicht, der die Tee- und Kaffee-Charta erben sollte – wussten, dass die Kämpfe zu seinen Gunsten manipuliert wurden.
»Lady Alleyne«, wandte sich Senex d’Ustini an Antonettas Mutter, »Euer Kleid ist wirklich prachtvoll. Und entdecke ich da etwa eine sarthische Sontoso-Stickerei an den Ärmeln? Ihr seid in der Tat eine wandelnde Werbung für den Ruhm des Seidenhandels.«
Lady Alleyne? Das Haus Alleyne besaß die Seiden-Charta. Das bedeutete, dass Antonetta, die gerade mit ihrer Gabel spielte, die reichste aller Chartas erben würde. Plötzlich hatte Kel ein leicht mulmiges Gefühl im Magen.
»Seide hat noch andere Verwendungszwecke als nur Mode«, warf Antonetta ein. »Die Ashkar nutzen sie für Verbände und Garn. Außerdem kann man Segel daraus herstellen und in Shenzhou wird sie anstelle von Papier zum Schreiben verwendet.«
Sena Anessa lachte leise. »Sehr clever, Demoselle Antonetta …«
»Zu clever«, sagte Artal Gremont. »Niemand mag ein cleveres Mädchen. Nicht wahr, Montfaucon?«
Montfaucon war offenbar der Mann, der ihm gegenübersaß. Er war auffällig gekleidet, in rosa Samt mit silbernen Borten, und seine Haut besaß einen dunklen, warmen Braunton. »Gremont«, setzte er gereizt an, beendete seinen Satz aber nicht, denn das Essen wurde hereingetragen.
Und was für ein Essen! Nicht die üblichen Eintöpfe, die die Schwestern im Orfelinat den Waisenkindern vorsetzten, sondern gebratene Kapaune mit Weißkohl, dazu mit Currypflaumen gefüllte Enten, herzhafte Kräuter- und Käse-Tarts, gegrillte Fische mit Öl und Zitrone sowie sarthische Gerichte wie etwa mit Rosenwasser beträufeltes Schweinefleisch auf einem Bett aus Nudeln.
Du darfst so viel essen, wie du willst, solange du dich nicht übergeben musst, hatte Bensimon gesagt.
Und Kel machte sich an die Arbeit. Er war sowieso die Hälfte der Zeit hungrig, und jetzt, nachdem er seinen Mageninhalt auf Jolivets Stiefel entleert hatte, war er förmlich ausgehungert. Eine Weile versuchte er, die anderen Gäste mit seinem Besteck zu imitieren, aber Hände waren nun mal schneller als Messer und Gabel. Als er seine Finger in ein Stück Käse-Salbei-Tart versenkte, sah er, wie Bensimon ihn finster anfunkelte.
Als Nächstes stellte Kel fest, dass Antonetta nicht aß, sondern mit wütender Miene auf ihr Essen starrte. Der glamouröse Montfaucon zwinkerte ihr zu. »Wenn Schönheit und Weisheit miteinander vermählt werden können, ist das sicherlich das Ideal. Aber in der Regel schenken die Götter nur das eine oder das andere. Ich denke, unsere Antonetta ist möglicherweise eine der glücklichen Ausnahmen.«
»Man kann nicht alles haben, sonst würden die Götter die Sterblichen beneiden«, sagte ein anderer Gast. Ein Mann mit kalten Augen, verkniffenen Gesichtszügen und hellolivfarbener Haut. Er erinnerte Kel an die Abbildungen in seinen Schulbüchern über adlige Castellaner, die Hunderte von Jahren zurückreichten. »Ist nicht genau das den Callatianern widerfahren? Sie bauten ihre Türme zu hoch in den Himmel hinauf, forderten die Götter mit ihren Errungenschaften heraus, und dafür wurde ihr Reich zerstört, nicht wahr?«
»Eine finstere Sichtweise, Roverge«, bemerkte ein freundlich aussehender älterer Mann. Er war blass, wie jemand, der viel Zeit in geschlossenen Räumen verbrachte. »Reiche neigen nun mal zur Entropie. Es ist schwierig, so viel Macht im Griff zu behalten. Zumindest wurde es mir vor langer Zeit so in der Schule beigebracht.« Er schenkte Kel ein Lächeln. »Hat man Euch nicht dasselbe gelehrt, Prinz?«
Alle wandten sich Kel zu und sahen ihn freundlich an, der sich fast an einem Bissen Tart verschluckte. Panisch stellte er sich vor, was passieren würde, wenn sie merkten, dass er nicht der Kronprinz war. Die Kastellwächter würden ihn umzingeln, ihn aus dem Palast zerren und über die Mauern werfen, wo er den Berg hinunterrollen würde, bis er ins Meer platschte und von einem Krokodil gefressen wurde.
»Aber Sieur Cazalet, seid Ihr nicht der Gebieter über alle Reichtümer in Castellan?«, fragte Antonetta. »Und ist Reichtum nicht auch Macht?«
Cazalet. Kel kannte den Namen: Die Cazalet-Charta umfasste das Bankwesen und die Goldkronenmünzen wurden auf der Straße manchmal Cazalets genannt.
»Seht ihr?«, bemerkte Artal Gremont. »Ich sage doch, sie ist zu clever.«
Kel verzog das Gesicht zu einem Lächeln. Er konnte seinen Mund nicht sehr weit öffnen, was wahrscheinlich ein Glück war, denn dadurch wirkte sein Lächeln eher kühl als enthusiastisch. Enthusiasmus, so sollte er später feststellen, galt bei einem Prinzen als verdächtig. »Ich lerne natürlich noch immer dazu, Sieur Cazalet«, erwiderte er. »Aber die Weisen sagen, dass derjenige, der alles will, alles verliert.«
Bensimons Mundwinkel zuckten, und ein Ausdruck echter Überraschung huschte über das Gesicht der Königin, den sie jedoch schnell wieder unterdrückte. Antonetta lächelte, was Kel durchaus gefiel.
Der König reagierte zwar überhaupt nicht auf diese Äußerung seines angeblichen Sohns, aber die Botschafterin von Sarthe lachte. »Wie schön, dass Euer Sohn so belesen ist, Markus.«
»Danke, Sena Anessa«, sagte die Königin, während der König weiterhin schwieg und Kel über den Rand seines großen Silberbechers nachdenklich musterte.
»Das war geschickt formuliert«, flüsterte Antonetta Kel zu. Ihre Augen leuchteten, wodurch sie doppelt so hübsch wirkte. Erneut zog sich Kels Magen zusammen, auf eine ungewohnte und dieses Mal keineswegs unangenehme Weise. »Vielleicht bist du ja doch nicht so krank.«
»O doch«, widersprach Kel inbrünstig. »Ich fühle mich äußerst unwohl und könnte jeden Moment alles Mögliche vergessen.«
Die Erwachsenen waren zu ihrem eigenen Gespräch zurückgekehrt. Kel konnte ihnen kaum folgen – zu viele unbekannte Namen, sowohl von Personen als auch von Dingen wie Verträgen und Handelsabkommen. Bis zu dem Moment, als Senex Petro sich mit einem höflichen Lächeln an den König wandte: »Apropos unverschämte Forderungen, Eure Hoheit, gibt es Neuigkeiten vom König der Lumpensammler?«
Kel riss die Augen auf. Er kannte den Namen des Lumpensammlerkönigs; jeder in der Stadt Castellan kannte ihn, aber er hätte nicht gedacht, dass das auch für die Adligen galt. Der Lumpensammlerkönig gehörte in die Straßen der Stadt, in die Schatten, in die sich nicht mal die Wächter trauten, in die Spielhöllen und Nachtasyle des Labyrinths.
Kel hatte Schwester Bonafilia einmal gefragt, wie alt der König der Lumpensammler sei. Sie hatte geantwortet, dass es ihn schon immer gegeben hatte, solange sie sich erinnern konnte. Und in der Tat hatte seine Gestalt in Castellan etwas Zeitloses an sich, wenn er ganz in Schwarz durch die Schatten schritt, ein Heer von Taschendieben und Langfingern in seinem Gefolge. Er hatte keine Angst vor der Pfeilschwadron oder der Stadtwache. Er fürchtete nichts und niemanden.
»Er ist ein Verbrecher«, erwiderte der König; seine raue Stimme klang ungerührt. »Und Verbrecher wird es immer geben.«
»Aber er bezeichnet sich selbst als König«, sagte Petro, weiterhin mit höflichem Lächeln. »Ist das nicht eine Herausforderung?«
Sena Anessa warf ihm einen besorgten Blick zu. Es war fast so, als würde jemand im Klassenzimmer einen Schlag austeilen, dachte Kel. Man wartete ab, ob der Schlag erwidert oder ignoriert wurde. Die Freunde desjenigen, der den Schlag austeilte, waren nervös. Schließlich stellte ein Angriff immer ein Risiko dar.
Doch Markus lächelte nur. »Er ist keine Bedrohung für mich«, sagte er. »Kinder spielen gern das Burgenspiel, aber der Lumpenkönig ist keine Herausforderung für den Marivent. Also, wollen wir nun die Fragen besprechen, die ich vorhin bezüglich des Schmalen Passes aufgeworfen habe?«
Sena Anessa wirkte erleichtert. »Eine ausgezeichnete Idee«, sagte sie. Und kurz darauf beteiligten sich die Gäste wieder an den Gesprächen über Handelsabkommen und die Große Südweststraße, die genauso gut auf Sarthisch hätten verlaufen können, denn Kel verstand kein Wort.
Antonetta tippte mit der stumpfen Klinge ihres Messers auf Kels Handgelenk. »Sie bringen den Nachtisch herein«, sagte sie und bedeutete ihm, sein Besteck in die Hand zu nehmen. »Du hattest recht. Du bist wirklich vergesslich.«
Eigentlich war Kel schon vollkommen satt. Zumindest hatte er das angenommen, bis er die Nachspeisen sah: in Rosenwasser und Honig getränkte Pflaumen und Pfirsiche; mit Zucker glasierte Blütenblätter; Gläser mit süß-saurem Sorbet; Becher mit gezuckerter Schokolade und Sahne; mit Granatapfelkernen gespickte Puddings sowie Teller voll Marzipantörtchen, die mit bunter Pastellglasur verziert waren.
Die Musiker spielten eine sanfte Melodie, als das letzte Silbertablett in den Saal getragen wurde. Darauf balancierte eine prächtige Torte in Gestalt eines Phönixes, reichlich mit Gold und Bronze überzogen und bis in die letzte Feder perfekt wiedergegeben. In dem Augenblick, als die Diener die Torte auf den Tisch stellten, ging sie in Flammen auf, begleitet von einem Chor bewundernder Ausrufe.
Kel verstand nicht, was so bewundernswert daran war, einen perfekten Kuchen in Brand zu stecken. Aber er wusste, dass er beeindruckt wirken sollte, als ein Stück des Phönix-Desserts auf einem goldenen Teller vor ihm platziert wurde. Es handelte sich um einen Biskuitkuchen mit harter, glänzender Glasur, wie der Panzer eines Käfers.