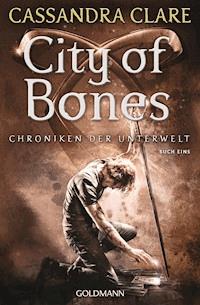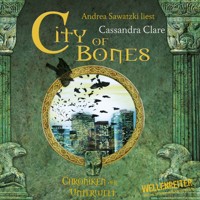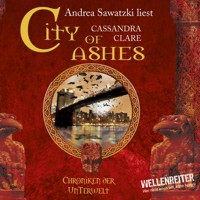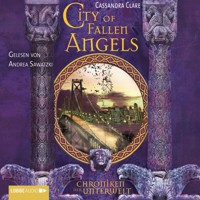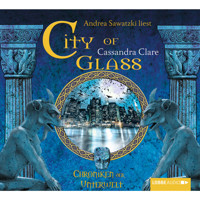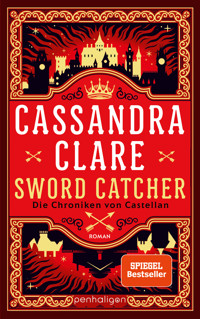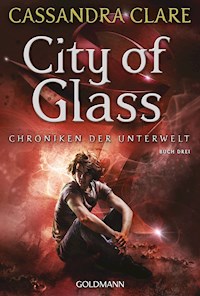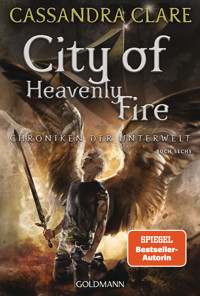
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chroniken der Unterwelt
- Sprache: Deutsch
Dunkelheit ist hereingebrochen über die Welt der Schattenjäger, Chaos und Zerstörung drohen die Nephilim endgültig zu überwältigen. Clary, Jace und ihre Freunde stehen ihrem bisher gefährlichsten Feind gegenüber: Clarys eigenem Bruder Sebastian Morgenstern. Systematisch sät dieser Zwietracht zwischen den Nephilim und erschafft mithilfe Dunkler Magie eine Armee albtraumhafter Kreaturen. Er erscheint unbesiegbar, zumindest auf dieser Welt. Und so machen sich die jungen Engelskrieger auf ins Reich der Dämonen – um Sebastian dort mit seinen eigenen Waffen zu schlagen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Die Welt der Schattenjäger wird von Zerstörung und ewig währender Dunkelheit bedroht. Clary, Jace und ihre Freunde stehen dem gefährlichsten Feind gegenüber, den die Welt der Nephilim je gesehen hat: Sebastian Morgenstern, Clarys eigenem Bruder.
Raffiniert sät dieser Zwietracht und Zweifel in den Reihen der Schattenjäger. Und erschafft gleichzeitig mit der Magie des Höllenkelchs eine Armee albtraumhafter, seelenloser Kreaturen.
Die bedrohten Nephilim ziehen sich nach Idris zurück – doch nicht einmal die berühmten Dämonentürme von Alicante können Sebastian in Schach halten. Zumal ein unerhörter Verrat die Gemeinschaft der Schattenjäger zusätzlich ins Wanken bringt. In die Flucht geschlagen, wenden sich Clary und ihre Freunde einem letzten, verzweifelten Plan zu: Sie brechen zu einer Reise tief ins Reich der Dämonen auf, in das noch kein Schattenjäger einen Fuß gesetzt hat. Und aus dem noch niemand zurückgekehrt ist …
Weitere Informationen zu Cassandra Clare sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Cassandra Clare
City of Heavenly Fire
Chroniken der Unterwelt
BUCH SECHS
Roman
Deutsch von Franca Fritz und Heinrich Koop
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »The Mortal Instruments. Book Six. City of Heavenly Fire« bei Margaret K. McElderry Books, an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division, New York.
Erstmals auf Deutsch erschienen im Jahr 2015.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Neuausgabe April 2024
Copyright © der Originalausgabe 2014 by Cassandra Clare, LLC
Copyright © dieser Ausgabe 2024
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Franca Fritz und Heinrich Koop © 2015 Arena Verlag GmbH, Würzburg, www.arena-verlag.de
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Entwurfs von Russell Gordon
Umschlagmotiv: © Cliff Nielsen
Illustration Buchrücken: © 2015 by Nicolas Delort (Landschaft), Pat Kinsella (Figur)
Karte auf den Umschlaginnenseiten: Drew Willis
TH · Herstellung: ik
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-31645-7V001
www.goldmann-verlag.de
FÜR ELIAS UND JONAH
Bei Gott ist’s eine Zierde,
und strebt der Mensch danach,
Ist’s allenfalls ein Funke
zu viel vom himmlischen Feuer.
John Dryden, Absalom und Achitophel*
PROLOGStröme wie Regen*
Das Institut in Los Angeles, Dezember 2007
Am Tag, als Emma Carstairs’ Eltern ermordet wurden, war strahlend schönes Wetter. Andererseits war das Wetter in Los Angeles eigentlich jeden Tag strahlend schön. Emmas Eltern hatten sie an diesem klaren Wintermorgen vor dem Institut abgesetzt, das in den Bergen hinter dem Pacific Coast Highway lag, mit direktem Blick auf den blauen Ozean. Der Himmel erstreckte sich als wolkenlose Fläche von den Klippen bei Pacific Palisades bis zu den Stränden von Point Dume.
In der Nacht zuvor waren Berichte über dämonische Aktivität in der Nähe der Brandungshöhlen im Nationalpark Leo Carillo eingetroffen, und das Institut hatte das Ehepaar Carstairs beauftragt, der Sache auf den Grund zu gehen. Später sollte Emma sich daran erinnern, dass ihre Mutter sich eine vom Wind zerzauste Haarsträhne hinters Ohr gestrichen hatte, als sie Emmas Vater anbot, ihn mit einer Furchtlosigkeitsrune zu versehen. Und dass John Carstairs lachend abgewinkt und gemeint hatte, er sei sich noch nicht sicher, was er von diesen neumodischen Runen halten solle. Ihm reichten die Runen aus dem Grauen Buch, vielen Dank auch.
Doch damals – als sie zu dritt vor dem Institut standen – wollte Emma keine Zeit vergeuden: Sie umarmte ihre Eltern rasch zum Abschied und stürmte dann die Treppe hinauf. Ihr Rucksack hüpfte auf ihrem Rücken hin und her, während sie sich noch einmal kurz umdrehte und ihnen zuwinkte.
Emma liebte das Training im Institut – nicht nur, weil ihr bester Freund Julian hier lebte, sondern auch, weil sie beim Betreten des Gebäudes jedes Mal das Gefühl hatte, übers Meer zu fliegen. Das Los-Angeles-Institut war ein imposanter Bau aus Holz und Stein und lag am Ende einer langen Schotterpiste, die sich durch die Hügel wand. Und von jedem Raum und jedem Stockwerk aus konnte man über das Meer und die Berge und den Himmel blicken, wogende Weiten in Blau, Grün und Gold. Emma träumte davon, eines Tages gemeinsam mit Jules aufs Dach hinaufzuklettern und herauszufinden, ob man von dort oben bis zur Wüste im Süden sehen konnte. Doch bisher war jeder Versuch von den Erwachsenen vereitelt worden.
Die Eingangstür kannte ihre Handfläche und öffnete sich bereitwillig unter ihrer vertrauten Berührung. Im Eingangsbereich und Erdgeschoss des Instituts wimmelte es von Schattenjägern, die geschäftig hin und her eilten. Vermutlich fand irgendein Meeting statt, überlegte Emma. Inmitten der Menge entdeckte sie Julians Vater, Andrew Blackthorn, den Leiter des Instituts, aber da sie sich nicht durch umständliche Begrüßungen aufhalten lassen wollte, huschte sie schnell in den Umkleideraum im ersten Stock. Hier tauschte sie Jeans und T-Shirt gegen ihre Trainingssachen – übergroßes Hemd, weite Baumwollhose und das Wichtigste: ihren Schultergurt mit der Klinge.
Cortana. Der Name bedeutete eigentlich nur »Kurzschwert«, aber Emma erschien die Waffe keineswegs kurz. Die Klinge war aus funkelndem Metall gefertigt, etwa so lang wie ihr Unterarm, und die darin eingravierten Worte jagten ihr jedes Mal einen Schauer über den Rücken: Ich bin Cortana, vom selben Stahl und Härtegrad wie Joyeuse und Durendal. Ihr Vater hatte ihr die Bedeutung der Worte erklärt, als er ihr die Waffe zum ersten Mal in ihre damals zehnjährigen Hände gelegt hatte.
»Bis zu deinem achtzehnten Geburtstag kannst du das Schwert zu Trainingszwecken nutzen. Dann wird es in deinen Besitz übergehen«, hatte John Carstairs gesagt und ihr lächelnd zugesehen, wie sie mit den Fingern vorsichtig über die Inschrift fuhr. »Verstehst du die Bedeutung dieser Worte?«
Emma hatte den Kopf geschüttelt. »Stahl« verstand sie, aber »Härtegrad«?
»Du hast doch schon mal von der Familie Wayland gehört«, erläuterte ihr Vater. »Sie waren die ersten Waffenmeister der Nephilim, bevor die Eisernen Schwestern begannen, alle Schattenjägerwaffen in ihrer Festung zu schmieden. Wayland, der Schmied fertigte zum Beispiel Excalibur und Joyeuse, die Schwerter von Artus und Lancelot, sowie Durendal, das Schwert des Helden Roland. Und aus dem gleichen Stahl schmiedete er auch diese Klinge hier. Um eine Stahlklinge stärker zu machen, muss sie gehärtet werden – das heißt, das Metall wird einer solch großen Hitze ausgesetzt, dass es beinahe schmilzt oder zerstört wird.« Er drückte ihr einen Kuss auf den Scheitel. »Dieses Schwert befindet sich seit Generationen im Besitz der Familie Carstairs, und die Inschrift soll uns daran erinnern, dass Schattenjäger die Waffen des Erzengels sind. Härtet man uns im Feuer, so werden wir nur stärker. Solange wir leiden, überleben wir.«
Emma konnte die sechs Jahre bis zu ihrem achtzehnten Geburtstag kaum abwarten – dann würde sie endlich durch die ganze Welt reisen und Dämonen bekämpfen, dann würde auch sie im Feuer gehärtet. Sie schwang sich das Schwert über die Schulter und verließ den Umkleideraum, wobei sie sich in Gedanken ihre Zukunft ausmalte. In ihrer Fantasie stand sie auf dem Steilufer von Point Dume, hoch über dem Meer, und schlug mit Cortana eine Horde Raumdämonen in die Flucht. Selbstverständlich mit Julian an ihrer Seite, der seine Lieblingswaffe, die Armbrust, gegen die Dämonen richtete.
Jules war immer bei ihr – anders konnte Emma sich das gar nicht vorstellen. Sie kannte ihn, solange sie sich erinnern konnte. Die Familien Blackthorn und Carstairs waren schon immer eng befreundet gewesen, und Jules war nur wenige Monate älter als Emma. Eine Welt ohne ihn gab es für sie buchstäblich nicht. Gemeinsam hatten sie im Babyalter im Pazifischen Ozean schwimmen gelernt. Gemeinsam hatten sie erst zu laufen und dann zu rennen gelernt. Seine Eltern hatten Emma herumgetragen – und später hatten seine älteren Geschwister Jules und sie eingesperrt, wenn sie etwas ausgefressen hatten.
Und sie hatten oft etwas ausgefressen. Als sie sieben waren, hatten sie Oscar, den flauschigen weißen Kater der Blackthorns, blau eingefärbt. Es war Emmas Idee gewesen. Aber Julian hatte die Schuld auf sich genommen, wie so oft. Schließlich sei sie ein Einzelkind, hatte er erklärt, und er selbst nur eines von sieben Kindern. Seine Eltern würden viel schneller als Emmas Eltern vergessen, dass sie wütend auf ihn waren.
Emma erinnerte sich noch gut an den Tag, als Jules Mutter gestorben war, kurz nach Tavvys Geburt. Und daran, wie sie seine Hand gehalten hatte, als der Leichnam in den Canyons verbrannt wurde und der Rauch hoch hinauf in den Himmel stieg. Sie erinnerte sich daran, dass Julian geweint hatte und sie sich damals wunderte, dass Jungen ganz anders weinten als Mädchen – in schrecklichen, abgehackten Schluchzern, die so klangen, als würden sie ihnen mit Haken aus der Brust gerissen. Vielleicht war es für Jungen ja schlimmer, weil man von ihnen erwartete, dass sie nicht weinten …
»Uff!« Emma taumelte einen Schritt zurück; sie war so tief in Gedanken versunken gewesen, dass sie geradewegs in Julians Vater hineingelaufen war – einen großen Mann mit den gleichen zerzausten braunen Haaren wie sie auch die meisten seiner Kinder hatten. »’tschuldigung, Mr Blackthorn!«
Der Institutsleiter grinste. »Ich bin noch nie jemandem begegnet, der sich so auf den Unterricht gefreut hat wie du«, rief er ihr nach, während sie durch den Korridor rannte.
Der Fechtsaal war Emmas absoluter Lieblingsraum. Er nahm fast eine ganze Etage des Instituts ein, und sowohl die Ost- als auch die Westwand waren durchgehend verglast. Praktisch überall, wo man hinblickte, sah man blaues Meer. Der ganze Küstenverlauf war von Norden nach Süden sichtbar und die endlosen Fluten des Pazifiks in Richtung Hawaii.
In der Mitte des Raums mit dem glänzenden Parkettboden stand die Tutorin der Familie Blackthorn, eine gebieterische Frau namens Katerina, und unterrichtete die Zwillinge gerade in der Kunst des Messerwerfens. Livvy folgte den Anweisungen wie immer aufs Wort, aber Ty war missmutig und bockig.
Julian lag in seinen weiten, leichten Trainingssachen in der Nähe des Westfensters auf dem Rücken und redete auf Mark ein, der den Kopf in ein Buch gesteckt hatte und sich alle Mühe gab, seinen jüngeren Halbbruder zu ignorieren.
»Findest du nicht auch, dass ›Mark‹ ein merkwürdiger Name für einen Schattenjäger ist?«, fragte Julian gerade, als Emma zu ihnen trat. »Ich meine, wenn man mal darüber nachdenkt, ist es irgendwie verwirrend: ›Markiere mich, Mark.‹«
Mark hob seinen blonden Schopf aus dem Buch, in dem er gerade las, und starrte seinen Bruder zornig an. Träge spielte Julian mit seiner Stele in der Hand. Er hielt sie wie einen Pinsel, wofür Emma ihn jedes Mal ausschimpfte. Schließlich sollte man eine Stele wie eine Stele halten – so als wäre sie eine Verlängerung der eigenen Hand und nicht das Werkzeug eines Künstlers.
Mark seufzte theatralisch. Mit seinen sechzehn Jahren war er gerade so viel älter als Emma und Julian, dass er alles, was die beiden taten, entweder nervig oder lächerlich fand. »Wenn es dich stört, kannst du mich ja bei meinem vollen Namen rufen«, erwiderte er.
»Mark Antony Blackthorn?« Julian rümpfte die Nase. »Das dauert viel zu lange. Was wäre, wenn uns ein Dämon angreift? Bevor ich deinen Namen auch nur halb ausgesprochen hätte, wärst du schon tot.«
»Ach, und in solch einer Situation würdest du also mir das Leben retten?«, fragte Mark. »Wovon träumst du sonst noch, du Winzling?«
»Wäre doch denkbar.« Julian, der es nicht mochte, wenn man ihn Winzling nannte, setzte sich auf. Seine Haare standen in alle Richtungen vom Kopf ab. Helen, seine älteste Schwester, attackierte ihn regelmäßig mit einer Haarbürste, aber meistens ohne Erfolg. Er hatte nun mal die Haare der Blackthorns, genau wie sein Vater und die meisten seiner Geschwister – wilde, wellige Haare von der Farbe dunkler Schokolade. Diese Familienähnlichkeit faszinierte Emma immer wieder: Sie selbst besaß kaum Ähnlichkeit mit ihren Eltern, wenn man einmal davon absah, dass ihr Vater ebenfalls blond war.
Helen war nun schon seit Monaten bei ihrer Freundin Aline in Idris. Die beiden hatten Familienringe getauscht und waren, wie Emmas Eltern sagten, »fest miteinander verbandelt« – was hauptsächlich bedeutete, dass sie sich die ganze Zeit sentimental anschmachteten. Emma war eisern entschlossen, wenn sie sich jemals verlieben sollte, dann würde sie auf keinen Fall so rumschmachten. Zwar war ihr bewusst, dass ein ziemliches Theater darum gemacht wurde, dass sowohl Helen als auch Aline Mädchen waren, aber sie verstand nicht, warum. Außerdem schienen die Blackthorns Aline sehr zu mögen: Sie hatte eine beruhigende Ausstrahlung und lenkte Helen von ihren ständigen Grübeleien ab.
Helens Abwesenheit bedeutete, dass niemand Jules die Haare schnitt, und das Sonnenlicht im Raum tauchte die lockigen Spitzen in dunkles Gold. Die Fenster auf der Ostseite gingen hinaus auf die schattigen Höhen und Täler der Bergkette, die das Meer vom San Fernando Valley trennte – dürre, staubige Hügel, geprägt von Canyons, Kakteen und Dornsträuchern. Manchmal trainierten die Schattenjäger im Freien. Emma liebte diese Ausflüge, das Aufstöbern von versteckten Pfaden, verborgenen Wasserfällen oder schläfrigen Echsen, die sich auf den umliegenden Steinen in der Sonne ausruhten. Julian gelang es oft, die Echsen auf seine Handfläche zu locken, wo sie dann ein Nickerchen machten, während er ihnen sanft mit dem Daumen über den Kopf strich.
»Vorsicht!«
Emma duckte sich, als ein Messer mit stumpfer Holzklinge an ihrem Kopf vorbeiflog, gegen das Fenster prallte und anschließend Mark am Bein traf. Er warf sein Buch auf den Boden und sprang mit finsterer Miene auf. Eigentlich war Mark Katerinas Assistent und sollte sie beim Training unterstützen, aber er las nun mal lieber, statt seine Geschwister zu unterrichten.
»Tiberius«, schimpfte Mark, »hör auf, mit Messern nach mir zu werfen.«
»Das war ein Versehen.« Livvy schob sich zwischen ihren Zwillingsbruder und Mark. Tiberius hatte extrem dunkles Haar und war der Einzige der Blackthorns, der nicht die braunen Haare und blaugrünen Augen der Familie geerbt hatte – mal abgesehen von Mark und Helen, die aufgrund ihres Feenbluts nicht ganz mitzählten. »Ty«, wie er von fast allen genannt wurde, hatte schwarze Locken und stahlgraue Augen.
»Nein, das war kein Versehen«, sagte Ty. »Ich hatte auf dich gezielt.«
Mark seufzte übertrieben und fuhr sich mit den Händen durch die Haare, sodass sie in alle Richtungen abstanden. Er hatte die leuchtend blaugrünen Augen der Blackthorns, aber sein Haar war platinblond, genau wie das seiner älteren Schwester und seiner Mutter. Es ging das Gerücht, dass Marks und Helens Mutter eine Feenprinzessin gewesen war, die eine Affäre mit Andrew Blackthorn gehabt hatte. Angeblich hatte sie die beiden aus der Verbindung hervorgegangenen Kinder eines Nachts auf der Türschwelle des Los-Angeles-Instituts ausgesetzt und war dann für immer verschwunden.
Julians Vater hatte seine Halb-Elbenkinder bei sich aufgenommen und sie wie Schattenjäger erzogen. Das Blut der Nephilim war nun einmal dominant. Und obwohl der Kongregation die Vorstellung nicht sonderlich gefiel, akzeptierte man Halb-Schattenweltkinder in den eigenen Reihen, solange deren Haut mit Runenmalen versehen werden konnte. Sowohl Helen als auch Mark hatten ihre erste Rune im Alter von zehn Jahren erhalten, und ihre Haut vertrug die Male problemlos. Emma wusste allerdings, dass Mark dieser Vorgang mehr Schmerzen bereitete als gewöhnlichen Schattenjägern. Sie hatte beobachtet, wie er bei jeder Berührung mit der Stele zusammenzuckte – auch wenn er das zu verbergen versuchte. In letzter Zeit waren ihr noch ein paar andere Dinge an Mark aufgefallen: sein elbenhaftes, attraktives Gesicht und seine breiten Schultern unter dem T-Shirt. Emma konnte nicht sagen, warum sie diese Dinge registrierte, und es gefiel ihr auch nicht unbedingt. Diese Beobachtungen weckten in ihr den Wunsch, Mark anzufauchen oder sich zu verstecken oder oft auch beides gleichzeitig.
»Du starrst schon wieder«, sagte Julian und betrachtete Emma über die Knie seiner mit Farbe beklecksten Trainingsmontur hinweg.
Ruckartig schreckte sie aus ihren Gedanken auf. »Ach ja? Und wohin?«
»In Marks Richtung – schon wieder.« Er klang genervt.
»Klappe!«, zischte Emma und schnappte sich Julians Stele. Sofort holte Jules sich die Stele zurück, und eine Balgerei brach aus. Emma kicherte, als sie sich von Julian wegrollte. Sie hatte so lange gemeinsam mit ihm trainiert, dass sie jede seiner Bewegungen schon ahnte, bevor er sie ausführte. Das einzige Problem war nur, dass sie viel zu behutsam mit ihm umging. Der Gedanke, dass irgendjemand Julian wehtun könnte, machte sie rasend – und das »irgendjemand« galt eben auch für sie selbst.
»Geht es um die Bienen in deinem Zimmer?«, fragte Mark fordernd, als er zu Tiberius schlenderte. »Du weißt genau, warum wir sie beseitigen mussten!«
»Ich nehme an, du hast es getan, um meine Pläne zu vereiteln«, sagte Ty. Tiberius war recht klein für seine zehn Jahre, aber er verfügte über den Wortschatz und die Ausdrucksweise eines Achtzigjährigen. Und er log nur selten – hauptsächlich deshalb, weil er nicht verstand, warum es manchmal notwendig war. Er konnte einfach nicht begreifen, wieso einiges, was er sagte oder tat, andere Leute bestürzte oder verärgerte. Ihre Wut verwirrte oder beängstigte ihn dann, je nach seiner eigenen Gemütslage.
»Es geht nicht darum, deine Pläne zu vereiteln, Ty. Aber du kannst nun mal keine Bienen in deinem Zimmer halten …«
»Ich habe ihr Verhalten studiert!«, entgegnete Ty, und Zornesröte schoss in seine blassen Wangen. »Das war wichtig, und die Bienen waren meine Freunde, und ich hatte die Situation vollkommen im Griff.«
»Genau wie damals mit der Klapperschlange, als du die Situation auch vollkommen im Griff hattest?«, erwiderte Mark. »Manchmal nehmen wir dir etwas weg, weil wir nicht wollen, dass du verletzt wirst. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, Ty, aber wir lieben dich.«
Ty musterte ihn mit verständnisloser Miene. Er wusste, was »Ich liebe dich« bedeutete, und er wusste auch, dass es etwas Gutes war. Aber er verstand nicht, wie es eine Erklärung für irgendetwas sein konnte.
Mark bückte sich, stützte die Hände auf die Knie und schaute Ty geradewegs in die stahlgrauen Augen. »Okay, ich mach dir einen Vorschlag …«
»Ha!« Emma war es gelungen, Julian auf den Rücken zu werfen, und sie versuchte, ihm die Stele zu entreißen. Er lachte und wand sich unter ihr, bis sie seinen Arm auf den Boden drückte.
»Ich geb auf«, prustete er. »Ich geb auf …«
Lachend schaute er zu ihr hoch, und Emma wurde schlagartig bewusst, dass es sich auf einmal irgendwie merkwürdig anfühlte, direkt auf Jules zu liegen, und dass er, genau wie Mark, ein hübsches Gesicht hatte. Rund und jungenhaft und vollkommen vertraut. Doch hinter seinem jetzigen Gesicht sah sie bereits das Gesicht, das er einmal haben würde, wenn er erst älter war.
Der Klang der Türglocke hallte durch das Institut bis hinauf in den Fechtsaal – ein liebliches, melodisches Geräusch, wie das Läuten von Kirchenglocken. Für Irdische sah das Institut wie eine alte spanische Missionsruine aus. Aber trotz der überall aufgestellten Schilder PRIVATBESITZ und ZUTRITT VERBOTEN gelang es manchmal jemandem, bis zur Eingangstür vorzudringen. In der Regel waren es Irdische mit einem Anflug von Zweitem Gesicht.
Emma rollte sich von Julian herunter und klopfte ihre Kleidung ab. Sie lachte nicht länger.
Julian setzte sich auf, stützte sich auf die Hände und sah sie erstaunt an. »Alles in Ordnung?«
»Hab mir den Ellbogen gestoßen«, log Emma und schaute hinüber zu den anderen. Livvy ließ sich von Katerina zeigen, wie man das Messer richtig hielt, und Ty stand vor Mark und schüttelte den Kopf. Ty. Sie selbst hatte Tiberius diesen Spitznamen kurz nach seiner Geburt verpasst, denn mit ihren achtzehn Monaten hatte sie seinen Namen nicht aussprechen können und ihn stattdessen »Ty-Ty« genannt. Manchmal fragte sie sich, ob er das noch wusste … oder überhaupt wissen wollte. Bei Ty konnte man nie sicher sagen, was ihn interessierte und was nicht.
»Emma?« Julian beugte sich vor, und im nächsten Moment schien um sie herum alles zu explodieren. Ein greller Lichtstrahl blitzte auf, und die Welt jenseits der Fensterscheiben leuchtete weißgolden und rot, als wäre das Institut in Flammen aufgegangen. Gleichzeitig schwankte der Boden unter ihren Füßen wie das Deck eines Schiffs. Emma rutschte vorwärts, als ein grässlicher Schrei aus dem Erdgeschoss zu ihnen hinaufdrang – ein schreckliches, nie gehörtes Kreischen.
Livvy schnappte keuchend nach Luft, rannte zu Ty und schlang die Arme um ihn, als könnte sie ihn vollständig umfangen und seinen Körper mit ihrem eigenen schützen. Livvy gehörte zu den wenigen Menschen, deren Berührung Ty nichts auszumachen schien. Er stand mit weit aufgerissenen Augen da und krallte sich mit einer Hand am Ärmel seiner Schwester fest. Mark hatte sich bereits aufgerichtet, und Katerina wirkte bleich unter der Fülle ihrer dunklen Locken.
»Ihr bleibt hier«, befahl sie Emma und Julian. Sie zog ihr Schwert aus der Scheide an ihrer Hüfte. »Passt auf die Zwillinge auf. Mark, du kommst mit mir.«
»Nein!«, rief Julian und rappelte sich auf. »Mark …«
»Mir wird schon nichts passieren, Jules«, versicherte Mark mit einem beruhigenden Lächeln; er hielt bereits einen Dolch in jeder Hand. Mark war geschickt und schnell im Umgang mit Messern und verfehlte sein Ziel nur selten. »Bleib bei Emma«, sagte er, nickte beiden zu und folgte dann Katerina. Eine Sekunde später schloss sich die Tür zum Flur hinter ihnen.
Jules trat näher an Emma heran, schob seine Hand in ihre und half ihr auf die Beine. Eigentlich wollte sie ihm sagen, dass es ihr gut ginge und sie selbst aufstehen könne, doch sie schwieg. Denn sie verstand den Drang, irgendetwas tun, irgendwie helfen zu wollen. Plötzlich hallte ein weiterer Schrei vom Erdgeschoss zu ihnen hoch – ein Schrei und das Klirren von splitterndem Glas. Emma lief durch den Raum zu den Zwillingen; die beiden standen vollkommen reglos da, wie kleine Statuen. Livvy war aschfahl, und Ty umklammerte ihren Ärmel mit eisernem Griff.
»Alles wird gut«, sagte Jules und legte seinem Bruder eine Hand auf die schmale Schulter. »Was auch immer da unten sein mag …«
»Du hast doch keine Ahnung, was da unten ist«, erwiderte Ty stockend. »Wie kannst du sagen, dass alles gut wird? Das weißt du doch gar nicht.«
Im selben Moment ertönte ein anderes Geräusch, schlimmer als jeder Schrei – ein schreckliches Heulen, wild und brutal. Werwölfe?, überlegte Emma verwirrt. Aber sie hatte den Ruf der Werwölfe schon einmal gehört. Das hier klang wesentlich bedrohlicher und unerbittlicher.
Hastig drückte Livvy sich an Tys Schulter. Tiberius hob das kleine bleiche Gesicht, und sein Blick wanderte von Emma zu Julian. »Wenn wir uns hier verstecken«, sagte Ty, »und das da unten findet uns und tut unserer Schwester weh, dann ist das deine Schuld.«
Livvy hatte das Gesicht in Tys Halsgrube vergraben. Ty hatte leise gesprochen, aber Emma zweifelte keine Sekunde daran, dass er es ernst meinte. Denn trotz Tiberius’ Furcht einflößendem Intellekt, trotz seiner Eigenartigkeit und seiner Gleichgültigkeit gegenüber anderen Leuten waren er und seine Zwillingsschwester unzertrennlich. Wenn Livvy krank war, schlief Ty am Fuß ihres Bettes; wenn sie sich eine Schramme zuzog, geriet er in Panik – und das Gleiche galt auch umgekehrt.
Emma sah die widerstreitenden Gefühle in Julians Gesicht. Er suchte ihren Blick, und sie nickte kaum merklich. Die Vorstellung, im Fechtsaal zu warten, bis das Wesen, das diese Geräusche von sich gab, sie hier fand, zog ihr förmlich die Haut über den Knochen zusammen.
Julian durchquerte den Raum und kehrte mit einem Recurvebogen und zwei Dolchen zurück. »Du musst Livvy jetzt loslassen, Ty«, bat er, und nach einem Moment lösten sich die Zwillinge voneinander. Jules reichte Livvy einen Dolch und hielt den anderen Tiberius entgegen, der die Waffe anstarrte, als hätte er so etwas noch nie gesehen. »Ty«, sagte Jules und ließ seine Hand sinken. »Warum hattest du die Bienen in deinem Zimmer? Was hat dir an ihnen so gut gefallen?«
Ty schwieg.
»Es gefällt dir, wie sie zusammenarbeiten, stimmt’s?«, fragte Julian. »Und genau das müssen wir jetzt auch tun – zusammenarbeiten. Wir werden hinüber ins Büro laufen und den Rat anrufen, okay? Einen Notruf tätigen. Damit der Rat Verstärkung schickt … um uns zu beschützen.«
Ty nickte kurz und streckte die Hand nach dem Dolch aus. »Das wäre auch mein Vorschlag gewesen, wenn Mark und Katerina mir zugehört hätten.«
»Das stimmt«, bestätigte Livvy. Sie hatte den Dolch mit mehr Selbstvertrauen als Ty entgegengenommen und hielt ihn so, als wüsste sie genau, wie man mit der Waffe umzugehen hatte. »Darüber hat er die ganze Zeit nachgedacht.«
»Wir müssen jetzt sehr, sehr leise sein«, sagte Jules. »Ihr beide folgt mir ins Büro.« Er hob den Kopf, und sein Blick traf sich mit Emmas. »Emma wird Tavvy und Dru holen und dann mit ihnen zusammen zu uns kommen. Okay?«
Emmas Herz sank im Sturzflug, tief hinab wie ein Seevogel. Octavian – Tavvy –, der Kleinste, war nur zwei Jahre alt. Und Dru mit ihren acht Jahren war noch zu jung für das Training im Fechtsaal. Selbstverständlich musste jemand die beiden holen. Und Jules Augen schauten sie flehentlich an. »Klar«, sagte sie. »Genau so machen wir das.«
Cortana hing über Emmas Schulter; in der Hand hielt sie ein Wurfmesser. Sie glaubte, das Metall wie einen Herzschlag durch ihre Adern pulsieren zu fühlen, während sie sich vorsichtig durch den Korridor bewegte, den Rücken an die Wand gepresst. Alle paar Meter war ein Fenster in das Mauerwerk eingelassen, und der Anblick des blauen Ozeans, der grünen Berge und der friedvollen weißen Wolken schien sie zu verspotten. Sie dachte an ihre Eltern, die irgendwo da draußen am Strand waren und keine Ahnung hatten, was hier im Institut vor sich ging. Emma wünschte, sie wären jetzt bei ihr, aber gleichzeitig war sie froh, dass sie weit weg waren. So befanden sie sich wenigstens außer Gefahr.
Sie schlich nun durch den Teil des Gebäudes, den sie am besten kannte: den Familientrakt. Lautlos huschte sie durch den Flur, vorbei an Helens leerem Zimmer, mit den weggepackten Sachen und der staubigen Tagesdecke. Dann vorbei an Julians Zimmer, das ihr von unzähligen Übernachtungen so vertraut war wie ihr eigenes, und schließlich vorbei an Marks wie immer verschlossener Tür. Das nächste Zimmer gehörte Mr Blackthorn, und direkt daneben lag das Kinderzimmer. Emma holte tief Luft und drückte die Tür mit der Schulter auf.
Beim Anblick, der sich ihr in dem kleinen, blau gestrichenen Raum bot, riss sie die Augen auf. Tavvy stand in seinem Kinderbettchen, die winzigen Hände um die Gitterstäbe geklammert. Seine feuchten Wangen waren vom Schreien ganz gerötet. Drusilla hatte sich vor seinem Bett aufgebaut, ein Schwert fest in der Hand – der Erzengel allein wusste, woher sie die Waffe hatte, die nun direkt auf Emma zeigte. Drus Hand zitterte so sehr, dass die Schwertspitze hin und her tanzte, und ihre Zöpfe standen zu beiden Seiten ihres runden Gesichts ab. Aber der Ausdruck in ihren Blackthorn-Augen zeugte von eiserner Entschlossenheit: Wag es ja nicht, meinen Bruder anzufassen.
»Dru«, sagte Emma, so sanft wie sie nur konnte. »Dru, ich bin’s. Jules hat mich geschickt, um euch beide zu holen.«
Sofort ließ Dru das Schwert klirrend zu Boden fallen und brach in Tränen aus. Emma lief an ihr vorbei, hob Octavian mit ihrem freien Arm aus dem Kinderbett und setzte ihn sich auf die Hüfte. Tavvy war zwar klein für sein Alter, wog aber dennoch gut zehn Kilo. Emma zuckte zusammen, als er sich in ihre Haare krallte.
»Memma«, sagte er.
»Scht.« Emma küsste ihn auf den Scheitel. Er roch nach Babypuder und Tränen. »Dru, halt dich einfach an meinem Gürtel fest, okay? Wir gehen jetzt zum Büro. Dort sind wir in Sicherheit.«
Dru klammerte sich mit ihren kleinen Händen an Emmas Waffengurt; ihr Tränenstrom war bereits versiegt. Schattenjäger weinten nur selten, selbst wenn sie erst acht Jahre alt waren.
Vorsichtig führte Emma die beiden Kinder aus dem Zimmer. Der Lärm, der aus dem Erdgeschoss zu ihnen drang, war noch schlimmer als zuvor: ununterbrochene Schreie, tiefes Heulen, das Splittern von Glas und Holz. Zentimeterweise bewegte Emma sich vorwärts, Tavvy fest an sich gedrückt. Beruhigend murmelte sie ihm wieder und wieder ins Ohr: »Alles wird gut.« Das Sonnenlicht fiel durch die Fenster, grell und fast boshaft blendete es Emma.
Und sie war tatsächlich fast blind, vor Sonne und vor Panik – denn das war die einzige Erklärung dafür, warum sie nun die falsche Richtung einschlug. Sie bog in einen Korridor, fand sich aber nicht wie erwartet im Bürotrakt wieder, sondern oberhalb der breiten Treppe, die zur Eingangshalle und der großen, doppelflügeligen Institutstür führte.
In der Halle wimmelte es von Schattenjägern. Emma erkannte einige von ihnen – Nephilim der Los-Angeles-Division in schwarzer Kampfmontur. Aber andere trugen rote Schattenjägerkleidung. Einige der Statuen im Eingangsbereich waren umgestürzt oder lagen zertrümmert auf dem Boden. Das Panoramafenster mit Blick aufs Meer war zerschlagen, und überall sah man Scherben und Blut.
Emma drehte sich der Magen um. In der Mitte der Eingangshalle stand eine hochgewachsene Gestalt in scharlachroter Montur und mit sehr hellen, fast weißblonden Haaren. Das Gesicht des Mannes wirkte wie die gemeißelten Marmorzüge des Erzengels Raziel, allerdings ohne jede Spur von Erbarmen. Seine Augen funkelten kohlrabenschwarz. In der einen Hand hielt er ein Schwert mit einem Sternenmuster auf der Klinge und in der anderen einen Kelch aus schimmerndem Adamant.
Der Anblick des Pokals rief eine Erinnerung in Emma wach. Die Erwachsenen sprachen vor den jüngeren Schattenjägern zwar nicht gern über Politik, doch Emma wusste, dass Valentin Morgensterns Sohn einen anderen Namen angenommen und Rache gegenüber der Nephilimgemeinschaft geschworen hatte. Sie wusste, dass er einen Kelch angefertigt hatte, der das Gegenteil des Engelskelches war und Schattenjäger in bösartige, dämonische Kreaturen verwandelte. Emma hatte gehört, wie Mr Blackthorn diese bösen Schattenjäger als die »Erdunkelten« bezeichnet und verkündet hatte, er würde lieber sterben, als in solch ein Wesen verwandelt zu werden.
Das musste er also sein: Jonathan Morgenstern, den alle Sebastian nannten – eine Gestalt wie aus einem Märchen, aus einer Gruselgeschichte, die man Kindern erzählte, um ihnen Angst einzujagen, und die nun leibhaftig dort unten stand. Valentins Sohn.
Emma legte ihre Hand auf Tavvys Kopf und drückte sein Gesicht an ihre Schulter. Sie konnte sich nicht von der Stelle rühren, so als würden Bleigewichte an ihren Füßen hängen. Um Sebastian herum waren Schattenjäger in schwarzer und roter Montur versammelt und dazu Gestalten in schwarzen Umhängen – waren das auch Nephilim? Emma konnte es nicht sagen, denn ihre Gesichter waren verborgen. Und dann entdeckte sie Mark: Ein Schattenjäger in roter Kluft hatte ihm die Hände auf den Rücken gedreht. Seine Dolche lagen vor seinen Füßen, und rotes Blut schimmerte auf seiner Trainingskleidung.
Sebastian hob eine Hand und krümmte einen langen weißen Finger. »Bring sie her«, befahl er, woraufhin die Menge in Bewegung geriet. Und dann trat Mr Blackthorn vor und schleifte Katerina hinter sich her. Sie wehrte sich und schlug mit den Fäusten auf ihn ein, doch er war zu stark. Mit ungläubigem Entsetzen schaute Emma zu, wie Mr Blackthorn ihre Tutorin auf die Knie zwang.
»Und nun«, sagte Sebastian mit einer Stimme wie Seide, »trink aus dem Höllenkelch.« Dann presste er den Rand des Pokals zwischen Katerinas Lippen.
Das war der Moment, in dem Emma herausfand, woher das schreckliche Heulen stammte, dieses grässliche Geräusch, das sie im Fechtsaal gehört hatten. Katerina versuchte, sich zu befreien, aber Sebastian war zu stark. Er rammte ihr den Kelch zwischen die Zähne, und Emma sah, wie Katerina keuchte und schließlich schluckte. Nach einem Moment riss sie sich los, und dieses Mal hielt Mr Blackthorn sie nicht fest: Er lachte, genau wie Sebastian. Katerina fiel auf die Knie, ihr Körper begann zu zucken und dann entrang sich ihrer Kehle ein einziger Schrei – schlimmer als ein Schrei, ein qualvolles Heulen, als würde ihr die Seele aus dem Leib gerissen.
Ein Lachen ging durch die Menge. Sebastian lächelte. Er strahlte etwas Schreckliches und zugleich Schönes aus, so wie Giftschlangen und weiße Haie etwas Schreckliches und zugleich Schönes an sich hatten. Emma entdeckte, dass er zwei Gefährten an seiner Seite hatte: eine Frau mit ergrauten braunen Haaren und einer Axt in der Hand und eine große Gestalt, die vollständig in einen schwarzen Umhang gehüllt war und von der man nichts außer den schwarzen Stiefeln sah, die unter dem Saum des Umhangs herausschauten. Nur wegen der Größe und der Breite der Schultern schloss Emma, dass es sich um einen Mann handeln musste.
»War das der letzte der Nephilim in diesem Institut?«, fragte Sebastian.
»Da wäre noch dieser Junge, Mark Blackthorn«, sagte die Frau neben ihm und zeigte mit dem Finger auf Mark. »Er müsste eigentlich alt genug sein.«
Sebastian blickte auf Katerina herab, die nicht länger unkontrolliert zuckte, sondern reglos dalag, die dunklen Haare wirr im Gesicht. »Erhebe dich, Schwester Katerina«, sagte er. »Erhebe dich und bring Mark Blackthorn zu mir.«
Wie angewurzelt stand Emma da und beobachtete, wie Katerina sich langsam aufrappelte. Solange Emma zurückdenken konnte, war Katerina die Tutorin des Instituts gewesen. Sie war schon ihre Lehrerin gewesen, als Tavvy auf die Welt gekommen und kurz darauf Jules’ Mutter gestorben war. Auch Emma hatte unter ihrer Aufsicht mit dem Training begonnen. Katerina hatte ihnen Fremdsprachen beigebracht, ihre Schnittwunden verbunden, ihre Kratzer versorgt und ihnen ihre ersten Waffen überreicht. Sie hatte im Grunde zur Familie gehört. Doch jetzt trat sie mit leerem Blick über die Scherben und das Blut auf dem Boden und streckte ihren Arm nach Mark aus.
Dru keuchte bestürzt auf und riss Emma aus ihrer Erstarrung. Emma wirbelte herum und legte Tavvy in Drus Arme. Das Mädchen taumelte ein wenig, fing sich dann aber und drückte ihren kleinen Bruder fest an sich. »Lauf«, flüsterte Emma. »Lauf zum Büro. Und sag Julian, dass ich gleich nachkomme.«
Irgendetwas an dem eindringlichen Ton in Emmas Stimme überzeugte das Mädchen. Drusilla gab kein einziges Widerwort, sondern umklammerte Tavvy nur fester und lief los. Ihre kleinen nackten Füße eilten lautlos über den Parkettboden.
Hastig wandte Emma sich wieder der Schreckensszene im Erdgeschoss zu. Katerina stand jetzt hinter Mark, presste ihm einen Dolch zwischen die Schulterblätter und stieß ihn vorwärts. Er strauchelte und fiel Sebastian fast vor die Füße. Mark befand sich nun näher an der Treppe, und Emma sah, dass er gekämpft hatte. An seinen Händen und Handgelenken leuchteten frische Schnittwunden, seine rechte Wange war blutverschmiert, und er hatte eindeutig keine Zeit gehabt, um eine Heilrune aufzutragen.
Sebastian betrachtete ihn und verzog dann angewidert die Lippen. »Der hier ist kein Vollblutnephilim«, stellte er fest. »Halbelbe, hab ich recht? Warum hat man mich nicht darüber informiert?«
Ein Raunen ging durch die Menge der Schattenjäger. Dann fragte die Frau mit den graubraunen Haaren: »Bedeutet das, dass der Kelch keine Wirkung auf ihn hat, Lord Sebastian?«
»Es bedeutet, dass ich ihn nicht will«, erwiderte Sebastian.
»Wir könnten ihn ins Salztal bringen«, schlug die Frau vor, »oder zu den Höhen von Edom und ihn dort Asmodeus und Lilith zum Wohlgefallen opfern.«
»Nein«, sagte Sebastian gedehnt. »Nein, ich halte es nicht für klug, das mit jemandem zu machen, der das Blut des Lichten Volks in sich trägt.«
Mark spuckte ihm ins Gesicht.
Sebastian erstarrte. Dann wandte er sich an Marks Vater. »Komm her und bändige ihn«, befahl er. »Verwunde ihn, wenn du willst. Meine Geduld mit deinem Mischling ist allmählich erschöpft.«
Sofort trat Mr Blackthorn vor, ein Breitschwert in der Hand. Die Klinge war bereits mit Blut bespritzt. Entsetzt weiteten sich Marks Augen. Sein Vater hob das Schwert …
Und das Wurfmesser verließ Emmas Hand. Es flog durch die Luft und bohrte sich tief in Sebastian Morgensterns Brust.
Sebastian taumelte rückwärts, und Mr Blackthorn ließ die Klinge sinken. Die anderen schrien bestürzt auf. Mark sprang auf die Beine, während Sebastian die Waffe in seiner Brust anstarrte, deren Heft aus seinem Herzen herausragte. Er runzelte die Stirn.
»Autsch«, sagte er und zog das Messer heraus. Die Klinge glänzte blutrot, aber Sebastian schien die Verletzung nicht weiter zu kümmern. Gelangweilt warf er die Waffe beiseite und blickte dann hoch.
Emma spürte, wie sich seine dunklen, leeren Augen auf sie hefteten, wie die Berührung einer kalten Hand. Sie fühlte, dass er sie taxierte, sie einschätzte und durchschaute und dann verwarf.
»Es ist eine Schande, dass du das hier nicht überleben wirst und dem Rat nicht berichten kannst, dass Lilith meine Kräfte ins Unermessliche gesteigert hat. Möglicherweise könnte Glorious meinem Leben ein Ende setzen. Ein Jammer, dass die Nephilim den Himmel um keinen weiteren Gefallen mehr bitten können, denn keine der armseligen Kriegswaffen, die sie in ihrer Adamant-Zitadelle schmieden, kann mir jetzt noch Schaden zufügen.« Er wandte sich an die umstehenden Schattenjäger. »Tötet das Mädchen«, forderte er und schnippte sich angewidert einen Blutstropfen von der Jacke.
Emma sah, dass Mark zur Treppe stürmen wollte, um als Erster bei ihr zu sein. Doch die dunkle Gestalt neben Sebastian hatte ihn bereits mit schwarzen Handschuhen gepackt und zerrte ihn zurück, die Arme um Mark geschlungen, fast so, als wolle er ihn festhalten und schützen. Emma sah noch, wie Mark versuchte, sich dem Griff zu entwinden, doch dann verlor sie ihn aus dem Blick, als die Erdunkelten die Stufen hinaufschwärmten.
Emma wirbelte herum und rannte los. Sie hatte an den kalifornischen Stränden sprinten gelernt, dort, wo der Sand bei jedem Schritt unter den Füßen nachgab, sodass sie auf festem Untergrund schnell wie der Wind war. Mit wehenden Haaren raste sie durch den Flur, sprang die Stufen einer kurzen Treppe hinab, wandte sich nach rechts und platzte ins Büro. Dann warf sie die Tür hinter sich zu und schob den Riegel vor, ehe sie sich wieder umdrehte.
Das geräumige Büro war mit Bücherregalen gesäumt, in denen etliche Nachschlagewerke standen. Im obersten Geschoss des Instituts gab es noch eine andere Bibliothek, doch dies hier war das Reich des Institutsleiters gewesen. Vor dem Fenster stand Mr Blackthorns Schreibtisch, auf dem sich zwei Telefonapparate befanden: ein weißer und ein schwarzer.
Julian hielt den Hörer des schwarzen Telefons in der Hand und brüllte gerade hinein: »Sie müssen das Portal noch geöffnet lassen! Wir sind noch nicht alle außer Gefahr! Bitte …«
Die Tür hinter Emma dröhnte und erzitterte, als sich die Erdunkelten dagegenwarfen. Bestürzt schaute Julian auf, und als er Emma sah, fiel ihm der Hörer aus der Hand. Emma erwiderte seinen Blick und schaute dann an ihm vorbei auf die hell erleuchtete Ostwand. In der Mitte der Wand schimmerte ein Portal, eine rechteckige Öffnung im Mauerwerk, durch die Emma wirbelnde silberne Formen erkennen konnte, ein Strudel aus Wolken und Wind.
Sie taumelte auf Julian zu, und er fing sie an den Schultern auf. Seine Finger bohrten sich in ihre Haut, als könnte er nicht glauben, dass sie tatsächlich bei ihm war. »Emma«, keuchte er und sprudelte dann hektisch hervor: »Em, wo ist Mark? Wo ist mein Vater?«
Emma schüttelte den Kopf. »Sie können nicht … ich konnte nicht …« Sie musste schlucken. »Sebastian Morgenstern hat sie«, erklärte Emma und zuckte zusammen, als die Tür unter einem weiteren Angriff erbebte. »Wir müssen zurück … sie holen …«, sagte sie und drehte sich um.
Doch Julians Hand hatte sich bereits fest um ihr Handgelenk gelegt. »Das Portal!«, brüllte er über das Heulen des Windes und das Dröhnen der Bürotür hinweg, die weiterhin attackiert wurde. »Es führt nach Idris! Der Rat hat es geöffnet! Emma, es wird nur noch ein paar Sekunden offen bleiben!«
»Aber was ist mit Mark?!«, rief sie, obwohl sie keine Ahnung hatte, was sie und Julian tun konnten oder wie sie sich durch die Menge der Erdunkelten im Flur kämpfen sollten, wie sie Sebastian Morgenstern besiegen sollten, der mächtiger und stärker war als jeder gewöhnliche Schattenjäger. »Wir müssen zurück …«
»Emma!«, brüllte Julian, und dann flog die Tür auf und die Erdunkelten strömten in den Raum.
Emma hörte, wie die Frau mit den graubraunen Haaren etwas schrie, irgendetwas über die Nephilim … dass sie alle in den Feuern von Edom brennen würden … dass sie alle verbrennen und sterben und vernichtet werden würden …
Julian stürmte auf das Portal zu und zerrte Emma hinter sich her. Und nach einem entsetzten Blick über die Schulter ließ sie sich bereitwillig mitziehen. Sie duckte sich, als ein Pfeil an ihnen vorbeiflog und das Fenster zu ihrer Rechten zertrümmerte. Julian packte Emma verzweifelt und schlang die Arme um sie. Sie spürte, wie er seine Finger in den Rücken ihrer Trainingsjacke krallte, während sie gemeinsam auf das Portal zustürzten und dann vom röhrenden Wirbelstrom verschlungen wurden.
Das verzehrende Feuer
Da ließ ich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte, und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen aller, die dich sahen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich; du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin!
Ezechiel 28,18–19
1 Das Teil ihres Bechers*
»Stell dir irgendeine beruhigende Szene vor. Den Strand in Los Angeles – weißer Sand, blaues Meer, du schlenderst am Wasser entlang …«
Jace hob ein Augenlid. »Das klingt sehr romantisch.«
Der Junge, der ihm gegenüberhockte, seufzte und fuhr sich mit den Händen durch die zotteligen dunklen Haare. Trotz des frischen Windes an diesem kalten Dezembertag hatte Jordan seine Jacke abgelegt und die Hemdärmel hochgekrempelt – Werwölfen machte das Wetter nicht so viel aus wie Menschen. Die beiden saßen einander gegenüber im braunen Gras auf einer Lichtung im Central Park, beide im Schneidersitz, die Hände mit den Handflächen nach oben auf den Knien.
Nicht weit von ihnen ragte ein Fels aus dem Boden auf, der in große und kleinere Brocken zerborsten war, und auf einem der größeren Findlinge thronten Alec und Isabelle Lightwood. Als Jace hochschaute, fing Isabelle seinen Blick auf und winkte ihm ermutigend zu. Alec, der ihre Handbewegung bemerkt hatte, stieß sie unsanft gegen die Schulter. Jace konnte sehen, dass er Izzy einen Vortrag hielt – wahrscheinlich darüber, dass sie Jace’ Konzentration nicht stören sollte. Jace musste lächeln: Keiner der beiden hatte wirklich einen Grund, hier bei ihm zu sein, aber sie hatten ihn dennoch begleitet, »zur moralischen Unterstützung«. Obwohl Jace ja vermutete, dass es eher damit zusammenhing, dass Alec in letzter Zeit nicht wusste, was er mit sich anfangen sollte, und dass Isabelle ihren Bruder nicht gern allein ließ, und dass beide ihren Eltern und dem Institut nach Kräften aus dem Weg gingen.
Jordan schnippte mit den Fingern vor seiner Nase. »Hörst du mir überhaupt zu?«
Jace runzelte die Stirn. »Ja, zumindest habe ich das, bis wir in diesen miesen kitschigen Werbefilm abgedriftet sind.«
»Okay, was genau würde sich denn beruhigend auf dein Gemüt auswirken und dich friedlich stimmen?«
Jace nahm die Hände von den Knien – der Lotussitz bescherte ihm Krämpfe in den Handgelenken –, lehnte sich zurück und stützte sich auf die Arme. Der kalte Wind zerrte an den wenigen vertrockneten Blättern, die noch an den Bäumen hingen. Vor dem bleichen Winterhimmel besaß das Laub eine schlichte Eleganz, wie in einer Tuschezeichnung. »Das Töten von Dämonen«, sagte er. »Eine klare, saubere Tötung ist sehr entspannend. Die langwierigen Kämpfe mit Blut und Dämonensekret sind nerviger, weil man anschließend immer alles sauber machen muss …«
»Nein, nein, nein.« Jordan hob die Hände in die Höhe. Unter den Ärmeln seines Shirts kamen die Tätowierungen zum Vorschein, die sich um seine Oberarme spannten. Shaantih, shaantih, shaantih. Jace wusste, dass die Worte »Friede jenseits des Bewusstseins« bedeuteten und dass man sie beim Aufsagen von Mantras dreimal wiederholen sollte, um den Geist zu beruhigen. Aber in der letzten Zeit schien ihn nichts beruhigen zu können. Das Feuer in seinen Adern sorgte zudem dafür, dass sein Verstand nicht zur Ruhe kam, dass seine Gedanken sich förmlich überschlugen wie explodierende Feuerwerkskörper. Träume, so lebendig und leuchtend wie Ölgemälde. Er hatte versucht, das Feuer mit Training aus seinem Körper zu vertreiben, hatte Stunde um Stunde im Fechtsaal verbracht, hatte Blut und Wasser geschwitzt und etliche Verletzungen, sogar einen Knochenbruch davongetragen. Doch dabei herausgekommen war nichts weiter als ein genervter Alec, der seine ständigen Bitten nach Heilrunen nicht mehr hören konnte. Und einmal hatte er versehentlich einen der Querbalken im Dachgestühl angekokelt.
Es war Simon gewesen, der ihnen erzählt hatte, dass sein Mitbewohner täglich meditierte und auf diese Weise die unbändigen Wutausbrüche in den Griff bekommen hatte, die oft Teil der Verwandlung zum Werwolf waren. Von dort war es nur noch ein kleiner Schritt gewesen, bis Clary vorgeschlagen hatte, Jace »könnte es doch mal ausprobieren«. Und hier saß er nun, bei seiner zweiten Meditationsstunde. Die erste Lektion hatte damit geendet, dass Jace einen Brandfleck auf Simons und Jordans Holzboden hinterlassen hatte, woraufhin Jordan vorgeschlagen hatte, die nächste Stunde lieber im Freien abzuhalten, um weitere Schäden an der Inneneinrichtung zu vermeiden.
»Keine Tötungen«, sagte Jordan nun. »Wir versuchen, deinen Geist zu beruhigen, dich mit Frieden zu erfüllen. Blut, Töten, Krieg – das sind alles keine friedlichen Dinge. Gibt es denn sonst nichts, was du gerne magst?«
»Waffen«, erwiderte Jace. »Ich mag Waffen.«
»Irgendwie hab ich das Gefühl, dass wir es hier mit einem problematischen Fall von persönlicher Philosophie zu tun haben.«
Jace beugte sich vor und legte die Handflächen flach auf den Rasen. »Ich bin ein Krieger«, sagte er. »Ich wurde von klein auf zum Krieger erzogen. Ich hatte kein Spielzeug, ich hatte Waffen. Bis zum Alter von fünf Jahren habe ich nachts mit einem Holzschwert in meinem Bett geschlafen. Meine ersten Bücher waren mittelalterliche Dämonologien mit zahlreichen Illuminationen. Die ersten Lieder, die ich gelernt habe, dienten der Vertreibung von Dämonen. Ich weiß, was meinem Geist Frieden bringt – und das sind keine weißen Sandstrände oder Vogelgezwitscher im Regenwald. Ich wünsche mir nichts mehr als eine Waffe in der Hand und eine siegreiche Strategie.«
Jordan musterte ihn ruhig. »Mit anderen Worten: Krieg ist das, was dir Frieden bringt.«
Jace warf die Hände hoch, rappelte sich auf und klopfte sich ein paar Halme von der Jeans. »Na endlich kapierst du’s.« Im nächsten Moment hörte er das Rascheln von trockenem Gras, drehte sich um und sah, wie Clary zwischen zwei Bäumen hindurch auf die Lichtung trat, dicht gefolgt von Simon. Sie hatte die Hände in die Gesäßtaschen geschoben und lachte.
Einen Moment lang beobachtete Jace die beiden: Es hatte eine eigenartige Faszination, wenn man Leute beobachtete, die nicht wussten, dass man sie beobachtete. Er erinnerte sich an seine zweite Begegnung mit Clary, als sie auf der anderen Seite im Java Jones gesessen hatte. Sie hatte mit Simon gescherzt und geredet, genau wie jetzt auch. Und Jace erinnerte sich auch wieder an den bis dahin unbekannten Anflug von Eifersucht, den er in seiner Brust gespürt und der ihm die Luft abgeschnürt hatte, und an das Gefühl seltsamer Genugtuung, als Clary Simon im Café zurückgelassen hatte, um ihm nach draußen zu folgen und mit ihm zu reden.
Inzwischen hatte sich vieles verändert. Seine nagende Eifersucht auf Simon hatte sich allmählich in eine Art widerwilligen Respekt für dessen Beharrlichkeit und Mut verwandelt, und inzwischen betrachtete er ihn als Freund – auch wenn er das niemals offen zugeben würde. Jace sah, dass Clary zu ihm hinüberschaute und ihm eine Kusshand zuwarf; ihr roter Pferdeschwanz wippte bei jedem Schritt. Sie war so klein – zierlich und puppenhaft, hatte er einst gedacht, bevor er miterlebt hatte, wie stark sie war.
Nun kam sie auf Jordan und ihn zu, während Simon den Hügel hinaufstieg, um sich zu Alec und Isabelle zu gesellen. Er ließ sich neben Isabelle nieder, die sich sofort zu ihm hinüberbeugte und irgendetwas sagte, wobei ihre langen schwarzen Haare ihr Gesicht wie ein Vorhang verdeckten.
Clary blieb vor Jace stehen und wippte lächelnd auf den Fersen vor und zurück. »Und, wie läuft’s?«
»Jordan will, dass ich an einen Strand denke«, verkündete Jace finster.
»Er ist stur«, wandte Clary sich an Jordan. »Eigentlich will er damit nur sagen, dass er deine Bemühungen zu schätzen weiß.«
»Nein, tu ich nicht«, widersprach Jace.
Jordan schnaubte. »Ohne mich würdest du jetzt über die Madison Avenue hopsen und Funken aus jeder Körperöffnung sprühen.« Er stand auf und streifte seine grüne Jacke über. »Dein Freund ist total durchgeknallt«, sagte er zu Clary.
»Stimmt, aber auch total sexy«, erwiderte Clary. »Das darf man nicht vergessen.«
Jordan zog eine gutmütige Grimasse. »Ich muss los«, sagte er. »Bin mit Maia verabredet.« Er salutierte gespielt und war im nächsten Moment zwischen den Bäumen verschwunden, mit dem lautlosen Trab des Wolfes, der unter seiner Haut schlummerte. Jace schaute ihm nach. Ein unerwarteter Retter, dachte er. Noch vor sechs Monaten hätte er jeden ausgelacht, der ihm erzählen wollte, dass er mal Verhaltensunterricht bei einem Werwolf nehmen würde.
Zwischen Jordan, Simon und Jace hatte sich in den vergangenen Monaten so etwas wie eine Freundschaft entwickelt. Jace nutzte die Wohnung der beiden gern als Zufluchtsort, weit weg von der täglichen Last des Instituts, weit weg von der Erinnerung daran, dass der Rat noch immer nicht auf einen Krieg mit Sebastian vorbereitet war.
Erchomai. Das Wort streifte etwas tief in Jace’ Innerem, wie die Berührung einer Feder, und ließ ihn erschaudern. Vor seinem geistigen Auge sah er eine Engelsschwinge, brutal vom Rumpf abgetrennt, in einer Lache aus goldenem Blut.
Ich komme.
»Was ist los?«, fragte Clary. Jace wirkte plötzlich meilenweit entfernt. Seit das Himmlische Feuer in seinen Körper eingedrungen war, zog er sich immer häufiger in sich selbst zurück. Clary hatte den Eindruck, dass es sich dabei um eine Nebenwirkung seiner Bemühungen handelte, seine Gefühle zu unterdrücken. Sie spürte einen kleinen Stich in der Brust. Als sie Jace kennengelernt hatte, war er unglaublich beherrscht gewesen. Damals hatte sie sein wahres Ich nur durch Risse in seinem persönlichen Schutzpanzer erkennen können – wie Licht, das durch einen schmalen Mauerspalt drang. Es hatte sehr lange gedauert, diese schützende Mauer zu durchbrechen. Doch nun zwang ihn das Feuer in seinen Adern, diesen Schutzwall erneut zu errichten und seine Gefühle aus Sicherheitsgründen zu unterdrücken. Aber wenn das Feuer eines Tages verschwunden war, würde er dann in der Lage sein, die Mauern wieder niederzureißen?
Jace blinzelte; ihre Stimme hatte ihn aus seinen Gedanken gerissen. Die kalte Wintersonne stand hoch am Himmel und ließ die Konturen seines Gesichts und die Schatten unter seinen Augen stärker hervortreten. Er tastete nach Clarys Hand und holte tief Luft. »Du hattest recht«, sagte er in dem ruhigen, ernsten Tonfall, den er nur ihr vorbehielt. »Es hilft tatsächlich – die Meditationsstunden mit Jordan. Es hilft, und ich weiß seine Bemühungen wirklich zu schätzen.«
»Ich weiß.« Clary umfasste sein Handgelenk. Seine Haut fühlte sich warm an; seit seiner Begegnung mit Glorious schien seine Körpertemperatur um einige Grade höher zu liegen als zuvor. Sein Herz schlug noch immer im vertrauten, beständigen Rhythmus, doch das Blut, das durch seine Adern rauschte, pulsierte unter ihren Fingern, erfüllt von der kinetischen Energie eines Feuers, das jeden Moment auszubrechen drohte.
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn auf die Wange zu küssen, doch Jace drehte im selben Moment den Kopf und ihre Lippen streiften sich. Seit das Feuer durch seine Adern raste, hatten sie nichts anderes gewagt, als sich zu küssen – und selbst das nur sehr zurückhaltend. Auch jetzt war Jace vorsichtig: Sein Mund glitt sanft über ihre Lippen, seine Hand schloss sich um ihre Schulter. Einen Augenblick lang standen sie Körper an Körper, und Clary spürte das Dröhnen und Pulsieren seines Blutes. Jace versuchte, sie näher an sich heranzuziehen, aber einen Sekundenbruchteil später sprang ein scharfer, knisternder Funke von ihm auf Clary über, wie das Britzeln von Reibungselektrizität. Sofort löste Jace sich von ihr und trat keuchend einen Schritt zurück. Doch bevor Clary irgendetwas sagen konnte, brandete auf dem nahe gelegenen Hügel sarkastischer Applaus auf. Simon, Isabelle und Alec winkten ihnen zu. Jace verbeugte sich, während Clary leicht verlegen zurückwich und die Daumen in den Gürtel ihrer Jeans einhakte.
Jace seufzte. »Sollen wir uns zu unseren nervigen, voyeuristischen Freunden gesellen?«
»Leider ist das die einzige Art von Freunden, die wir haben.« Clary gab ihm mit der Schulter einen Schubs, dann kletterten sie gemeinsam den Hügel hinauf. Simon und Isabelle saßen nebeneinander und unterhielten sich leise. Alec hockte einen halben Meter entfernt und starrte mit einem Ausdruck äußerster Konzentration auf das Display seines Handys.
Jace ließ sich neben seinem Parabatai auf den Felsbrocken sinken. »Ich hab gehört, wenn man diese Dinger nur lange genug anstarrt, klingeln sie irgendwann.«
»Er hat Magnus eine SMS geschickt«, erklärte Isabelle und musterte ihren Bruder missbilligend.
»Hab ich nicht«, widersprach Alec automatisch.
»Doch, hast du wohl«, sagte Jace, der Alec über die Schulter schaute. »Und du hast ihn angerufen. Ich kann die Liste mit den gewählten Nummern sehen.«
»Er hat heute Geburtstag«, sagte Alec und klappte das Mobiltelefon zu. In der letzten Zeit wirkte er irgendwie dünner, fast schon hager in seinem zerschlissenen blauen Pullover mit den löchrigen Ellbogen. Seine Lippen waren rau und rissig. Clary empfand tiefes Mitgefühl mit ihm: Die erste Woche, nachdem Magnus sich von ihm getrennt hatte, hatte Alec in einem benommenen Zustand aus Trauer und Unglaube verbracht. Keiner von ihnen hatte es richtig glauben können. Clary hatte immer gedacht, Magnus würde Alec lieben, wirklich lieben. Und offensichtlich hatte Alec das auch angenommen. »Ich wollte nicht, dass er glaubt … dass ich nicht … dass er denkt, ich hätte seinen Geburtstag vergessen.«
»Du quälst dich damit doch nur«, sagte Jace.
Alec zuckte die Achseln. »Das musst du gerade sagen. ›Oh, ich liebe sie. Oh, sie ist meine Schwester. Oh, warum nur, warum, warum, warum …?‹«
Jace bewarf Alec mit einer Handvoll trockenem Laub, sodass dieser entrüstet schnaubte.
Isabelle lachte. »Er hat recht, Jace – und das weißt du auch.«
»Gib mir dein Handy«, forderte Jace und ignorierte Isabelle. »Komm schon, Alexander.«
»Das geht dich nichts an«, erwiderte Alec und hielt das Telefon außer Reichweite. »Vergiss es einfach, okay?«
»Du isst nicht, du schläfst nicht, du starrst nur auf dein Handy – und das soll ich einfach so vergessen?«, konterte Jace. In seiner Stimme schwang eine erstaunliche Portion Ärger mit. Clary wusste, wie sehr es ihn bedrückte, Alec so unglücklich zu sehen, aber sie war sich nicht sicher, ob Alec das auch wusste. Unter normalen Umständen würde Jace jeden, der Alec wehtat, töten oder wenigstens mit fürchterlicher Rache drohen, doch dieser Fall lag vollkommen anders. Jace siegte für sein Leben gern, aber ein gebrochenes Herz konnte man nicht besiegen, auch nicht, wenn es sich um das Herz eines anderen Menschen handelte. Auch nicht, wenn es sich um jemanden handelte, den man sehr gern hatte.
Im nächsten Moment beugte Jace sich zu seinem Parabatai hinüber und entriss ihm das Smartphone. Alec protestierte und streckte die Hand danach aus, aber Jace wehrte ihn mit einem Arm ab und scrollte mit der anderen Hand geschickt durch die gesendeten Mitteilungen. »Magnus, bitte ruf mich zurück. Ich muss einfach wissen, ob es dir gut geht …« Jace schüttelte den Kopf. »Nein, das geht gar nicht.« Mit einer entschlossenen Bewegung brach er das Handy in der Mitte durch. Das Display wurde dunkel, als er die beiden Hälften auf den Boden fallen ließ. »So.«
Ungläubig starrte Alec auf die Einzelteile vor ihm. »Du hast mein HANDY ZERBROCHEN.«
Jace zuckte die Achseln. »Männer lassen nicht zu, dass Männer ständig bei anderen Männern anrufen. Okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz richtig formuliert. Aber Freunde lassen nicht zu, dass ihre Freunde ständig bei ihrem Ex anrufen und wieder auflegen. Ernsthaft. Du musst damit aufhören.«
Alec musterte ihn wütend. »Also hast du einfach mein nagelneues Handy kaputt gemacht? Na, herzlichen Dank.«
Jace lächelte gelassen und lehnte sich gegen den Fels. »Keine Ursache.«
»Sieh es mal positiv«, schlug Isabelle vor. »Jetzt kann Mom dich wenigstens nicht mehr mit SMS-Nachrichten bombardieren. Sie hat mir heute schon sechs Stück geschickt. Mittlerweile hab ich mein Handy abgeschaltet.« Mit einem vielsagenden Blick klopfte sie auf ihre Jackentasche.
»Was will sie denn?«, fragte Simon.
»Irgendwelche Besprechungen«, erklärte Isabelle. »Eidesstattliche Erklärungen. Der Rat will wieder und wieder hören, was bei dem Kampf gegen Sebastian in dieser verlassenen Gegend in Irland genau passiert ist. Wir alle mussten schon etliche Male aussagen. Wie Jace das Himmlische Feuer von Glorious absorbiert hat … wie die Dunklen Schattenjäger ausgesehen haben und der Höllenkelch und ihre Waffen und ihre Runen. Und was wir getragen haben, was Sebastian getragen hat, was alle getragen haben … fast wie Telefonsex, nur extrem langweilig.«
Simon verschluckte sich fast und lachte unterdrückt.
»Außerdem will der Rat wissen, was Sebastian unserer Meinung nach beabsichtigt«, fügte Alec hinzu. »Wann er zurückkommt. Und was er dann vorhat.«
Clary stützte die Ellbogen auf die Knie. »Ist doch gut zu wissen, dass der Rat wie immer einen wohldurchdachten und soliden Plan hat.«
»Die Ratsmitglieder wollen es einfach nicht glauben«, sagte Jace und starrte zum Himmel hinauf. »Das ist das Problem. Ganz gleich, wie oft wir ihnen berichten, was wir in Irland gesehen haben. Ganz gleich, wie oft wir ihnen versichern, dass die Erdunkelten extrem gefährlich sind. Sie wollen einfach nicht wahrhaben, dass Nephilim wirklich korrupt sein können. Und dass Schattenjäger andere Schattenjäger töten.«
Clary war dabei gewesen, als Sebastian die ersten der Erdunkelten erschaffen hatte. Sie hatte die Leere in ihren Augen gesehen und die blinde Raserei, mit der sie kämpften. Sie jagten ihr Angst ein. »Das sind keine Schattenjäger mehr«, sagte sie leise. »Das sind keine Lebewesen mehr.«
»Aber es fällt einem schwer, das zu glauben, wenn man es nicht mit eigenen Augen gesehen hat«, meinte Alec. »Und Sebastian hat nur eine Handvoll dieser Dunklen Nephilim. Eine kleine Truppe, weit verstreut – der Rat will nicht glauben, dass er eine tatsächliche Bedrohung darstellt. Und falls doch, dann geht man lieber davon aus, dass er eher für uns hier in New York eine Gefahr ist als für die Gemeinschaft der Nephilim im Allgemeinen.«
»In einem Punkt hat der Rat recht: Wenn Sebastian sich überhaupt für irgendetwas interessiert, dann für Clary«, sagte Jace, und Clary spürte, wie ihr ein eisiger Schauer über den Rücken lief, eine Mischung aus Abscheu und Sorge. »Sebastian hat keine richtigen Gefühle. Jedenfalls nicht wie wir anderen. Aber wenn er welche hätte, dann würden sie Clary gelten. Und Jocelyn. Er hasst sie.« Jace schwieg einen Moment nachdenklich. »Aber ich glaube nicht, dass er direkt hier zuschlagen würde. Das wäre … zu offensichtlich.«
»Hoffentlich hast du das dem Rat erzählt«, sagte Simon.
»Bestimmt hundert Mal«, erklärte Jace. »Aber ich habe nicht den Eindruck, dass man auf meine Meinung gesteigerten Wert legt.«
Clary blickte auf ihre Hände. Genau wie die anderen war auch sie von den Ratsmitgliedern befragt worden und hatte ihnen auf jede ihrer Fragen eine Antwort geliefert. Aber es gab nach wie vor ein paar Dinge, die sie ihnen nicht über Sebastian erzählt hatte, die sie niemandem erzählt hatte. Vor allem die Dinge, die er von ihr wollte.
Seit ihrer Rückkehr aus Irland hatte sie nicht oft geträumt, aber wenn, dann waren es Albträume gewesen, Albträume von ihrem Bruder.
»Es kommt mir vor, als würde man versuchen, ein Gespenst zu bekämpfen«, sagte Jace. »Sie können Sebastian nicht orten, sie können ihn nicht aufspüren und auch keine der Schattenjäger, die er verwandelt hat.«
»Die Ratsmitglieder tun, was sie können«, sagte Alec. »Um Idris und Alicante hat man die Schutzwälle verstärkt, genau genommen alle Schutzschilde. Und inzwischen hat man Dutzende Experten auf die Wrangelinsel geschickt.«
Die Wrangelinsel war der zentrale Standort für alle Schutzschilde der Welt – jenes magische Abwehrsystem, das die Erde im Allgemeinen und Idris im Besonderen vor einer Dämoneninvasion schützte. Zwar gelang es manchen Dämonen, diese Schranken zu durchbrechen, aber Clary mochte sich gar nicht ausmalen, wie schlimm die Situation erst wäre, wenn es die Schutzschilde nicht gäbe.
»Ich habe gehört, wie Mom gesagt hat, dass die Hexenwesen des Spirallabyrinths nach einem Weg suchen, um die Wirkung des Höllenkelchs rückgängig zu machen«, erzählte Isabelle. »Natürlich wäre das Ganze leichter, wenn sie irgendwelche Leichname hätten, die sie analysieren könnten …« Sie verstummte.
Und Clary wusste, warum. Die Leichen der Dunklen Schattenjäger, die in dieser trostlosen irischen Landschaft ihr Leben gelassen hatten, waren zur genaueren Untersuchung in die Stadt der Gebeine gebracht worden. Aber die Stillen Brüder hatten keine Gelegenheit gehabt, die Toten zu obduzieren, da diese über Nacht zu jahrzehntealten Leichnamen verwest waren. Es war ihnen nichts anderes übrig geblieben, als die Überreste einzuäschern.
Isabelle fand ihre Stimme wieder: »Und die Eisernen Schwestern produzieren Waffen am laufenden Band. Tausende weitere Seraphklingen, Schwerter, Chakrams … alle möglichen Waffen … und alle in Himmlischem Feuer geschmiedet.« Ihr Blick wanderte zu Jace. In den Tagen unmittelbar nach dem Kampf in jener menschenleeren Gegend namens Burren, als das Feuer so brutal durch Jace’ Adern gerast war, dass er manchmal vor Schmerz aufgeschrien hatte, da hatten die Brüder der Stille ihn wieder und wieder untersucht. Sie hatten Flammen und Eis ausprobiert, geweihtes Metall und Kalteisen, im Versuch, das Feuer aus seinem Körper zu entfernen oder es zumindest einzudämmen.
Aber es war ihnen nicht gelungen. Glorious’ Feuer, das einst in der Klinge gefangen gewesen war, schien es nicht eilig zu haben, jemand anderen zu besiedeln oder Jace’ Körper überhaupt für irgendeine andere Art der Behausung verlassen zu wollen. Bruder Zachariah hatte Clary erzählt, dass schon die ersten Schattenjäger versucht hatten, das Himmlische Feuer in einer Waffe einzufangen, um es als wirksames Mittel gegen Dämonen einsetzen zu können. Doch sämtliche Versuche waren vergebens gewesen, und schließlich hatten sie die Seraphklingen zu ihren bevorzugten Waffen gemacht. Und genau wie damals hatten die Stillen Brüder auch dieses Mal letztendlich aufgeben müssen: Glorious’