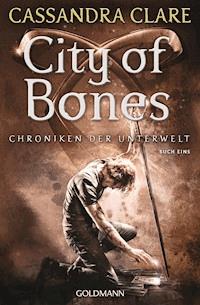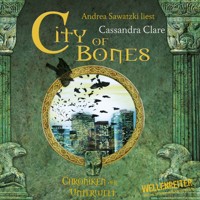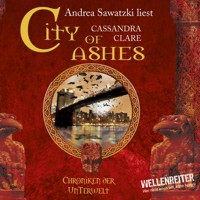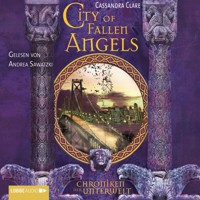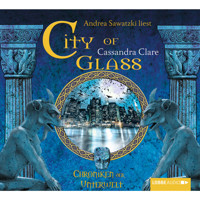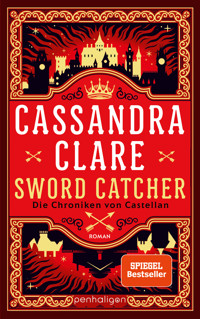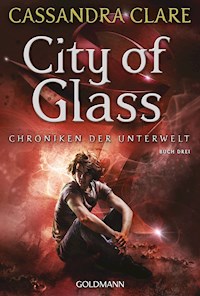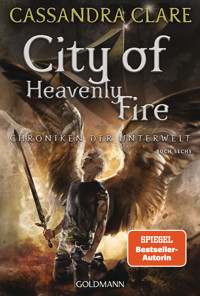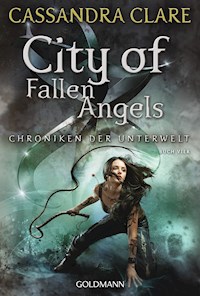
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Chroniken der Unterwelt
- Sprache: Deutsch
New York City, die Stadt, die niemals schläft. Hier finden auch die Wesen der Unterwelt ein Zuhause: Feen, Werwölfe und Vampire, Hexenwesen und Dämonen. Lange Zeit bekämpften sie alle sich bis aufs Blut – jetzt ist Frieden einkehrt. Endlich kann die 16-jährige Clary ihr Leben in vollen Zügen genießen: ihre Ausbildung zur Schattenjägerin ebenso wie das bevorstehende Hochzeitsfest ihrer Mutter. Und natürlich die Liebe zu ihrem Mitstreiter Jace, zu der sie sich nun bekennen kann. Doch abseits des Idylls braut sich ein dunkler Sturm zusammen. Ist der Krieg, den Clary und ihre Freunde gewonnen glaubten, doch noch nicht vorbei?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 759
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Lange Zeit bekämpften die Wesen der Unterwelt sich bis aufs Blut, gab es auch innerhalb der Schattenjägergemeinschaft Streit, Grausamkeit, Verrat. Nun ist Frieden eingekehrt, und zurück zu Hause in New York freut sich Clary Fray auf das Leben, von dem sie immer geträumt hat: eine offizielle Ausbildung zur Schattenjägerin, die Traumhochzeit ihrer Mutter und – wichtiger als alles andere – die Möglichkeit, sich endlich zu ihrer eigenen großen Liebe zu bekennen, Jace Herondale.
Doch anders als erhofft, fällt bald ein dunkler Schatten auf Clarys Glück. Ein Schattenjäger nach dem anderen wird Opfer eines mysteriösen Mörders, und so gerät der neue, noch sehr zerbrechliche Frieden schnell wieder in Gefahr. Und auch Jace wirkt seltsam distanziert, zieht sich immer weiter von Clary zurück. Diese versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen – und muss feststellen, dass sie selbst es war, die eine fatale Kette von Ereignissen in Gang gesetzt hat. Ereignisse, die am Ende alles, für das sie je gekämpft hat, in einen bodenlosen Abgrund reißen könnten …
Weitere Informationen zu Cassandra Clare
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Cassandra Clare
City of Fallen Angels
Chroniken der Unterwelt
BUCH VIER
Roman
Deutsch von Franca Fritz und Heinrich Koop
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »The Mortal Instruments. Book Four. City of Fallen Angels« bei Margaret K. McElderry Books, an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division, New York.
Erstmals auf Deutsch erschienen im Jahr 2011.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Neuausgabe April 2022
Copyright © der Originalausgabe 2011 by Cassandra Clare, LLC
Copyright © dieser Ausgabe 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Franca Fritz und
Heinrich Koop © 2011 Arena Verlag GmbH, Würzburg. www.arena-verlag.de
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Entwurfs von Russell Gordon
Umschlagmotiv: © Cliff Nielsen
Illustration Buchrücken: © 2015 by Nicolas Delort (Landschaft), Pat Kinsella (Figur)
Karte auf den Umschlaginnenseiten: Drew Willis
TH · Herstellung: ik
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-24317-3V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Josh
Sommes-nous les deux livres d’un même ouvrage?
Würgeengel
Es gibt Seuchen, die in Dunkelheit wandeln, und es gibt Würgeengel, gehüllt in den Schleier der Unstofflichkeit und mit einer wenig mitteilsamen Natur, die wir zwar nicht sehen, aber deren Kraft wir spüren und unter deren Schwert wir fallen.
JEREMY TAYLOR, »EINE GRABPREDIGT«
1Herr und Meister
»Einen Kaffee, bitte.«
Die Kellnerin hob skeptisch die sorgfältig nachgezogenen Augenbrauen. »Sie wollen nix essen?«, fragte sie. Ihr ausländischer Akzent war ebenso deutlich zu hören wie ihre Enttäuschung.
Simon Lewis konnte es ihr nicht verübeln; wahrscheinlich hatte sie auf ein besseres Trinkgeld gehofft als das, das sie von einer einzelnen Tasse Kaffee erwarten konnte. Aber schließlich war es nicht seine Schuld, dass Vampire nichts aßen. Manchmal bestellte er in einem Restaurant einfach irgendetwas, nur um den Eindruck von Normalität zu wahren, aber an diesem Dienstagabend im Veselka schien ihm das Ganze nicht der Mühe wert, zumal sich kaum andere Gäste im Lokal aufhielten. »Nur den Kaffee, bitte.«
Achselzuckend nahm die Kellnerin die laminierte Speisekarte an sich und ging zur Theke, um seine Bestellung aufzugeben. Simon ließ sich gegen die harte Lehne des Plastikstuhls sinken und schaute sich um. Veselka, ein Restaurant an der Kreuzung von Ninth Street und Second Avenue, zählte zu seinen Lieblingsorten in der Lower East Side – eines jener alteingesessenen Esslokale mit schwarz-weißen Malereien an den Wänden, in denen man ganze Tage ungestört sitzen konnte, solange man nur alle halbe Stunde einen Kaffee bestellte. Außerdem gab es hier die besten vegetarischen Piroggen und Simons absoluten Lieblings-Borschtsch … aber das lag ja nun unwiderruflich hinter ihm.
Es war Mitte Oktober, und das Personal hatte gerade die Halloween-Dekorationen angebracht – ein wackliges Schild mit der Aufschrift »Gib mir Borschtsch, sonst setzt es worscht!« und einen Pappkarton-Vampir namens »Graf Blinula«, in Anspielung auf ein typisches Gericht auf der Speisekarte. Einst hatten Simon und Clary die schäbige Deko irrsinnig komisch gefunden, doch der Graf mit seinen falschen Vampirzähnen und dem schwarzen Umhang erschien ihm inzwischen nicht mehr ganz so lustig wie früher.
Simon warf einen Blick aus dem Fenster. Draußen war es dunkel, und eine kräftige Brise blies trockenes Laub wie buntes Konfetti durch die Second Avenue. Ein junges Mädchen schlenderte über den Gehweg, ein Mädchen in einem eng geschnürten Trenchcoat, mit langem schwarzem Haar, das im Wind wirbelte. Sämtliche Passanten, denen sie begegnete, blieben stehen und drehten sich nach ihr um. Auch Simon hatte früher solchen Mädchen nachgeschaut und sich im Vorbeigehen gefragt, wohin sie wohl gingen und mit wem sie verabredet waren. Jedenfalls nicht mit Jungs wie ihm, so viel war mal sicher.
Doch auch was das anging, hatten sich die Zeiten geändert: Dieses Mädchen war tatsächlich mit ihm verabredet. Die Schelle an der Eingangstür des Lokals bimmelte, als die Klinke heruntergedrückt wurde und Isabelle Lightwood das Restaurant betrat. Sie lächelte, als sie Simon sah, marschierte schnurstracks auf ihn zu, ließ den Mantel von den Schultern gleiten und drapierte ihn zusammen mit ihrem schwarzen Seidenschal über die Stuhllehne, ehe sie sich an den Tisch setzte. Unter dem Trenchcoat trug sie eines ihrer »Typisch-Isabelle-Outfits«, wie Clary es formuliert hätte: ein enges, kurzes Samtkleid, dazu Netzstrümpfe und hohe Schnürstiefel. Aus dem Rand ihres linken Stiefels ragte das Heft eines Messers – von dem Simon aber wusste, dass nur er es sehen konnte. Dennoch schauten sämtliche Gäste zu ihnen herüber und verfolgten gespannt, wie Isabelle Platz nahm und dabei ihre Haare schwungvoll nach hinten warf. Ganz gleich was sie trug, Isabelle zog überall die Aufmerksamkeit auf sich wie ein Feuerwerk am Himmel.
Die schöne Isabelle Lightwood. Als Simon sie kennengelernt hatte, war er davon ausgegangen, dass sie an einen Jungen wie ihn keine Zeit vergeuden würde. Und damit hatte er gar nicht mal so falsch gelegen. Isabelle bevorzugte Jungs, vor denen ihre Eltern sie immer gewarnt hatten, und in ihrem Universum bedeutete das nun mal Schattenweltler – Elben, Werwölfe und Vampire. Es verwunderte Simon noch immer, dass Isabelle und er sich in den vergangenen Wochen regelmäßig gesehen hatten – auch wenn ihre Beziehung sich meist auf kurze Treffen wie dieses beschränkte und er sich nach wie vor fragte, ob sie beide sich überhaupt verabreden würden, wenn er sich nicht in einen Vampir verwandelt und damit sein ganzes Leben sich schlagartig verändert hätte.
Isabelle schob sich eine Locke hinters Ohr und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. »Du siehst gut aus.«
Simon warf einen Blick auf sein Spiegelbild in der Restaurantscheibe. Seit sie sich regelmäßig trafen, war Isabelles Einfluss auf sein Erscheinungsbild nicht zu übersehen: Sie hatte ihn genötigt, seinen Kapuzenpullover gegen eine Lederjacke zu tauschen und seine Turnschuhe gegen Designerstiefel – die, nebenbei bemerkt, dreihundert Dollar das Paar kosteten. Zwar trug er noch immer seine charakteristischen Spruch-T-Shirts (auf diesem stand Existenzialisten tun es ohne Sinn und Verstand), aber seine Jeans hatten nicht länger aufgescheuerte Knie oder Löcher in den Taschen. Außerdem hatte er sich die Haare wachsen lassen, sodass sie ihm nun in die Augen fielen und damit seine Stirn verdeckten. Aber das war eher eine Notwendigkeit gewesen als Isabelles Idee.
Clary machte sich wegen seines neuen Looks regelmäßig lustig über ihn, aber andererseits fand sie fast alles an seinem Liebesleben latent lustig. Sie konnte einfach nicht glauben, dass er sich tatsächlich ernsthaft mit Isabelle verabredete. Und natürlich konnte sie auch nicht glauben, dass er sich gleichzeitig und genauso ernsthaft mit Maia Roberts traf, einer gemeinsamen Freundin, die ganz zufällig eine Werwölfin war. Und Clary konnte erst recht nicht glauben, dass Simon weder Isabelle noch Maia von der jeweils anderen erzählt hatte.
Simon war sich nicht ganz sicher, wie er überhaupt in diese Situation geraten war. Maia kam gern zu ihm nach Hause, um gemeinsam auf der Xbox zu spielen, denn in der verlassenen Polizeiwache, die ihrem Werwolfrudel als Quartier diente, gab es keine Spielekonsolen. Aber erst nach dem dritten oder vierten Besuch hatte sie sich zu ihm herübergebeugt und ihm einen Abschiedskuss gegeben, bevor sie ging. Simon war angenehm überrascht gewesen und hatte dann Clary angerufen, um sich zu erkundigen, ob er Isabelle davon erzählen sollte.
»Klär erst mal für dich, was zwischen dir und Isabelle läuft«, hatte Clary empfohlen. »Und dann erzähl es ihr.«
Doch dieser Rat hatte sich als ziemlich schlecht erwiesen. Inzwischen war ein ganzer Monat vergangen, und er wusste noch immer nicht, was zwischen ihm und Isabelle eigentlich lief. Und deshalb hatte er geschwiegen – doch je mehr Zeit verstrich, desto unangenehmer erschien ihm der Gedanke, überhaupt etwas zu sagen. Bis jetzt war es ihm gelungen, das Ganze irgendwie zu managen. Isabelle und Maia waren nicht unbedingt die besten Freundinnen und sahen einander nur selten. Unglücklicherweise sollte sich das aber bald ändern: In ein paar Wochen würden Clarys Mutter und ihr langjähriger Freund Luke heiraten, und sowohl Isabelle als auch Maia waren zur Hochzeit eingeladen – eine Aussicht, die Simon mehr Angst einjagte als die Vorstellung, von einem wütenden Mob von Vampirjägern durch die Straßen New Yorks gehetzt zu werden.
»So«, sagte Isabelle und riss Simon aus seinen Gedanken, »warum treffen wir uns hier und nicht bei Taki’s? Da hätte man dir auf jeden Fall Blut serviert.«
Angesichts der Lautstärke ihrer Stimme zuckte Simon nervös zusammen. Isabelle war alles andere als subtil. Glücklicherweise schien niemand ihr Gespräch zu verfolgen – nicht einmal die Kellnerin, die zurückgekehrt war, Simon eine Tasse Kaffee auf den Tisch knallte, Izzy einen Blick zuwarf und ohne jedes weitere Wort wieder verschwand.
»Mir gefällt es hier«, erklärte Simon. »Clary und ich sind früher oft hierhergekommen, nach ihrem Kunstunterricht. Hier gibt’s großartigen Borschtsch und Blini – weißt du, so was wie kleine süße Pfannkuchen. Und außerdem ist das Lokal die ganze Nacht geöffnet.«
Das schien Isabelle jedoch überhaupt nicht zu interessieren. Sie starrte an ihm vorbei. »Und was ist das da?«
Simon folgte ihrem Blick. »Das ist Graf Blinula.«
»Graf Blinula?«
Simon zuckte die Achseln. »Das ist eine Halloween-Deko. Graf Blinula ist für die Kids gedacht. So ähnlich wie diese Fruchtgummi-Vampire oder Graf Zahl aus der Sesamstraße.« Als er ihren verständnislosen Blick sah, musste er grinsen. »Du weißt schon … dieser Vampir, der den Kindern das Zählen beibringt.«
Isabelle schüttelte den Kopf. »Es gibt eine Fernsehsendung, in der Kinder von einem Vampir das Zählen lernen?«
»Du würdest es verstehen, wenn du es gesehen hättest«, murmelte Simon.
»Es existiert ein mythologischer Hintergrund für eine derartige Konstruktion«, dozierte Isabelle in oberlehrerhaftem Schattenjägerton. »Manche Sagen unterstützen die These, dass Vampire einem Zählzwang unterliegen, und behaupten, wenn man Reis vor ihnen ausstreut, müssten sie sofort innehalten mit allem, was sie gerade tun, um jedes einzelne Reiskorn zu zählen. Natürlich steckt darin kein Körnchen Wahrheit, genauso wenig wie in dieser angeblichen Abwehrwirkung von Knoblauch. Kinder sollten auf keinen Fall von Vampiren unterrichtet werden: Vampire sind furchterregend.«
»Vielen Dank«, erwiderte Simon. »Das ist ein Scherz, Isabelle. Eine Puppenfigur … Graf Zahl … Der zählt halt gerne … ›Also, liebe Kinder, was hat Graf Zahl heute gegessen? Ein Schokoplätzchen, zwei Schokoplätzchen, drei Schokoplätzchen …‹«
Ein Schwall kalter Luft fegte durch das Lokal, als die Restauranttür geöffnet wurde und ein weiterer Gast den Raum betrat. Isabelle schauderte, griff nach ihrem schwarzen Seidenschal und bemerkte: »Das ist vollkommen unrealistisch.«
»Was wär dir denn lieber? ›Also, liebe Kinder, was hat Graf Zahl heute gegessen? Einen hilflosen Dorfbewohner, zwei hilflose Dorfbewohner, drei hilflose Dorfbewohner …‹«
»Psssst.« Isabelle hatte sich den Schal um den Hals gewickelt, beugte sich nun vor und legte ihre Hand auf Simons Handgelenk. Ihre großen dunklen Augen waren plötzlich zum Leben erwacht und funkelten auf eine Weise wie sonst nur bei der Jagd auf Dämonen – oder beim Gedanken an die Jagd auf Dämonen. »Sieh mal da rüber.«
Simon folgte ihrem Blick. Zwei Männer standen vor der Glasvitrine mit den frischen Backwaren – Kuchen mit dickem Zuckerguss, Teller mit Rugelach und cremegefülltes Gebäck. Allerdings sah keiner der beiden Männer so aus, als würde er sich besonders für Nahrungsmittel interessieren. Beide waren klein und erschreckend hager, so sehr, dass ihre Wangenknochen wie Messer aus den farblosen Gesichtern hervorstachen. Und beide hatten schüttere graue Haare, hellgraue Augen und trugen eng geschnürte anthrazitfarbene Mäntel, die fast bis zum Boden reichten.
»Und«, wandte Isabelle sich wieder an Simon, »für was hältst du die beiden?«
Simon musterte die Männer verstohlen. Doch sie fingen seinen Blick auf und starrten ihn aus wimpernlosen Augen an, die an leere Augenhöhlen erinnerten. »Irgendwie wirken sie auf mich wie bösartige Gartenzwerge.«
»Das sind menschliche Domestiken«, zischte Isabelle. »Sie gehören einem Vampir.«
»›Gehören‹ im Sinne von …?«
Isabelle schnaubte ungeduldig. »Beim Erzengel, du weißt aber auch gar nichts über deine Art, oder? Ist dir denn wenigstens klar, wie Vampire gemacht werden?«
»Na ja, wenn eine Vampirmama und ein Vampirpapa sich ganz doll lieb haben …«
Verächtlich verzog Isabelle das Gesicht. »Okay, du magst vielleicht wissen, dass Vampire keinen Sex brauchen, um sich fortzupflanzen, aber ich wette, du hast keine Ahnung, wie das Ganze wirklich funktioniert.«
»Klar weiß ich das«, protestierte Simon. »Ich bin ein Vampir, weil ich vor meinem Tod von Raphaels Blut getrunken habe. Das Trinken von Blut plus Tod ergibt einen Vampir.«
»Nicht ganz«, entgegnete Isabelle. »Du bist ein Vampir, weil du von Raphaels Blut getrunken hast, danach von anderen Vampiren gebissen wurdest und dann gestorben bist. Man muss irgendwann im Laufe dieses Vorgangs gebissen werden.«
»Wieso?«
»Vampirspeichel hat … bestimmte Eigenschaften. Transformative Eigenschaften.«
»Igitt«, sagte Simon.
»Komm mir nicht mit ›Igitt‹. Du bist doch derjenige mit dem magischen Speichel. Vampire halten sich immer ein paar Menschen und ernähren sich von ihnen, wenn sie mal kein Blut im Haus haben – wie wandelnde Snackautomaten.« Izzy klang angewidert. »Man sollte annehmen, dass die Opfer vom ständigen Blutverlust total geschwächt wären, aber Vampirspeichel hat auch heilende Kräfte. Der Speichel erhöht die Zahl ihrer roten Blutkörperchen, macht sie stärker und gesünder und lässt sie länger leben. Aus diesem Grund verstößt es auch nicht gegen das Gesetz, wenn Vampire sich bei Menschen bedienen. Dadurch wird ihnen ja kein richtiger Schaden zugefügt. Natürlich kommt es hin und wieder vor, dass ein Vampir mehr als nur einen Snack will und beschließt, sich einen Domestiken zuzulegen. In diesem Fall gibt er seinem gebissenen Opfer kleine Mengen seines eigenen Vampirblutes … ganz einfach, um den betreffenden Menschen fügsam zu halten und ihn an seinen Gebieter zu binden. Menschliche Domestiken beten ihre Herren und Meister an und dienen ihnen von ganzem Herzen. Sie wollen nichts anderes, als in ihrer Nähe zu sein. Genau wie du, als du zum Hotel Dumort zurückgekehrt bist – du wurdest magisch angezogen von dem Vampir, dessen Blut du getrunken hattest.«
»Raphael«, bestätigte Simon mit düsterer Stimme. »Allerdings verspüre ich dieses brennende Verlangen in letzter Zeit nicht mehr – so viel kann ich dir verraten.«
»Nein, denn das Verlangen verschwindet, wenn man sich erst einmal in einen vollwertigen Vampir verwandelt hat. Nur die Domestiken verehren ihre Gebieter und sind nicht in der Lage, ihnen den Gehorsam zu verweigern. Kapierst du das denn nicht? Als du zum Dumort zurückgekehrt bist, hat Raphaels Clan dir das Blut vollständig aus den Adern gesaugt und daraufhin bist du gestorben und hast dich in einen Vampir verwandelt. Aber wenn sie dir, statt Blut abzuzapfen, weiteres Vampirblut gegeben hätten, hättest du dich letztendlich in einen Domestiken verwandelt.«
»Das ist ja alles sehr interessant«, bemerkte Simon, »aber das erklärt noch nicht, wieso uns diese beiden Typen so anstarren.«
Isabelle warf den Männern erneut einen Blick zu. »Sie starren dich an. Vielleicht ist ja ihr Gebieter gestorben und sie suchen nach einem anderen Vampir, dem sie gehören können. Du könntest sie dir als Haustiere halten«, fügte sie grinsend hinzu.
»Vielleicht sind sie aber auch wegen der köstlichen Kartoffelpuffer hier«, meinte Simon.
»Menschliche Domestiken essen keine normalen Lebensmittel. Sie ernähren sich von einer Mischung aus Vampirblut und Tierblut. Dadurch verharren sie in einem scheintodähnlichen Zustand. Sie sind zwar nicht unsterblich, altern aber sehr, sehr langsam.«
»Dummerweise scheinen sie aber nicht in der Lage zu sein, ihr Erscheinungsbild einigermaßen zu bewahren«, kommentierte Simon nach einem weiteren Blick auf die beiden.
Im nächsten Moment setzte Isabelle sich kerzengerade. »Und sie sind auf dem Weg zu unserem Tisch. Ich schätze, gleich werden wir wissen, was sie von dir wollen.«
Die Domestiken bewegten sich, als würden sie auf Rädern rollen: Statt einzelne Schritte zurückzulegen, schienen sie geräuschlos durch den Raum zu gleiten. Innerhalb weniger Sekunden hatten sie das Restaurant durchquert, und als sie sich Simons Tisch näherten, hatte Isabelle bereits den spitzen Dolch aus ihrem linken Stiefelrand gezogen. Die stilettartige Waffe lag quer auf dem Tisch und funkelte im Schein der Neonbeleuchtung. Auf beiden Seiten des Heftes waren Kreuze in das dunkle, schwere Silber geprägt. Die meisten vampirabwehrenden Waffen schienen mit Kreuzen versehen zu sein – vermutlich in der Annahme, dass die meisten Vampire christlichen Glaubens waren, überlegte Simon. Wer hätte gedacht, dass die Zugehörigkeit zu einer religiösen Minderheit derart vorteilhaft sein konnte?
»Das ist nah genug«, sagte Isabelle, als die beiden Domestiken vor ihnen stehen blieben. Die Finger der jungen Schattenjägerin lagen scheinbar ruhig auf dem Tisch, allerdings nur Zentimeter von ihrem Dolch entfernt. »Bringt euer Anliegen vor.«
»Schattenjägerin«, wisperte die linke der beiden Gestalten in heiserem Ton, »wir wussten nicht, dass die Nephilim in diese Angelegenheit involviert sind.«
Spöttisch zog Isabelle eine ihrer feinen Augenbrauen hoch. »Und um welche Angelegenheit soll es sich dabei handeln?«
Der zweite Domestik zeigte mit einem langen grauen Finger auf Simon. Der Nagel am Ende des letzten Fingerglieds war gelblich und spitz. »Wir haben etwas Geschäftliches mit dem Tageslichtler zu besprechen.«
»Nein, habt ihr nicht«, widersprach Simon. »Ich hab keine Ahnung, wer ihr beide seid. Ich hab euch noch nie gesehen.«
»Mein Name ist Walker«, erklärte die erste Gestalt. »Und dies ist Mr Archer. Wir dienen dem mächtigsten Vampir von New York. Dem Oberhaupt des einflussreichsten Clans in ganz Manhattan.«
»Raphael Santiago«, sagte Isabelle. »Also werdet ihr auch wissen, dass Simon keinem einzigen Clan angehört. Er ist frei und ungebunden.«
Mr Walker schenkte ihr ein mattes Lächeln. »Das Oberhaupt des Clans hofft, dass sich an dieser Situation vielleicht etwas ändern ließe.«
Simons Blick traf sich mit Isabelles. Sie zuckte die Achseln. »Hatte Raphael dir nicht gesagt, er wolle, dass du dich von seinem Clan fernhältst?«
»Vielleicht hat er ja seine Meinung geändert«, überlegte Simon. »Du weißt doch, wie er ist. Launisch. Unberechenbar.«
»Woher soll ich das wissen? Seit unserer letzten Begegnung in jener Nacht, als ich gedroht habe, ihn mit einem Kerzenständer zu erschlagen, hab ich ihn nicht mehr gesehen. Er hat es allerdings sportlich genommen. Hat nicht mal mit der Wimper gezuckt.«
»Na großartig«, bemerkte Simon. Die beiden Domestiken starrten ihn weiterhin unverwandt an. Ihre blassen Augen schimmerten in einem gräulichen Weiß, wie schmutziger Schnee. »Wenn Raphael mich in seinem Clan aufnehmen möchte, dann nur, weil er irgendetwas von mir will. Ihr könnt mir also genauso gut auch gleich hier an Ort und Stelle sagen, worum es dabei geht.«
»Wir sind in die Pläne des Oberhauptes nicht eingeweiht«, erwiderte Mr Archer in leicht hochnäsigem Ton.
»Tja, das ist dann Pech«, meinte Simon. »In dem Fall muss Raphael wohl auf mich verzichten.«
»Wenn Sie uns nicht freiwillig begleiten, sind wir befugt, Sie nötigenfalls mit Gewalt zu unserem Oberhaupt zu bringen.«
Der Dolch schien wie von selbst in Isabelles Hand zu springen – zumindest hatte es den Anschein, da sie sich kaum bewegt hatte. Dennoch hielt sie die Waffe plötzlich in den Fingern und drehte sie leichthändig. »An eurer Stelle würde ich das gar nicht erst versuchen.«
Mr Archer fletschte die Zähne und knurrte: »Seit wann betätigen sich die Kinder des Erzengels als Leibwächter für entartete Schattenweltler? Ich hätte angenommen, dass so etwas unterhalb Ihres Niveaus wäre, Isabelle Lightwood.«
»Ich bin nicht sein Bodyguard«, entgegnete Isabelle. »Ich bin seine feste Freundin. Und das verleiht mir das Recht, euch die Hölle heißzumachen, wenn ihr ihm lästig fallt. Und damit basta.«
Feste Freundin? Simon war derart überrascht, dass er sie verblüfft ansah, doch Isabelle fixierte die beiden Domestiken mit einem Funkeln in den dunklen Augen. Einerseits konnte Simon sich nicht erinnern, dass Isabelle sich jemals zuvor als seine Freundin bezeichnet hatte, andererseits war dies symptomatisch dafür, wie seltsam sein Leben inzwischen verlief: Isabelles Bemerkung hatte ihn mehr aus der Bahn geworfen als die Tatsache, dass man ihn gerade zu einem Treffen mit dem mächtigsten Vampir New Yorks herbeizitieren wollte.
»Unser Oberhaupt«, setzte Mr Walker in einem Tonfall an, den er vermutlich für besänftigend hielt, »möchte dem Tageslichtler einen Vorschlag unterbreiten …«
»Sein Name ist Simon. Simon Lewis.«
»Möchte Mr Lewis einen Vorschlag unterbreiten. Ich kann Ihnen versichern: Mr Lewis wird feststellen, dass es für ihn äußerst lukrativ ist, wenn er sich bereit erklärt, uns zu begleiten und den Vorschlag unseres Oberhauptes anzuhören. Ich schwöre bei der Ehre unseres Oberhauptes, dass Ihnen kein Schaden zugefügt werden wird, Tageslichtler. Und falls Sie das Angebot unseres Oberhauptes auszuschlagen wünschen, steht Ihnen dies vollkommen frei.«
Unser Oberhaupt dies, unser Oberhaupt jenes. Mr Walker sprach diese Worte mit einer solchen Mischung aus Bewunderung und Ehrfurcht, dass Simon innerlich schauderte. Wie schrecklich, derart an jemand anderen gebunden zu sein und keinen eigenen Willen mehr zu besitzen.
Isabelle schüttelte den Kopf, sah Simon eindringlich an und formulierte mit den Lippen ein stummes »Nein«.
Vermutlich hatte sie recht, dachte Simon. Isabelle war eine hervorragende Schattenjägerin. Sie ging bereits seit ihrem zwölften Lebensjahr auf die Jagd nach Dämonen und gesetzlosen Schattenwesen – bösartigen Vampiren, Hexenmeistern, die schwarze Magie betrieben, Werwölfen, die Amok liefen und Menschen anfielen. In ihrem Metier war Isabelle wahrscheinlich besser als jeder andere Nephilim ihres Alters, mal abgesehen von ihrem Stiefbruder Jace. Und Sebastian nicht zu vergessen, überlegte Simon – Sebastian, der noch besser gewesen war als diese beiden. Aber er lebte nicht mehr.
»Also gut«, sagte er. »Ich komme mit.«
Isabelle riss die Augen auf. »Simon!«
Beide Domestiken rieben sich die Hände wie Schurken in einem Comicheft. Dabei war nicht die Geste an sich unheimlich, sondern eher die Tatsache, dass sie sich im exakt selben Moment und auf genau dieselbe Weise die Hände rieben – wie Marionetten, an deren Fäden gleichzeitig gezogen wurde.
»Ausgezeichnet«, sagte Mr Archer.
Klirrend knallte Isabelle den Dolch auf den Tisch und beugte sich vor, wobei ihre glänzenden dunklen Haare über die Tischplatte streiften. »Sei doch nicht dämlich, Simon«, wisperte sie eindringlich. »Es besteht nicht der geringste Grund, sie zu begleiten. Und außerdem ist Raphael ein Blödmann.«
»Raphael ist der Anführer eines Vampirclans«, erwiderte Simon. »Sein Blut hat mich in einen Vampir verwandelt. Er ist mein … mein … wie auch immer das genannt wird.«
»Ahnherr, Schöpfer, Erzeuger – es gibt eine Million Namen für das, was er getan hat«, erläuterte Isabelle einen Moment abgelenkt. »Und vielleicht hat ja sein Blut dich in einen Vampir verwandelt. Aber er hat dich nicht zu einem Tageslichtler gemacht.« Ihre Blicke trafen sich quer über den Tisch hinweg. Jace hat dich zu einem Tageslichtler gemacht. Doch das würde Isabelle niemals laut aussprechen; nur wenige kannten die ganze Wahrheit und wussten, wer Jace wirklich war und wieso dies Simon zu dem machte, der er war. »Du brauchst Raphael nicht zu gehorchen«, fügte Isabelle hinzu.
»Natürlich brauche ich das nicht«, erwiderte Simon mit gesenkter Stimme. »Aber was passiert, wenn ich mich jetzt weigere, ihn aufzusuchen? Glaubst du ernsthaft, Raphael wäre jemand, der das Ganze dann einfach auf sich beruhen lässt? Ganz bestimmt nicht – er wird mir weiterhin seine Leute auf den Hals hetzen.« Rasch warf er einen Blick auf die beiden Domestiken, die aussahen, als würden sie ihm beipflichten. Vielleicht bildete er sich das aber auch nur ein. »Die Clanmitglieder werden mir ständig und überall auflauern. Wenn ich abends ausgehe, in der Schule, bei Clary …«
»Na und? Denkst du, Clary könnte damit nicht umgehen?« Genervt riss Isabelle die Arme hoch. »Okay. Dann lass mich wenigstens mitkommen.«
»Vollkommen ausgeschlossen«, warf Mr Archer ein. »Das hier geht die Nephilim nichts an. Dies ist eine Angelegenheit der Nachtkinder.«
»Ich lasse nicht zu …«
»Das Gesetz gibt uns das Recht, unsere Angelegenheiten privat zu regeln«, entgegnete Mr Walker förmlich. »Unter unseresgleichen.«
Simon musterte die beiden. »Lasst uns einen Augenblick allein«, sagte er. »Ich möchte mit Isabelle unter vier Augen reden.«
Einen Moment lang herrschte Stille. Um sie herum brummte das Restaurant: Zahlreiche Besucher der Spätvorstellungen im Kinocenter am Ende der Straße waren ins Lokal geströmt, und Kellnerinnen eilten hin und her und jonglierten dampfende Teller, während die Gäste an den umliegenden Tischen lachten und redeten und die Köche hinter der Theke sich gegenseitig die Bestellungen zuriefen. Niemand schaute zu ihnen herüber oder schien irgendetwas Ungewöhnliches zu bemerken. Inzwischen war Simon zwar an die Verwendung von Zauberglanz gewöhnt, aber manchmal – insbesondere wenn er mit Isabelle zusammen war – überkam ihn das Gefühl, hinter einer unsichtbaren Glaswand gefangen zu sitzen, abgeschottet vom Rest der Menschheit und von ihrem Alltagsleben.
»Wie Sie wünschen«, sagte Mr Walker schließlich und trat einen Schritt zurück. »Aber unser Oberhaupt schätzt es nicht, wenn man es warten lässt.« Damit zogen sich die beiden Domestiken zur Eingangstür zurück und blieben dort wie Statuen wartend stehen – scheinbar unberührt von der kalten Luft, die jedes Mal hereinwehte, sobald ein Gast das Lokal betrat oder verließ.
Simon wandte sich wieder Isabelle zu. »Keine Sorge, das geht schon in Ordnung. Sie werden mir nichts tun. Sie können mir nichts tun. Raphael weiß alles über …« Verlegen deutete er auf seine Stirn. »Über das hier.«
Isabelle beugte sich über den Tisch und strich seine Haare beiseite, wobei ihre Berührung eher kühl analysierend als sanft wirkte. Skeptisch runzelte sie die Stirn.
Simon hatte das Runenmal oft genug im Spiegel betrachtet, um genau zu wissen, wie es aussah: als hätte jemand einen feinen Pinsel genommen und ihm ein schlichtes Zeichen auf die Stirn aufgetragen, knapp oberhalb der Augenbrauen. Die Konturen des Mals schienen sich manchmal zu verändern, so wie die Umrisse von Wolkenformationen, aber es war immer klar und deutlich zu erkennen: schwarz und irgendwie gefährlich, wie ein Warnschild in einer fremden Sprache.
»Und das funktioniert … wirklich?«, wisperte Isabelle.
»Raphael ist von seiner Wirkung überzeugt«, erklärte Simon. »Und ich habe keinen Grund, das Gegenteil anzunehmen.« Er umfasste ihr Handgelenk und zog es von seinem Gesicht fort. »Mir passiert schon nichts, Isabelle.«
Die junge Schattenjägerin seufzte. »Jede Phase meines langjährigen Trainings sagt mir, dass das keine gute Idee ist.«
Simon drückte sanft ihre Finger. »Komm schon. Du willst doch auch wissen, was Raphael plant, oder?«
Isabelle tätschelte seine Hand und lehnte sich zurück. »Sobald du wieder zurück bist, musst du mir haargenau erzählen, was er von dir wollte. Ruf mich sofort an.«
»Mach ich«, versprach Simon, stand dann auf und zog den Reißverschluss seiner Jacke zu. »Und könntest du mir bitte einen Gefallen tun? Zwei Gefallen, genau genommen.«
Isabelle musterte ihn leicht belustigt. »Was denn?«, fragte sie zögernd.
»Clary meinte, sie würde heute Abend im Institut trainieren. Falls du ihr also begegnest, sag ihr nicht, mit wem ich mich treffe. Sie macht sich sonst nur unnötig Sorgen.«
Isabelle rollte mit den Augen. »Okay, okay. Und was noch?«
Simon beugte sich vor und küsste sie auf die Wange. »Probier mal den Borschtsch, bevor du aufbrichst. Der ist echt klasse.«
Mr Walker und Mr Archer waren nicht die gesprächigsten Begleiter. Schweigend führten sie Simon durch die Straßen der Lower East Side, ihm immer ein paar Schritte voraus, in ihrem merkwürdig gleitenden Gang. Obwohl es inzwischen recht spät geworden war, wimmelte es auf den Gehwegen vor Passanten – New Yorker, die von der Spätschicht oder einem Restaurantbesuch nach Hause eilten, mit gesenktem Kopf, den Kragen gegen den beißend kalten Wind hochgeschlagen. Am Straßenrand von St. Mark’s Place, einem Abschnitt der Eighth Street, waren Klapptische aufgestellt, auf denen alles Mögliche zum Verkauf präsentiert wurde – von billigen Socken über Bleistiftskizzen von New York bis hin zu Räucherstäbchen. Laub raschelte über den Bürgersteig wie getrocknete Knochen. In der Luft hing eine Mixtur aus Autoabgasen und Sandelholz, unter die sich der Geruch von Menschen mischte – Haut und Blut.
Simons Magen ballte sich zusammen. Er bemühte sich, immer ein paar Flaschen Tierblut in seinem Zimmer vorrätig zu halten – in einem kleinen Kühlschrank, der gut versteckt hinter seinen Klamotten im Kleiderschrank stand, wo seine Mutter ihn nicht sehen konnte. Auf diese Weise versuchte er zu verhindern, dass ihn sein Hungergefühl vollkommen überwältigte. Aber das Blut war ekelerregend. Er hatte gedacht, er würde sich im Lauf der Zeit daran gewöhnen, vielleicht sogar danach verlangen. Doch obwohl es den schlimmsten Hunger stillte, konnte er nicht darin schwelgen, so wie er früher etwa Schokolade genossen hatte oder vegetarische Burritos oder Mokkaeis. Es war und blieb nun mal nur Blut.
Allerdings war das immer noch besser, als mit Heißhunger durch die Straßen zu laufen. Denn das bedeutete, dass er Dinge riechen konnte, die er nicht riechen wollte: Salz auf menschlicher Haut, den süßlichen Geruch von Blut, der aus den Poren der Passanten aufstieg. So wie jetzt in diesem Moment: Der Duft verstärkte seinen Hunger, und er spürte, wie sein Magen knurrte – was sich gleichzeitig vollkommen falsch anfühlte. Doch Simon kämpfte dagegen an, krümmte sich leicht nach vorn, schob die Fäuste in die Taschen seiner Jacke und versuchte, durch den Mund zu atmen.
Nach einer Weile bogen sie in die Third Avenue ein und blieben dann nach weiteren Metern vor einem Restaurant stehen, auf dessen Schild »Cloister Cafe« stand und »Garten ganzjährig geöffnet«.
Verwundert schaute Simon zu dem Schild hinauf. »Was tun wir hier?«
»Dies ist der Treffpunkt, den unser Oberhaupt ausgewählt hat«, sagte Mr Walker mit ausdrucksloser Stimme.
»Ach.« Simon war verwirrt. »Ich hätte gedacht, ein Treffen im Dachgewölbe einer ungeweihten Kathedrale oder in irgendeiner Krypta voller alter Knochen würde eher Raphaels Stil entsprechen. Bisher ist er mir nie als ein Typ für trendige Restaurants erschienen.«
Beide Domestiken starrten ihn an. »Gibt es ein Problem, Tageslichtler?«, fragte Mr Archer schließlich.
Simon hörte einen gewissen Vorwurf in seiner Frage. »Nein. Kein Problem.«
Im Inneren des Restaurants, an dessen Wand sich eine Marmortheke über die ganze Länge des Raums erstreckte, war es relativ dunkel und kein einziger Kellner näherte sich ihnen, als sie den Saal durchquerten und durch eine Tür hinaus in eine Art Biergarten traten.
Viele New Yorker Restaurants besaßen eine Gartenterrasse, aber nur wenige waren so spät im Jahr noch geöffnet. Die Terrasse des Cloister Cafe befand sich in einem Hinterhof zwischen mehreren Gebäuden, und die Mauern waren mit Wandgemälden dekoriert, die italienische Landschaften und Gärten voller prächtiger Pflanzen zeigten. In den Zweigen der Bäume, deren Blätter der Herbst bereits golden und rostbraun gefärbt hatte, hingen weiße Lichterketten, während die Terrassenheizstrahler, die zwischen den Tischen verteilt waren, einen rötlichen Schein warfen und der kleine Springbrunnen in der Mitte des Biergartens angenehm plätscherte.
Nur einer der Tische war besetzt – allerdings saß dort nicht Raphael. Eine schlanke Dame mit einem breiten Hut thronte auf einem Stuhl in der Nähe der Außenmauer. Als Simon sich verwirrt umschaute, hob sie eine Hand und winkte ihm zu. Verwundert drehte Simon sich um, um nachzusehen, ob noch jemand anderes hinter ihm stand, aber natürlich war dort niemand. Walker und Archer hatten sich inzwischen wieder in Bewegung gesetzt, und Simon folgte ihnen ratlos, während sie den Innenhof durchquerten und dann ein paar Schritte vor der Dame stehen blieben.
Walker verbeugte sich tief. »Mylady«, sagte er ehrfürchtig.
Die Dame lächelte. »Walker«, erwiderte sie. »Und Archer. Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr Simon zu mir gebracht habt.«
»Moment mal«, warf Simon ein und schaute von der Frau zu den beiden Domestiken und wieder zurück. »Sie sind nicht Raphael.«
»Du meine Güte, nein, glücklicherweise nicht.« Schwungvoll nahm die Frau ihren Hut ab, unter dem eine Fülle silberblonder Haare zum Vorschein kam, die sich über ihre Schultern ergossen und im Schein der Lichterketten hell aufleuchteten. Ihr glattes weißes, leicht ovales Gesicht wurde von riesigen hellgrünen Augen beherrscht. Sie trug eine schwarze Bluse zu einem engen Rock, lange schwarze Handschuhe und einen schwarzen Seidenschal um den Hals. Ihr Alter ließ sich unmöglich abschätzen – oder eher das Alter, in dem sie in einen Vampir verwandelt worden war. »Mein Name ist Camille Belcourt. Sehr erfreut, dich kennenzulernen«, säuselte sie nun und streckte Simon ihre schwarz behandschuhte Hand entgegen.
»Man hat mir gesagt, ich würde hier Raphael Santiago treffen«, erwiderte Simon, ohne ihre Hand zu ergreifen. »Arbeiten Sie für ihn?«
Camille Belcourt lachte hell auf; ihr Lachen klang wie das Plätschern eines Brunnens. »Ganz gewiss nicht! Allerdings hat er früher für mich gearbeitet.«
Im selben Moment erinnerte Simon sich wieder. Ich dachte, jemand anderes würde euren Clan anführen … hatte er sich gegenüber Raphael geäußert, vor nicht allzu langer Zeit in Idris – was ihm heute jedoch wie eine halbe Ewigkeit vorkam.
Camille ist noch nicht zu uns zurückgekehrt, hatte Raphael erwidert. In der Zwischenzeit bin ich ihr Stellvertreter.
»Sie sind die Anführerin des örtlichen Vampirclans«, konstatierte Simon und wandte sich dann an die beiden Domestiken. »Ihr habt mich reingelegt. Ihr habt mir gesagt, ich würde hier Raphael treffen.«
»Ich habe immer nur vom Oberhaupt des Clans gesprochen«, erwiderte Mr Walker. Seine Augen wirkten riesig und leer – so leer, dass Simon sich fragte, ob die beiden ihn wirklich absichtlich an der Nase herumgeführt hatten oder ob sie nicht schlichtweg wie Roboter darauf programmiert waren, immer nur das zu sagen, was ihr Gebieter ihnen befahl, und Unstimmigkeiten überhaupt nicht wahrnahmen. »Und das hier ist unser Oberhaupt.«
»In der Tat.« Camille schenkte ihren Domestiken ein strahlendes Lächeln. »Bitte wartet drinnen, Walker, Archer. Ich muss mit Simon sprechen … allein.« Irgendetwas an der Art und Weise, wie sie seinen Namen sagte und das Wort »allein« aussprach, ließ ihre Bemerkung in Simons Ohren wie eine heimliche Liebkosung klingen.
Die Domestiken verbeugten sich und zogen sich dann zurück. Als Mr Archer sich zum Gehen wandte, erhaschte Simon einen kurzen Blick auf ein verschwommenes Mal an seiner Kehle – ein dunkler Fleck, der fast wie graue Farbe wirkte, mit zwei schwarzen Tupfen in der Mitte. Bei den dunkleren Stellen handelte es sich um Einstiche, umgeben von trockener, rauer Haut. Simon spürte, wie er unwillkürlich erschauderte.
»Bitte«, sagte Camille und klopfte auf den Stuhl neben sich, »nimm doch Platz. Möchtest du ein Glas Wein?«
Unbehaglich ließ Simon sich auf der Kante des harten Metallstuhls nieder. »Ich trinke eigentlich keinen Alkohol.«
»Natürlich«, pflichtete Camille voller Verständnis bei. »Du bist ja beinahe noch ein Frischling, nicht wahr? Aber mach dir keine Sorgen. Im Laufe der Zeit wirst du lernen, Wein und andere Getränke zu konsumieren. Einige der ältesten Vertreter unserer Art können sogar menschliche Nahrung verzehren, ohne allzu große Nebenwirkungen befürchten zu müssen.«
Allzu große Nebenwirkungen? Dieser Gedanke gefiel Simon ganz und gar nicht. »Dauert das hier lange?«, fragte er und warf demonstrativ einen Blick auf sein Mobiltelefon, das ihm verriet, dass es bereits nach halb elf war. »Ich muss mal langsam nach Hause.«
Camille nippte an ihrem Weinglas. »Tatsächlich? Und warum?«
Weil meine Mom auf mich wartet. Okay, okay, das brauchte diese Frau ja nicht unbedingt zu wissen. »Sie haben mich mitten aus einer Verabredung gerissen«, erwiderte er. »Und ich frage mich, was wohl so wichtig gewesen ist, dass Sie mich unbedingt sofort sprechen wollten.«
»Du lebst noch bei deiner Mutter, nicht wahr?«, erkundigte Camille sich statt einer Antwort und stellte das Glas ab. »Ist es nicht ein wenig seltsam, dass ein so mächtiger Vampir wie du sich weigert, das elterliche Nest zu verlassen und sich einem Clan anzuschließen?«
»Dann haben Sie mein Date also unterbrochen, nur um sich darüber lustig zu machen, dass ich noch zu Hause wohne? Hätten Sie das nicht an einem Abend machen können, an dem ich keine Verabredung habe? Was übrigens für die meisten Abende gilt, nur falls Sie sich das gefragt haben sollten.«
»Ich mache mich nicht über dich lustig, Simon.« Camille fuhr sich mit der Zunge über die Unterlippe, als würde sie den Wein kosten, von dem sie gerade getrunken hatte. »Ich möchte lediglich gern wissen, warum du dich nicht Raphaels Clan angeschlossen hast.«
Bei dem es sich doch auch um deinen Clan handelt, oder?, fragte Simon sich, entgegnete dann aber: »Ich habe den starken Verdacht, Raphael wollte nicht, dass ich mich ihm anschließe. Genau genommen teilte er mir mit, er würde mich in Ruhe lassen, wenn ich ihm nicht in die Quere käme. Also bin ich ihm aus dem Weg gegangen.«
»Ach, wirklich.« Camilles grüne Augen leuchteten.
»Eigentlich wollte ich nie ein Vampir sein«, fügte Simon hinzu und wunderte sich über sich selbst, dass er dieser seltsamen Frau derart persönliche Dinge erzählte. »Ich habe mir immer nur ein ganz normales Leben gewünscht. Und als ich herausfand, dass ich ein Tageslichtler bin, hoffte ich, dass das immer noch möglich wäre. Oder zumindest so was Ähnliches wie ein normales Leben. Ich kann zur Schule gehen, ich kann zu Hause wohnen bleiben, mit meiner Mutter und meiner Schwester unter einem Dach leben …«
»Solange du nie in ihrer Gegenwart etwas isst«, ergänzte Camille. »Solange du dein Bedürfnis nach Blut vor ihnen verbirgst. Du hast noch nie frisches Menschenblut getrunken, oder? Immer nur abgefülltes Blut in Beuteln. Abgestandenes Blut. Tierblut.« Sie rümpfte die Nase.
Simon dachte an Jace, drängte den Gedanken aber hastig beiseite. Jace konnte man nicht exakt als Menschen bezeichnen. »Nein, das hab ich noch nicht«, beantwortete er Camilles Frage.
»Aber das wirst du eines Tages. Und wenn du erst einmal frisches Menschenblut gekostet hast, wirst du es nie wieder vergessen.« Sie beugte sich vor, und ihre hellen Haare streiften Simons Hand. »Du kannst dein wahres Ich nicht auf immer und ewig verstecken.«
»Welcher Teenager lügt denn nicht gegenüber seinen Eltern?«, konterte Simon. »Aber davon abgesehen wüsste ich nicht, was Sie das angeht. Genau genommen bin ich mir immer noch nicht im Klaren darüber, was ich hier eigentlich soll.«
Camille beugte sich weiter vor, sodass der Kragen ihrer schwarzen Seidenbluse weit aufsprang und ihr Dekolleté präsentierte. Wenn Simon noch ein Mensch gewesen wäre, wäre er in diesem Moment knallrot geworden. »Darf ich einmal einen Blick darauf werfen?«, hauchte sie.
Simon konnte förmlich spüren, wie er sie mit riesigen Stielaugen anstarrte. »Worauf einen Blick werfen?«
Camille lächelte. »Auf das Mal, natürlich, Dummerchen. Das Mal des unsteten Wanderers.«
Verblüfft öffnete Simon den Mund und schloss ihn dann wieder. Woher weiß sie davon? Nur sehr wenige Leute wussten von dem Runenmal, mit dem Clary ihn in Idris versehen hatte. Raphael hatte ihm zu verstehen gegeben, dass in dieser Angelegenheit strengste Verschwiegenheit herrschen müsse, und Simon hatte sich immer daran gehalten.
Aber Camille musterte ihn aus grünen, ruhigen Augen, und aus irgendeinem Grund war er bereit, alles zu tun, was sie von ihm verlangte. Irgendetwas in ihrem Blick, irgendetwas im Timbre ihrer Stimme veranlasste ihn dazu. Simon fasste sich an die Stirn, schob seine Haare beiseite und entblößte seine Haut, damit sie das Mal inspizieren konnte.
Im nächsten Moment weiteten sich Camilles Augen und ihre Lippen öffneten sich leicht. Dann griff sie sich flüchtig an die Kehle, als wollte sie den nicht existenten Pulsschlag überprüfen.
»Oh«, murmelte sie. »Welch eine günstige Fügung des Schicksals, Simon. Welch ein Glück.«
»Das ist ein Fluch, kein Segen, das wissen Sie doch wohl, oder?«
Camilles Augen funkelten. »›Und Kain sprach zu Jehova: Zu groß ist meine Strafe, um sie zu tragen.‹ Ist sie größer, als du ertragen kannst, Simon?«
Simon lehnte sich zurück und ließ seine Haare wieder in die Stirn fallen. »Ich kann es ertragen.«
»Aber du willst es nicht.« Camille fuhr mit einem behandschuhten Finger über den Rand ihres Weinglases, den Blick noch immer auf Simon geheftet. »Was würdest du sagen, wenn ich dir einen Weg zeige, wie du den von dir sogenannten ›Fluch‹ in einen Segen verwandeln kannst?«
Ich würde sagen: Endlich kommst du zur Sache und verrätst mir, warum du mich hierherzitiert hast, was immerhin ein Anfang ist. »Ich höre.«
»Als ich mich dir vorgestellt habe, hast du meinen Namen wiedererkannt«, setzte Camille an. »Raphael hat mich früher also schon einmal erwähnt. So ist es doch, oder?« Sie sprach mit einem Akzent, einer leicht fremdländischen Sprachfärbung, die Simon jedoch nicht zuordnen konnte.
»Er meinte, Sie seien die Anführerin des Vampirclans und er handle nur als Ihr Stellvertreter, solange Sie fort seien. Er würde sie repräsentieren wie ein … ein Vizepräsident oder so was.«
»Ah.« Camille biss sich sanft auf die Unterlippe. »Genau genommen entspricht das nicht ganz den Tatsachen. Ich würde dir gern die Wahrheit erzählen, Simon. Denn ich möchte dir gern ein Angebot unterbreiten. Aber zunächst brauche ich dein Ehrenwort.«
»Ehrenwort? Worauf?«
»Darauf, dass alles, was wir beide heute Abend hier besprechen, vertraulich bleibt. Niemand darf etwas davon erfahren. Weder deine kleine rothaarige Freundin Clary noch eine der beiden jungen Damen, mit denen du angebandelt hast. Und auch keiner der Lightwoods. Niemand.«
Simon lehnte sich zurück. »Und was ist, wenn ich das nicht versprechen will?«
»Dann steht es dir frei zu gehen«, erklärte Camille. »Allerdings wirst du dann nie erfahren, was ich dir mitteilen möchte. Und das wäre ein großes Versäumnis, welches du sehr bedauern würdest.«
»Ich bin zwar neugierig«, räumte Simon ein, »aber ich weiß nicht, ob ich wirklich so neugierig bin …«
In Camilles Augen zeichnete sich eine Spur von Überraschung und Belustigung ab – und vielleicht sogar so etwas wie Respekt, dachte Simon. »Nichts von dem, was ich dir zu sagen habe, betrifft deine Freunde. Es wird weder ihre Sicherheit noch ihr Wohlergehen gefährden. Die auferlegte Verschwiegenheit ist zu meinem eigenen Schutz.«
Simon musterte sie skeptisch. Meinte sie das ernst? Vampire waren ja nicht wie Feenwesen, die nicht lügen konnten. Andererseits musste er sich eingestehen, dass er doch ziemlich neugierig war. »Okay. Ich werde Ihr Geheimnis wahren. Es sei denn, irgendetwas von dem, was Sie mir erzählen, bringt meine Freunde in Gefahr. In dem Fall ist unsere Abmachung null und nichtig.«
Camilles Lächeln wirkte frostig. Simon konnte ihr ansehen, dass sie es nicht schätzte, wenn man ihr keinen Glauben schenkte. »Nun gut«, sagte sie. »Vermutlich bleibt mir keine andere Wahl, da ich deine Hilfe wirklich dringend benötige.« Sie beugte sich vor, und ihre schlanke Hand spielte mit dem Stiel ihres Weinglases. »Bis vor nicht allzu langer Zeit habe ich den Manhattaner Clan geleitet, und dies recht erfolgreich. Wir besaßen ein wundervolles Quartier in einem alten Vorkriegsgebäude in der Upper West Side … nicht dieses Rattenloch von einem Hotel, in dem Santiago meine Leute derzeit eingepfercht hat. Santiago – Raphael, wie du ihn nennst – war mein stellvertretender Kommandeur. Mein treuester Gefährte … zumindest hatte ich das immer angenommen. Bis ich eines Nachts herausfand, dass er Menschen umbrachte, aus purer Lust am Töten: Er trieb sie in dieses alte Hotel in Spanish Harlem, trank ihr Blut und warf ihre Knochen dann in den Müllcontainer neben dem Gebäude. Er ging unnötige Risiken ein und verstieß gegen den Bündnisvertrag.« Camille nahm einen Schluck Wein. »Als ich ihn mit diesen Fakten konfrontieren wollte, musste ich feststellen, dass er dem restlichen Clan erzählt hatte, ich sei die Mörderin, die Gesetzesbrecherin. Das Ganze war eine abgekartete Sache. Santiago wollte mich töten, um an die Macht zu gelangen. Ich konnte gerade noch fliehen, nur begleitet von Walker und Archer, die zu mir halten und meine Sicherheit gewährleisten.«
»Dann hat Raphael also die ganze Zeit nur behauptet, er würde den Clan bis zu Ihrer Rückkehr stellvertretend leiten?«
Verächtlich verzog Camille das Gesicht. »Santiago ist ein gewiefter Lügner. Er möchte durchaus, dass ich zurückkehre, so viel steht fest – damit er mich umbringen und dann den Clan offiziell übernehmen kann.«
Simon wusste nicht recht, welche Antwort Camille von ihm erwartete. Er war es nicht gewöhnt, dass erwachsene Frauen ihn mit großen, tränenerfüllten Augen ansahen oder ihm ihre Lebensgeschichte anvertrauten. »Das tut mir leid«, sagte er schließlich.
Die Vampirdame zuckte die Achseln – eine sehr expressive Geste, die in Simon die Frage weckte, ob sie vielleicht aus Frankreich stammte und demnach einen französischen Akzent besaß. »Das alles liegt lange zurück«, erklärte Camille. »Ich habe mich all die Jahre in London versteckt gehalten, nach Verbündeten gesucht, auf den rechten Augenblick gewartet. Und dann habe ich von dir gehört.« Abwehrend hielt sie eine Hand hoch. »Ich kann dir nicht sagen, woher, denn ich habe mich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Aber in dem Moment, als mir deine Geschichte zu Ohren kam, wurde mir klar, dass du derjenige bist, auf den ich all die Jahre gewartet habe.«
»Wer, ich? Tatsächlich?«
Camille beugte sich vor und berührte Simons Hand. »Santiago fürchtet sich vor dir, Simon, und das sollte er auch. Du bist zwar einer seinesgleichen, ein Vampir, aber du kannst nicht verletzt oder getötet werden. Gegen dich kann er nicht einmal einen Finger erheben, ohne den Zorn Gottes auf sich zu ziehen.«
Einen Moment lang herrschte Stille. Simon konnte das schwache elektrische Brummen der Lichterkette über ihm hören, das Plätschern des Steinbrunnens in der Mitte der Gartenterrasse und im Hintergrund das hektische Treiben der Großstadt. Dann sagte er mit leiser Stimme: »Sie haben es ausgesprochen.«
»Was meinst du, Simon?«
»Seinen Namen. Sie haben gesagt: ›den Zorn G…‹« Doch das Wort ätzte und brannte in seinem Mund, so wie jedes Mal.
»Ja. Gottes.« Camille zog ihre Hand zurück, aber ihre Augen wirkten warm und freundlich. »Unsere Art hat viele, viele Geheimnisse, die ich dir alle erzählen, dir zeigen kann. Dann wirst du auch begreifen, dass du nicht verflucht bist.«
»Ma’am …«
»Camille. Du musst mich Camille nennen.«
»Ich verstehe noch immer nicht, was Sie von mir wollen.«
»Nein, wirklich nicht?« Sie schüttelte den Kopf, und ihre leuchtenden Haare tanzten um ihr Gesicht herum. »Ich möchte, dass du dich mir anschließt, Simon. Dich mit mir gegen Santiago verbündest. Wir werden gemeinsam in sein rattenverseuchtes Hotel marschieren. In dem Moment, in dem seine Anhänger sehen, dass du an meiner Seite stehst, werden sie ihm den Rücken kehren und zu mir zurückkommen. Ich bin davon überzeugt, dass sie mir ergeben sind … trotz ihrer Furcht vor Raphael. Wenn sie uns erst einmal gemeinsam sehen, wird diese Furcht verfliegen und sie werden sich uns anschließen. Der Mensch kann sich dem Himmlischen nicht widersetzen.«
»Ich weiß nicht recht«, gab Simon zu bedenken. »In der Bibel hat Jakob mit einem Engel gerungen und gewonnen.«
Camille musterte ihn mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Religionsunterricht«, murmelte Simon achselzuckend.
»›Und Jakob gab dem Orte den Namen Peniel: Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen.‹ Wie du siehst, bist du nicht der Einzige, der die Heilige Schrift kennt.« Der skeptische Ausdruck in ihren Augen war verschwunden, und sie lächelte wieder. »Du magst dir dessen vielleicht nicht bewusst sein, Tageslichtler, aber solange du dieses Mal trägst, bist du der rächende Arm Gottes. Niemand kann sich gegen dich erheben. Und ganz gewiss kein Vampir.«
»Haben Sie denn Angst vor mir?«, fragte Simon und bereute seine Worte fast im selben Moment.
Camilles grüne Augen verdüsterten sich wie Gewitterwolken. »Ich? Angst vor dir?« Doch dann fasste sie sich wieder, ihre Gesichtszüge glätteten sich und ihre Miene hellte sich auf. »Natürlich nicht«, sagte sie. »Du bist ein intelligenter junger Mann. Ich bin fest davon überzeugt, dass du die Klugheit meines Angebotes erkennen und dich mir anschließen wirst.«
»Und wie genau lautet Ihr Angebot? Ich meine, ich verstehe zwar den Teil, wo wir gemeinsam gegen Raphael vorgehen, aber was passiert danach? Schließlich hasse ich Raphael nicht abgrundtief, und ich will ihn auch nicht einfach abservieren, nur um ihn los zu sein. Er lässt mich in Ruhe. Mehr habe ich nie gewollt.«
Camille faltete die Hände in ihrem Schoß. An ihrem linken Mittelfinger trug sie über ihrem Handschuh einen silbernen Ring mit einem blauen Edelstein. »Du denkst nur, dass du genau das willst, Simon. Du glaubst, Raphael erweist dir einen Gefallen dadurch, dass er dich in Ruhe lässt, wie du es formulierst. Doch in Wahrheit treibt er dich in die Isolation. Im Moment magst du zwar denken, dass du keine anderen Vertreter deiner Art um dich herum brauchst. Du bist zufrieden mit den Freunden, die du derzeit hast – Menschen und Schattenjäger. Und du hast dich damit arrangiert, Flaschen mit Blut in deinem Zimmer zu verstecken und deiner Mutter etwas vorzulügen.«
»Woher wissen Sie das …«
Doch Camille ignorierte seinen Einwurf und fuhr ungerührt fort: »Aber was ist in zehn Jahren, wenn du eigentlich deinen sechsundzwanzigsten Geburtstag feiern solltest? Oder in zwanzig oder dreißig Jahren? Glaubst du ernsthaft, dass niemand merken wird, wie alle um dich herum altern und sich verändern, nur du nicht?«
Simon schwieg. Er wollte Camille gegenüber nicht zugeben, dass er noch nicht so weit in die Zukunft gedacht hatte … dass er so weit gar nicht denken wollte.
»Raphael hat dir das Gefühl gegeben, dass andere Vampire Gift für dich sind. Aber so muss es nicht notwendigerweise bleiben. Die Ewigkeit ist eine sehr lange Zeit, wenn man sie allein verbringen muss, ohne andere seiner Art – andere, die dich verstehen. Du bist mit den Schattenjägern befreundet, aber du kannst niemals einer der ihren werden. Du wirst immer anders sein, immer ein Außenseiter bleiben. Aber bei uns könntest du dazugehören.« Als die Vampirdame sich erneut vorbeugte, funkelte ihr Ring in einem grellen Licht, das Simon in den Augen stach. »Wir verfügen über jahrtausendealtes Wissen, das wir mit dir teilen könnten, Simon. Du könntest lernen, wie du deine wahre Identität vor anderen verborgen hältst oder wie du normal essen und trinken und den Namen Gottes aussprechen kannst. Raphael hat dieses Wissen grausamerweise vor dir geheim gehalten und dich sogar glauben gemacht, dass dies alles nicht existiert, nicht möglich ist. Aber es ist möglich. Und ich kann dir dabei helfen.«
»Wenn ich zuerst Ihnen helfe«, erwiderte Simon.
Camille lächelte, sodass ihre spitzen weißen Zähne zum Vorschein kamen. »Wir werden uns gegenseitig helfen.«
Langsam lehnte Simon sich zurück. Der Eisenstuhl war hart und unbequem, und plötzlich fühlte er sich sehr müde. Als er einen Blick auf seine Hände warf, konnte er die Adern in einem dunklen Ton durch die Haut schimmern sehen, wie ein Spinnennetz, das sich über seine Knöchel erstreckte. Er benötigte dringend Blut. Außerdem musste er unbedingt mit Clary reden – und er brauchte Zeit zum Nachdenken.
»Ich habe dich schockiert«, fuhr Camille nun fort. »Ich weiß … es ist ziemlich viel auf einmal. Und ich würde dir liebend gern Zeit zum Nachdenken geben … so viel Zeit, wie du brauchst, um das alles zu verdauen und dir ein Urteil zu bilden. Aber so viel Zeit haben wir nicht, Simon. Solange ich mich in dieser Stadt aufhalte, schwebe ich in ständiger Gefahr, dass Raphael und seine Kohorten mir auflauern.«
»Kohorten?« Trotz der ganzen Umstände musste Simon leicht grinsen.
Camille wirkte verwirrt. »Ja. Und?«
»Na ja, dieses Wort … ›Kohorte‹, das klingt genauso, als würde man ›Missetäter‹ sagen oder ›Lakai‹.«
Die Vampirdame starrte ihn verständnislos an.
Simon seufzte. »’tschuldigung. Wahrscheinlich haben Sie nicht annähernd so viele schlechte Filme gesehen wie ich.«
Camille runzelte leicht die Stirn, und zwischen ihren Augenbrauen zeichnete sich eine sehr feine Linie ab. »Man hat mir zwar gesagt, dass du ein wenig eigenartig wärst … Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich nicht viele Vampire deiner Generation kenne. Allerdings habe ich den Eindruck, es wird mir guttun, Umgang mit jemandem zu pflegen, der so … jung ist.«
»Frisches Blut«, sagte Simon.
Bei dieser Bemerkung musste Camille lächeln. »Dann bist du also bereit? Gewillt, mein Angebot anzunehmen? Und mit mir zusammenzuarbeiten?«
Unentschlossen schaute Simon hinauf zum Nachthimmel. Die weiße Lichterkette schien sämtliche Sterne zu überstrahlen. »Ich … ich weiß Ihr Angebot zu schätzen«, sagte er nach einer Weile, »ganz ehrlich.« So ein Mist, dachte er. Es musste doch irgendeinen anderen Weg geben, das zu formulieren, ohne gleich wie jemand zu klingen, der eine Einladung zum Abschlussball ablehnt: Ich fühle mich wirklich geschmeichelt, aber … Dann kam ihm ein anderer Gedanke: Genau wie Raphael sprach auch Camille sehr förmlich und steif, als befände sie sich in einem Märchen. Vielleicht könnte er das ja mal versuchen … »Ich benötige etwas Zeit, um eine Entscheidung zu treffen«, setzte er an. »Das werden Sie doch gewiss verstehen.«
Ein feines Lächeln umspielte Camilles Lippen, das nur die Spitzen ihrer Fangzähne zum Vorschein kommen ließ. »Du hast fünf Tage und keine Minute länger«, erwiderte sie und hielt ihm ihre behandschuhte Hand entgegen, in der irgendetwas schimmerte: eine kleine Glasphiole, etwa von der Größe eines Parfümpröbchens. Allerdings schien das Glasröhrchen ein dunkelbraunes Pulver zu enthalten. »Graberde«, erklärte Camille. »Wenn du die Phiole zerbrichst, werde ich wissen, dass du mich zu sprechen wünschst. Falls ich innerhalb der nächsten fünf Tage nichts von dir höre, werde ich Walker aussenden, um deine Antwort einzuholen.«
Simon nahm das Glasröhrchen entgegen und steckte es in seine Jackentasche. »Und wenn meine Antwort Nein lautet?«, fragte er.
»Das würde mich sehr enttäuschen. Aber wir würden als Freunde scheiden«, verkündete sie und schob dann ihr Weinglas von sich fort. »Auf Wiedersehen, Simon.«
Als Simon sich erhob, erzeugte der Metallstuhl ein quietschendes Geräusch auf den Steinplatten, ein zu lautes Schleifen … Simon hatte das Gefühl, als müsste er noch irgendetwas sagen, aber er hatte keine Ahnung, was. Einstweilen schien er jedoch entlassen zu sein. Er beschloss, sich lieber wie einer dieser merkwürdigen modernen Vampire mit schlechten Manieren zu verhalten, als das Risiko einzugehen, erneut in ein Gespräch verwickelt zu werden. Also machte er ohne ein weiteres Wort auf dem Absatz kehrt.
Auf seinem Weg durch das Restaurant kam er an Walker und Archer vorbei, die in ihren langen grauen Mänteln und mit hängenden Schultern in der Nähe der wuchtigen Marmortheke warteten. Er spürte, wie sie ihn anstarrten, und winkte ihnen im Vorbeigehen kurz mit den Fingern zu – eine Mischung aus einer freundlichen Abschiedsgeste und einer Abfuhr. Archer fletschte die Zähne – stumpfe, menschliche Zähne – und marschierte dann in Richtung Gartenterrasse, dicht gefolgt von Walker. Simon sah, wie sie sich auf den Stühlen gegenüber von Camille niederließen, die allerdings nicht aufschaute, als die beiden Platz nahmen. Doch im nächsten Moment erloschen die weißen Lichterketten, die den Garten beleuchtet hatten, schlagartig – nicht einzeln, sondern alle gleichzeitig, sodass Simon auf eine vor seinen Augen verschwimmende dunkle Fläche starrte, als hätte jemand die Sterne ausgeschaltet. Und als die Kellner den Schaden bemerkten und nach draußen eilten, um das Problem zu beheben und die Terrasse wieder in sanftweißes Licht zu tauchen, waren Camille und ihre menschlichen Domestiken in der Dunkelheit verschwunden.
Simon schloss die Tür zu seinem Elternhaus auf – einem jener identisch aussehenden Reihenhäuser mit den Ziegelsteinfassaden, die typisch für sein Viertel in Brooklyn waren – und drückte sie einen Spalt auf, wobei er angestrengt lauschte.
Er hatte seiner Mutter erzählt, er würde bei Eric mit den anderen Bandmitgliedern für den Auftritt am Samstag proben. Und es hatte einmal eine Zeit gegeben, wo sie ihm einfach geglaubt hatte, ohne jede Nachfrage. Elaine Lewis war als Mutter immer ziemlich entspannt gewesen und hatte weder Simon noch seiner Schwester irgendwelche Vorschriften gemacht, auch nicht, wenn es darum ging, wann sie abends zu Hause sein sollten, nicht einmal an ganz normalen Schultagen. Simon war daran gewöhnt, bis spätnachts bei Clary zu bleiben, um dann gegen zwei Uhr morgens leise nach Hause zu kommen und in sein Bett zu fallen – ein Verhalten, das seiner Mutter früher nur selten einen Kommentar entlockt hatte.
Aber inzwischen sah die Sache völlig anders aus. Er war fast zwei Wochen lang in Idris gewesen, dem Heimatland aller Schattenjäger, und einfach von zu Hause verschwunden, ohne jede Möglichkeit zu einer Entschuldigung oder Erklärung. Im Anschluss hatte der Hexenmeister Magnus Bane eingreifen und Simons Mutter mit einem Amnesiezauber belegen müssen, sodass sie sich nun nicht mehr daran erinnern konnte, dass Simon überhaupt fort gewesen war. Oder zumindest nicht bewusst daran erinnerte. Allerdings hatte sich ihr Verhalten verändert. In den vergangenen Wochen war sie irgendwie argwöhnisch geworden – sie wich ihm kaum von der Seite, beobachtete ihn ständig und bestand darauf, dass er um eine bestimmte Uhrzeit zu Hause zu sein hatte. Als er beim letzten Mal von einem Date mit Maia spät heimgekehrt war, hatte er Elaine wartend in einem Sessel im Flur vorgefunden, die Arme über der Brust verschränkt und mit einem Ausdruck mühsam beherrschter Wut in den Augen.
An jenem Abend hatte er ihre Atmung wahrgenommen, noch bevor er sie gesehen hatte. Doch jetzt hörte er nur das dumpfe Geräusch des eingeschalteten Fernsehers, das aus dem Wohnzimmer in den Flur drang. Seine Mutter musste auf ihn gewartet haben, während sie wahrscheinlich etliche Folgen ihrer Lieblings-Krankenhausserie geguckt hatte. Leise drückte Simon die Haustür hinter sich ins Schloss und lehnte sich dagegen, um Kraft für eine weitere Lüge zu sammeln.
Es war schon schlimm genug, dass er in Gegenwart seiner Familie nichts essen konnte. Glücklicherweise fuhr seine Mutter frühmorgens zur Arbeit und kehrte oft erst spät zurück, und seine Schwester Rebecca, die in New Jersey aufs College ging und nur gelegentlich zu Hause aufkreuzte, um ihre Wäsche zu waschen, war zu selten da, um irgendetwas zu bemerken. Wenn Simon am Morgen aufstand, war seine Mutter meist schon aus der Tür und das liebevoll zubereitete Frühstück und das Mittagessen standen auf der Küchentheke. Beides entsorgte er auf dem Weg zur Schule in irgendeinem Müllcontainer. Dagegen gestaltete sich das Abendessen sehr viel schwieriger. Wenn seine Mutter zu Hause war, schob er das Essen lustlos auf dem Teller hin und her und behauptete, er hätte keinen Hunger. Oder er verkündete, er wolle den Teller mit auf sein Zimmer nehmen und beim Lernen essen. Ein- oder zweimal hatte er sogar ein paar Bissen heruntergewürgt, nur um seine Mutter glücklich zu machen, aber danach hatte er Stunden schwitzend und würgend im Bad verbracht, bis auch der letzte Rest des Abendessens wieder aus seinem Körper heraus war.
Simon hasste es, dass er seine Mutter belügen musste. Früher hatte er immer Mitleid mit Clary gehabt, wegen ihres angespannten Verhältnisses zu Jocelyn, der überängstlichsten Mutter, die er kannte. Doch inzwischen war es genau umgekehrt: Seit Valentins Tod hatte sich Jocelyns restriktive Haltung gegenüber Clary so weit gelockert, dass man sie fast schon als normale Mutter bezeichnen konnte. Dagegen spürte Simon nun jedes Mal den schweren Blick seiner Mutter auf sich lasten, wie ein unausgesprochener Vorwurf, der ständig im Raum stand.
Entschlossen straffte er nun die Schultern, legte seine Kuriertasche neben der Haustür ab und ging ins Wohnzimmer, um sich die zu erwartende Gardinenpredigt anzuhören. Der Fernseher war auf den Nachrichtensender eingestellt, und der Moderator berichtete gerade von einer ergreifenden Lokalstory – in einer Gasse hinter einem Krankenhaus in der Innenstadt hatte man einen ausgesetzten Säugling gefunden. Simon war überrascht: Normalerweise hasste seine Mom Nachrichtensendungen, weil sie sie deprimierend fand. Doch als er einen Blick auf das Sofa warf, war ihm sofort alles klar. Seine Mutter schlief tief und fest; ihre Brille lag auf dem Couchtisch, und auf dem Boden stand ein halb leeres Glas. Simon konnte den Geruch bereits aus der Entfernung wahrnehmen – vermutlich Whisky – und verspürte einen heißen Stich. Seine Mutter trank so gut wie nie Alkohol.
Leise ging er in ihr Schlafzimmer und kehrte mit einer Häkeldecke zurück. Seine Mom schlief noch immer; ihr Atem ging ruhig und gleichmäßig. Elaine Lewis war eine kleine, vogelartige Frau mit einer Fülle schwarzer Locken, zwischen denen die ersten grauen Strähnen leuchteten. Aber sie weigerte sich, ihre Haare zu färben. Sie arbeitete für eine gemeinnützige Umweltorganisation, und die meisten ihrer Kleidungsstücke waren mit Tiermotiven dieser Organisation versehen – so wie das mit Delfinen und Wellen bedruckte Batikkleid, das sie in diesem Moment trug, und die Anstecknadel, gefertigt aus einem in Bernstein konservierten, kleinen Fisch. Dessen lackiertes Auge schien Simon vorwurfsvoll anzustarren, als er sich zu seiner Mutter hinabbeugte, um ihr die Decke bis über die Schultern zu ziehen.
Im selben Augenblick bewegte sie sich unruhig und drehte den Kopf von ihm fort. »Simon«, wisperte sie. »Simon, wo bist du?«
Bestürzt ließ Simon die Decke los und richtete sich auf. Vielleicht sollte er sie wecken, damit sie sich nicht länger Sorgen machte. Aber dann würden wieder all die Fragen folgen, die er nicht beantworten wollte, und dieser gekränkte Ausdruck auf ihrem Gesicht erscheinen, den er nicht ertragen konnte. Leise wandte er sich ab und ging in sein Zimmer.