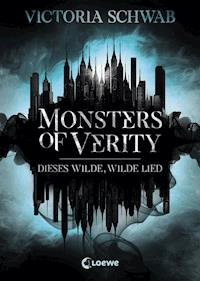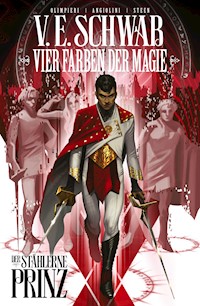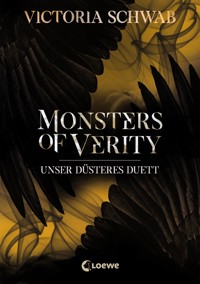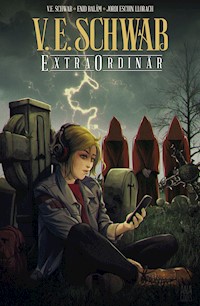9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die City of Ghosts-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Dunkle Tunnel, mysteriöse Unfälle, eine Stadt voller Geister
Cassidy Blake (und ihrem Geisterfreund Jacob) bleibt keine Zeit, sich von den Ereignissen in Edinburgh zu erholen, denn die Geister-Fernsehshow ihrer Eltern führt sie direkt zum nächsten Drehort: nach Paris.
Klar macht es Spaß, Croissants zu essen und den Eiffelturm zu erklimmen, doch tief unter der Stadt wartet in den Katakomben auf Cassidy eine besonders unheimliche Gefahr. Cassidy muss auf ihre noch wachsenden Fähigkeiten als Geisterjägerin vertrauen, um mit Hilfe von alten und neuen Freunden ein schauriges Geheimnis zu lüften und die Stadt vor dem gefährlichen Geist zu retten.
Alle Bände der City-of-Ghosts-Reihe:
Die Geister, die mich riefen
Im Reich der vergessenen Geister
Der Bote aus der Dunkelheit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Ähnliche
Autorin
Victoria Schwab hat ihre Leidenschaft schon früh zum Beruf gemacht und ihre Romane stehen seitdem regelmäßig auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Wenn sie nicht gerade durch die Straßen von Paris schlendert oder sich in einem Café in Edinburgh neue Monster ausdenkt, lebt sie in Nashville, Tennessee.
Übersetzerin
Tanja Ohlsen studierte klassische Archäologie und Anglistik in Heidelberg und Berlin. Neben ihrer Tätigkeit auf verschiedenen Ausgrabungen machte sie ihre staatliche Übersetzerprüfung im Fachgebiet Geisteswissenschaften und hat mittlerweile über 150 Titel aus dem Englischen, Norwegischen und Dänischen übersetzt. Wenn sie nicht gerade übersetzt, unternimmt sie mit Vorliebe lange Expeditionen mit dem Seekajak an der norwegischen Küste.
Mehr über cbj auf Instagram unter @cbjverlag
Victoria Schwab
Im Reich der vergessenen Geister
Aus dem Englischenvon Tanja Ohlsen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2019 by Victoria Schwab
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Tunnel of Bones« bei Scholastic Press, an imprint of Scholastic Inc.
Published in agreement with the author, c/o BARORINTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A.
© 2021 für die deutschsprachige Ausgabe bei
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem Englischen von Tanja Ohlsen
Lektorat: Michelle Landau
Karte von Paris: © 2019 Maxime Plasse
Coverillustration und – gestaltung: Melanie Korte
mk · Herstellung: BO
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-25371-4V002
www.cbj-verlag.de
Für meine Familie, die manchmal weit weg, mir aber immer nah ist.
»Die Vergangenheit ist ein hartnäckiges Gespenst, das bei jeder Gelegenheit herumgeistert.«
TEIL EINS
Die Stadt der Lichter
Kapitel 1
Ratternd fährt der Zug unter der Stadt hindurch.
An den Fenstern huschen Schatten vorbei, kaum mehr als verwischte Bewegungen, die beinahe mit dem Dunkel dahinter verschmelzen. Ich spüre das Wabern des Schleiers und das Pulsieren der Geister um mich herum.
»Was für ein angenehmer Gedanke«, sagt mein bester Freund Jacob und schiebt die Hände in die Hosentaschen.
»Angsthase«, flüstere ich zurück. Als würde mich die Gegenwart so vieler Geister nicht beeindrucken.
Mein Kater Grim sieht mich aus dem Katzenkorb auf meinem Schoß heraus an und seine grünen Augen drohen mir mit Rache für seine derzeitige Gefangenschaft. Mum und Dad sitzen uns mit ihrem Gepäck gegenüber. Über ihren Köpfen prangt eine Karte der U-Bahn, aber für mich sind das nur ein Haufen verworrener bunter Linien, die eher ein Labyrinth darstellen als eine hilfreiche Karte. Ich war mal mit meinen Eltern in New York City, wo wir jeden Tag U-Bahn gefahren sind. Trotzdem wusste ich nie, wohin wir fuhren.
Und das, obwohl damals alles auf Englisch war.
Jacob sitzt neben mir und lehnt sich an die Wand. Ich sehe wieder aus dem Fenster und betrachte mein Spiegelbild in der Scheibe: strubbeliges braunes Haar, braune Augen, ein rundes Gesicht und eine altmodische Kamera um meinen Hals. Aber der Platz neben mir, auf dem Jacob sitzen sollte, ist leer.
Vielleicht sollte ich das erklären. Jacob ist, wie er es selbst ausdrückt, »körperlich eingeschränkt«. Im Grunde ist er ein Geist. Außer mir kann ihn keiner sehen. (Außer mir und einem Mädchen namens Lara, die wir vor Kurzem kennen gelernt haben. Aber das liegt daran, dass sie genauso ist wie ich – oder ich wie sie – jemand, der die Grenze zwischen Leben und Tod überschritten hat und zurückgekehrt ist.) Wenn diese toter-bester-Freund-Sache komisch klingt, dann liegt das daran, dass es so ist. Aber das ist nicht mal das Merkwürdigste in meinem Leben.
Mein Name ist Cassidy Blake und vor einem Jahr wäre ich beinahe ertrunken. Jacob hat mich gerettet, und seitdem kann ich durch den Schleier gehen, an einen Ort voller Geister und ruheloser Toter. Es ist meine Aufgabe, sie weiterzuschicken.
Jacob verzieht das Gesicht. »Lara behauptet, dass das deine Aufgabe ist.«
Ich habe vergessen, zu erwähnen, dass Jacob meine Gedanken lesen kann. So was kann passieren, wenn ein Geist einen Menschen von der Schwelle des Todes zurückholt – da gerät wohl einiges durcheinander. Und als wäre es nicht schon schräg genug, von einem gedankenlesenden toten Jungen heimgesucht zu werden, sitzen wir nur in diesem Zug, weil meine Eltern eine Reality-TV-Sendung über die größten Geisterstädte der Welt drehen.
Siehst du?
Die Tatsache, dass Jacob ein Geist ist, wirkt langsam schon fast normal, oder?
»Paranormal«, bemerkt er mit einem schiefen Grinsen.
Ich verdrehe die Augen, während der Zug langsamer wird und über den Lautsprecher die Station angesagt wird.
»Concorde.«
»Wir sind da«, erklärt Mum und springt auf.
Der Zug hält an, wir steigen aus und kämpfen uns durch die Menschenmenge. Ich bin froh, dass Dad mir Grims Katzenkorb abnimmt – dieser Kater ist schwerer, als er aussieht –, bevor wir unsere Koffer die Treppe hinaufhieven.
Oben auf der Straße bleibe ich stehen, weil mir die Luft wegbleibt. Nicht wegen der Treppe, sondern wegen des Anblicks, der sich mir bietet. Wir stehen auf einem riesigen Platz. Kreisrund, umgeben von hellen steinernen Gebäuden, die im Licht des späten Nachmittags leuchten. Überall blinken Goldverzierungen, an den Fußweggeländern, Straßenlaternen, an Springbrunnen und Balkonen. Und dahinter ragt der Eiffelturm wie ein stählerner Speer in den Himmel.
Mum breitet die Arme aus, als könne sie die ganze Stadt umarmen.
»Willkommen in Paris!«
Man sollte meinen, eine Stadt ist eine Stadt ist eine Stadt.
Falsch gedacht. Wir sind aus Edinburgh in Schottland hierhergekommen, aus einem Nest schwerer Steine und enger Straßen, wo man immer das Gefühl hat, im Schatten zu stehen.
Aber Paris?
Paris ist weitläufig, elegant und hell.
Jetzt, wo wir wieder über der Erde sind, hat das Pochen der Geister nachgelassen und der Schleier ist nur noch der Hauch einer Berührung, ein graues Flackern am Rand meines Blickfeldes. Vielleicht ist Paris nicht ganz so sehr von Geistern heimgesucht wie Edinburgh. Vielleicht …
Aber wenn das so wäre, wären wir nicht hier.
Meine Eltern sind nicht auf der Spur von Märchen.
Sie sind Geistergeschichten auf der Spur.
»Hier entlang«, sagt Dad, und wir folgen einer breiten Straße, der Rue de Rivoli, die auf der einen Seite von teuren Geschäften und auf der anderen von Bäumen gesäumt ist.
Menschen in schicken Anzügen und hochhackigen Schuhen hasten an uns vorbei. An einer Wand lehnen zwei Teenager: Der Junge hat die Hände in die Hosen seiner schwarzen Skinny Jeans gesteckt und das Mädchen trägt eine Seidenbluse mit einer Schleife am Hals. Sie sieht aus, als wäre sie einem Modemagazin entsprungen. Wir kommen an einem Mädchen mit glitzernden Ballerinas vorbei und ein Junge in einem gestreiften Polohemd führt einen Pudel spazieren. Hier sind sogar die Hunde perfekt gestylt und frisiert.
Ich sehe an mir selbst hinunter und komme mir in meinem lila T-Shirt, meiner grauen Stretchhose und meinen Turnschuhen plötzlich völlig underdressed vor.
Jacob sieht immer gleich aus: Sein blondes Haar ist immer verstrubbelt, sein Superhelden-T-Shirt immer zerknittert, seine dunklen Jeans an den Knien verschlissen und seine Schuhe so abgenutzt, dass ich nicht mehr erkennen kann, welche Farbe sie mal hatten.
Jacob zuckt mit den Achseln und meint unbekümmert: »Mir reicht das.«
Aber es ist leicht, sich nicht darum zu kümmern, was die anderen von einem halten, wenn sie einen nicht sehen können.
Ich hebe die Kamera und betrachte den Pariser Gehweg durch den gesprungenen Sucher. Die Kamera ist ein altes Analoggerät mit einem Schwarz-Weiß-Film. Sie war schon alt, bevor sie zusammen mit mir in einem eiskalten Fluss gelandet ist, zu Hause, nördlich von New York. Und in Schottland wurde sie dann gegen einen Grabstein geworfen, woraufhin die Linse zersplittert ist. Eine nette Frau in einem Fotogeschäft hat mir eine Ersatzlinse gegeben, aber die hat mitten auf dem Glas eine Schliere wie einen Daumenabdruck – ein weiterer Mangel auf der Liste.
Aber was diese Kamera so besonders macht, ist, wie sie hinter dem Schleier funktioniert: Sie fängt einen Teil der anderen Seite ein. Sie sieht dort nicht ganz so gut wie ich, aber auf jeden Fall mehr als sie sollte. Einen Schatten der Schattenwelt.
Ich lasse die Kamera sinken, als das Handy in meiner Tasche piept.
Es ist eine Nachricht von Lara.
Lara Chowdhury habe ich in Edinburgh kennengelernt. Wir sind etwa gleich alt, aber man könnte gut sagen, dass sie mir in der Geisterjäger-Branche um Jahre voraus ist. Sie hat das Glück, dass sie ihre Sommerferien mit dem Geist ihres toten Onkels verbringen kann, der zufällig alles über das Übernatürliche weiß – oder wusste. Er war kein »Zwischenweltler« – wie Lara Leute wie uns nennt –, sondern nur ein Mann mit einer großen Bibliothek und einem morbiden Hobby.
Lara: Steckst du schon in Schwierigkeiten?
Ich: Definiere Schwierigkeiten.
Lara: Cassidy Blake.
Ich kann den genervten Ton in ihrem geschniegelten englischen Akzent förmlich hören.
Ich: Ich bin gerade erst angekommen. Vertrau mir ein bisschen.
Lara: Das ist keine Antwort.
Ich hebe das Telefon, grinse dämlich und mache ein Foto von mir mit erhobenem Daumen auf der belebten Straße. Jacob ist auch im Bildausschnitt, aber auf dem Foto sieht man ihn natürlich nicht.
Ich: Schönen Gruß von Jacob und mir.
»Von dir vielleicht«, grummelt er, als er die Nachricht über meine Schulter liest. »Ich habe ihr nichts zu sagen.«
Wie aufs Stichwort kommt Laras Antwort.
Lara: Sag dem Geist, er soll weiterziehen.
»Ah, wir sind da«, verkündet Mum und nickt zu einem Hotel direkt vor uns. Ich stecke das Telefon wieder ein und sehe hoch.
Der Eingang ist reich verziert. Glas mit Facettenschliff, ein Teppich auf dem Gehweg und eine Markise mit dem Namen: Hotel Valeur. Ein Mann im Anzug hält uns die Tür auf, als wir eintreten.
Es gibt Orte, da schreien einen die Geister geradezu an … aber dieser hier gehört nicht dazu.
Wir betreten eine große, glänzende Lobby aus Marmor und Gold. Es gibt Säulen, Blumensträuße und einen silbernen Teewagen voller Porzellantassen. Ich komme mir vor wie in einem eleganten Geschäft. Und wir – Eltern, ein Mädchen, ein Kater und ein Geist – scheinen hier alle offensichtlich und vollkommen fehl am Platz zu sein.
»Bienvenue«, sagt die Frau an der Rezeption und lässt ihren Blick skeptisch von uns zu unserem Gepäck und dem schwarzen Kater in seinem Katzenkorb schweifen.
»Hallo!«, erwidert Mum fröhlich und die Frau schaltet auf Englisch um.
»Willkommen im Hotel Valeur. Waren Sie schon einmal hier?«
»Nein«, antwortet Dad. »Wir sind das erste Mal in Paris.«
»Oh!« Die Frau zieht eine dunkle Braue hoch. »Was führt Sie denn in unsere Stadt?«
»Wir sind geschäftlich hier«, erklärt Dad, doch im gleichen Augenblick sagt Mum: »Wir drehen eine Fernsehshow.«
Die Laune der Empfangsdame schlägt um und sie verzieht missbilligend den Mund.
»Ach ja«, sagt sie, »Sie sind bestimmt die … Geisterjäger.« Die Art wie sie das sagt, lässt mich rot anlaufen, und mein Magen zieht sich zusammen.
Jacob lässt die Fingerknöchel knacken. »Ich sehe, wir haben hier eine Skeptikerin.«
Noch vor einem Monat hätte er nicht einmal eine Scheibe beschlagen lassen können. Jetzt sieht er sich nach etwas um, das er kaputt machen kann, und entdeckt schließlich den Teewagen. Ich werfe ihm einen warnenden Blick zu und sage lautlos: Nicht!
In meinem Kopf hallen Laras Worte wider.
Geister gehören nicht in das Dazwischen und schon gar nicht auf diese Seite.
Je länger er bleibt, desto stärker wird er.
»Wir sind Forscher des Paranormalen«, korrigiert Mum die Dame.
Die rümpft die Nase. »Ich denke nicht, dass Sie hier so etwas finden«, behauptet sie und tippt mit ihren perfekt manikürten Fingernägeln auf der Tastatur herum. »Paris ist eine Stadt der Kunst, der Kultur und der Geschichte.«
»Nun«, beginnt Dad, »ich bin Historiker und …«
Doch Mum legt ihm die Hand auf den Arm, als wolle sie sagen: Es lohnt sich nicht, darüber zu diskutieren.
Die Frau gibt uns unsere Schlüssel. In dem Moment schafft Jacob es, den Teewagen anzuschubsen, sodass eine Tasse über den Rand fällt. Ich kann sie gerade noch auffangen.
»Böser Geist!«, schelte ich.
»Spielverderber«, mault Jacob, als wir meinen Eltern nach oben folgen.
In Schottland haben die Leute über Geister gesprochen, wie von einer schrulligen Tante oder einem seltsamen Kind in der Nachbarschaft. Ungewöhnlich, ja, aber zweifellos vorhanden. In Edinburgh spuken an jeder Ecke Geister herum, von der Burg bis in die dunklen Höhlen. Selbst das Lane’s End, das nette kleine Bed&Breakfast, in dem wir gewohnt haben, hatte seinen eigenen Geist.
Aber hier im Hotel Valeur gibt es keine dunklen Ecken und keine ominösen Geräusche.
Nicht mal die Zimmertür quietscht, als wir sie aufmachen.
Wir bewohnen eine Suite mit je einem Schlafzimmer zu jeder Seite eines eleganten Wohnzimmers. Alles ist frisch, sauber und neu.
Entsetzt sieht Jacob mich an. »Das ist ja fast, als wünschst du dir, dass es spukt.«
»Nein«, gebe ich zurück. »Es ist nur … seltsam, dass es nicht spukt.«
Dad muss mich gehört haben, denn er fragt: »Was hält Jacob von unserer neuen Behausung?«
Ich verdrehe die Augen.
Es ist praktisch, einen Geist zum Freund zu haben. Ich kann ihn mit ins Kino schmuggeln, muss meine Süßigkeiten nicht mit ihm teilen und bin nie wirklich einsam. Natürlich muss man einige Grundregeln aufstellen, wenn der beste Freund nicht den Gesetzen der Körperlichkeit unterworfen ist. Kein absichtliches Erschrecken. Kein Durchqueren geschlossener Schlaf- oder Badezimmertüren. Kein plötzliches Verschwinden mitten in einem Streit.
Aber es gibt auch Nachteile. Es ist zum Beispiel immer unangenehm, wenn man bei »Selbstgesprächen« erwischt wird. Aber das Schlimmste ist, dass Dad Jacob für meinen imaginären Freund hält – eine Art präpubertären Bewältigungsmechanismus.
»Jacob befürchtet, dass er hier der einzige Geist ist.«
»Leg mir keine Worte in den Mund!« Jacob sieht mich böse an.
Ich lasse Grim frei, der sich sofort aufs Sofa verzieht und sein Missfallen kundtut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er uns für seine Gefangenschaft verflucht, aber vielleicht hat er auch einfach nur Hunger.
Mum schüttet ihm etwas Trockenfutter in eine Schale, Dad fängt an auszupacken und ich bringe meine Sachen in das kleinere der beiden Schlafzimmer. Als ich wieder herauskomme, hat Mum ein Fenster aufgemacht, lehnt sich über das schmiedeeiserne Geländer und atmet tief durch.
»Was für ein wundervoller Abend«, sagt sie und winkt mich zu sich. Die Sonne ist bereits untergegangen und der Himmel ist von Rosa-, Violett und Orangetönen durchzogen. Paris erstreckt sich in alle Himmelsrichtungen. Die Rue de Rivoli ist immer noch voller Menschen und aus dieser Höhe kann ich hinter den Bäumen eine große Grünanlage erkennen.
»Das«, erklärt Mum, »sind die Tuilerien. Das ist ein Jardin – ein Park, könnte man sagen.«
Hinter dem Garten fließt ein breiter Fluss, von dem Mum sagt, dass er Seine heißt, und dahinter erhebt sich eine Wand aus hellen Gebäuden, die alle sehr prunkvoll und sehr hübsch aussehen. Doch je länger ich mir Paris ansehe, desto mehr wundere ich mich.
»He, Mum«, frage ich. »Warum sind wir hier? In dieser Stadt scheint es gar nicht so sehr zu spuken.«
»Lass dich vom ersten Eindruck nicht täuschen, Cass«, meint meine Mutter. »In Paris gibt es Hunderte von Spukgeschichten.« Sie nickt zum Park hinüber. »Zum Beispiel die Tuilerien und die Legende von Jean dem Henker.«
»Frag lieber nicht«, warnt mich Jacob, doch ich habe schon angebissen.
»Wer war das?«
»Nun«, berichtet Mum im Plauderton, »vor etwa fünfhundert Jahren gab es hier eine Königin namens Catherine und die hatte einen Auftragsmörder namens Jean der Henker.«
»Diese Geschichte geht ganz bestimmt gut aus«, wirft Jacob ein.
»Jean war dazu da, Catherines Feinde zu beseitigen. Das Problem war nur, dass er im Laufe der Zeit zu viele ihrer Geheimnisse kannte. Und damit ihre königlichen Geschäfte weiterhin Privatsache blieben, befahl sie schließlich auch seinen Tod. Er wurde genau da drüben in den Tuilerien umgebracht. Aber als sie am nächsten Tag wiederkamen, um seine Leiche zu holen, war sie fort.« Mum spreizt die Finger, als führe sie einen Zaubertrick vor. »Seine Leiche wurde nie gefunden, und seitdem ist Jean immer wieder Königen und Königinnen erschienen, als unheilbringender Schicksalsbote für die Monarchen von Frankreich.«
Damit dreht sie sich wieder ins Zimmer um.
Dad sitzt auf dem Sofa und hat seinen Ordner für die Show auf den Tisch vor sich gelegt. In einem Anflug beinahe katzenhaften Verhaltens steht Grim auf, geht zu ihm und reibt seine Schnurrhaare an einer Ecke des Ordners.
Auf dem Ordnerrücken steht: Inspecters
Inspecters war der Titel des Buches meiner Eltern, als es das nur in gedruckter Form gab und noch nicht als Fernsehserie. Es ist schon irgendwie ironisch, dass ich damals, als sie beschlossen haben, über paranormale Phänomene zu schreiben, noch keinerlei eigene Erfahrungen damit hatte. Ich war noch nicht mit meinem Fahrrad von einer Brücke gestürzt, noch nicht in einen eisigen Fluss gefallen und noch nicht beinahe ertrunken, kannte Jacob noch nicht, konnte noch nicht hinter den Schleier gehen und wusste noch nicht, dass ich eine Geisterjägerin bin.
Jacob räuspert sich, weil er diesen Ausdruck äußerst unangenehm findet.
Ich werfe ihm einen Blick zu.
Geister…retterin?
Er zieht eine Braue hoch. »Ziemlich hochtrabend.«
Sucherin?
»Ich bin doch keine Schatztruhe.«
Spezialistin?
Er überlegt. »Schon besser. Aber nicht wirklich stilvoll.«
Egal, denke ich demonstrativ. Auf jeden Fall hatten meine Eltern keine Ahnung. Haben sie immer noch nicht, aber ihre Show bedeutet für mich, dass ich an neue Orte komme und neue Menschen kennenlerne – sowohl lebende als auch tote.
Mum schlägt ihren Ordner am zweiten Reiter auf, auf dem steht:
Inspecters
Folge Zwei
Ort: Paris, Frankreich
Und darunter steht der Titel der Folge:
Der Knochentunnel
»Na«, meint Jacob übertrieben begeistert. »Das klingt ja vielversprechend.«
»Dann sehen wir mal, was wir hier haben«, sagt Mum und betrachtet einen Stadtplan. Von der Mitte aus verlaufen spiralförmig Zahlen darüber, von eins bis zwanzig.
»Was bedeutet das?«, will ich wissen.
»Arrondissements«, sagt Dad und erklärt, dass das die schicke französische Umschreibung für »Bezirk« ist.
Ich sitze auf dem Sofa neben Mum, die zum Drehplan vorblättert.
Katakomben
Jardin du Luxembourg
Eiffelturm
Brücke Pont Marie
Kathedrale Notre-Dame
Die Liste geht noch weiter. Es juckt mich in den Fingern, ihr den Ordner wegzunehmen und zu lesen, was meine Eltern über diese Orte zusammengetragen haben. Aber ich will ihnen lieber zuhören, wenn wir vor Ort sind und sie die Geschichten erzählen. Ich will sie so erleben wie die Zuschauer der Fernsehsendung.
»Oh ja«, bemerkt Jacob sarkastisch. »Wer will schon vorbereitet sein, wenn man sich auch einfach so ins Unbekannte stürzen kann?«
Lass mich raten, denke ich, du hast zu denen gehört, die das Ende eines Buches immer zuerst gelesen haben.
»Nein«, knurrt Jacob und fährt dann fort: »Ich meine, nur wenn es gruselig war. Oder traurig. Oder wenn ich Angst hatte, um – ist doch auch egal, oder?«
Ich muss ein Lächeln unterdrücken.
»Cassidy«, sagt Mum, »dein Vater und ich haben uns unterhalten …«
Oh nein! Als Mum das letzte Mal ihre »Familienbesprechungsstimme« ausgepackt hat, musste ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass meine Pläne für den Sommer von einer Fernsehshow über den Haufen geworfen worden waren.
»Wir möchten, dass du dich mehr am Projekt beteiligst«, erklärt Dad.
»Beteiligen?«, frage ich. »Inwiefern?« Vor Beginn unserer Reise hatten wir uns bereits darüber unterhalten, dass ich lieber nicht vor die Kamera treten soll. Ich fühle mich wohler, wenn ich dahinter stehe und …
»Fotos«, sagt Mum. »Für die Show.«
»Ich denke da an einen Blick hinter die Kulissen«, schlägt Dad vor. »Bonusinhalt sozusagen. Der Sender hätte gern etwas zusätzliches Material, und wir dachten, du würdest vielleicht gern ein wenig helfen, auf praktische Art.«
»Und damit du nicht wieder Unsinn machst«, ergänzt Jacob, der sich auf die Rückenlehne des Sofas gesetzt hat.
Vielleicht hat er ja recht. Vielleicht soll mich das nur daran hindern, davonzulaufen und mir von mächtigen Geistern meinen Lebensfaden stehlen zu lassen. Und davon, wieder wegen Ordnungswidrigkeiten und Grabschändung verhaftet zu werden.
Trotzdem fühle ich mich geschmeichelt.
»Mache ich gern«, verspreche ich und drücke die Kamera an meine Brust.
»Super«, antwortet Dad, steht auf und reckt sich. »Wir fangen erst morgen an zu drehen. Wie wäre es, wenn wir ein wenig an die frische Luft gehen? Vielleicht ein Spaziergang in den Tuilerien?«
»Perfekt«, meint Mum fröhlich. »Vielleicht erhaschen wir ja einen Blick auf den guten, alten Jean.«
Kapitel 2
Die Tuilerien als »Garten« zu bezeichnen, ist, wie Hogwarts eine »Schule« zu nennen.
Im Prinzip ist es richtig, aber der Ausdruck wird beidem nicht gerecht.
Die Dämmerung weicht schon der Nacht, als wir den Park betreten. Der Sandweg ist so breit wie eine Straße, flankiert von Bäumen, die sich über unseren Köpfen hochwölben und uns die Sicht auf den Sonnenuntergang nehmen. Weitere Wege gehen hier und da ab, ziehen sich zwischen großen, teilweise mit Rosen bepflanzten Rasenflächen entlang.
Ich habe das Gefühl, die Welt von Alice im Wunderland betreten zu haben.
Das Buch fand ich immer ein wenig gruselig und mit diesem Park geht es mir ähnlich. Vielleicht liegt es daran, dass nachts alles gespenstischer aussieht als am Tag. Deshalb haben die Menschen ja auch Angst im Dunkeln. Was man nicht sieht, ist viel furchterregender als das, was man sehen kann. Das Auge führt einen in die Irre und lässt einen finstere Gestalten in dunklen Ecken sehen. Aber die Nacht ist nicht das Einzige, was den Garten unheimlich macht.
Mit jedem Schritt wird der Schleier ein wenig schwerer und das Gemurmel der Geister etwas lauter.
Vielleicht spukt es in Paris doch mehr, als ich dachte.
Mum hakt sich bei Dad unter.
»Was für ein großartiger Ort«, stellt sie fest und legt den Kopf an seine Schulter.
»Die Tuilerien haben eine aufregende Geschichte«, erzählt Dad mit seiner Lehrerstimme. »Sie wurden im 16. Jahrhundert als königlicher Palastgarten angelegt.«
Am Ende der Tuilerien, hinter einem Rosenfeld, das selbst die Herz-Königin neidisch gemacht hätte, steht das größte Gebäude, das ich je gesehen habe. Es ist so breit wie der ganze Park und u-förmig angelegt, sodass die beiden Flügel das Ende des Gartens in eine steinerne Umarmung nehmen.
»Was ist denn das?«, frage ich.
»Das wäre dann wohl der Palast«, erklärt Dad. »Oder zumindest die aktuelle Version davon. Das Original ist 1871 abgebrannt.«
Beim Näherkommen sehe ich im Hof des Palastes etwas aufragen – eine leuchtende Glaspyramide. Dad sagt, dass sich im Palast heute das Museum Louvre befindet.
Stirnrunzelnd betrachte ich die Pyramide. »Das sieht mir nicht groß genug aus für ein Museum.«
»Das liegt daran, dass das Museum darunter liegt«, sagt Dad lachend. »Und darum herum. Die Pyramide ist nur der Eingang.«
Mum nickt. »Eine Erinnerung daran, dass es immer mehr gibt, als das Auge auf den ersten Blick …«
Plötzliche Schreie schneiden ihr das Wort ab.
Jacob und ich zucken zusammen. Die Schreie sind so hoch und dünn, dass ich zuerst glaube, sie kämen durch den Schleier, doch dann erkenne ich, dass es eigentlich Freudenschreie sind. Denn hinter der nächsten Baumreihe stoßen wir auf einen Jahrmarkt, komplett mit Riesenrad, kleiner Achterbahn, Spielen und Imbissbuden.
Bei dem Anblick schlägt mein Herz höher, und ich steuere schon auf die bunten Karussells zu, als mir ein leiser Windhauch den Geruch von Zucker und Teig zuträgt. Abrupt bleibe ich stehen, drehe mich nach der Quelle des himmlischen Duftes um und entdecke einen Stand mit der Aufschrift Crêpes.
»Was ist ein Krepe?«, frage ich.
»Das spricht man ›Krepp‹ aus«, amüsiert sich Dad. »Das ist eine Art dünner Pfannkuchen mit Butter und Zucker, oder Schokolade oder Obst, der dann zusammengefaltet wird.«
»Klingt gut«, finde ich.
»Klingt hervorragend«, findet Jacob.
Mum zückt ein paar silberne und goldene Münzen. »Wenn man in Frankreich ist, muss man die einfach probieren«, meint sie, als wir uns in die Schlange stellen. Am Tresen kann ich zusehen, wie ein Mann den Teig hauchdünn auf die Backplatten streicht.
Er stellt mir eine Frage auf Französisch und sieht mich abwartend an.
»Chocolat«, antwortet Dad. Um das zu verstehen, muss ich nicht mal Französisch können.
Der Mann dreht den Crêpe um und verteilt einen Löffel Schokoladencreme darauf, bevor er ihn erst einmal und dann noch einmal in der Mitte zusammenfaltet und dann in eine Papiertüte steckt.
Dad bezahlt und Mum nimmt den Crêpe entgegen. Wir setzen uns an einen der weißen Tische am Wegrand, die von den Lichtern des Jahrmarkts beleuchtet werden.
»Hier, meine Tochter«, sagt Mum und hält mir den Crêpe hin. »Etwas für deine Bildung.«
Ich nehme einen Bissen und der Geschmack des heißen, süßen Pfannkuchens und der weichen Schokolade erfüllt meinen Mund. Es ist simpel und doch köstlich. Während wir uns den Crêpe teilen – von dem Dad viel zu große Bissen nimmt –, Mum sich einen Schokoladenfleck von der Nase wischt und Jacob mit seinen großen blauen Augen das Riesenrad beobachtet, vergesse ich fast, weshalb wir hier sind. Ich mache ein Foto von meinen Eltern vor dem Jahrmarkt und stelle mir vor, wir wären nur eine normale Familie im Urlaub.
Doch dann spüre ich das Tippen auf meiner Schulter, den Druck des Schleiers an meinem Rücken. Meine Aufmerksamkeit richtet sich auf den dunklen Teil des Parks. Er ruft nach mir. Früher dachte ich, dass es die Neugier ist, die mich ins Zwischendrin zieht. Doch jetzt weiß ich, dass es etwas Anderes ist.
Bestimmung.
Jacob wirft mir einen Blick zu. »Nein«, sagt er, doch ich bin schon aufgestanden.
»Alles in Ordnung?«, fragt Mum.
»Ja«, antworte ich. »Ich muss nur aufs Klo.«
»Nein, musst du nicht!«, flüstert Jacob.
»Da hinter den Ständen habe ich eines gesehen«, sagt Mum und zeigt mit dem Finger darauf.
»Cassidy!«, jault Jacob.
»Bin gleich zurück!«, sage ich zu meinen Eltern.
Ich bin schon unterwegs, als Dad mir nachruft, ich solle nicht zu weit weggehen.
»Mach ich nicht!«, rufe ich zurück.
Dad sieht mich streng an. Nach der Geschichte mit dem Von-einem-Geist-hinter-dem-Schleier-Gefangen-werden-und-in-einem-offenen-Grab-um-meinen-Lebensfaden-Kämpfen (oder wie meine Eltern es nennen: nachdem ich unerlaubt abgehauen bin und mehrere Stunden später aufgegriffen wurde, weil ich in einen Friedhof eingebrochen war) muss ich mich immer noch anstrengen, ihr Vertrauen wiederzugewinnen.
Ich schlüpfe an den Ständen vorbei und schwenke nach rechts vom Hauptweg ab.
»Wo gehen wir denn hin?«, erkundigt sich Jacob.
»Nachsehen, ob Jean der Henker noch hier ist.«
»Du machst wohl Witze!«
Mache ich nicht. Ich taste nach dem Spiegelanhänger in meiner hinteren Hosentasche. Er war ein Abschiedsgeschenk von Lara.
Sie wäre wütend, wenn sie wüsste, dass ich ihn in der Tasche habe und nicht um den Hals trage. Sie sagt, dass Leute wie wir nicht nur Jäger sind, wir sind Leuchtfeuer, die Geister und Gespenster anlocken. Aber Spiegel wirken bei allen Arten von Spukerscheinungen, einschließlich Jacob. Deshalb trage ich den Anhänger nicht um den Hals. Lara würde wahrscheinlich sagen, genau deshalb sollte ich es tun.
Ich muss wohl nicht extra erwähnen, dass sie nicht viel von Jacob hält.
»Lara hält von nichts viel«, stichelt Jacob.
Die beiden kommen nicht gut miteinander aus. So was nennt man wohl Meinungsverschiedenheiten.
»Ihre Meinung ist, dass ich nicht hierhergehöre!«, fährt Jacob auf.
»Na, im Prinzip tust du das ja auch nicht«, flüstere ich und wickle mir die Kette mit dem Spiegel um das Handgelenk. »Und jetzt lass uns Jean suchen.«
Jacob verzieht das Gesicht und sein Missfallen lässt die Luft um ihn herum ganz leicht flimmern. »Und dabei war es so ein schöner Abend.«
»Na, komm schon«, sage ich und fasse das Medaillon fester. »Bist du gar nicht neugierig?«
»Ehrlich gesagt, nein«, antwortet er und verschränkt die Arme vor der Brust, als ich nach dem Schleier greife. »Wirklich nicht. Ich habe absolut kein Bedürfnis, herauszufinden, ob …«
Den Rest höre ich nicht mehr. Ich ziehe den Schleier beiseite und trete hindurch, woraufhin die Welt um mich herum …
… verschwindet.
Die Jahrmarktlichter, die Menschen, die Geräusche und Gerüche der Sommernacht sind weg. Einen Augenblick lang habe ich das Gefühl zu fallen. Ich stürze in eiskaltes Wasser, spüre den Kälteschock in meiner Lunge. Dann habe ich wieder festen Boden unter den Füßen.
Daran habe ich mich bis jetzt noch nicht gewöhnt.
Werde ich wohl auch nie.
Ich richte mich auf und stoße bebend die Luft aus, während die Welt um mich herum wieder Gestalt annimmt. Anders. Blasser.
Ich bin hinter dem Schleier.
Im Zwischendrin.
Es ist dunkel und ruhig und stockfinstere Nacht. Kein Jahrmarkt, keine Menschen, und wegen der Dunkelheit und den Nebelstreifen, die über die Rasenflächen ziehen, kann ich kaum etwas sehen.
Eine Sekunde später taucht ein offensichtlich schmollender Jacob neben mir auf.
»Du hättest ja nicht mitkommen müssen«, sage ich.
Er scharrt mit dem Fuß im Gras. »Ja, ja.«
Ich lächle. Freundschaftsregel Nummer 21: Freunde lassen einander hinter dem Schleier nicht allein.
Hier sieht Jacob anders aus, voller und farbiger. Ich kann nicht länger durch ihn hindurchsehen. Ich hingegen bin weniger massiv als vorher, eher verwaschen und grau, abgesehen von einem leuchtenden Faden in meiner Brust.
Doch es ist kein Faden, es ist ein Leben.
Mein Leben.
Es leuchtet schwach bläulich-weiß, und wenn ich in meine Brust greifen und ihn wie bei einer gruseligen Demonstration herausziehen würde, könnte man sehen, dass er nicht mehr ganz perfekt ist. An der Stelle, wo er auseinandergerissen wurde, ist jetzt eine Linie, ein dünner Spalt. Ich habe die Teile wieder aneinandergefügt und er scheint gut zu funktionieren, aber ich habe keine Lust, herauszufinden, wie oft ein Lebensfaden reißen kann, bevor er endgültig den Geist aufgibt.
»Na also«, meint Jacob und sieht sich um, »scheint keiner da zu sein. Wir können also wieder gehen.«
Ich bin genauso nervös wie er, aber ich bleibe standhaft. Irgendjemand ist hier. Es muss jemand hier sein. So ist das mit dem Schleier: Er existiert nur da, wo es Geister gibt. Es ist wie eine Bühne, auf der Geister immer wieder ihre letzten Stunden durchleben. Was auch immer ihnen passiert ist, lässt sie nicht weiterziehen.